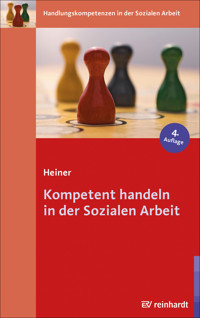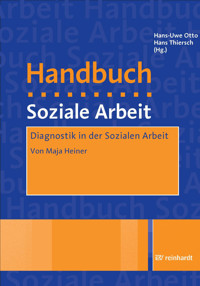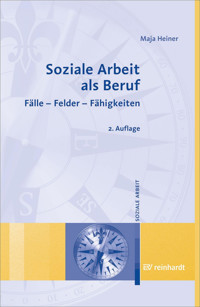
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit beschäftigen sich mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, regeln Konflikte oder vermitteln Dienstleistungen. Manche verstehen sich eher als BeraterIn, andere eher als ManagerIn, TrainerIn oder als AnwältIn der Benachteiligten. Was aber macht diesen Beruf wirklich aus? In diesem Buch wird ein handlungstheoretisch fundiertes Profil des Berufes entwickelt. Dargestellt werden: -- Ziele und Rahmenbedingungen des Berufes -- Arbeitsfelder und Tätigkeitsgruppen -- Fallbeispiele erfahrener Fachkräfte -- Kernkompetenzen Die vielfältigen Facetten beruflicher Identität ergänzen sich so zu einem anschaulichen Qualifikationsprofil beruflichen Handelns in der Sozialen Arbeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1010
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Maja Heiner
Soziale Arbeit als Beruf
Fälle – Felder – Fähigkeiten
2., durchgesehene Auflage
Mit 18 Abbildungen und 25 Tabellen
Ernst Reinhardt Verlag München Basel
Prof. Dr. Maja Heiner, war Professorin für Sozialpädagogik an der Eberhard Karls Universität Tübingen; Arbeitsschwerpunkte: Methoden der Sozialen Arbeit, Diagnostisches Fallverstehen, Evaluation, Qualitative Fall- und Interaktionsanalysen
Cover unter Verwendung eines Fotos von panthermedia.net/mecky
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-02147-5 (Print)
ISBN 978-3-497-61589-6 (PDF E-Book)
ISBN 978-3-497-61590-2 (EPUB E-Book)
2., durchgesehene Auflage
© 2010 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Reihenkonzeption Umschlag: Oliver Linke, Augsburg
Satz: Fotosatz Reinhard Amann, Aichstetten
Druck und Bindung: Ebner & Spiegel, Ulm
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort zur 1. Auflage
Einführung Die Profession zwischen Fall und Feld
1 Soziale Arbeit zwischen Fall und Feld: Zielsetzung und Aufbau des Buches
2 Ein Fall aus der Praxis: Arbeit mit und für Familie Bleicher
3 Die handlungstheoretische Perspektive: Soziale Arbeit als Figurierung von Kräftefeldern
Teil A Systematische Darstellung: Ziele, Aufgaben und Formen professionellen Handelns in der Sozialen Arbeit
1 Sozialstaatliche Rahmenbedingungen beruflichen Handelns
1.1 Sozialstaatliche Steuerung: Soziale Arbeit zwischen Abhängigkeit und Autonomie
1.2 Finanzierung und Kosten Sozialer Arbeit
2 Auftrag, Aufgaben und Tätigkeiten Sozialer Arbeit
2.1 Aufgabenfelder Sozialer Arbeit: Personalisation, Qualifikation, Reproduktion, Rehabilitation und Resozialisation im Lebensverlauf
2.2 Der Auftrag der Sozialen Arbeit: Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft im Spannungsfeld von Hilfe, Kontrolle und präventiver Intervention
2.3 Die doppelte Aufgabenstellung Sozialer Arbeit: Fallbezogene und fallübergreifende Arbeit mit dem Klientensystem und dem Leistungssystem
2.4 Tätigkeitsgruppen und Tätigkeitsformen bezogen auf Interaktion, Situation, Organisation und Infrastruktur
3 Professionalität, Expertise und das Kompetenzprofil Sozialer Arbeit
3.1 Aufgaben und Merkmale von Professionen
3.2 Professionalität als wissenschaftlich und ethisch fundiertes Handeln
3.3 Gegenstand und Kompetenzprofil Sozialer Arbeit im Vergleich zu anderen Berufen
3.4 Professionelles Handeln als organisationell gestütztes Handeln 202
Teil B Kasuistik des Gelingens und Scheiterns
1 Die Methode der Untersuchung
1.1 Datenerhebung und Datenauswertung
1.2 Materialbasis und Aussagekraft der Kasuistik
2 Interpretation der Interviews mit Fachkräften der Sozialen Arbeit
2.1 Soziale Arbeit im Allgemeinen Sozialdienst des Jugendamtes
2.1.1 Frau Neumann: „Wir sind hier eine Beratungsstelle des Jugendamtes, Allgemeiner Sozialdienst, so eine psychosoziale Grundversorgung an Beratung.“
2.1.2 Herr Faller: „Und wir müssen ein Stück weit Glück haben, dass es dann die Wendung nimmt, dass also die Mutter gewissermaßen auch zum Partner wird in dieser Maßnahme.“
2.2 Soziale Arbeit in Tagesgruppen für Kinder und Jugendliche
2.2.1 Frau Palmer: „Also ich versteh mich schon oft eher als Mülleimer.“
2.2.2 Frau Jallmer: „Das ist manchmal verrückt, so schwierig wie die Leute teilweise sind. Aber in dem Rahmen schaffen sie es doch.“
2.3 Soziale Arbeit in der Wohnungslosenhilfe für junge Erwachsene
2.3.1 Frau Tummerer: „Wo ich dann halt langsam so aufpassen muss, dass ich das Verständnis nicht verliere.“
2.3.2 Frau Adler: „Wichtig ist so diese Gratwanderung zwischen den anderen machen lassen, ihm seine Verantwortung für sich überlassen und ihm dann aber auch mal Verantwortung abnehmen, wenn er sie grad nicht tragen kann.“
2.4 Soziale Arbeit in der Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung (ISE)
2.4.1 Frau Wagner: „Das ist schon ein Erfolg, wenn jemandem klar wird, ... in meinem Leben passiert, wofür ich mich entscheide.“
2.5 Soziale Arbeit im Frauenhaus
2.5.1 Frau Vogel: „Wenn ich Prioritäten setzen kann und dazu stehen kann, mich nicht ablenken lasse, das ist für mich Erfolg.“
2.6 Soziale Arbeit in der Psychiatrischen Klinik
2.6.1 Frau Günter: „Da geht es auch um ’ne Machtfrage einfach. Wer ist derjenige, der therapeutisch arbeiten darf?“
2.6.2 Herr Kollert: „Erfolg? In den 19 Jahren, in denen ich hier bin, habe ich deswegen eigentlich wenig Frustrationen, weil ich es eigentlich immer von mir aus definiere: ‚Habe ich es richtig gemacht?‘“
2.7 Soziale Arbeit in der gemeindenahen Sozialpsychiatrie
2.7.1 Frau Binder: „Also (...) diese langsame Entwicklung in der Psychiatrie, das ist zum Teil einfach nervenaufreibend.“
2.7.2 Frau Lenz: „Erfolg? Wenn Personen es dann schaffen, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu entwickeln und zu stabilisieren ...bei manchen Personen sehen wir auch eine wirklich wunderbare Entwicklung.“
2.8 Soziale Arbeit in der Suchtberatung
2.8.1 Frau Rillinger: „Es mangelt mir an Leuten, die mit mir bereit wären, auch (...) einfach mal was Neues auszuprobieren.“
2.9 Soziale Arbeit in der gesetzlichen Betreuung Entmündigter
2.9.1 Frau Ulbrich: „Vertrauen ist eine unheimlich wichtige Basis (...). Dazu gehören auch viele persönliche Kontakte, gerade am Anfang. Wobei unser Problem ist, die kosten Geld.“
2.10 Soziale Arbeit in der Schuldnerberatung
2.10.1 Frau Müller: „Ich finde das teilweise als sehr angenehm entlastend und auch interessant so (...) eben mit dem gesellschaftlichen Rahmen auch was zu tun zu haben, also nicht bloß mit dem Individuum, sondern mit den Bedingungen.“
2.11 Soziale Arbeit in der Obdachlosensiedlung
2.11.1 Frau Ilg: „Flickschusterei (...) ohne also generell etwas an den Lebensbedingungen der Leute irgendwie verändern zu können. Von dem her liegt es an anderen Strukturen, an einer anderen Politik.“
Teil C Berufliche Anforderungen, berufliches Selbstverständnis und die Figurierung von Kräftefeldern
1 Berufliches Selbstverständnis in der Praxis
1.1 Handlungsmodelle der Praxis zwischen Dominanz, Aufopferung, Serviceleistung und Passung
1.2 Handlungsorientierungen und die Figurierung von Kräftefeldern
2 Berufliche Anforderungen und professionelle Bewältigungsmuster
2.1 Zentrale berufliche Anforderungen und Fähigkeiten
2.2 Reflektierte Parteilichkeit und hilfreiche Kontrolle bei der Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft
2.3 Entwicklung realisierbarer und herausfordernder Ziele angesichts ungewisser Erfolgsaussichten in unterstrukturierten Tätigkeitsfeldern
2.4 Aufgabenorientierte partizipative Beziehungsgestaltung und begrenzte Hilfe in alltagsnahen Situationen
2.5 Interinstitutionelle und multiprofessionelle Kooperation und Vermittlung von Dienstleistungen bei unklarem oder umstrittenem beruflichen Profil
2.6 Weiterentwicklung der institutionellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen eines sozialstaatlich abhängigen Berufs
2.7 Nutzung ganzheitlicher und mehrperspektivischer Deutungsmuster als Fundament entwicklungsoffener Problemlösungsansätze
3 Zusammenfassung und Ausblick
3.1 Zentrale Aussagen und Begriffe
3.2 Ganzheitlichkeit und Professionalität – überzogene Ansprüche?
Anhang
Anhang 1: Didaktische Materialien zum Buch
1 Didaktische Anregungen zur Nutzung des Buches
2 Fragestellungen zum Selbststudium und zur Prüfungsvorbereitung
Anhang 2: Informationsquellen
1 Internet: Statistiken, Sozialberichte, Rechtsgrundlagen, Organisationen, Bücher, Stellenangebote etc
1.1 Portale
1.2 Linksammlungen und weitere Webadressen
1.3 Sozialberichte der Bundesregierung
2 Bibliografien, Rezensionen, Fachdatenbanken, Fachlexika, Handbücher
2.1 Bibliografien, Fachdatenbanken
2.2 Buchbesprechungen, Rezensionen
2.3 Fachlexika, Handbücher, umfassende empirische Analysen
2.3.1 Arbeitsfeldübergreifend
2.3.2 Arbeits- und tätigkeitsfeldspezifisch
Literatur
Sachregister
„The major function of social work is concerned with helping people perform their normal life tasks by providing information and knowledge, social support, social skills, and social opportunities; it is also concerned with helping people deal with interference and abuse from other individuals and groups, with physical and mental disabilities, and with overburdening responsibilities they have for others. Most important, social work’s objective is to strengthen the community’s capacities to solve problems. (...) It is only by creating a community that we establish a basis for commitment, obligation, and social support. We must build communities that are excited about their child care systems, that find it exhilarating to care for the mentally ill and the frail aged, that make demands upon people to behave, to contribute, and to care for one another.“ (Specht/Courtney 1994, 25f)
Vorwort zur 1. Auflage
Sigmund Freud war der Auffassung, dass zwei Berufe sich Unmögliches vorgenommen hätten: Politiker die Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse und Therapeuten die Änderung menschlichen Verhaltens. Hätte Freud den Beruf der Sozialen Arbeit gekannt, so hätte er ihm wohl attestiert, dass er das Unmögliche im Quadrat anstrebt: die Initiierung und Unterstützung der Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse und menschlicher Verhaltensmuster.
Dieser doppelte Anspruch und die Bandbreite der Aufgaben und Tätigkeitsfelder dieses Berufes haben mich seit jeher fasziniert. Seit meiner ersten Berufung zur Professorin für Soziale Arbeit sind inzwischen über dreißig Jahre vergangen. Aber die Faszination bei Exkursionen oder Praxisberatungs- und Forschungsvorhaben ist immer noch so groß wie damals bei meinem ersten Besuch einer Obdachlosensiedlung. Als mir die eisernen Flur- und Haustüren in dieser trostlosen, mit grauer Ölfarbe gestrichenen Unterkunft gezeigt wurden, berichtete der Gemeinwesenarbeiter empört, die von der Stadtverwaltung akzeptierte Begründung der Wohnungsbaugesellschaft laute: „Holztüren werden ja doch nur im Suff zertreten, also sind hier doch keine Schönheitsreparaturen angesagt!“ Es gab dort in der Tat Alkoholprobleme und körperliche Auseinandersetzungen. Aber ebenso offenkundig war die Botschaft dieser entwürdigenden Unterkunft: „Ihr seid es nicht wert. Aus euch wird eh nichts mehr.“ In einem Großstadtsozialamt, einem ramponierten Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert mit repräsentativer, geschwungener Treppe musste man am Ende der achtziger Jahre große Netze im Treppenhaus spannen, damit sich nicht noch weitere „Kunden“ das Treppenhaus herabstürzten und umbrachten. In den sehr breiten Fluren standen entmutigt aussehende Menschen; an die Wand gelehnt, weil es kaum Stühle gab. In einem anderen Großstadtsozialamt – etwa zehn Jahre später – berichtete der Leiter: „Seitdem wir die Flure farbig mit diesen Motiven ausgestaltet haben, Motive, die die Sozialhilfeempfänger mit einem Künstler entwickelt haben, gibt es keinen Vandalismus mehr. Natürlich haben wir auch die Mitarbeiter geschult.“ Und die Türen in der Obdachlosenunterkunft waren inzwischen aus Holz, Wohnungen zusammengelegt und eine Auflösung solcher sozialen Brennpunkte geplant. Die Alkoholprobleme waren damit keineswegs verschwunden, aber eine andere, zukunftsorientierte, hoffnungsfrohere Arbeit mit der ganzen Familie war möglich geworden, teilweise unter Einbeziehung der Nachbarschaft. Hier wehte inzwischen ein anderer Geist, zu dessen Entstehen die Fachkräfte der Sozialen Arbeit ebenso beigetragen hatten wie PolitikerInnen und JounalistInnen – ein Geist, den das Motto dieses Buches von Harry Specht prägnant kennzeichnet. Inzwischen allerdings ist das Erreichte schon wieder gefährdet, der Sozialdarwinismus auf dem Vormarsch.
Der Beruf der Sozialen Arbeit und das Fach haben sich mittlerweile etabliert und konsolidiert. Alleine die im Anhang aufgeführten Handbücher, Lexika und Datenbanken belegen nicht nur eine quantitative Expansion, sondern auch eine qualitative Weiterentwicklung. Aber die Breite der Tätigkeitsfelder und die Vielfalt der theoretischen Ansätze, Begriffe und Themen erschweren die Bündelung des Wissens und der Erfahrungen. Die gegenwärtige Tendenz zur Häppchenkultur der Vermittlung von gebrauchsfähigem Spezialwissen (z.B. in modularisierten Studiengängen, wissenschaftlichen Kurzreferaten oder „Postersessions“ auf Tagungen sowie Anderthalbtagestrainings in der Weiterbildung) ist mir äußerst suspekt. Der Überblick droht verloren zu gehen, und für Grundsatzfragen oder identitätsstiftende Überlegungen bleibt kaum noch Platz. Darüber nachzusinnen, wozu und wie man für diesen anspruchsvollen Beruf ausbilden kann, warum man ihn ausüben möchte und wie man ihn über Jahre ausfüllen kann, verlangt neben einer reflexiven Grundhaltung vor allem Zeit: Zeit und Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit sich selbst, den unterschiedlichen Sichtweisen anderer Menschen und dem komplexen Bedingungsgefüge moderner Gesellschaften – welch ein Luxus!
Insofern stellt dieses Buch im Zeitalter der raschen Vermarktung von aktuellem Spezialwissen einen Anachronismus dar. Es ist einerseits ein einführendes Lehrbuch – aber dafür zu umfangreich. Es soll der Vermittlung von Grundkenntnissen und -begriffen dienen – aber gleichzeitig auch der Diskussion unterschiedlicher Ansätze. Es ist ein Forschungsbericht mit umfangreichem empirischen Material – aber zugleich eine Auseinandersetzung mit Grundfragen des Berufes, die über das empirische Material hinausführt.
Mit diesen Ansprüchen wuchs und wuchs das Manuskript und wäre sicher nie fertig geworden, wenn mich nicht so viele Menschen ermutigt hätten, es zu Ende zu schreiben – am Ende vor allem mit Ermahnungen, nicht diese oder jene interessante Frage auch noch zu thematisieren. Viele Fassungen mussten von meinen studentischen Hilfskräften Karin Rothenhäuser und Julia Messerschmidt aus einem ziemlich unleserlichen Manuskript rekonstruiert werden. Christa Wirsching konnte dabei am Ende schon fast meine Gedanken lesen und danach Graphiken erstellen. Viele Tübinger KollegInnen gaben hilfreiche Rückmeldungen zu einzelnen Kapiteln oder sogar zum ganzen Manuskript, insbesondere Michael Benda, Eberhard Bolay, Conny Füssenhäuser, Ulrich Otto, Hans Thiersch und ganz besonders ausdauernd, kritisch und anregend Angelika Iser. Auf spezifische Einzelbeiträge von KollegInnen und DoktorandInnen wird im Text verwiesen. Und nicht zuletzt haben die Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die bereit waren, sich interviewen zu lassen, dazu beigetragen, dass ein anschauliches und breit gefächertes Bild des Berufes entstehen konnte. Die studentischen Testleserinnen der Endfassung Stephanie Hamann und Susanne Gerstner haben mir geholfen, manche Dinge noch klarer darzustellen.
Und ein gewisser R. ist erleichtert, dass es nun endlich vorbei ist, und sich eine gewisse M. nicht mehr im Morgengrauen, während der Mond noch auf den Ammersee scheint, von einer neuen Formulierungsidee um den Schlaf gebracht, an den Schreibtisch schleicht, oder abends selbst beim Rotwein noch Theorien diskutieren möchte. Nun bleibt auch wieder mehr gemeinsame Zeit für den Garten. Und das erinnert mich an den Ausspruch, den der Aufklärer Voltaire dem ernüchterten Optimisten Candide in den Mund legte: „Il faut cultiver notre jardin“ – denn, so verstehe ich ihn, nur so verändern sich Landschaften.
Maja Heiner
Tübingen, im Oktober 2007
Einführung
Die Profession zwischen Fall und Feld
1 Soziale Arbeit zwischen Fall und Feld: Zielsetzung und Aufbau des Buches
Die Soziale Arbeit ist ein Beruf mit vielen Facetten: Man arbeitet mit Kindern, Erwachsenen oder alten Menschen, hilft in Notlagen, fördert persönliche Entwicklungen, regelt Konflikte, vermittelt Gelder, Unterkünfte, Dienstleistungen und hat dabei mit vielen Organisationen zu tun. Man kann sich als Seelsorger oder Manager, als Trainerin oder Ersatzmutter, als Anwalt der Benachteiligten oder als Sozialtherapeut verstehen. All dies stimmt – mehr oder weniger. Es ist kein Beruf, in dem Langeweile zu befürchten ist – es sei denn, man ist resigniert und ausgebrannt. Es ist allerdings auch kein Beruf, in dem man Reichtümer erwerben kann.
Berufe, die gesellschaftlich bedeutsame Aufgaben übernommen haben, versuchen, sich als „Professionen“, d.h. als gehobene Berufe mit besonderer, anerkannter Expertise zu etablieren. Die Vielfältigkeit der Aufgaben, Auftraggeber, Organisationen, Organisationsformen und Methoden erschweren es der Sozialen Arbeit, sich als eine Profession zu etablieren und zu einem einheitlichen Selbstverständnis zu gelangen, um gemeinsame Anliegen berufspolitisch zu vertreten. Die einzelnen Fachkräfte entwickeln zwar eine tätigkeitsfeldbezogene Identität, z.B. als SuchtberaterIn, ErziehungsberaterIn, SchuldnerberaterIn oder als MitarbeiterIn der Bewährungshilfe, des Allgemeinen Sozialdienstes des Jugendamts, des Krankenhaussozialdienstes, der Schulsozialarbeit, des Sozialpsychiatrischen Dienstes, der Werkstatt für Behinderte, des Erziehungsheims, der Tagesgruppe, der Sozialpädagogischen Familienhilfe, des Betreuten Jugendwohnens etc. Die Entwicklung einer Identität als Fachkraft für Soziale Arbeit fällt wesentlich schwerer. Nicht nur wegen dieser Unterschiedlichkeit der Aufgabenfelder, sondern auch wegen der Heterogenität ihrer Wissensquellen und Wissensbestände, ihrer vielfachen Anleihen bei anderen Wissenschaftsdisziplinen (Psychologie, Soziologie, Politologie etc.) ist der Professionalisierungsgrad der Sozialen Arbeit umstritten.
Das folgende Buch umreißt das Profil der Sozialen Arbeit als Profession und möchte so zur Identitätsklärung der Fachkräfte beitragen. Die scheinbar einfache Frage, was dieser Beruf wie zu erreichen versucht und was er erreichen kann, soll aus der Sicht von Theorie und Praxis beantwortet werden. Die Klärung der beruflichen Identität ist einerseits eine persönliche Aufgabe jeder Fachkraft. Angesichts (berufs-)biografischer Entwicklungen und kontinuierlicher gesellschaftlicher Veränderungsprozesse, die zu neuen Aufgabenstellungen führen, wird diese nie ganz abgeschlossen sein. Zugleich ist die Klärung der beruflichen Identität eine kollektive Aufgabe der Profession (z.B. ihrer Fachverbände, ihres Berufsverbandes und ihrer Ausbildungsstätten). Neben kollegialen Gesprächen liefern diese Organisationen wichtige Grundlagen für die individuelle Klärung des beruflichen Selbstverständnisses. Im Folgenden wird versucht, zu diesem Prozess beizutragen, indem aus einer handlungstheoretischen Perspektive theoretische und empirische Erkenntnisse der Sozialen Arbeit (Profession und Disziplin) in Beziehung gesetzt werden. Fachkräfte aus unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit schildern in Teil B den Berufsalltag aus ihren Erfahrungen, sodass insbesondere Studierende ohne Praxiserfahrungen ein anschauliches Bild davon erhalten, was es heißt, diesen Beruf auszuüben.
Berufe stellen zentrale Strukturierungsfaktoren dar, sowohl für den Einzelnen, sein Selbstbild, seine soziale Position, seinen Alltag – als auch für die Gesellschaft, ihre Arbeitsteilung und ihr Machtgefüge. In fast allen Gesellschaften unterliegen sie vielfältigen Regulierungen. Der Staat legt über Berufsbilder, Ausbildungs- und Entgeltordnungen weitgehend fest, welche Aufgaben ein Beruf unter welchen Rahmenbedingungen übernimmt. Er regelt dies in Auseinandersetzung mit den Tarifparteien und Fachverbänden. Zugleich definieren aber auch die Mitglieder eines Berufs ihr berufliches Selbstverständnis und versuchen, auf rechtliche Kodifizierungen, staatliche Rahmenvorgaben und auf die öffentliche Wahrnehmung ihres Tuns Einfluss zu nehmen. Insbesondere Professionen geben sich mit den staatlich zugeschriebenen und gesellschaftlich gewünschten Aufgaben nicht zufrieden. Sie definieren sich selbst und versuchen, dieses Selbstverständnis unter Berufung auf ihre wissenschaftlich fundierte Expertise und ihr berufliches Erfahrungswissen politisch durchzusetzen. Sie erschließen sich neue Tätigkeitsfelder und sind bemüht, ihr gesellschaftliches Ansehen zu erhöhen. Über Fachorganisationen und die öffentlichen Präsentationen ihrer Leistungen, Anliegen und Forderungen versuchen sie, sich zu profilieren. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Soziale Arbeit aus Liebe zum Nächsten ein „stilles Dienen“ war. Der Beruf konkurriert heute mit anderen Berufen, denen einmal mehr, einmal weniger gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Anerkennung zuteil wird. Dann fließen Gelder, die zuvor zum Teil der Sozialen Arbeit zugute kamen, in den Bildungsbereich (z.B. in die Schulen) oder in den Gesundheitsbereich (z.B. in eine pharmakologisch ausgerichtete Prävention). Oder andere Berufsgruppen werden bevorzugt im Sozialbereich beschäftigt. Das Personal in der Sozialen Arbeit wird entsprechend abgebaut, die Qualifikation der Beschäftigten abgesenkt oder ihr Entgelt reduziert. Berufe werden auf diese Weise entscheidend durch gesellschaftliche und politische Entwicklungen geprägt und unterliegen einem ständigen Wandel.
Dieses Buch gliedert sich nach der Einführung in drei Teile: Teil A beschreibt die Aufgaben, Arbeits- und Tätigkeitsfelder und entwirft ein Profil des Berufs; Teil B präsentiert anhand von Interviews mit erfahrenen Fachkräften der Sozialen Arbeit verschiedene Fälle des Gelingens und Scheiterns im Berufsalltag; Teil C stellt auf dieser theoretischen und empirischen Grundlage ein Modell zur Analyse und Planung professionellen Handelns dar. Zentrale berufliche Anforderungen werden definiert und mit den zu ihrer Bewältigung notwendigen Fähigkeiten in Beziehung gesetzt. Insofern schreitet die Darstellung von den Feldern des Berufs über die Fälle des Gelingens und Scheiterns zur Darstellung der notwendigen Fähigkeiten beruflichen Handelns voran. Beschrieben werden diese Fähigkeiten, indem mögliche Verhaltensalternativen, z.B. in Bezug auf Nähe und Distanz, Hilfe und Kontrolle oder Über- und Unterforderung benannt werden, zwischen denen sich die Fachkräfte angemessen platzieren müssen. Welche Kompetenzen verknüpft mit welchen Vorgehensweisen dafür im Einzelnen erforderlich sind, wäre in einem Lehrbuch zum methodischen Handeln auszuführen. Dafür werden hier nur die Grundlagen gelegt, indem die Aufgaben und Anforderungen des Berufs theoretisch begründet, begrifflich gefasst und konzeptionell systematisiert werden. Die Herangehensweise ist durchgängig eine handlungstheoretische, welche in Kap.A-3 erläutert und begründet wird. Ausgehend von der Frage, was wie zu tun ist, was zu tun schwer oder leicht fällt und was unter welchen Bedingungen gelingt oder misslingt, wird versucht, die Eigenart dieses Berufs zu fassen.
„Vom Fall zum Feld“ war eine Maxime, die in den 1970er Jahren eine wünschenswerte Umorientierung professionellen Denkens und Handelns in eine griffige Formulierung brachte (Hinte et al. 1999). Gefordert wurde eine Abkehr von kontextunabhängigen Ursachenerklärungen und Schuldzuschreibungen, nach denen der Einzelne für seine Schwierigkeiten allein verantwortlich ist. Als mögliche Belastungsfaktoren sollten die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ebenso analysiert werden wie das jeweilige soziale Umfeld. Zugleich sollten im Zuge dieser sozialökologischen Wende das soziale Umfeld, die Familie, der Freundeskreis, die Nachbarschaft und darüber hinaus auch umfassendere soziale Systeme – wie das Bildungssystem oder das Gesundheitssystem – als Ressource für die Unterstützung und Förderung der KlientInnen besser genutzt werden. Dies erforderte eine Überwindung der klassischen Dreiteilung der Methoden in Einzelfallhilfe, Gruppen- und Gemeinwesenarbeit. Diese sozialökologische Wende bezog sich auch auf das berufliche Handeln der Fachkräfte. Als Mitglieder von Organisationen und Infrastruktureinrichtungen sind sie selbst Teile von sozialen Systemen, die in einem bestimmten Feld kooperieren. Mit zunehmender Ausdifferenzierung der regionalen Dienstleistungslandschaft wurde dieser Aspekt immer wichtiger. Er findet heute seinen Niederschlag in der Forderung nach einer gemeinsamen sozialräumlichen Planung und Verantwortung aller sozialstaatlichen und verbandlichen Organisationen.
Berufe lassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven beschreiben: Aus der Perspektive der Personen, die den Beruf ausüben; aus der Perspektive ihrer KlientInnen, die auf die Leistungen des Berufs angewiesen sind bzw. dessen Eingriffe erdulden müssen; aus der Perspektive der Gesellschaft, für die der Beruf bestimmte Aufgaben übernimmt. Die Darstellung in diesem Buch setzt sich vor allem mit der Sicht der Fachkräfte auseinander, die diesen Beruf ausüben. Als „Fachkräfte“ werden im Folgenden nur Personen mit einer einschlägigen Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universität bezeichnet – also weder Pflegekräfte, ErzieherInnen, KinderpflegerInnen noch PsychologInnen oder TherapeutInnen –, auch wenn diese in der gleichen Organisation beschäftigt sind und ähnliche Tätigkeiten ausüben. Indem in Teil B die Sicht der Fachkräfte der Sozialen Arbeit und ihr subjektives Erleben sehr ausführlich erörtert werden, soll zumindest ein wenig nachvollziehbar werden, wie es sich „anfühlt“, SozialarbeiterIn zu sein.
In der Darstellung fehlt die Perspektive der KlientInnen – die Beschreibung der Wirkung dieses Berufs aus deren Sicht. Als Korrektiv dieser Einseitigkeit wird in der Einführung ein „Fall“ geschildert: Zwar sprechen auch in diesem Fall die Klientinnen nicht über sich; vielmehr wird referiert, was sie sagten oder taten. Zumindest zeigt dieser Bericht anschaulich, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben, welche Mühe selbst kleine Fortschritte kosten und wie tastend, experimentierend und dialogisch der Hilfeprozess angelegt sein muss, um in solchen Lebenslagen positive Veränderungen zu ermöglichen.
Zugleich dürfte damit bereits ansatzweise deutlich werden: Menschen in Notlagen zu helfen, sie in ihrer Entwicklung zu fördern, in Schwierigkeiten zu unterstützen und in Krisen zu beschützen, ist eine anstrengende, komplizierte und keineswegs immer dankbare Aufgabe. Wie man diese professionell angehen kann, unter welchen gesellschaftlichen, sozialpolitischen und organisatorischen Bedingungen dies geschieht und auf der Grundlage welchen beruflichen Selbstverständnisses dies am ehesten gelingen dürfte, das versucht dieses Buch zu vermitteln.
2 Ein Fall aus der Praxis: Arbeit mit und für Familie Bleicher
Die Soziale Arbeit ist ein Beruf, in dem die Fachkräfte fast immer sehr unterschiedlichen Erwartungen begegnen: Öffentlichkeit und Politik erwarten von ihnen oftmals etwas anderes als der Arbeitgeber und beide jeweils wiederum etwas anderes als ihre KlientInnen. Und unter den Kollegen ist man sich ebenso nicht immer einig, was zu tun, wie es zu tun ist und was man dabei erreichen kann. Nicht zuletzt haben die KlientInnen bestimmte Hoffnungen und Befürchtungen. Und auch auf ihrer Seite können die Erwartungen nochmals auseinander gehen. So hofft ein Teil der überforderten Angehörigen eines dementen, entmündigten alten Menschen z.B. auf Entlastung und sichere Unterbringung, der alte Mensch will in seiner Wohnung bleiben, ein anderer Teil der Angehörigen sucht nach einem Mittelweg durch eine Kombination von Unterbringung in einer Tagespflegeeinrichtung während der Woche und ambulanter Pflege am Wochenende. Der ambulante Pflegedienst erklärt, dass er dies nicht leisten kann und beruft sich auf die Einschätzung des Hausarztes. Die Sozialarbeiterin, die vom Gericht als Betreuerin des alten Menschen eine vormundschaftliche Funktion übernahm, versucht nun, unter diesen Bedingungen dem Wunsch des alten Menschen so weit wie möglich entgegenzukommen – hat aber auch Verständnis für die Angehörigen, die beispielsweise fürchten, dass sich die alte Frau doch wieder irgendwie Kerzen beschafft, die sie so liebt und dann vergisst, diese weit genug von Vorhängen und anderen brennbaren Gegenständen entfernt aufzustellen und ins Bett geht, ohne sie auszublasen.
Oftmals ist nicht klar, was die Aufgabe der Fachkraft ist. Wie weit soll sie sich z.B. in diesem Fall bemühen, zwischen den Angehörigen zu vermitteln und die Nachbarn zu beruhigen? Wie viel Zeit hat sie für diese Arbeit mit dem sozialen Umfeld? Wie viel Zeit, um Lösungen zu finden, die nicht nur ein Überleben, sondern ein menschenwürdiges Leben sichern? Wie viel Zeit (insbesondere bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen), um Erfahrungen zu ermöglichen, die es erlauben, verhinderte Entwicklungen nachzuholen.
Die gleichzeitige Komplexität der Probleme, die Offenheit der Aufgabenstellung und die Widersprüchlichkeit der Erwartungen verlangen von den Fachkräften zunächst eine Klärung der eigenen Rolle, der denkbaren Ziele und Prioritäten und eine kontinuierliche Abstimmung dieser Überlegungen mit allen Beteiligten. Insofern ist die Soziale Arbeit in besonderem Maße ein reflexiver und dialogisch angelegter Beruf. Dabei ist in jedem Fall (sei der „Fall“ eine Person, eine Familie, eine Gruppe, ein Stadtteil oder eine Organisation) ein dreifacher kontinuierlicher Klärungsprozess nötig. Dieser lässt sich nach folgenden Fragen unterteilen:
1. Ist dies ein Fall, den ich bearbeiten kann oder muss, weil ich in doppeltem Sinn die Kompetenzen dafür besitze – also zuständig und fähig bin, ihn zu bearbeiten? Ist dieses ein Fall für mich, oder muss ich ihn weitervermitteln an andere Organisationen?
2. Wie kann es mir gelingen, in diesem Fall mit den Beteiligten in einen produktiven Austausch zu treten, obwohl sie zu misstrauisch, zu resigniert oder zu stolz sind, um Unterstützung anzunehmen? Wie kann daraus ein Fall werden, an dem ich mit den Beteiligten auf eine Lösung hinarbeiten kann?
3. Und was könnte ein (gemeinsames) Ziel der Beteiligten sein? Wie sehen sie das Problem, wie sehe ich es? Was sind die Ursachen, was ist zu tun und was könnte ein Weg zu einer Lösung sein? Habe ich überhaupt verstanden, worum es hier geht, so dass ich sagen kann, dies ist ein Fall von?
Diese dreifache Klärung (Fall für, mit, von) bildet ein Kernstück der methodischen Überlegungen einer reflektierten, professionellen Berufsausübung (Müller 2006). Das folgende Fallbeispiel verdeutlicht anschaulich die schwierigen Suchbewegungen solcher Überlegungen im Austausch mit vielen Beteiligten. Nicht immer dauern die Suchprozesse so lang (vier Jahre!) und sind so kompliziert wie im Fall der Arbeit mit der Familie Bleicher. Aber die „strukturierte Offenheit“ (Thiersch 1993b) des Vorgehens ist auch für andere Arbeitsfelder charakteristisch.
Der Fall stammt aus den Akten eines Jugendamts. In diesen Akten sind u.a. zahlreiche Schriftstücke weiterer Organisationen in Kopie abgeheftet. Namen, Orte, teilweise auch das Alter der Beteiligten wurden geändert, um ein Wiedererkennen der Betroffenen zu verhindern. Es ist die leicht überarbeitete Fassung der zusammenfassenden Darstellung des Jugendamtmitarbeiters Meinolf Pieper.
Fallbeispiel
Frau Bleicher ist 42 Jahre alt und lebt allein mit ihren beiden Kindern Daniela (11) und Frederick (9). Sie war zweimal verheiratet. Ihr Sohn aus erster Ehe lebt beim Vater. Frau Bleicher hat schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu diesem inzwischen volljährigen Sohn.
Von ihrem zweiten Mann, dem Vater von Daniela und Frederick, ist sie geschieden. Nach Aussagen von Frau Bleicher war er Alkoholiker. Zu einem ersten Kontakt mit dem Jugendamt kam es, weil ein Nachbar den Allgemeinen Sozialdienst (ASD) des Jugendamtes informierte, dass Frau Bleicher schon tagsüber betrunken sei. Sie brülle dann ihre Kinder laut an und schlage sie auch. Daniela habe große, blaue Flecken am Kopf und war deswegen seit zwei Tagen nicht mehr in der Schule. Die Schule bestätigte das Fernbleiben. Ein Hausbesuch zeigte, dass die Schilderungen des Nachbarn zutrafen. Bei dieser ersten Kontaktaufnahme erklärte Frau Bleicher, die unter Alkoholeinfluss stand, dass sie mit ihrem Partner häufiger Streit habe. Dies führe derzeit zu einem etwas vermehrten Alkoholkonsum, sie habe sonst keine Alkoholprobleme.
Die Familie wohnt in einer Zweizimmerwohnung in einer Siedlung mit hohem Ausländeranteil. Im Haus von Frau Bleicher wohnen drei russlanddeutsche Familien, von denen sich die anderen deutschen Familien, auch Frau Bleicher, bewusst abgrenzen. „Die“ würden schon morgens „harte Sachen“, „billigen Wodka“ usw. trinken. Die beiden Kinder teilen sich ein Zimmer, die Mutter bewohnt den anderen Raum. Auf die Fachkraft des ASD machte die Wohnung einen sehr sauberen, ordentlichen und liebevoll eingerichteten Eindruck. Die Kinder wirken äußerlich gut versorgt, angemessen gekleidet und ernährt. Im Bericht des Jugendamtes heißt es weiter, dass sich die Mutter nach weiteren Gesprächen und Besuchen bereit erklärte, eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen. Nach einigen Terminen brach sie den Kontakt jedoch wieder ab, weil sie die Beraterin als „blöd“ und „oberklug“ empfand. Die Sozialarbeiterin bemühte sich daraufhin eine andere Beraterin für sie zu finden. Dann kam die Urlaubszeit, das „Sommerloch“.
Nach ca. fünf Monaten gingen erneut Hinweise von Nachbarschaft und Polizei ein, dass Frau Bleicher in betrunkenem Zustand ihre Aufsichtspflicht verletzt habe. Daniela wurde um 22 Uhr 15 von der Polizei auf der Straße aufgegriffen. Frau Bleicher berichtete, dass sie sich von ihrem Lebenspartner getrennt habe. Gleichzeitig war es ihr jedoch gelungen, eine Arbeit zu finden. Vom Jugendamt wurde diese Entwicklung positiv bewertet. Die Schwierigkeiten wurden als vorübergehende Belastungen durch die Trennung eingestuft, da Frau Bleicher dieses Mal keine Alkoholfahne aufwies, als sie im Jugendamt erschien.
Frau Bleicher schilderte, dass sie in ihrer Kindheit von ihrem Vater häufig geprügelt worden sei. Er sei Alkoholiker gewesen und habe sie wie einen Jungen behandelt. Daher habe sie auch Probleme damit, Daniela anzunehmen. Mit ihrem Sohn sei alles viel einfacher. Sie berichtete von zunehmenden Unstimmigkeiten mit ihrer Tochter, die ihr nicht mehr gehorche. Diese sei wohl in der „vorpubertären“ Phase. Sie selbst fühle sich überfordert. Nach einem weiteren Gespräch stellte sie einen Antrag auf Jugendhilfe („Erziehungsbeistand“) – in der Hoffnung, entlastet zu werden.
In der Folgezeit beruhigte sich die Situation und es gab eine lange Phase ohne Auffälligkeiten. „Frau Bleicher hatte einen neuen Partner gefunden, der sich gut in die regelmäßigen Gespräche mit dem Jugendamt einbinden ließ. Deutlich wurde, dass Frau Bleicher sich bemühte, eine neue Familie mit ihrem derzeitigen Freund aufzubauen“ (Jugendamtsbericht an das Familiengericht aus 04/1999). Schon zwei Monate später allerdings informierte Frau Bleicher das Jugendamt, dass ihr Lebensgefährte „bei Nacht und Nebel“ abgehauen sei. Er habe das Konto leergeräumt und sie somit auch noch um ihr Geld betrogen.
Drei Wochen später teilte Frau Bleicher dem Jugendamt mit, dass sie einen neuen Freund habe. Die Unterstützung durch die Fachkraft der Erziehungsbeistandschaft wollte sie beenden. Sie fühle sich zu sehr beobachtet und überwacht. Auch die Gespräche mit der Jugendamtsmitarbeiterin wollte sie nicht mehr fortführen. Bei weiteren Kontaktaufnahmeversuchen von Seiten des Jugendamtes stellte sich heraus, dass ihr neuer Freund diese Kontakte nicht wünschte.
Einige Wochen später kam es zu mehreren gewalttätigen Übergriffen des Freundes auf Frau Bleicher, die Polizeieinsätze und Anzeigen nicht nur von Nachbarn, sondern auch von Frau Bleicher nach sich zogen. Da unklar war, inwiefern auch die Kinder von den Übergriffen betroffen waren, entschied das Jugendamt, das zuständige Familiengericht anzurufen. Das Klima in der Wohnung sei nicht angstfrei und das Wohl der Kinder gefährdet. Ein Zugang zur Familie bestehe nicht mehr, so dass „gerichtlicherseits eine Gefährdung der Kinder abgeklärt werden müsse“ (Jugendamtsbericht an das Familiengericht).
Etwa vier Wochen nach der Beantragung der Überprüfung der Kindeswohlgefährdung fand eine Gerichtsanhörung statt. Frau Bleicher erklärte, wieder regelmäßigen Kontakt zur Suchtberatungsstelle zu unterhalten und auch gemeinsam mit ihrem Freund eine psychologische Beratungsstelle zu besuchen, um weitere Gewaltausbrüche zu vermeiden. Das Gericht machte der Mutter die Auflage, dieses weiterhin zu tun. Außerdem sollte sie wieder kontinuierlichen Kontakt mit der Mitarbeiterin des Jugendamtes halten (Protokoll der Gerichtsanhörung).
Im Oktober kam es zur Unterbringung von Daniela im Rahmen einer Inobhutnahme durch das Jugendamt und zu einer Unterbringung in einer Notaufnahme-Pflegestelle. Vorangegangen waren Streitigkeiten zwischen Daniela und ihrer Mutter. Die Mutter hatte die kurzfristige Unterbringung ihrer Tochter durch einen Anruf beim Jugendamt veranlasst. Sie sei kurz davor auszurasten. „Sie will zu ihrem Schutz und zum Schutz ihrer Tochter diese kurzfristig und vielleicht sogar langfristig unterbringen lassen“ (Meldezettel über die Inobhutnahme der Rufbereitschaft des Jugendamts).
Frau Bleicher schilderte nach der Inobhutnahme immer wieder, dass sie mit Daniela nicht zurechtkomme. Sie habe Angst davor, dass ihre Tochter „abrutsche“, da sie auch intensive Kontakte zu Jungen aufgenommen hätte. Sie beantragte schließlich die Unterbringung von Daniela in einer betreuten Wohngruppe. Daniela selbst äußerte, nicht mehr nach Hause gehen, sondern in einer Wohngruppe leben zu wollen (Jugendamtsakte).
Auch die Polizei erwartete vom Jugendamt, dass Daniela untergebracht werde. Belastend für die Familiensituation seien insbesondere die Konflikte zwischen Frau Bleicher und ihrem Lebenspartner. „Frau Bleicher und ihr Lebensgefährte sind alkoholabhängig und bei der Polizei sehr gut bekannt. In den letzten Wochen und Monaten kam es mehrmals zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Frau Bleicher und ihrem Partner, so dass entweder die Mutter oder auch die Kinder die Polizei anriefen“ (Polizeibericht). Fast täglich sei Frau Bleicher von ihrem Lebensgefährten, teilweise auch im Beisein der Kinder geschlagen worden (Jugendamtsbericht an das Familiengericht, Polizeiberichte).
Laut Aktenvermerk wurden drei Jugendhilfeeinrichtungen zur Auswahl angefragt, die über freie Platzkapazitäten verfügten. Nach einem Vorstellungs- und Informationsgespräch mit Frau Bleicher und Daniela vor Ort wurde eine Außenwohngruppe mit sechs Plätzen ca. 20 km vom Wohnort der Mutter entfernt ausgewählt. In dieser Einrichtung sind Familiengespräche verbindlicher Teil des Angebotes. Darüber hinaus ist die Einbindung der Familien durch Familientage, Familienfeste und die Teilnahme an Gruppenaktivitäten konzeptuell verankert (Informationsschrift der Jugendhilfeeinrichtung). Die Aufnahme Danielas in dieser Einrichtung erfolgte auf gemeinsamen Wunsch der Mutter und des Mädchens.
Als Zielsetzung der stationären Betreuung wurde formuliert, dass Daniela einen geschützten, engen und sicheren Rahmen brauche, um sich positiv entwickeln zu können. Die Mutter könne ihr diesen Rahmen derzeit nicht bieten. Daniela benötige dringend Begleitung zur Bewältigung der Pubertät, hauptsächlich in Bezug auf ihr Essverhalten und den Umgang mit Jungen. Außerdem sollte Daniela beim Lernen für die Schule unterstützt werden, da sie sich in letzter Zeit sehr verschlechtert hatte (Protokoll des Hilfeplangesprächs).
Während der Heimunterbringung war die Bezugserzieherin Danielas, die eine Fortbildung zur Familientherapeutin abgeschlossen hatte, maßgeblich an der Arbeit mit der Herkunftsfamilie beteiligt. Zunächst freiwillig, später per Gerichtsbeschluss (siehe oben) war die Mutter gehalten, eine Suchtberatung und mit ihrem Lebensgefährten eine psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen.
Hilfeplangespräche zwischen Jugendamt, Gruppenbetreuerin und Bezugserzieherin aus der Wohngruppe sowie Daniela und ihrer Mutter fanden regelmäßig halbjährlich statt. Monatliche, teilweise auch häufigere Telefonate zwischen der Jugendamtsmitarbeiterin und der Betreuerin Danielas sicherten ein gemeinsames Vorgehen auf der Basis aktuellster Informationen und gleicher oder zumindest bekannter Einschätzungen der Entwicklungen. Zusätzlich fanden in Krisensituationen persönliche Gespräche zwischen der Jugendamtsmitarbeiterin und der Mutter statt (in zahlreichen Aktenvermerken dokumentiert).
Zu Beginn der Unterbringung Danielas in der Wohngruppe meldete sich der Vater beim Jugendamt und bat um Auskunft über die Situation seiner Kinder. Die sorgeberechtigte Mutter lehnte dies jedoch ab. Es konnte jedoch erreicht werden, dass die Mutter ihre Zustimmung zur Information des Vaters über den Hilfeprozess durch das Jugendamt gab. Dies führte zu einer zunehmend stärkeren (schriftlichen und telefonischen) Einbindung des Vaters – trotz erheblicher räumlicher Distanz. Schließlich konnte auch der persönliche Kontakt zwischen Daniela, ihrem Bruder Frederick und dem Vater nach Jahren neu geknüpft werden.
Daniela integrierte sich einerseits sehr gut in die Wohngruppe und in ihre neue Schule. Andererseits hatte sie den starken Wunsch, wieder zu ihrer Mutter zurückzukehren, zumal ihr Bruder nach wie vor zu Hause leben durfte. Es wurde deutlich, dass Daniela sich gegenüber ihrem Bruder stark benachteiligt und aus der Familie ausgestoßen fühlte (Gesprächsprotokoll). Daher wurde vereinbart, dass die Gruppenbetreuerin intensive Gespräche mit Daniela führen sollte, um ihre Lebenssituation im Heim, aber auch die familiäre Position zu erörtern. Im nächsten Hilfeplangespräch mit dem Jugendamt berichtete die Gruppenbetreuerin, dass Daniela inzwischen verstanden habe, „dass es nicht darum geht, dass sie nicht von der Mutter gewollt und alle gegen sie seien. Daniela habe zwischenzeitlich erkannt, dass der Grund für die Unterbringung in der momentan schwierigen Situation der Mutter liegt“ (Hilfeplanprotokoll).
Mit Frau Bleicher wurde besprochen, dass sie Daniela gegenüber eine klare Haltung einnehmen müsse. Die Gruppenbetreuerin hatte beobachtet, dass sie auf Äußerungen ihrer Tochter, sie wolle wieder nach Hause zurück, sehr unsicher und unklar reagierte. Daniela besuchte ihre Mutter regelmäßig jedes zweite Wochenende und teilweise in den Ferien. Um erneute Konflikte zu vermeiden, aber auch ein konsequenteres Verhalten der Mutter zu erreichen, wurden in Absprache mit dem Jugendamt Gespräche zwischen Gruppenbetreuerin und Mutter zum Umgang mit Daniela vereinbart.
Um das Wohlergehen Fredericks ebenfalls sicherzustellen, sollte die Jugendamtsmitarbeiterin regelmäßig über erfolgte Entwicklungen und Gespräche von der Gruppenbetreuerin und von der Mutter informiert werden. Auch das Familiengericht wünschte darüber weiterhin regelmäßig Berichterstattung.
Eine Krisensituation trat etwa ein halbes Jahr später ein, als Frau Bleicher erneut von ihrem Lebensgefährten geschlagen wurde. Frederick hatte die Polizei gerufen, die den Lebensgefährten verhaftete. Da dieser noch eine Haftstrafe zu verbüßen hatte, sei er auf unbestimmte Zeit, mindestens jedoch ein Jahr fort. Frederick lehnte einen Auszug bei der Mutter – ebenso wie Frau Bleicher selbst – vehement ab. Die Mutter betonte, dass Schwierigkeiten zwischen ihr und ihrer Tochter bestünden, nicht jedoch mit dem Sohn. Dies sei schon immer so gewesen. Es wurde vereinbart, intensive Kontakte zwischen Jugendamt und Mutter fortzuführen (Aktenvermerk des Jugendamts).
In den folgen Wochen beruhigte sich die Situation bei der Mutter, in der Wohngruppe von Daniela wurde sie jedoch schwieriger. Daniela fühlte sich zwischen Wohngruppe und Mutter hin- und hergerissen. Sie lief aus der Gruppe fort, wurde polizeilich gesucht und bei der Mutter gefunden. Die Mutter hatte sich nicht bei der Gruppenbetreuerin gemeldet und mitgeteilt, dass ihre Tochter bei ihr sei (Aktenvermerk). Die Mutter erklärte im Gespräch mit Gruppenbetreuerin und Jugendamtsmitarbeiterin, dass es ihr schwer falle, ihren Kindern Grenzen zu geben und sich durchzusetzen.
Die Schulferien sollte Daniela bei der Mutter verbringen. Zur Vorbereitung sollten sich die Betreuerin der Wohngruppe und Frau Bleicher eine Zeitlang wöchentlich treffen, um genau zu besprechen, was Daniela lernen muss, während sie daheim ist, wenn sie nach Hause zurückkehren möchte. Frau Bleicher bekam von der Wohngruppe einen Plan, in den sie das Verhalten ihrer Tochter während der Ferien notieren sollte, um ihn gemeinsam mit der Betreuerin auszuwerten. Darüber hinaus wollte die Wohngruppe mit dem Mädchen eine schriftliche Vereinbarung treffen, wie sich Daniela in der Gruppe und auch bei der Mutter zu verhalten habe, um das Zusammenleben stressfrei zu gestalten. Die Ferien verliefen weitgehend problemlos.
Im nächsten Hilfeplangespräch wurde mitgeteilt, dass sich Danielas Schulsituation stabilisiert hatte und sie gut benotet wurde. Mutter und Tochter berichteten übereinstimmend, dass sich ihr Verhältnis gebessert habe; dass es jedoch nach wie vor Auseinandersetzungen gäbe, wenn sie längere Zeit miteinander verbringen würden. Daniela äußerte dennoch den Wunsch, jedes Wochenende bei der Mutter zu verbringen. Frau Bleicher war dies zum damaligen Zeitpunkt zu viel. Es wurde vereinbart, dass stattdessen regelmäßig zweimal pro Woche Telefonate stattfinden sollten.
Die Zielsetzung der Hilfe in der Wohngruppe und zu Hause wurde dahingehend modifiziert, dass Daniela mehr Eigenverantwortung übernehmen sollte, z. B. für Alltagserledigungen, Haushalt, Mithilfe bei der Mutter. Sie sollte aber auch darin unterstützt werden, sich den Anforderungen der Mutter nicht zu schnell anzupassen aus Hilflosigkeit und Angst vor Liebesentzug. Sie sollte lernen, sich von anderen abzugrenzen. Hierzu wurden konkrete Möglichkeiten der Umsetzung besprochen, z. B. schriftlich anderen Menschen Wünsche, Enttäuschungen, Freude und Lob mitzuteilen.
Einen Monat später wurde dem Jugendamt von der Betreuerin mitgeteilt, dass Frau Bleicher einen neuen Lebensgefährten habe. Dieser lebe in Trennung und sei mit seinen beiden Kindern (12 und 17 Jahre) quasi bei Frau Bleicher eingezogen, so dass nunmehr fünf Personen in der 2-Zimmer-Wohnung wohnen würden. Diese Situation würde Frau Bleicher sehr überfordern. Sie habe sich daher aus der Zusammenarbeit mit der Wohngruppe völlig zurückgezogen. Daniela würde immer auffälliger, auch in der Schule und leide unter dem Rückzug der Mutter. Der Lebensgefährte von Frau Bleicher müsse zur Haftvermeidung in einigen Wochen eine stationäre Alkoholtherapie antreten. Einigkeit bestand zwischen der Gruppenbetreuerin aus der Wohngruppe und der Jugendamtsmitarbeiterin darüber, dass Frau Bleicher nicht fremde Kinder betreuen kann, wenn sie mit ihren eigenen schon überfordert ist. Außerdem belaste diese Lebenssituation Frederick sehr (Aktenvermerk Jugendamt).
Vier Wochen später teilte die Betreuerin aus der Wohngruppe der Jugendamtsmitarbeiterin mit, dass die häusliche Situation bei Familie Bleicher extrem problematisch geworden sei. Es habe gewalttätige Übergriffe auf Frau Bleicher durch ihren Freund gegeben; die Wohnung sei teilweise von ihm verwüstet worden. Die weitere Entwicklung sei unklar, der Alkoholkonsum von Frau Bleicher wäre wieder sehr kritisch (Aktenvermerk). Frau Bleicher zog drei Wochen später mit Frederick zu ihrem Lebensgefährten. Durch den Umzug der Familie fand jugendamtsintern ein Zuständigkeitswechsel statt, so dass eine neue Bezirkssozialarbeiterin die weitere Begleitung der Hilfe übernahm. Im Vorfeld wurde der Wechsel mit Frau Bleicher besprochen, die jedoch keine Probleme sah, sich auf eine neue Sozialarbeiterin einzustellen (Aktenvermerk).
Anlässlich eines Hilfeplangesprächs drei Monate später berichtete Frau Bleicher, dass der 12-jährige Sohn des Lebensgefährten zu seiner Mutter umgezogen sei. Auch der ältere Sohn sei ausgezogen, so dass sich die Situation insgesamt entspannt habe.
Die Entwicklung Danielas nahm ebenfalls eine positive Wendung. Sie erledigte ihre Aufgaben zu Hause problemlos und selbstständig nach Plan. Manchmal sei sie jedoch aufsässig, so dass es dann Diskussionen mit der Mutter gebe. Auch von der Betreuerin der Gruppe wurde berichtet, dass Daniela nicht mehr so hilflos wirken würde und sie Anforderungen wesentlich besser aushalten könne. Der klare Gruppenrahmen und die Gruppenstruktur hätten ihr sehr gut getan. Daniela äußerte den Wunsch, die häuslichen Besuche wieder auf jedes Wochenende auszudehnen. Die Mutter, die zunächst eher skeptisch war, konnte sich dann jedoch darauf einlassen. Dieser Entschluss wurde von allen Beteiligten – auch vom Lebensgefährten der Mutter – mitgetragen (Hilfeplanprotokoll des Jugendamts).
Die häusliche Situation, der Umzug und die in der neuen Paarbeziehung wieder stattfindenden massiven, zum Teil körperlich ausgetragenen Streitigkeiten, belasteten Frederick zunehmend. Er versuchte seine Mutter in Gewaltsituationen zu schützen und übernahm immer mehr Verantwortung für sie. Die Schule berichtete über massive Aufmerksamkeitsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten (Aktenvermerk über Gespräche mit dem Lehrer). Auf Wunsch der Mutter wurde Frederick in einer sozialpädagogischen Tagesgruppe aufgenommen und betreut.
Vier Monate später beruhigte sich die gesamte Familiensituation zunächst, da der Lebensgefährte von Frau Bleicher die gerichtlich verfügte Alkoholtherapie antrat und nach Abbruch dieser Therapie inhaftiert wurde. Wenige Wochen später wurde die Situation jedoch wieder kritischer, da nun verstärkt Alkoholexzesse der Mutter auftraten. Die Tagesgruppe teilte mit, dass Frederick nicht mehr zu halten sei; zunehmend aggressiver sei er geworden und kaum noch ansprechbar. Die Jugendamtsmitarbeiterin erklärte der Mutter, dass eine Fremdunterbringung Fredericks nun unausweichlich sei. Das Familiengericht wurde ebenfalls über die aktuelle Entwicklung unterrichtet. Vor diesem Hintergrund reichte Frau Bleicher einen Antrag auf Heimerziehung für ihren Sohn ein. Das Gericht bestellte einen Verfahrenspfleger für Frederick, beließ der Mutter aber das Sorgerecht. In 09/2001 wurde Frederick in einer nur von Jungen bewohnten Außenwohngruppe, ca. 25 km vom Wohnort der Mutter entfernt, aufgenommen.
Die Veränderung des sozialen und erzieherischen Umfeldes tat Frederick zunächst gut. Er kam in Gruppe und Schule zurecht und lernte auch sein aggressives Verhalten besser zu steuern. Er war freundlich, umgänglich und beliebt. Nach einem dreiviertel Jahr jedoch blieb er immer häufiger ohne Genehmigung von der Wohngruppe fort und blieb bei seiner Mutter. Nach diesen Besuchen veränderte sich sein Verhalten extrem. Er wurde immer aggressiver und weniger ansprechbar (Bericht des Verfahrenspflegers an das Gericht). Als Ursache dieser Verhaltensänderungen sah der Verfahrenspfleger die Haftentlassung des Lebensgefährten von Frau Bleicher an. „Nach seiner Rückkehr entstand für Frederick wieder die Notwendigkeit, seine Mutter vor Gewalttätigkeiten zu schützen“ (Gerichtsbeschlussbegründung). Frau Bleicher hatte ihre Arbeitsstelle verloren, weil die Firma Konkurs anmelden musste. Mehrere erfolglose Bewerbungen hatten sie völlig demoralisiert, so dass sie wieder vermehrt Alkohol trank und auch mit dem Jugendamt kaum noch Kontakte zuließ. Auf Antrag des Jugendamts wurde Frau Bleicher schließlich vom Gericht die elterliche Sorge für ihren Sohn vollständig und für ihre Tochter das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen und dem Jugendamt übertragen.
Parallel hierzu erfolgte ein Hilfeplangespräch in der Wohngruppe von Frederick, an dem auch seine Mutter beteiligt war. Sie erklärte, dass sie es für dringend notwendig halte, dass ihr Sohn sie weiterhin besuchen käme. Die Mitarbeiterin des Jugendamtes musste ihr jedoch mitteilen, dass dies in der gegenwärtigen Situation Frederick nur schaden würde und deshalb nicht möglich sei. In der Wohngruppe jedoch könnten Kontakte regelmäßig und häufig stattfinden. Damit war Frau Bleicher jedoch nicht einverstanden. Die Jugendamtsmitarbeiterin erklärte ihr daraufhin, wie sie beim Jugendamt Einspruch gegen diese Entscheidung einlegen könne.
Nachdem Daniela einige Monate zuvor einen ersten Besuchskontakt zum Vater hatte, sollte auch Frederick ein Besuch ermöglicht werden. Er hatte schon von sich aus mehrfach schriftlich und telefonisch Kontakt zum Vater aufgenommen. Der Vater, ein trockener Alkoholiker, lebte mittlerweile in finanziell abgesicherten Verhältnissen mit einer neuen Partnerin. Er war bereit, mehr Verantwortung für seine Kinder zu übernehmen.
Die folgenden neun Monate waren von starken Annäherungsversuchen der Kinder an ihre Mutter gekennzeichnet. Frederick, dem Besuche bei der Mutter von Seiten des Jugendamtes und des Gruppenbetreuers untersagt worden waren, nutzte jede Gelegenheit, heimlich zu seiner Mutter zu fahren. Gleichzeitig wurde er in der Gruppe immer schwerer lenkbar, baute schulisch ab, und sein Verbleib in der Einrichtung war in Frage gestellt (Jugendamtsbericht an das Familiengericht). Besuche in der Wohngruppe und vor allem Gespräche mit dem Gruppenbetreuer Fredericks lehnte die Mutter ab, da sie sich von ihm bevormundet fühlte. Der Gruppenbetreuer seinerseits unternahm nichts, um eine bessere Beziehung zur Mutter aufzubauen.
Parallel entstand ein zunehmend enger Kontakt von Frederick zu seinem Vater in Form von Telefonaten und Wochenendbesuchen. Angesichts der immer problematischer werdenden Situation in der Wohngruppe und der immer stabileren Beziehung zum Vater wurden vom Jugendamt die Möglichkeiten eines Umzugs von Frederick zum Vater geprüft. Intensive Gespräche mit dem Vater, dessen Lebensgefährtin und Frederick fanden im Jugendamt, in der Wohngruppe und beim Vater zu Hause statt. Der Vater und der mittlerweile fast 12-jährige Frederick entschieden sich schließlich, dass Frederick zum Schuljahresende zum Vater ziehen sollte. Die Mutter äußerte zunächst erhebliche Bedenken gegen den Umzug, da sich der Vater lange Zeit überhaupt nicht um seine Kinder gekümmert hatte. Nach mehreren, intensiven Gesprächen mit der Jugendamtsmitarbeiterin und ihrem Sohn konnte sie dessen Entscheidung akzeptieren. Zeitgleich zog es Daniela immer stärker zur Mutter. Frau Bleicher äußerte nun häufiger, ihre Tochter wieder aufnehmen zu wollen und sich dies zuzutrauen. Daniela besuchte die Mutter inzwischen regelmäßig an allen Wochenenden. Mutter und Tochter mussten dabei lernen, immer wieder Absprachen zum Zusammenleben zu treffen. Diese Aushandlungsprozesse wurden von der Gruppenbetreuerin aus der Wohngruppe über Monate intensiv begleitet.
Die Mutter war zwischenzeitlich in eine andere städtische Wohnung umgezogen. Sie lebte „offiziell“ überwiegend allein. Ihr Lebensgefährte hatte ein eigenes Zimmer in einer städtischen Unterkunft, das ihm nach seiner Haftentlassung zugewiesen worden war. Es bestanden somit räumliche Ausweichmöglichkeiten, die auch die Paarbeziehung beruhigten. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wurde eine Rückkehr Danielas zu ihrer Mutter für einen Probezeitraum von sechs Wochen vereinbart. Während dieser Probephase sollte der Heimplatz erhalten bleiben, um Daniela bei einer Krise wieder dort aufnehmen zu können (Jugendamtsbericht an das Familiengericht).
Frederick wurde im Juli 2003 zu seinem Vater entlassen. Der Vater stellte zuvor einen Antrag auf Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge beim zuständigen Familiengericht. Bei einer Gerichtsanhörung erklärte die Mutter sich mit der Übertragung unter der Bedingung einverstanden, dass sie ihren Sohn regelmäßig sehen könne. Seitdem lebt Frederick bei seinem Vater, der nun auch das Sorgerecht hat. Er entwickelt sich sehr positiv, besucht die Regelschule mit guten Leistungen und ist im neuen Umfeld integriert. Ambulante Hilfen waren in den folgenden sechs Monaten nicht notwendig.
Einige Monate zuvor war probeweise die Rückführung Danielas zu ihrer Mutter durch Beschluss des Familiengerichtes ermöglicht worden. Die kurzfristige Rückkehr zur Mutter erfolgte bereits während des laufenden Schuljahres, da sowohl Mutter als auch Tochter massiv hierauf drangen: „Vor dem Hintergrund der sich bildenden Symbiose zwischen Mutter und Tochter stieß die Wohngruppe an ihre betreuerischen Grenzen. Die Wohngruppe „stimmt daher einer probeweisen Rückführung Danielas zu ihrer Mutter ebenfalls zu“ (Hilfeplanprotokoll).
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht wurde dennoch beim Jugendamt belassen, um gegebenenfalls in einer Krisensituation rasch reagieren zu können. Ein solches Eingreifen wurde zwischenzeitlich immer wieder einmal notwendig; teilweise eskalierten die Konflikte zwischen Mutter und Tochter oder es kam zu Phasen von Alkoholmissbrauch bei Frau Bleicher. Auch die Paarbeziehung ist noch immer durch Gewaltepisoden geprägt; diese haben jedoch abgenommen, seit die Partner in getrennten Wohnungen leben – was nicht zuletzt auf Drängen der Tochter zurückzugehen scheint. Der Auftrag des Jugendamts wurde nochmals umdefiniert. Er bezieht sich derzeit vor allem auf finanzielle Probleme, da Frau Bleicher sich für ihren Lebenspartner verschuldete. Außerdem soll Frau Bleicher ermutigt werden, ihre Idee, nochmals eine Suchtberatung zu nutzen, umzusetzen. Daniela ist froh, wieder zu Hause zu leben und zeigt gute schulische Leistungen (Hilfeplanprotokoll).
Für mich ist das Berührende an diesem Fall die Bereitschaft aller Beteiligten, selbst in ausweglosen Situationen und nach immer neuen Rückschlägen dennoch weiter nach Lösungen zu suchen und auf positive Veränderungen zu hoffen. Viele Personen müssen bereit sein, dazu beizutragen: die Familienmitglieder, die Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Jugendamt, in den Wohngruppen und auch der Verfahrenspfleger der Richter des Familiengerichtes. Alle gehen dabei immer wieder schwer kalkulierbare Risiken ein, versuchen Neues und kooperieren trotz erheblicher Zweifel. Sie geraten dabei teilweise in Konkurrenz und erkennen dies nicht immer rechtzeitig. Vor allem die Zusammenarbeit der Mitarbeiterin aus der Wohngruppe Danielas mit der Familie ist ungewöhnlich eng und intensiv. Gemeinsam finden sie zu Lösungen, die vorher niemand für möglich gehalten hätte. Frederick findet beim Vater eine familiale Konstellation, in der er nicht mehr als Beschützer der Mutter überfordert ist. Daniela, die mit ihm rivalisierte, erlangt für die Mutter eine neue Bedeutung, nachdem Frederick ausgezogen ist. Sie kann nicht nur zur Mutter zurückkehren, sie hat inzwischen auch gelernt, besser für sich selbst zu sorgen und fordert z.B. von der Mutter eine Abgrenzung gegenüber dem gewalttätigen Partner.
Solche „Lösungen“ beruhen vorrangig auf der Kraft der Familienmitglieder, aber auch auf unterstützenden, strukturellen Rahmenbedingungen. Glücklicherweise war eine wohnortnahe Unterbringung der Kinder möglich. So riss die Beziehung zur Mutter nicht ab; zum Vater konnte sie wieder neu geknüpft werden. Das Heim beteiligte sich aktiv an allen Überlegungen zur Rückführung der Kinder, schottete die neue Lebenswelt nicht gegenüber der alten ab und geriet zumindest bei Daniela nicht in Konkurrenz zur Herkunftsfamilie. Die Mitarbeiterin im Heim (mit familientherapeutischer Zusatzausbildung) baute nicht nur Brücken zwischen den beiden sozialen Systemen (Heimgruppe und Familie). Sie begleitete sehr intensiv (einmal wöchentlich!) die Versuche Danielas, nach Hause zurückzukehren. Sie unterstützte Mutter und Kind sogar vor Ort dabei, neue Formen des Zusammenlebens zu entwickeln und erproben. Alle Beteiligten waren bereit, sich häufig zu Gesprächen zu treffen (Hilfeplanentwicklung, -konferenzen) oder sich telefonisch ständig auf dem Laufenden zu halten. Das alles kostet Zeit und damit Geld und muss in Kostenvereinbarungen des Heimträgers mit dem Jugendamt genehmigt und vom Jugendamt gegenüber politischen Sparzwängen verteidigt werden. So haben viele Faktoren zu einem guten Ende geführt.
Dieses Beispiel stammt aus einem bestimmten Tätigkeitsfeld und ist insofern nur begrenzt auf andere Problemlagen und Adressaten übertragbar. Einige durchgängige Merkmale Sozialer Arbeit werden aber hier exemplarisch deutlich: die mehrfache, oft biografische Belastung der Klientel; die Verschränkung von ökonomischen, sozialen und psychischen Problemen; der suchende und ausprobierende Zielfindungsprozess angesichts unklarer und widersprüchlicher Erwartungen; der hohe Kooperationsaufwand unter den Anbietern von Hilfen; die Verknüpfung von Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit, von Hilfe und Kontrolle. Und nicht zuletzt zeigt sich an diesem Beispiel die Produktivität von Unterstützungsarrangements, bei denen sich die Fachkräfte dem „Eigensinn“ der Betroffenen so flexibel und geduldig wie möglich anpassen und ihnen dadurch das Finden individueller „Lösungen“ ihrer Probleme ermöglichen. Eine aufmerksame Entwicklungsbeobachtung, gut koordinierte Einflussnahme und geduldige Zuversicht ist nötig, um eine solche, immer noch fragile Stabilisierung zumindest manchmal zu erreichen.
3 Die handlungstheoretische Perspektive: Soziale Arbeit als Figurierung von Kräftefeldern
Die Soziale Arbeit hat – wie jeder Beruf – die Aufgabe, bestimmte Ziele zu erreichen. Aus handlungstheoretischer Perspektive, aus der die folgende Darstellung entwickelt wird, steht die Frage im Mittelpunkt, was Fachkräfte tun (können), um angestrebte Veränderungen herbeizuführen und in welchen Kräftefeldern dies geschieht. Die theoretischen Grundlagen dieser Herangehensweise sollen im Folgenden skizziert werden. Für LeserInnen, die kaum über Wissen zur Theorie der Sozialen Arbeit verfügen, empfiehlt es sich, dieses Kapitel zunächst nur diagonal zu lesen und erst am Schluss durchzuarbeiten (vgl. zur Einführung Hamburger 2003; Sahle 2002).
Bezogen auf die Aufgabenstellung des Berufs ist handlungstheoretisch zunächst die Erkenntnis von Bedeutung, dass die Soziale Arbeit nur einen Teil der angestrebten Veränderungen selbst bewirken und sicherstellen kann. Sie kann dafür sorgen, dass eine Familie das ihr zustehende Geld erhält; einen Arzt, Berater oder Nachhilfelehrer findet etc. – also diese und andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, die sie bei der Lebensbewältigung unterstützen. Vielleicht aber will die Familie keine Hilfe annehmen, weil sie ihre Lage nicht als problematisch empfindet oder hofft, ihre Schwierigkeiten allein zu bewältigen. Vielleicht hat sie schlechte Erfahrungen mit Ärzten, Beratern oder Lehrern gemacht – und traut von daher auch der Sozialarbeiterin nicht so recht. Die Veränderung von äußeren Umständen, von Sachverhalten und Objekten hat die Fachkraft im Rahmen ihrer Zuständigkeit und der gegebenen Gesetze und Verordnungen weitgehend in der Hand. Sie kann die finanzielle Lage der Familie verbessern, indem sie z.B. beim Ausfüllen eines Antrages hilft. Sie kann auch Hand anlegen bei der Säuberung der vermüllten Wohnung eines fast blinden, alleinlebenden alten Menschen.
Im Vergleich dazu verlangt die Veränderung des Verhaltens von Personen, dass diese selbst bereit sind, sich und ihre Lebensumstände zu verändern, dass sie überhaupt die Notwendigkeit einer Veränderung einsehen. Deswegen sind äußere Umstände oftmals nicht so einfach zu optimieren. Der alte Mensch wird vieles gesammelt haben, woran er hängt und was er nicht als „Müll“ entsorgen lassen will. Auch die Verbesserung der äußeren Lebensbedingungen erfordert die Bereitschaft zur Kooperation. Die Veränderung von Personen ist vorrangig das Ergebnis einer Selbständerung. Die Soziale Arbeit kann die Bereitschaft, das eigene Denken, Fühlen und Handeln zu ändern, „nur“ anregen und unterstützen. Dies geschieht häufig nicht durch unmittelbare Beeinflussung von Personen, sondern durch Gespräche. Die Soziale Arbeit trägt zur Veränderung von Lebenslagen und Lebensweisen bei, indem sie Kräftefelder schafft oder beeinflusst, die solche Veränderungen erleichtern. Soziale Arbeit ist Arbeit in und an den sozialen Kräftefeldern, in denen Menschen leben; ist Arbeit mit ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld, in Kooperation mit anderen Organisationen. Sie zielt dabei als Beruf auf die Beeinflussung gesellschaftlicher und politischer Konstellationen, die zu Belastungen und Gefährdungen beitragen. „Kräftefelder“ sind Konstellationen, die aus der Interaktion von Personen mit unterschiedlichen Ressourcen unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen entstehen. Sie sind insofern Aktualisierungen von Ausprägungen sozialer „Figurationen“ – ein Begriff von Elias, dessen Theorie im Folgenden erläutert wird.
Hinderliche äußere Kräftefelder können aus Personen bestehen (z.B. der Clique des Jugendlichen, in der es „cool“ ist, Drogen zu nehmen) oder auch aus Organisationen (z.B. der Schule, die den Drogenhandel und die Gewalt auf dem Schulhof ignoriert). Das innere Kräftefeld der Person besteht aus widerstrebenden Impulsen, die den Jugendlichen z.B. zwischen den Erwartungen seiner Clique, seiner Eltern und seinen eigenen Vorstellungen von seinem künftigen Leben und seiner Persönlichkeit schwanken lassen. Die Beeinflussung von sehr komplexen Kräftefeldern, ihre ganzheitliche Figurierung durch den Aufbau von Aktionssystemen ist ein methodisches Spezifikum Sozialer Arbeit und ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Aufgaben und Vorgehensweise dieses Berufes. Dieser Grundgedanke wird sich durch das ganze Buch ziehen.
Der Beruf der Sozialen Arbeit lässt sich von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen ausgehend beschreiben und analysieren. Aus handlungstheoretischer Perspektive stehen die Akteure, d.h. die Fachkräfte des Berufes, ihre Kooperationspartner und ihre Klientel als Handelnde im Mittelpunkt (Birgmeier 2003). Dabei interessiert nicht allein ihr Tun, dessen Ergebnis oder dessen äußere Voraussetzungen. Der Prozess des Handelns, das „Warum“ und das „Wie“ und damit die inneren Voraussetzungen, welche die Akteure motiviert haben zu handeln, sind ebenso bedeutsam, denn Handlungen sind – im Unterschied zu reaktiven Verhaltensweisen – dadurch gekennzeichnet, dass der Handelnde ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, eine Intention verfolgt. Dieses Ziel kann ihm dabei mehr oder minder bewusst sein. Bei Routinehandlungen, insbesondere wenn sie nicht sehr komplex sind, wird der Akteur auf bewährte, wenig reflektierte und leicht abrufbare Handlungspläne zurückgreifen. In anderen Fällen, bei schwierigeren, selteneren und komplexeren Aufgaben, entwirft er bewusst einen detaillierten Handlungsplan, um sein Ziel zu erreichen. Im Zuge der Umsetzung des Handlungsplans und vor allem nach Abschluss der gesamten Handlung wird das tatsächliche Ergebnis des Tuns mit dem angestrebten Ergebnis verglichen. Entspricht es nicht den Erwartungen, so kann der Akteur erneute Anstrengungen zur Erreichung derselben Ziele unternehmen, die Ziele verändern oder aufgeben. Eine handlungstheoretische Analyse muss auf die Handlungsziele, auf den Handlungsplan, auf den Handlungsprozess (d.h. den Verlauf der Umsetzung der Ziele im Vergleich zu den Vorgaben des Handlungsplans) sowie auf die Handlungsergebnisse und auf die Handlungsbedingungen eingehen, um die ganze Handlungskette abzubilden. Die Begründung der Handlungsziele sowie die Bewertung der Handlungsalternativen und Handlungsergebnisse, die für die Steuerung der Handlungen entscheidend sind, bedürfen dabei einer besonders genauen Analyse (ausführlicher zu situativen Motivationsprozessen vgl. Lanterman 1980; zum Kreislauf reflektierter Praxisentscheidungen vgl. Payne 2005, 34). Das Ziel, das von einem Akteur im Nachhinein als Grund des Handelns angegeben wird, muss allerdings nicht die einzige oder bestimmende Ursache seines Handelns gewesen sein (Beckermann 1977). Ziele als Handlungsimpulse können sich verändern, erst allmählich ins Bewusstsein treten – oder gar nicht bewusstseinsfähig sein. Insofern beruht die dargestellte Handlungskette auf einem stark vereinfachenden, primär bewusste kognitive Prozesse erfassenden handlungstheoretischen Modell. Neurowissenschaftler, die sich für das Verhältnis von explizitem, und implizitem Wissen interessieren, nehmen an, dass sich Bewusstsein vor allem als Reaktion auf bereits ausgelöste Handlungsimpulse bildet (Roth 2001, 194f) und insofern Reflexion nicht Voraussetzung sondern in der Regel (oder häufiger) Konsequenz des Handelns ist.
Bisher existiert kein geschlossenes Programm einer sozialwissenschaftlichen Handlungstheorie. Erste beeindruckende Versuche, eine solche Handlungstheorie auf interdisziplinärer Basis zu entwickeln und dabei soziologische und psychologische Erkenntnisse zu verknüpfen, wurden zwar bereits Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre unternommen (Kaminski 1983; Lenk 1978, 1980, 1981, 1984). Bis heute leidet die Entwicklung einer sozialwissenschaftlichen Handlungstheorie jedoch unter der Abkapselung der einzelnen Disziplinen; nur selten kommt es zu einem Austausch zwischen Pädagogen, Psychologen, Soziologen und anderen Wissenschaftlern. Und selbst innerhalb eines Faches sind sehr unterschiedliche theoretische Ansätze zu finden (zur Handlungstheorie der Soziologie vgl. den Überblick von Miebach 1991, Esser 1993). Querverbindungen zwischen soziologischen und psychologischen Handlungstheorien lassen sich am ehesten über die sogenannte verstehende oder interpretative Soziologie und die Theorie des Symbolischen Interaktionismus herstellen. Der mit dieser soziologischen Richtung verknüpfte handlungstheoretische Ansatz soll hier kurz beschrieben werden (zur Einführung in die Denkweise vgl. Luckmann 1992; zum Überblick Helle 2001). Auf mögliche Querverbindungen zur Handlungstheorie der Psychologie wird verwiesen (v. Cranach 1991, 1994; v. Cranach et al. 1980; Groeben 1986, Groeben et al. 1988; zur Kritik der kognitivistischen, Sinnzusammenhänge zergliedernden Handlungstheorie von Dörner oder v. Cranach vgl. Charlton 1987).
Erkenntnistheoretisch unterscheidet sich die Position der sogenannten Verstehenden Soziologie und des Symbolischen Interaktionismus von anderen Positionen durch die These, dass jede Art von Wahrnehmung der Welt (z.B. der sozialen Ordnung) als gegebenem, äußeren Objekt, nicht als Vorgang zu begreifen ist, bei dem dieses Objekt unabhängig vom Wahrnehmenden existiert und von ihm nur „richtig“ erfasst werden muss. Wahrnehmung ist kein Vorgang, bei dem die objektive Welt über Sinneseindrücke im Inneren des Gehirns wie in einem Spiegel registriert wird und es nur darauf ankommt, dass der Spiegel nicht beschlagen oder schräg aufgestellt ist. Wahrnehmung ist vielmehr immer das Ergebnis einer Interaktion zwischen dem, was erkannt werden soll, und dem, der erkennen will. Sie ist das Ergebnis einer zielgerichteten und interessengeleiteten Handlung (Mead 1972; 1973). Entsprechend ist Wahrnehmung immer selektiv und erfolgt erfahrungsgeprägt. Aus der Sicht des Symbolischen Interaktionismus ist die damit gegebene Subjektivität von Wahrnehmungen für die Erkenntnis von sozialem Handeln bedeutsam. Denn nicht die (vermeintlich) objektive Situation beeinflusst das Handeln, sondern ihre subjektive Wahrnehmung und Deutung (Blumer 1969; Schütz 1974). Oder, wie das Thomas-Theorem festhält: „Eine Situation, die als wirklich definiert worden ist, ist real in ihren Konsequenzen“ (Thomas 1965, 114; Gouldner 1974, 58).
Die Konzentration des Symbolischen Interaktionismus auf das Subjekt, auf das Handeln des Einzelnen im Austausch mit anderen Personen, führt dazu, dass nicht die „Strukturen“ (als Verfestigungen früherer sozialer Handlungen vieler Menschen z.B. in Normen, Gesetzen, Institutionen und Organisationen), sondern der Prozess ihrer Produktion, ihr Entstehen im Handeln und ihre Veränderung durch Handeln untersucht und für entscheidend gehalten werden. Mittels dieser handlungstheoretischen Perspektive wird das Augenmerk auf die Vorgänge gelenkt, mit denen der Mensch seine eigene Umwelt produziert oder zumindest mitgestaltet. Dabei lassen sich allerdings – bezogen auf den Freiheitsgrad des individuellen Handelns – recht unterschiedliche Akzentsetzungen feststellen. So wird der Einfluss der Sozialstruktur auf die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung z.B. von Strauss stark betont (Strauss 1959).
Ganz im Sinne der handlungstheoretischen Perspektive lehnte es Norbert Elias immer ab, die Gesellschaft als etwas zu begreifen, das als festgefügte Struktur dem Individuum unveränderbar gegenübersteht. Er verwies mehrfach auf das Wechselverhältnis von Individuum und Gesellschaft und betonte, dass es keine Gesellschaft ohne kontinuierliche wechselseitige Abstimmung der in ihr lebenden Menschen geben kann (Elias 1984, 36ff, 123f; 1987, 41f, 76f, 93f; 1997, 325f). Geschichte ist für ihn „allemal die Geschichte einer Gesellschaft, aber ganz gewiss einer Gesellschaft von Individuen“ (Elias 1987, 41). Entsprechend versteht er Gesellschaft als ein von Individuen geschaffenes und getragenes Interdependenzgeflecht, als „soziale Figuration“. Je größer die Komplexität sozialer Figurationen durch die Zahl der unmittelbar Handelnden oder der mittelbaren Einflüsse wird, desto ungewisser ist die Übereinstimmung der Ergebnisse individueller Handlungen mit den Absichten der Akteure. Trotz individueller Handlungsspielräume gilt:
„Die fundamentale Verflechtung der Einzelnen, menschlichen Pläne und Handlungen kann Wandlungen und Gestaltungen herbeiführen, die kein einzelner Mensch geplant oder geschaffen hat. Aus der Interdependenz der Menschen, ergibt sich so eine Ordnung ganz spezifischer Art, die zwingender und stärker ist, als Wille und Vernunft der einzelnen Menschen, die sie bilden“ (Elias 1987, 93f).
Entsprechend erlebt sich der Einzelne trotz seiner Einflussmöglichkeiten und Handlungsspielräume oft als fremdbestimmt und machtlos. Der Einzelne ist aber nicht nur Opfer, sondern zugleich auch Gestalter der Verhältnisse und als Handelnder für sein Handeln verantwortlich – und sei es nur, indem er „Fremdzwänge“ auf seine Weise in „Selbstzwänge“ verwandelt (Elias 1997, 324).
„Es ist die individuelle Selbststeuerung des Einzelnen in Beziehung zu anderen Menschen, die deren Selbststeuerung Grenzen setzt und sie bindet. Der einzelne Mensch ist, um es schlagwortartig zu sagen, beides: Münze und Prägstock zugleich. Die Prägstockfunktion des einen mag größer sein als die von anderen, er ist immer zugleich auch Münze. Und noch der gesellschaftlich Schwächste hat seinen Anteil an der Prägung und der Bindung von anderen Angehörigen seines Verbandes, gering, wie er sein mag“ (Elias 1987, 84).
Machtunterschiede werden von Elias trotz der Betonung der Wechselwirkung sozialen Handelns – anders als in manchen systemtheoretischen Ansätzen – sehr deutlich gesehen (Elias 1986, 77).