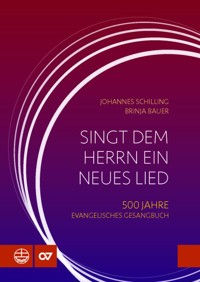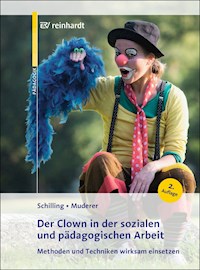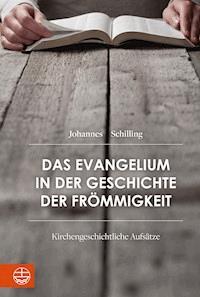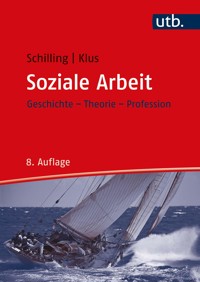
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Studienbücher für soziale Berufe
- Sprache: Deutsch
Studierende der Sozialen Arbeit finden in diesem Buch einen Leitfaden für ihr Studienfach – von den Anfängen der Armenfürsorge über Theorien und Methoden bis hin zu heutigen Berufsbildern und dem professionellen Selbstverständnis. Das Buch hilft den Studierenden dabei, • die Entwicklung des Studienfaches nachzuvollziehen, • die Ziele, Aufgaben und Methoden des Arbeitsfeldes kennen zu lernen, • die Berufsfelder in der Sozialen Arbeit zu differenzieren, • theoretische Modelle zu verstehen. Didaktische Elemente, Fragen zum Text bzw. zur Prüfungsvorbereitung und Zusammenfassungen erleichtern die Arbeit mit diesem Buch. Mit der mittlerweile 8. Auflage zählt das Buch zu den Standardwerken im Studium Soziale Arbeit. utb+: Leser:innen erhalten zusätzlich zum Buch ausführliche Prüfungsfragen mit Antworten als digitales Zusatzmaterial, um das erlernte Wissen zu überprüfen und zu vertiefen. Erhältlich über utb.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
utb 8304
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink • Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht • Göttingen – Böhlau Verlag • Wien • Köln
Verlag Barbara Budrich • Opladen • Toronto
facultas • Wien
Haupt Verlag • Bern
Verlag Julius Klinkhardt • Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck • Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag • Tübingen
Psychiatrie Verlag • Köln
Ernst Reinhardt Verlag • München
transcript Verlag • Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer • Stuttgart
UVK Verlag • München
Waxmann • Münster • New York
wbv Publikation • Bielefeld
Wochenschau Verlag • Frankfurt am Main
Studienbücher für soziale Berufe; 1
Hrsg. von Prof. Dr. Roland Merten, Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Prof. Dr. Cornelia Schweppe, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt
Johannes Schilling • Sebastian Klus
Soziale Arbeit
Geschichte – Theorie – Profession
8., aktualisierte Auflage
Mit 26 Abbildungen, 13 Praxisbeispielen und 137 Übungsfragen
Mit Online-Material
Ernst Reinhardt Verlag München
Johannes Schilling, Dr., ehem. Professor an der Hochschule Düsseldorf, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften; insbes. Didaktik/Methodik; Jugendarbeit und Freizeitpädagogik
Sebastian Klus, Dr., Professor für Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit, Kath. Hochschule Freiburg, Studienbereich Soziale Arbeit
Außerdem sind folgende Bände lieferbar:
Schilling, J.: Didaktik/Methodik Sozialer Arbeit (978-3-8252-8782-5) Schilling, J.: Anthropologie (978-3-497-01821-5) Schilling, J./Muderer, C.: Der Clown in der sozialen und pädagogischen Arbeit (978-3-497-02537-4)
Die 1.–2. Auflage wurde von Johannes Schilling verfasst, die 3.–5. Auflage in Co-Autorenschaft von Johannes Schilling und Susanne Zeller.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
UTB-Band-Nr.: 8304 ISBN 978-3-8252-8808-2 (Print)
8., aktualisierte Auflage © 2022 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i. S. v. § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart Cover unter Verwendung eines Fotos von: © Christophe Baudot – Fotolia.com Satz: JÖRG KALIES – Satz, Layout, Grafik & Druck, Unterumbach
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Einleitung
1 Sozialarbeit – Geschichte der Armenpflege und Armenfürsorge / Wohlfahrtspflege
1.1 Urkategorie der Armenpflege und Fürsorge: Armut und Hilfe
1.2 Armenfürsorge für Erwachsene im Mittelalter (um 12.–13. Jh.) und zu Beginn der Neuzeit (14.–16. Jh.)
1.2.1 Thomas von Aquin (1224–1274)
1.2.2 Martin Luther (1483–1546)
1.2.3 John Calvin (1509–1564)
1.2.4 Humanismus
1.2.5 Juan Luis Vives (1492–1540)
1.2.6 Nürnberger Bettel- und Armenordnungen (1370)
1.3 Erwachsenenfürsorge im Zeitalter der Industrialisierung (18.–19. Jh.)
1.3.1 Industrielle Entwicklung – Pauperismus
1.3.2 Elberfelder Quartiersystem (1867)
1.3.3 Straßburger Quartiersystem (1905)
1.3.4 Sozialgesetzgebung Otto von Bismarcks (1815–1898)
1.4 Wohlfahrtspflege für Erwachsene im 20. Jahrhundert
1.4.1 Kaiserreich und Weimarer Republik (bis 1933)
1.4.2 Alice Salomon (1872–1948)
1.5 Volkspflege im Nationalsozialismus (1933–1945)
1.6 Nach dem Zweiten Weltkrieg: Bundesrepublik Deutschland (seit 1945)
1.7 Armut und Hilfe in der bundesrepublikanischen Sozialarbeit
1.7.1 Armut
1.7.2 Soziale Hilfe
1.8 Zusammenfassung
2 Sozialpädagogik – Geschichte der Jugendfürsorge / Jugendpflege
2.1 Öffentliche Hilfe für Kinder (Jugendfürsorge)
2.2 Armenfürsorge für Kinder im Mittelalter (12.–13. Jh.) und zu Beginn der Neuzeit (14.–16. Jh.)
2.2.1 Findel- und Waisenhäuser
2.2.2 Erziehungskonzept von Juan Luis Vives (1492–1540)
2.3 Jugendfürsorge im Zeitalter der Industrialisierung (17.–18. Jh.)
2.3.1 Hallesche Anstalten von August Hermann Francke (1663–1727)
2.3.2 Hamburgische Armenreform: Caspar Voght (1752–1839)
2.3.3 Rettungshausbewegung/Rauhes Haus in Hamburg: Johann Hinrich Wichern (1808–1881)
2.3.4 Kindergartenbewegung: Wegbereiter und Friedrich Fröbel (1782–1852)
2.3.5 Kirchliche und staatliche Kinderfürsorge
2.4 Wohlfahrtspflege für Kinder im 20. Jahrhundert
2.4.1 Kaiserreich und Weimarer Republik (bis 1933)
2.4.2 Nationalsozialismus (1933–1945)
2.5 Nach dem Zweiten Weltkrieg: Bundesrepublik Deutschland (seit 1945) – Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
2.6 Sozialpädagogik
2.6.1 Sozialpädagogische Bewegung
2.6.2 Begriff Sozialpädagogik
2.7 Jugendhilfe und Jugendarbeit
2.8 Vorbeugung, Prävention
2.8.1 Vorbeugen aus sozialpädagogischer Sicht
2.8.2 Vorbeugen aus jugendpolitischer Sicht
2.8.3 Vorbeugen aus sozialpolitischer Sicht
2.9 Hilfe in den Erziehungs- und Bildungsinstitutionen Familie, Schule und Sozialpädagogik
2.9.1 Primäre Erziehungsinstitution: Familie
2.9.2 Sekundäre Erziehungs- und Bildungsinstitution: Schule
2.9.3 Tertiäre Erziehungs- und Bildungsinstitution: Sozialpädagogik
2.10 Zusammenfassung
3 Entstehungsgeschichte Sozialer Arbeit: Sozialarbeit – Sozialpädagogik – Soziale Arbeit
3.1 Sozialarbeit – Sozialpädagogik
3.1.1 Geschichtliche Wurzeln
3.1.2 Sozialarbeit
3.1.3 Sozialpädagogik
3.2 „Sozial“ und soziale Probleme
3.2.1 Was heißt „sozial“?
3.2.2 Was ist ein soziales Problem?
3.2.3 Soziale Arbeit als Dienstleistung
3.2.4 Soziale Arbeit als (eine) Menschenrechtsprofession
3.2.5 Soziale Arbeit und Menschenbild
3.2.6 Soziale Arbeit als Ressourcenorientierung
3.3 Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Soziale Arbeit: Konvergenz und ihr Verständnis im 21. Jahrhundert
3.4 Erziehung, Bildung, Lernen, Pädagogik
3.4.1 Erziehung
3.4.2 Bildung
3.4.3 Lernen
3.4.4 Pädagogik
3.5 Prävention, Gesundheit, Wohlbefinden
3.5.1 Soziale Arbeit und Gesundheitsfürsorge
3.5.2 Geschichte der Gesundheitsfürsorge
3.5.3 Gesundheit
3.5.4 Wohlbefinden
3.6 Zusammenfassung
4 Theorie-Modelle in der Geschichte Sozialer Arbeit
4.1 Gegenstandsbereich Sozialer Arbeit
4.2 Theorievielfalt
4.3 Geisteswissenschaftlicher Ansatz Sozialer Arbeit: Herman Nohl und Gertrud Bäumer
4.3.1 Herman Nohl (1879–1960)
4.3.2 Sozialpädagogik nach Gertrud Bäumer (1873–1954)
4.4 Emanzipativer, kritisch-materialistischer Ansatz Sozialer Arbeit: Klaus Mollenhauer (1928–1998)
4.5 Lebensweltorientierter Ansatz Sozialer Arbeit: Hans Thiersch (1935)
4.6 Systemtheoretischer Ansatz Sozialer Arbeit: Michael Bommes (1954–2010) und Albert Scherr (1958)
4.7 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession: Silvia Staub-Bernasconi (1936)
4.8 Theorien für die Soziale Arbeit als emergente Handlungswissenschaft
4.9 Zusammenfassung
5 Ziele und Methoden Sozialer Arbeit
5.1 Definition Sozialer Arbeit der International Federation of Social Workers
5.2 Ziele Sozialer Arbeit
5.3 Phasen der Entwicklung von Methoden Sozialer Arbeit
5.3.1 Erste Phase: Anfänge (Beginn des 20. Jh.)
5.3.2 Zweite Phase: Übernahme amerikanischer Methoden (1950er Jahre)
5.3.3 Dritte Phase: Methodenkritik (etwa 1968–1975)
5.3.4 Vierte Phase: Ausdifferenzierung (1980er Jahre)
5.3.5 Fünfte Phase: Neue Trends (1990er Jahre)
5.4 Methodisches Handeln Sozialer Arbeit
5.5 Beratung als Schlüsselkompetenz Sozialer Arbeit
5.5.1 Veränderungen in der Gesellschaft
5.5.2 Abgrenzung zu anderen Begriffen
5.5.3 Soziale Beratung
5.6 Evidence-Based Practice Sozialer Arbeit
5.7 Zusammenfassung
6 Studium – Berufsfelder – Profession
6.1 Studium Sozialer Arbeit
6.1.1 Berufsausbildung im Zeitalter der Industrialisierung (1893–1933)
6.1.2 Berufsausbildung im Nationalsozialismus (1933–1945)
6.1.3 Berufsausbildung nach dem Zweiten Weltkrieg
6.1.4 Berufsausbildung Sozialer Arbeit nach dem Bologna Beschluss
6.2 Arbeitsfelder Sozialer Arbeit
6.3 Träger Sozialer Arbeit
6.3.1 Öffentliche Organisation Sozialer Arbeit
6.3.2 Träger Sozialer Arbeit (Jugendamt)
6.3.3 Freie Träger Sozialer Arbeit (Wohlfahrtsverbände)
6.3.4 Träger anderer Hilfsangebote Sozialer Arbeit (Jugendverbände)
6.3.5 Zusammenarbeit der Träger: Subsidiaritätsprinzip
6.4 Verberuflichung und Professionalisierung
6.4.1 Verberuflichung
6.4.2 Professionalisierung
6.4.3 Kompetenzen in der Sozialen Arbeit
6.5 Verständnis Sozialer Arbeit – Fachgewerkschaft für Soziale Arbeit (DBSH)
6.5.1 Historische Entwicklung gewerkschaftlicher Organisationen
6.5.2 Soziale Arbeit – Grundsatzprogramm des DBSH
6.6 Gesellschaftliche Funktionen Sozialer Arbeit
6.6.1 Sozialpolitik und Soziale Arbeit
6.6.2 Doppelmandat und Tripelmandat
6.6.3 Verhältnis zwischen Profession und Politik/Wirtschaft
6.6.4 Soziale Arbeit als Dienstleistung
6.7 Zusammenfassung
7 Was heißt Soziale Arbeit?
Literatur
Sachregister
Einleitung
Abbildung 1: Soziale Arbeit als alter Baum
„Die Soziale Arbeit ist ein alter Baum mit unzähligen Jahresringen. Seine Rinde bindet sehr unterschiedliche Traditionen unter Vorspiegelung einer trügerischen Einheitlichkeit zusammen. Wir müssen uns immer wieder von neuem daran erinnern, dass die Wurzeln unseres Berufes sowohl beim Aufseher im Arbeits- und Zuchthaus und der Armenpolizei des ausgehenden Mittelalters liegen, als auch bei den Fröbelschen Spielführerinnen und den ehrenamtlichen Kindergärtnerinnen der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung.“ (Müller 1992, 52 f.)
C. W. Müller hat für die Entwicklung Sozialer Arbeit das Bild eines Baumes entworfen. Dieses Bild haben wir aufgegriffen und jeweils zu Beginn eines Kapitels, quasi als Überblick, die zu behandelnden Themen bildlich in diesen Baum eingearbeitet. Mit jedem Kapitel wächst dieser Baum (Jahresringe). Zuerst werden die Wurzeln Sozialer Arbeit bedacht, es folgt der Stamm mit den einzelnen Phasen Sozialer Arbeit, in den Ästen und Zweigen wird die Vielfalt und Vielseitigkeit Sozialer Arbeit deutlich. Die alles zusammenfassende Krone des Baumes zeigt die Gesamtheit aller Aspekte Sozialer Arbeit. So müsste man eigentlich auf die Frage „Was ist Soziale Arbeit?“ antworten: „Soziale Arbeit ist das Ganze, das in dem Bild des Baumes dargestellt wurde.“
Hilf dir selbst, sonst helfen dir SozialarbeiterInnen/ SozialpädagogInnen!
Diese 8., aktualisierte Auflage möchten wir zum Anlass nehmen, über das Ziel des Buches nachzudenken. Außerdem möchten sich die Autoren und der Verlag an dieser Stelle bei den LeserInnen für ihr Interesse bedanken.
An wen richtet sich dieses Buch?
Es gibt wohl vier Gruppen, für die dieses Buch interessant ist:
■ Allen in der Sozialen Arbeit Tätigen gibt dieses Buch einen Überblick über die Geschichte und Wurzeln Sozialer Arbeit.
■ Wer nicht in der Sozialen Arbeit tätig ist, aber SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen und ihre Arbeit kennt und schätzt, kann sich in diesem Buch über deren Berufsbild informieren.
■ Wer das Fachgebiet Soziale Arbeit studiert oder studieren möchte, für den soll dies in erster Linie ein Einführungs- und Lehrbuch sein. Studierende erwarten als Einstieg sicher keine großen theoretischen Abhandlungen, sondern eine für sie in Sprache und Form verständliche Einführung in das von ihnen studierte Berufsfeld. Den Studierenden soll das Buch einen Überblick bieten über die Inhalte ihres Studienfaches. Wem das nicht reicht, wer mehr wissen möchte, den verweisen wir auf die weiterführende Literatur oder empfehlen ein Gespräch mit einem Dozenten oder einer Dozentin. Diese werden sich bestimmt über motivierte StudentInnen freuen.
■ Und was kann dieses Einführungs- und Lehrbuch für KollegInnen sein? Wir nehmen an, dass sie aus diesem Buch das auswählen, was sie gebrauchen können. Jeder hat eine andere Vorstellung von Sozialer Arbeit, vertritt andere Theorien und Konzepte und das ist gut so. Ihnen allen in einem Buch gerecht zu werden, ist unmöglich, was sie auch wissen und nicht erwarten. Das Buch kann ihnen eine Hilfe sein, sie können Anregungen übernehmen.
Bei allen Wünschen und Erwartungen an dieses Buch möchten wir in Erinnerung bringen, worum es uns geht: Wir möchten vor allem den geschichtlichen Hintergrund Sozialer Arbeit herausarbeiten und die Studierenden für die Geschichte und die Grundlagen der Sozialen Arbeit sensibilisieren. StudentInnen, die mehr über die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit oder über neuere Theorien wissen möchten, stehen Standardwerke zur Verfügung, die sie sicherlich kennen und mit denen sie auch arbeiten.
Wir hoffen, dass dieses Buch auch weiterhin interessierten LeserInnen eine gute Einführung in die Thematik der Sozialen Arbeit sein kann und dass die neu formulierten Prüfungsfragen eine gute Lernhilfe bieten, um das erworbene Wissen zu vertiefen.
Wie ist dieses Buch gegliedert?
Das 1. und 2. Kapitel zeigen den geschichtlichen Zusammenhang von Sozialarbeit/Sozialpädagogik auf. Dies ist unmöglich, ohne den historischen Prozess, der sie hervorgebracht hat, zu begreifen. Wenn ich nicht weiß, woher ich komme, welche Wurzeln meine – auch berufliche – Identität hat, kann ich auch nicht wissen, wohin ich gehen soll. Es werden die geschichtlichen Wurzeln von Sozialarbeit und Sozialpädagogik nachgezeichnet.
Das 3. Kapitel gibt Hilfestellung bei der Erklärung, was Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Soziale Arbeit eigentlich ist. Sind Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Soziale Arbeit identisch? Gibt es Unterschiede? Wie soll man das Verhältnis der Berufszweige Sozialarbeit und Sozialpädagogik zueinander sehen? Es geht um die Konvergenz von Sozialarbeit und Sozialpädagogik zur Sozialen Arbeit.
Das 4. Kapitel behandelt Theoriemodelle. Es existiert eine Vielfalt von Theorieansätzen Sozialer Arbeit. Einige Theoriemodelle werden ausgewählt und vorgestellt.
Das 5. Kapitel legt das Eigentliche und Typische Sozialer Arbeit dar. Die Frage nach den Zielen, Aufgaben und Methoden Sozialer Arbeit muss gestellt und beantwortet werden. Es geht um die Frage nach dem Berufsbild Sozialer Arbeit.
Das 6. Kapitel stellt die Entwicklung der Berufsausbildung vor, erklärt, wie Soziale Arbeit organisiert ist und was man über die Verberuflichung wissen sollte.
Das 7. Kapitel fasst alle Überlegungen der einzelnen Kapitel zur Sozialen Arbeit im Überblick zusammen und gibt Antwort auf die Frage: Was ist Soziale Arbeit?
In der Fachliteratur werden die Begriffe Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Soziale Arbeit z.T. recht willkürlich benutzt. Wenn wir aus Büchern zitieren, kommt es vor, dass dieser „Wortsalat“ auch hier Eingang findet. Eigentlich müsste es konsequent nur „Soziale Arbeit“ heißen.
Warum soll ich die Berufsgeschichte Sozialer Arbeit studieren?
Warum soll man die Frage nach Sozialarbeit/ Sozialpädagogik/Sozialer Arbeit mit einem Rückblick in die Geschichte unserer Profession beginnen? Warum beginnen wir nicht gleich damit, die gegenwärtigen Herausforderungen Sozialer Arbeit in Angriff zu nehmen? Der Grund liegt nicht darin, dass viele Bücher diese Art des Einstiegs wählen, sondern weil es von großer Wichtigkeit ist, dass SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen, die sich mit ihrem Berufsbild identifizieren wollen, sich der historischen Wurzeln ihres Berufes bewusst sind. Dies bedeutet: Wir müssen für die Entwicklung einer spezifischen Berufsidentität erst einmal zurückblicken, um überhaupt vorwärts gehen zu können. Eine komplexe Gegenwart kann ohne historische Rückgriffe gar nicht verstanden werden. Gegenwart und Zukunft(sgestaltung) ist ohne das Verständnis vergangener prägender Epochen nicht denkbar.
Die geschichtliche Entwicklung der Sozialarbeit/ Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit ist Grundlage für ein berufliches Selbstverständnis. So wie andere Berufe, etwa die Medizin oder Jura, grundlegende Positionen im Rückgriff auf ihre Geschichte bestimmen (Humanmedizin auf Paracelsus, Jurisprudenz auf das römische Recht etc.), hat auch die Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Soziale Arbeit eine hochinteressante und wechselhafte Entwicklung hinter sich.
„Es ist unmöglich, eine Institution ohne den historischen Prozess, der sie hervorgebracht hat, zu begreifen.“ (Münchmeier 1992, 372)
Der Rückgriff auf die Geschichte in ihren verschiedenen Entwicklungslinien soll deutlich machen, dass Soziale Arbeit einerseits aus ihrer Geschichte heraus zu verstehen ist, andererseits z.T. mit den gleichen Worten neue Inhalte verbunden sind, was zu zahlreichen Missverständnissen führt. Es sollen Leitlinien herausgearbeitet werden, anhand derer aufgezeigt werden kann, wie die Profession in ihren unterschiedlichen Entstehungsepochen zu begreifen ist. Armenpflege/Fürsorge (Erwachsener) und Jugendfürsorge haben zwar vergleichbare geschichtliche Wurzeln, entwickeln sich jedoch mit dem ausgehenden Mittelalter zu eigenständigen fürsorgerischen Einrichtungen, was in den ersten beiden Kapiteln kurz skizziert werden soll. Die Darstellung erfolgt unter Bezugnahme auf Persönlichkeiten und Orte. Selbstverständlich hätte man auch eine andere Einteilung vornehmen können. Es geht um die markanten Stufen einer langfristigen Entwicklung kommunaler bzw. staatlicher Armenpflege- und Fürsorgepolitik im Kontext gesellschaftlicher Transformationsprozesse.
Der geschichtliche Verlauf der zunächst ehrenamtlichen sozialen Tätigkeitsbereiche durch öffentliche Armenpflege und Fürsorge hin zu einer eigenständigen Profession kann in folgende Zeitabschnitte eingeteilt werden:
1. Armenfürsorge für Erwachsene bzw. Kinder im Mittelalter (um 12.–13. Jh.) und zu Beginn der Neuzeit (14.–16. Jh.)
2. Erwachsenenfürsorge bzw. Jugendfürsorge im Zeitalter der Industrialisierung (18.–19. Jh.)
3. Wohlfahrtspflege für Erwachsene bzw. Jugendwohlfahrtspflege für Kinder vor dem Zweiten Weltkrieg
4. Nach dem Zweiten Weltkrieg: Bundesrepublik Deutschland: Armut und Hilfe (seit 1945)
Erklärung von Zeichen und Symbolen
Einige Textstellen sind mit Zeichen/Symbolen versehen, die einer schnelleren Orientierung dienen sollen. Hier ihre Erläuterung:
Zu Beginn eines Kapitels geben wir anhand einer Grafik in Form eines Baumes einen zusammenfassenden Überblick über die Themen des jeweiligen Kapitels.
Reflexionsfragen: Immer, wo Sie dieses Zeichen sehen, werden Reflexionsfragen formuliert, die der Leser zunächst für sich beantworten soll.
Merksatz: Wichtige Inhalte sollen leicht zu erkennen sein. Sie sind eingerahmt und durch dieses Zeichen markiert.
Zusammenfassung: Am Ende einer Ausführung werden die wichtigsten Überlegungen jeweils noch einmal zusammengefasst.
Praxisbeispiele: Jedes Kapitel enthält Praxisbeispiele. Am Schluss eines Kapitels wird mithilfe von Lösungsvorschlägen noch einmal näher auf diese eingegangen.
Weiterführende Literatur: Am Schluss eines Kapitels finden sich Hinweise auf Weiterführende Literatur.
Lernfragen: Anhand der Fragen können die LeserInnen ihren Wissensstand überprüfen. Die Lernfragen mit dazugehörigen Antworten stehen als Online-Zusatzmaterial bereit. Dieses wird auf den jeweiligen Buchseiten unter www.utb-shop.de und www.reinhardt-verlag.de zum Download zur Verfügung gestellt.
Donaueschingen / Freiburg, Herbst 2021 Johannes Schilling und Sebastian Klus
1 Sozialarbeit – Geschichte der Armenpflege und Armenfürsorge / Wohlfahrtspflege
Abbildung 2: Geschichtliche Wurzeln der Sozialarbeit
1.1 Urkategorie der Armenpflege und Fürsorge: Armut und Hilfe
1. Praxis-Situation: Problem – Hilfe
Frau Stark, 36 Jahre alt, ist alleinerziehende Mutter ihrer beiden Töchter von acht und zehn Jahren. Sie arbeitet als Verkäuferin in einer Bäckerei. Mit ihrem Verdienst kann sie ihre Familie mehr schlecht als recht ernähren. Sie und ihre beiden Töchter müssen auf vieles verzichten. In den Urlaub zu fahren oder ins Kino zu gehen, ist für sie Luxus, den sie sich nicht leisten können. Frau Starks Bekannte raten ihr, sich finanzielle Unterstützung vom Jobcenter zu holen. Das sei ihr gutes Recht. Frau Stark lehnt dies jedoch energisch ab. Sie kommt schon alleine zurecht. Sie braucht das Jobcenter nicht. Die wollen einen ja nur ausfragen, kontrollieren und am Ende hat man das Gefühl, versagt zu haben und deshalb Hilfe zu brauchen. Sie ist stolz, dass sie es mit ihren Kindern so gut alleine schafft. Sie buckelt nicht vor anderen, schon gar nicht vor Leuten vom Jobcenter.
Wie ist Ihre Meinung? Was würden Sie Frau Stark raten?
Zu den Grundkonstanten der Armenpflege und Fürsorge zählen die beiden Begriffe Armut und Hilfe.
Hilfe, eine Urkategorie
„Hilfe ist eine Urkategorie des menschlichen Handelns überhaupt, ein Begriff, der nicht weiter zurückzuführen ist, außer auf den des gesellschaftlichen Handelns überhaupt … Hilfe ist eine gesellschaftliche Kategorie. Ihr Begriff bezeichnet ein Verhalten im menschlichen Zusammenleben.“ (Scherpner 1962, 122)
„Hilfsbedürftig und damit Gegenstand der fürsorgerischen Hilfe sind also diejenigen Gemeinschaftsmitglieder, die aus irgendwelchen Gründen den Anforderungen der Gemeinschaft gegenüber versagen, die nicht imstande sind, den Platz im Gemeinschaftsleben zu behaupten, an den sie gestellt sind, und die daher in der Gefahr sind, aus der Gemeinschaft herauszufallen.“ (Scherpner 1962, 138)
„Mir geht es gut. Ich komme sehr gut alleine klar.“Wer so argumentiert, dem muss man einerseits Selbstbewusstsein und entsprechende Kompetenz bescheinigen. Andererseits kann man auch Bedenken haben. Kommt man im Leben immer alleine zurecht, muss man nicht mitunter auch Hilfe in Anspruch nehmen? Wie ist Ihre Meinung?
Die Urgeschichte der Menschheit (Phylogenese) zeigt, dass Menschen die Hilfe ihrer Gruppe, Familie, ihres Clans oder Stammes brauchten, um zu überleben. Und die Ontogenese eines Menschen belegt, dass ein Baby, Kleinkind, Kind ohne die Hilfe seiner Eltern bzw. Erwachsener und der sozialen Umwelt nicht existieren kann.
Somit ist (gegenseitige) Hilfe eine natur- und lebensnotwendige Kategorie der Menschheit.
Hilfe als Handlungsform
Führt man diesen Gedanken weiter auf unsere Zeit, so kann man Hilfe verstehen als Handlungsform des Beratens, Bildens und Unterstützens. Hilfe wird dabei vor allem als Kommunikation verstanden, durch die Ressourcen unterschiedlicher Art zur Lebensführung und Lebensbewältigung entdeckt, transferiert oder mobilisiert werden. Hilfe in diesem Sinne ist als Grundprozess der Sozialen Arbeit anzusehen. Dieser Prozess der Hilfe basiert auf zwei Grundpfeilern: Subjekten, die der Hilfe bedürfen und Institutionen, Professionellen, die helfen wollen. Damit schließt Hilfe auch automatisch Kontrolle mit ein, ist doppeltes Mandat (Schefold 2012, 1126). Hilfe und Kontrolle sind zwei Seiten des gleichen Sachverhaltes.
Armut
Armut begleitet die Menschheit von Beginn an und begegnet uns in unterschiedlichen Formen. Weitgehend wurde Armut jedoch innerfamiliär versucht aufzufangen, d. h. die Großfamilie, das „ganze Haus“, die Verwandtschaft, die Zunft etc. war verantwortlich, wenn jemand in Not geriet. Armut wurde als Problem der sozialen (Klein-)Gruppe verstanden und es wurde darauf entsprechend reagiert. Die Hilfe und Unterstützung durch die sozialen Primärverbände (Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft) sind typische Hilfeformen einer agrarischen Gesellschaft. In den bäuerlichen Großfamilien und überschaubaren Dorfgemeinschaften half man sich gegenseitig.
öffentliche Armenfürsorge
Erst seit dem Zeitpunkt, als die sozialen Primärverbände die Armut aufgrund von Kriegen, Krankheit etc. nicht mehr intern beheben konnten und die Armut „öffentlich“, bzw. zur sozialen Problemlage wurde, gab es Armenpflegemaßnahmen durch die sich entwickelnden Städte und Kommunen als eigenständige Hilfsangebote, d. h. die Familien- und Nachbarschaftshilfe wurde zunehmend durch ein öffentlich-hoheitliches Leistungs- aber auch Kontrollsystem abgelöst.
Diese neu entstandene öffentliche Armenpflege, die nach und nach zur öffentlichen „Fürsorge“, dann Wohlfahrtspflege wurde, lässt sich nach Inhalt und Zielgruppe unterscheiden:
■ Erwachsenen-Fürsorge: Bei „Unangepasstheit“ an die materiellen Lebensbedingungen, wirtschaftlichem Versagen, materieller Not wurde Hilfe angeboten.
■ Kinder-Fürsorge: Bei Unzulänglichkeiten gegenüber der moralischen Ordnung, Verwahrlosung wurde Hilfe angeboten und man begann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts von Jugendfürsorge zu sprechen.
Unter Verwahrlosung verstand der Frankfurter Fürsorgetheoretiker und Hochschullehrer Hans Scherpner (1898–1959) „jedes individuelle Versagen gegenüber den moralischen Anforderungen, das aus einem Mangel an Erziehung und Bewahrung, aus dem ‚Wahr-los-Sein‘ hervorgeht.“ (Scherpner 1962, 138)
Grundtypen der Hilfsbedürftigkeit
Die beiden Grundtypen der Hilfsbedürftigkeit stehen zwar in Wechselbeziehung, dennoch kann man sie deutlich voneinander unterscheiden: Unter Armut wurde in ihrer typischen Ausprägung ein Notstand des Erwachsenen, unter Verwahrlosung dagegen eine typische Erscheinung jugendlicher Hilfsbedürftigkeit verstanden.
Diese Unterscheidung von Scherpner in „Armut“ und „Verwahrlosung“ begründet die Aufteilung in Erwachsenen-Fürsorge und Kinder- (bzw. Jugend-)Fürsorge. In dieser unterschiedlichen Form der Armut bzw. Hilfe liegt nun auch die Entstehungsgeschichte von Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Erwachsenen-Fürsorge ist das, was wir z. T. mit Sozialarbeit und Kinder-(Jugend-) Fürsorge das, was wir z. T. mit Sozialpädagogik bezeichnen würden (Abbildung 3).
Abbildung 3: Entstehungsgeschichte
Hilfe als Urkategorie menschlichen Handelns hat viele Facetten und nicht jede Hilfe ist Fürsorge. Scherpner bezeichnet im Unterschied zu anderen Hilfeformen die „fürsorgerische Hilfe“ als eine Form, aus der im Verlauf der Zeit die Hilfseinrichtungen planmäßiger Art hervorgegangen sind, die wir herkömmlich als „Fürsorge“ bezeichnen.
Als Ergebnis dieser Differenzierung gelangt Scherpner zu folgender Umschreibung von Fürsorge:
Fürsorge
„Unter Fürsorge verstehen wir organisierte Hilfeleistungen der Gesellschaft an einzelne ihrer Glieder, die in der Gefahr stehen, sich aus dem Gemeinschafts- und Gesellschaftsgefüge, aus ihrer Ordnung und ihrem Leben herauszulösen und ihr zu entgleiten. Konkreter gesagt: die Fürsorge versucht Menschen, die den Anforderungen des Gemeinschafts- und Gesellschaftslebens – sei es in wirtschaftlicher, sei es in moralischer Hinsicht – nicht genügen können, zu stützen und zu halten, oder, wenn es sein muss, sie an anderer geeigneter Stelle einzugliedern, damit sie aus eigener Kraft am Leben des Ganzen wieder sinnvoll teilnehmen können.“ (Scherpner 1966, 10)
öffentliche Hilfeorganisation
Aus den beiden Grundkategorien Hilfe und Armut folgt logischerweise die Herausbildung von sozialen Organisationen. Dies bedeutete, in dem Maße, wie gegenseitige Hilfe die Kapazitäten der sozialen Primärverbände überstieg, wurden öffentliche Hilfeorganisationen notwendig und es entstand die öffentliche Armenpflege bzw. -Fürsorge (Abbildung 4).
Abbildung 4: Grundmodell
Im Laufe der Berufsgeschichte gab es nun im Hinblick auf gesellschaftliche Transformationsprozesse unterschiedliche theoretische Erklärungsmodelle. Im Folgenden soll die Berufsgeschichte der Sozialarbeit/Sozial- pädagogik anhand theoretischer Modelle zu den Kategorien Armut – Hilfe – Öffentliche Fürsorge und ihrem Verhältnis zueinander näher skizziert werden.
Entstehung und Ausgangspunkt von Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Sozialer Arbeit ist die Tatsache, dass die (Groß-)Familie, das ‚ganze Haus‘, die Verwandtschaft, die Zunft, das Dorf etc. nicht mehr eigenständig Arme versorgen und Armut verhindern konnten und deshalb öffentliche Armenpflege bzw. -Fürsorge notwendig wurde.
Die Entwicklung der (Erwachsenen-)Armenpflege ist überwiegend die Geschichte der Sozialarbeit und die Geschichte der Kinder- (bzw. Jugend-)Fürsorge überwiegend die Geschichte der Sozialpädagogik. Sie hatte die Aufgabe, Kinder durch Erziehung vor Verwahrlosung zu schützen. Findel- und Waisenhäuser übernahmen die Versorgung derjenigen Kinder, für die keine Familie aufkam. Beide haben aber dieselben Wurzeln in den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und Armenpflegestrukturen des frühen 16. Jahrhunderts.
1.2 Armenfürsorge für Erwachsene im Mittelalter (um 12.–13. Jh.) und zu Beginn der Neuzeit (14.–16. Jh.)
1.2.1 Thomas von Aquin (1224–1274)
„Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher in das Himmelreich.“ (Neues Testament Mt. 19, 24)Die Reichen im Mittelalter hatten offensichtlich ein Problem. Was würden Sie den Reichen raten, zu tun?
erste Theorie über Armut
Im hohen Mittelalter gehörte die Kölner Universität zu den führenden Universitäten Europas. Hier lehrten bedeutende Theologen und Philosophen wie z. B. Albertus Magnus und Thomas von Aquin. Thomas von Aquin wäre, versuchte man ihn in unsere Zeit zu versetzen, ein klassischer Angehöriger der sog. „Apo“ (Außerparlamentarische Oppositionsbewegung der gesellschaftskritischen 1968er Studentengeneration), ein Aussteiger, und trotz übler Verleumdungen und Drohungen seitens der damaligen katholischen Kirche (Engelke et al. 2014, 43) nimmt seine Theorie (die thomistische Almosenlehre) innerhalb der christlichen Lehre eine herausragende Stellung ein. Sie beeinflusste in außerordentlicher Weise das abendländische theologische und soziale Denken. Die Almosenlehre des Thomas von Aquin kann man als erste Theorie über Armut verstehen. In ihr behandelt er Themen der Sozialen Arbeit, wie z. B. Armut, Almosen, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Arbeitspflicht, Lebensunterhalt. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Gesellschaftsordnung.
Almosenlehre
Die Almosenlehre des Thomas von Aquin umfasst folgende Vorstellungen:
1. Gesellschaftsordnung: Das Gemeinwohl steht vor dem Wohl des Individuums, der Einzelne hat sich der Gemeinschaft unterzuordnen. Dies entspricht der göttlichen Ordnung. Sie spiegelt sich in der Ständeordnung des Mittelalters wider:
■ geistlicher Stand (oberster Stand)
■ weltlicher Stand (Herrschaft)
■ bürgerlicher Stand
■ armer Stand (Besitzlose)
■ bedürftiger Stand (Witwen, Waisen, Krüppel, Kranke)
Außerhalb dieser Ordnung stehen die Ehrlosen (öffentliche Sünder wie Diebe, Ehebrecher, Mörder). Diese natürliche und soziale Ordnung ist ursprünglich von Gott gewollt. Armut war hiernach Ausdruck einer ewigen Ordnung, ein notwendiger Stand.
2. Arbeit: Der Mensch definiert sich durch seine Hinordnung auf das Jenseits; das eigentliche Leben beginnt nach dem Tod. Deshalb geht es im Leben des Menschen auch primär um die Verherrlichung Gottes und um das Seelenheil. Die Arbeit ist in diesem Zusammenhang sekundär, sie dient dem Erwerb des Lebensunterhalts. Allerdings entspricht es einem natürlichen Gesetz, dass der Mensch für seinen Lebensunterhalt sorgen muss, es ist zugleich ein göttliches Gebot. Aus dieser Überlegung heraus begründet Thomas von Aquin eine Verpflichtung zur Arbeit für diejenigen, die nicht eigenen Besitz haben und davon leben können.
3. Armut und Betteln: Für den Aquinaten erhält Armut und Betteln vom Evangelium her seine Bedeutung.
Almosen
Die Notleidenden haben in der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung einen unentbehrlichen Platz. Sie sind für die reichen „Sünder“ wichtig. Arme bieten den Reichen Gelegenheit zu verdienstlichem Tun, zum Almosengeben. Das Almosen war neben Beten und Fasten eine Möglichkeit der ‚satisfactio‘, der Genugtuung für begangene Sünden, zudem war es unbedingte religiöse Pflicht eines jeden Christen (Marburger 1979, 48). Das Almosen ist verankert im Bußsakrament. Durch Beten, Fasten und Bußetun konnte der Sünder/die Sünderin Genugtuung erreichen. Durch das Bußsakrament wurde der Sünder/die Sünderin auf die Notwendigkeit des Almosengebens verwiesen. Hierin lag die Ausdehnung der Liebestätigkeit jener Zeit. Im Mittelpunkt steht allerdings nicht der/die EmpfängerIn der Gaben, sondern der/die GeberIn. Not und Elend werden religiös-ethisch gesehen und nicht ökonomisch-gesellschaftlich. Deshalb gab es auch keinen Grund zur Änderung der Gesellschaftsordnung oder zur Abschaffung der Armut. Der Umfang der zu gebenden Almosen richtete sich nicht nach der Notlage des Armen, sondern nach der Lebenssituation des Spenders. Es geht nicht um die Beseitigung der Armut, sondern um die Erhaltung des Armen in seinem Stand der Reichen wegen.
Geiler von Kaysersberg (1445–1510)
In Straßburg entwickelte der Münsterprediger Geiler von Kaysersberg (1445–1510) die Almosenlehre des Thomas von Aquin dahingehend weiter, dass die weltliche Obrigkeit, vor allem die Städte, das Recht und die Pflicht zur Versorgung und Kontrolle der Armen hätten. Kaysersberg ist damit einer der Begründer der neueren Fürsorge, die im Spätmittelalter ihren Ausgangspunkt hat. Zur neuen Sichtweise auf Armut und Betteln haben wirtschaftliche, religiöse und gesellschaftliche Entwicklungen beigetragen. Durch sie trat eine Veränderung der Wahrnehmung und auch Bewertung des Bettelns ein. Betteln wurde verboten.
Nach christlicher Auffassung, entscheidend geprägt von Thomas von Aquin, galten die Armen als ein eigener gesellschaftlicher Stand. Er wurde um der Reichen willen erhalten, damit diese sich durch Almosengeben den „Himmel verdienen“ konnten. An eine Abschaffung des Standes der Armen war nicht gedacht. Eine Änderung dieser Sichtweise nahm erstmals Geiler von Kaysersberg vor.
1.2.2 Martin Luther (1483–1546)
Martin Luther widerspricht der Lehre, man könne sich den Himmel verdienen. Wie ist Ihre Meinung?
Gottes Gnade
Der Theologe Martin Luther stellte sich gegen die Auffassung des ehemaligen Bischofs von Karthago und Kirchenlehrers Caecilius Cyprianus (200–258), der bereits im 2. Jahrhundert die Meinung vertreten hatte, man könne sich den Himmel durch Almosengeben und Kauf von Ablässen „verdienen“ und dadurch seine Sünden tilgen. Luther beruft sich vor allem auf die Bibelstelle im dritten Kapitel des Paulusbriefes an die Römer: „Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens, denn wir sind überzeugt, daß der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, unabhängig von Gesetzeswerken.“ (Röm 3, 27 f.). Nicht durch Werke, also auch nicht durch Werke des Almosengebens, können die Wohlhabenden nach Luthers Auffassung durch das Nadelöhr ins Himmelreich gelangen. Sondern er lehrte, dass man sich den Himmel nicht verdienen, sondern nur durch den Glauben und die Gnade Gottes gerettet werden könne.
1.2.3 John Calvin (1509–1564)
gottgefälliges Arbeiten
Die calvinistische Arbeitsmoral veränderte ebenfalls die Beurteilung des Bettlertums. Statt der thomistischen Almosenlehre galt jetzt der Satz des Apostel Paulus: „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen“. Nach der Auffassung des Anhängers von Luthers Lehre John Calvin ist nicht jeder Mensch von Gott erwählt. Er nahm an, dass Erfolg im irdischen Leben ein Zeichen der besonderen Erwähltheit sei und somit bereits das Unterpfand ewiger Bestimmung darstelle (Buchkremer 1982, 34). Die Arbeit sei somit Gott wohlgefällig, betteln aber eine Verletzung der Nächstenliebe. Armut wurde als selbstverschuldet angesehen und geächtet. Man trachtete danach, durch harten Zwang die sündigen Müßiggänger zu bessern, bis „ihre Hände so viel zu tun und ihre Körper so viel zu ertragen gelernt haben, daß ihnen Arbeit und Lernen leichter erscheinen als Müßiggang.“ (Scherpner 1966, 43) Denn „Müßiggang ist aller Laster Anfang“.
1.2.4 Humanismus
Der Humanismus (vetreten v. a. durch Erasmus von Rotterdam 1466–1536, Thomas Morus 1477–1535 und Juan Luis Vives 1492–1540) war in erster Linie eine religiöse und bildungsmäßige Reformbewegung, eine „katholische Reformation“ vor der eigentlichen Reformation Luthers. Der Humanismus hielt an wesentlichen Aussagen der katholischen Kirchenlehre fest, wollte die Kirche jedoch von dem „wirren Geschnörkel scholastischer Spitzfindigkeiten“ des Mittelalters befreien und sie mit Bezug auf die alten Texte der antiken Philosophen in ihrer praktischen Einfachheit wieder allen zugänglich machen. Bezüglich der Soziallehre des Humanismus verlangte z. B. Thomas Morus in seiner „Utopia“ die Arbeitspflicht für alle Arbeitsfähigen.
Bettel- bzw. Armenverordnung
Als Beleg für die praktische Umsetzung dieser neuen Sichtweise können die Bettel- bzw. Armenverordnungen genannt werden. In den ersten städtischen Armenordnungen der Stadt Nürnberg (1370/1478/1522) geht es um die frühesten Versuche, der Armut vorbeugend zu begegnen. Bettelnden Eltern sollten die Kinder weggenommen und diesen dann durch die Obrigkeit Dienst- und Arbeitsplätze vermittelt werden. Durch vorbeugende Maßnahmen wollte man Kindern beibringen, durch Arbeit ihr Brot zu verdienen. Nach und nach wurden alle BettlerInnen in Armenverzeichnissen erfasst. Eigens dafür eingesetzte Armenpfleger sollten den Kindern Arbeit in den handwerklichen Berufen vermitteln. Wer von den Erwachsenen die Erlaubnis zum Betteln erhalten hatte, musste ein sichtbares Armenabzeichen tragen. Das Almosengeben sollte mit dem Beginn der frühen Neuzeit und der entstehenden (protestantischen) Arbeitsethik nach und nach nur noch als letzte Möglichkeit angesehen werden, Armen zu helfen.
1.2.5 Juan Luis Vives (1492–1540)
Aus welchem Jahrhundert könnten folgende Überlegungen stammen?„Jeder Mensch soll arbeiten. Wer keine Arbeit hat, soll einen Arbeitsplatz vermittelt bekommen (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme). Es soll sich dabei um einen Beruf handeln, den man früher gelernt oder an dem man Freude hat.
Jeder Betrieb soll Arbeitslose aufnehmen. Bei öffentlicher Vergabe von Aufträgen soll die Stadt diejenigen Betriebe berücksichtigen, die Arbeitslose eingestellt haben. Wer sich von den Arbeitslosen selbständig macht, soll durch Aufträge der öffentlichen Haushalte unterstützt werden.”
Diese Überlegungen klingen sehr modern und zeitgemäß. Sie wurden jedoch bereits im 16. Jahrhundert von dem Humanisten Juan Luis Vives entwickelt, um damit der Armut seiner Zeit zu begegnen.
Unterstützung der Armen
Vives (geboren in Spanien, Studium in Valencia und Paris, Lehre in Löwen und Oxford) war der in Deutschland in Vergessenheit geratene, dritte große Humanist neben Erasmus und Morus. Der Gelehrte Vives hat sich besonders auf den Gebieten der Philosophie, Philologie und Pädagogik hervorgetan. Für die Geschichte der Sozialen Arbeit ist er von größter historischer Bedeutung, weil er 1526 mit seiner „de subventione pauperum“ (Die Unterstützung der Armen) die erste neuzeitliche Armenpflegetheorie vorgelegt hat. In ihr hat sich die gesamte Opposition der beginnenden Neuzeit gegen die armenpflegerischen und pädagogischen Missbräuche des späten Mittelalters gebündelt (Engelke et al. 2014, 65 f.; Zeller 2006). Sein Humanismus, der auch von Einflüssen der jüdisch-biblischen Sozialethik durchzogen ist, hat für die Entwicklung der Armenpflege in der Neuzeit ganz entscheidende Impulse gegeben und ist in vielen Punkten immer noch hochaktuell. Vives hat ein System der Armenfürsorge entwickelt, in dem alle Bereiche der Armenpflege von der materiellen Unterstützung bis zur bildungsmäßigen Förderung von Kindern/Jugendlichen in einem einheitlichen Sinnzusammenhang stehen. Die Not in seiner Zeit bewegte ihn, sich mit dieser auseinanderzusetzen. Er analysierte die Lage der städtischen Armen und entwarf eine Theorie, wie man ihnen helfen könnte.Vives geht in seinem Theoriekonzept von vier Grundsätzen aus:
Arbeit, ein Wert an sich
1. Arbeitspflicht für Arme: Vives war der Überzeugung, dass der Mensch eine natürliche Veranlagung zur körperlichen und geistigen Aktivität hat. Arbeit war mit der „protestantischen Arbeitsethik“ ein Wert an sich geworden. Deshalb forderte er eine Hingabe an die Arbeit um der Arbeit willen. Nicht mehr, weil sie als göttliches Gebot verordnet, nicht mehr, weil sie als Mittel zur Erfüllung wertvoller Zwecke notwendig sei, sondern weil sie dem Menschen seiner Anlage entsprechend an und für sich ein erstrebenswertes Gut vermittelt, kann man vom Menschen erwarten und verlangen, dass er seinen Kräften entsprechend arbeitet (Scherpner 1962, 91). Daher lehnte Vives auch das Betteln als Broterwerb ab. Betteln sollte möglichst ganz abgeschafft werden. Der Humanist Vives lehnte die mittelalterliche Glorifizierung der Armen und Armut ab und wandte sich ersten säkularen Prinzipien eines neuen Armenpflegewesens und frühneuzeitlicher Sozialpolitik zu (Zeller 2006, 156–212).
2. Versorgung der Armen mit Arbeit: Die Arbeitsvermittlung wird bei Vives zum wichtigsten Mittel der Unterstützung der Armen. Der erste Schritt der Vermittlung ist die Prüfung der Arbeitsfähigkeit. Die begutachtende Instanz soll ein Arzt sein. Da es bei der Vermittlung arbeitsfähiger Armer um eine möglichst dauerhafte Aufhebung der Armut geht, sollten die Betroffenen in einen Beruf vermittelt werden, den sie früher erlernt hatten. Falls Handwerksmeister die Vermittlung von Armen ablehnen sollten, schlug Vives vor, dass durch Anordnung der städtischen Verwaltungen den einzelnen Handwerksmeistern eine bestimmte Anzahl von Armen zugewiesen werden soll, die selber keine Arbeitsstelle finden konnten. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten einer solchen Zwangslösung will Vives dadurch beseitigen, dass der Rat der Stadt alle öffentlichen Aufträge außer an die zur Selbständigkeit gelangten Armen auch an die Handwerksmeister vergeben soll, die Arme und Lehrlinge aufgenommen hatten (Scherpner 1962, 96). Wer trotz aller Anreize als arbeitsfähiger Armer nicht arbeiten will, für den sieht Vives strenge arbeitserzieherische Maßnahmen vor, wobei er aber ungeachtet dessen die Würde des Armen nicht verletzt sehen wollte.
3. Individualisierungsprinzip in der Armenpflege: Dieses System der Armenversorgung setzt eine Untersuchung der besonderen Notlage des einzelnen Armen voraus. Alle Armen sind sorgfältig in ein Armenverzeichnis einzutragen. In diesem soll festgehalten werden: die spezielle Notlage der Armen, die Art ihres früheren Lebensunterhalts, der Anlass der Verarmung, ihre Lebensart, ihre Moral. Die Entscheidung über die Arbeitsfähigkeit liegt bei einem Arzt. Vives System will Rücksicht auf den ganzen notleidenden Menschen nehmen, damit ihm eine gerechte Hilfe zuteil wird. Umfang, Art und Dauer der Unterstützung soll ganz individuell ausgerichtet sein. Sie orientiert sich an den geistigen, leiblichen und materiellen Bedürfnissen eines Menschen.
4. Erziehungsprinzip in der Armenpflege: Die Hilfeleistung enthält nach Vives grundsätzlich einen erzieherischen Charakter, der den vornehmsten Aspekt der Unterstützung darstellt. Vives fordert eine allgemeine Institution der Erziehungsaufsicht auch für Erwachsene. Mit der Armenpflege will er nicht mehr bloß die Armen aus ihrer Notlage befreien und damit eine Gefährdung des gesellschaftlichen Lebens beseitigen. Armenfürsorge strebt zugleich auch die moralische Förderung des Einzelnen, seine Erziehung zum guten Bürger an. Die fortschrittlichen Ideen dieses Voraufklärers und Humanisten kann in einem Zehn-Punkte-Sozialprogramm zusammengefasst werden.
Zehn-Punkte-Sozialprogramm aus der frühen Neuzeit von Juan Luis Vives 1526
■ Anlegen von Verzeichnissen zur Erfassung und individualisierenden Bedürftigkeitsprüfung
■ Ausweisung ortsfremder Bettler
■ Erziehung der Arbeitsfähigen zur Arbeit
■ Rückführung und Arbeitsvermittlung in alte Berufszweige
■ Arbeitsvermittlung für Ungelernte und Jugendliche
■ Bevorzugung von Handwerksmeistern, die Arbeitsplätze schaffen, bei öffentlichen Aufträgen
■ Durchsetzung des Arbeitszwangs für Arbeitsverweigerer
■ Versorgung von nicht mehr Arbeitsfähigen
■ Versorgung und Erziehung von Findelkindern
■ Ausarbeitung von Finanzierungsplänen
(aus: Zeller 2006, 187)
Die Almosenlehre von Thomas von Aquin erfährt durch den Humanismus und Calvinismus grundlegende Veränderungen. Arbeit wurde zu einer Gottespflicht und Betteln sollte verboten werden.
Nach Juan Luis Vives sollte den arbeitsfähigen Armen Arbeit vermittelt werden. Jeder Arbeitslose wurde als Einzelfall behandelt, um eine gerechte Hilfe zu gewährleisten. Durch die Hilfeleistung wollte man auch die Armen zu „guten Bürgern“ erziehen. Unter einem „guten Bürger“ verstand der Humanist Vives einen Menschen, der sich auch für die Belange des Gemeinwohls engagiert.
1.2.6 Nürnberger Bettel- und Armenordnungen (1370)
Bettelordnung
Die Maßnahmen gegen das Betteln wurden mit dem ausklingenden Mittelalter immer strenger gehandhabt. Es wurden Bettelzeichen verteilt, die deutlich sichtbar an der Kleidung getragen werden mussten. Außerdem war Betteln zunehmend nur noch an den kirchlichen Feiertagen erlaubt. Wer an anderen Tagen angetroffen wurde, durfte die Stadt einen Monat lang nicht mehr betreten. Die erste städtische „Bettelordnung“ mit Bettelverboten und der Einführung erster Bettelabzeichen für einheimische Bettler wurde 1370 in Nürnberg erlassen.
In der zweiten Nürnberger Bettelordnung von 1478 versuchte man die Wurzeln der Armut direkter anzugehen. Dies bedeutete, dass Kinder nicht mehr aufgezogen werden sollten, bis sie selbst ihren Lebensunterhalt erbetteln konnten, sondern das entscheidend Neue war, dass die Kinder der Armen lernen sollten, sich ohne Almosen, nur durch ihre eigene Arbeit zu unterhalten. Von der Obrigkeit wurde den Kindern ein Arbeitsplatz vermittelt. Durch diese vorbeugende Maßnahme wollte man erreichen, dass die Kinder nicht mehr bettelten, sondern ihr Brot durch Arbeit verdienen lernten.
Die ordnungspolitischen strengen Maßnahmen mussten durch die örtliche Polizei oder auch durch die manchmal als „Knechte“ bezeichneten Armenpfleger durchgeführt werden. Bei den städtischen Unterschichten hatte man bereits seit dem Spätmittelalter begonnen, zwischen der „primären Armut“ als unterste Grenze des Existenzminimums und der „sekundären Armut“ als Grenze zu unterscheiden, unterhalb derer eine „standesgemäße“ Lebensführung nicht mehr möglich war. Die Differenzierung zwischen „arm“ und „bedürftig“ war für die städtische Armenpflege wichtig, weil davon die Kategorisierung abhing, ob jemand als „Armer“ zur Arbeit gezwungen werden konnte oder zu den tatsächlich „Bedürftigen“ gerechnet werden musste. Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, äußere Faktoren wie z. B. Missernten, Ernährungskrisen, Kriegskatastrophen und Seuchen zogen zwangsläufig Verarmung und Bedürftigkeit nach sich.
3. Nürnberger Armenverordnung
1522 erließ wiederum die Nürnberger Stadtverwaltung einen dritten ordnungspolitischen Maßnahmenkatalog, der jetzt aber nicht mehr „Bettel“- sondern „Armenordnung“ genannt und auch von anderen Städten übernommen wurde. Diese Armenordnung wurde in ganz Europa führend. Danach wurde zunächst das Betteln vor Kirchen verboten. Zwei oder drei Personen hatten für die Bedürftigen auszusagen, dass diese wirklich in Not waren. Und die Bettelzeichen trennten „ortsansässige“ von „nicht ortsansässigen“ Bettlern. Über diese Maßnahmen steckte die Obrigkeit einen engen Handlungsrahmen für die Bettler ab und kontrollierte auch deren moralischen Lebenswandel. Bei Hausbesuchen sollten nun auch genau Alter, Gesundheitszustand, Wohnbedingungen und Familiensituation festgehalten werden, um die Arbeitsfähigkeit zu überprüfen und danach unberechtigte Ansprüche ablehnen oder gewähren zu können. Der folgende Auszug stammt aus der Nürnberger Armenordnung von 1522:
„Vor der Durchführung dieses Almosens werden die Knechte mehr als einmal durch die ganze Stadt (…) gegangen sein und alle Bürger und Bürgerinnen, die des Almosens bedürftig sind, sorgfältig verzeichnet haben; sie verzeichnen auch, wieviel jeder öffentlich auftretende Bettler mit seiner wöchentlichen Bettelei einsammelt, auch wieviel Kinder ein jeder dieser Bettler hat, welches Alter und welche Ausbildung die Eltern und Kinder haben, und ob diese Kinder zum Teil gar in der Lage sind, mit Dienstleistung und ihrer Hände Arbeit ihr Brot zu erwerben und die Unterhaltung ihrer Eltern zu übernehmen; diese werden auch besonders deshalb schriftlich erfaßt, um ihnen durch die Pfleger und ihre Helfer in den Handwerken oder sonstwo Anstellungen zu verschaffen, damit sie mit Arbeit aufwachsen und mit der Zeit ohne Almosen auskommen können. Dazu haben sich die genannten vier Knechte bei den umwohnenden Nachbarn dieser Bettler und Armen zu erkundigen und sorgfältig zu notieren, was für einen guten oder schlechten Leumund diese Armen besaßen und noch besitzen, (…).“ (Sachße/Tennstedt 1980, 68 f.)
Die Höhe der Unterstützung richtete sich nach dem jeweiligen Personenstand. Wenn das Almosen wegen „unchristlichem“ Lebenswandel oder anderer Defizite verweigert werden musste, wirkten die Armenpfleger erzieherisch darauf hin, dass die Bedürftigen wieder auf die „rechte Bahn“ kamen. In der Nürnberger Armenordnung sind sogar schon Vorformen von Evaluation zu erkennen. So berichteten Armenpfleger beispielsweise, dass sie bei Hausbesuchen Erfolge feststellen konnten, wenn ehemalige Bettler und Müßiggänger wieder in ihren alten Handwerksberufen tätig waren und auch deren Kinder das Betteln aufgegeben hatten. Von einem beruflich „korrekt“ arbeitenden Armenpfleger erwartete die Stadtverwaltung ebenso den sorgfältigen Umgang mit öffentlichen Geldern (Zeller 2006, 133–139).
Konzept der Nürnberger Armenordnung von 1522 zur Durchsetzung der Bettelverbote
– Anstellung von Armenpflegern
– Gemeinsame Beratungen
– Hausbesuche/Bedürftigkeitsüberprüfung
– Verteilung von Bettelabzeichen
– Feststellung der Arbeitsfähigkeit bzw. -unfähigkeit
– Arbeitsbeschaffung
– Aktenführung
– Kassenverwaltung
– Genaue Festlegung der Höhe der Unterstützung
– Erziehungsmaßnahmen
– Besorgen von Arzneien
– Überprüfungen der geleisteten Maßnahmen
(Zeller 2006, 140)
1.3 Erwachsenenfürsorge im Zeitalter der Industrialisierung (18.–19. Jh.)
1.3.1 Industrielle Entwicklung – Pauperismus
Die rapide Umgestaltung Deutschlands zu einer Industriegesellschaft nach der Reichsgründung von 1871 hatte weitreichende soziale Folgen. Können Sie sich vorstellen, um welche es sich handelt?
Mit zunehmend sozialpolitisch ausgerichteten Konzepten und den im 19. Jahrhundert hinzukommenden neuhumanistischen Bildungs- und Erziehungsidealen auch für die unteren Schichten sowie im Zuge der Verweltlichung der Armenpflege wurde der alte polizeiliche Armenpflegebegriff schließlich immer mehr von dem Begriff Armenfürsorge, noch später Wohlfahrtspflege abgelöst. So wurden Sozialpolitisierung, Sozialdisziplinierung und im 19. Jahrhundert durch die Entstehung von freien Wohlfahrtsverbänden auch Konfessionalisierung wesentliche Meilensteine des Armen- und Fürsorgewesens in die europäische Moderne.
Der Pauperismus ist keine Folge der Industrialisierung, sondern bereits früher durch folgende Entwicklung entstanden: Mit der Bauernbefreiung (1807–1811) und der Einführung der Gewerbefreiheit (1810/11) wird den abhängigen Bevölkerungsschichten erstmals die Möglichkeit zu ungehinderter Familiengründung gegeben, was bei gleichzeitiger Abnahme der Sterblichkeit als Folge hygienischer Maßnahmen zu einem erheblichen Geburtenüberschuss und damit zu einer Überbevölkerung führte. Überbevölkerung und große Geldknappheit des Staates führten zu einem Mangel an Arbeitsplätzen und zu einer bis dahin nie gekannten Massenverarmung. Das bedeutete, dass nicht die Industrialisierung, sondern gerade ihre Verzögerung bei gleichzeitiger Überbevölkerung zum Pauperismus oder zur Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten führte. Mit der Entstehung der Industriezentren kam es zu einer Binnenwanderung unbekannten Ausmaßes.
Seit etwa 1820 verläuft die industrielle Revolution in einem rasanten Tempo. Die rapide Umgestaltung Deutschlands zu einer Industriegesellschaft nach der Reichsgründung (1871) hatte weitreichende soziale Folgen. Gab es zu Beginn des Jahrhunderts etwa 300.000 Fabrikarbeiter, so waren es 1872 bereits sechs Millionen und um 1900 sogar zwölf Millionen.
sozioökonomischer Strukturwandel
Sachße und Tennstedt belegen den sozioökonomischen Strukturwandel dieses Jahrhunderts mit empirischen Daten:
1. Um 1750 lebten in Deutschland um 16–18 Millionen Einwohner, um 1900 waren es 56 Millionen.
2. Um 1800 lebte der größte Teil der Bevölkerung auf dem Lande. Von den 1016 Städten waren 998 noch typische Ackerbürgerstädte, d. h. Einwohner, die von landwirtschaftlichen Betrieben lebten. 1910 hatten 66 % der Bevölkerung ihren Wohnsitz in der Stadt (Sachße/Tennstedt 1980, 179–180).
3. „Die Anteile der Beschäftigten innerhalb der einzelnen Wirtschaftssektoren verschoben sich entscheidend vom primären Sektor (Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Fischerei) zum sekundären Sektor (Industrie, Handwerk, Verlag, Bergbau, …) und tertiären Sektor (Dienstleistung, Handel, Verkehr, Banken, …). 1800 waren von 10,5 Mio. Beschäftigten 62 v. H. im primären, 21 v. H. im sekundären und 17 v. H. im tertiären Wirtschaftssektor beschäftigt, 1914 waren von 31,3 Mio. Beschäftigten 34 v. H. im primären Sektor, 38 v. H. im sekundären und 28 v. H. im tertiären Sektor beschäftigt.“ (Sachße/Tennstedt 1980, 179 f.)
Die städtischen Ballungszentren boten ein Bild der Armut, des Elends und der Verwahrlosung. Industrie und Markt brachten nicht Harmonie und Wohlstand, sondern spalteten die Gesellschaft.
Das Bevölkerungswachstum war für den Übergang vom agrarisch-handwerklichen zum kapitalistisch-industriellen Wirtschaftssystem, für die Wandlungen im Bereich von Armut und Armenwesen deshalb von entscheidender Bedeutung, weil zunächst die Bevölkerung schneller wuchs als die Wirtschaft (Sachße/Tennstedt 1980, 181).
Einstellung zu den Armen
Bezüglich der Armenfürsorge handelte der Staat weniger im Interesse der Armen, als vielmehr in seinem eigenen Interesse. Die Einstellung zu den Armen fassen Christoph Sachße und Florian Tennstedt in drei Punkten zusammen:
1. Die Armen hatten keinen Rechtsanspruch auf Unterstützung. Die Unterstützung galt mehr im Sinne Polizeirecht vor Fürsorgerecht. Es ging um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, um Gefahrenabwehr.
2. Die Armen, d. h. wer öffentliche Hilfe in Anspruch nahm, war von der Mitwirkung an den drei Gewalten des konstitutionellen Rechtsstaates (Legislative, Exekutive, Judikative) ausgeschlossen.
3. Neben diesen allgemeinen diskriminierenden Beschränkungen der Armen konnten die einzelnen Staaten des Deutschen Reiches weitere, ergänzende Eingriffe vornehmen. So durften z. B. in Bayern Ordnungskräfte die Wohnung der Armen jederzeit betreten, in Sachsen über Tun und Lassen im häuslichen Leben Rechenschaft fordern (Sachße/Tennstedt 1980, 212 f.). Arme mussten die ihnen zugewiesene Arbeit verrichten, im Weigerungsfall wurden Arbeitsscheu unterstellt und Haftstrafen verhängt.
Bettelvögte, Armenpfleger
Interessant ist aus heutiger Sicht, dass bis zu Beginn des 20. Jahrhundert die Versorgung wie auch die Disziplinierung und Kontrolle Hilfsbedürftiger durch öffentliche Armenverwaltungen nicht von Frauen, sondern ausschließlich von Bürgern mit Wahlrecht, also nur von ehrenamtlich tätigen Männern durchgeführt werden durften. In der Regel waren es ausgediente Soldaten oder Polizeidiener, welchen die Verteilung von Almosen übertragen wurde. Sie erhielten für ihre Tätigkeit etwa ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts von den Kommunen eine – mal mehr, mal weniger hohe – Aufwandsentschädigung. Man bezeichnete diese Tätigkeit regional unterschiedlich: Armen- und Bettelvögte, Gassendiener, Almosenknechte, Almosenpfleger, Kostendiener, Polizeidiener, Polizeisoldaten, Revierdeputierte, Armeninspektoren oder Armenpfleger. Ehrenwerte Bürger konnten nur dann ehrenamtlich in der Armenfürsorge tätig werden, wenn sie Mitglied eines städtischen Rates waren. Die Armenfürsorge galt dann als bürgerliches Ehrenamt.
1.3.2 Elberfelder Quartiersystem (1867)
Was halten Sie von folgendem Vorschlag, die Armenpflege in Quartieren bzw. Bezirken zu organisieren?
1.Man teilte eine Stadt in Bezirke auf und diese wiederum in Quartiere.
2.Jedem Bezirk stand ein ehrenamtlicher Vorsteher und jedem Quartier ein ehrenamtlicher Pfleger vor.
3.Jeder Pfleger hatte 2–4 Arme zu betreuen.
4.Den Armen sollte durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen geholfen werden.
Frage: Worin sehen Sie Chancen und Probleme bei dieser Form der Neuorganisation der Armenpflege?
Elberfeld (heute: Duisburg) war eine große Industriestadt. Um 1800 hatte sie etwa 12.000 Einwohner, 1852 bereits 50.364 und 1885 schon 106.492. Elberfeld gehörte damit zu den am raschesten wachsenden Fabrikstädten Deutschlands (Landwehr/Baron 1995, 22–26). Das Elberfelder System, von Daniel von der Heydt, Gustav Schieper und David Peters (Armenordnung vom 9. Juli 1852) konzipiert, war zu seiner Zeit das wirksamste und fand in weiten Teilen Deutschlands wie auch im Ausland große Anerkennung und Nachfolger. Es galt bis ins 21. Jahrhundert als Vorbild für die Organisation der Armenpflege. Ziel war es, die zu Armenzwecken verfügbaren Mittel mit größtmöglicher Sparsamkeit einzusetzen. Sachße und Tennstedt fassen die Grundsätze der Organisation und die materiellen Ziele in vier Punkten zusammen:
1. „Ehrenamtliche Arbeit in der öffentlichen Wohlfahrtspflege: Die verantwortliche Armenbehörde stellte eine große Anzahl freiwilliger Helfer und Helferinnen in ihren Dienst, die die Armen aufzusuchen, zu kontrollieren und nach Maßgabe ihres Befundes Unterstützung zu beantragen hatten;
2. Individualisierung der öffentlichen Wohlfahrtspflege: Keinem Armenpfleger sollten mehr als vier Familien oder alleinstehende Arme unterstellt werden, damit gründlich geprüft und kontrolliert werden konnte;
3. Dezentralisierung der öffentlichen Wohlfahrtspflege: Die Armenpfleger sollten nicht als ausführende Organe im Dienste der Stadtverwaltung tätig sein, sondern in den Bezirksversammlungen selbständig Unterstützung beschließen; die Armenverwaltung regelte die Tätigkeit der Pfleger durch genaue Instruktion;
4. Vermeidung von Dauerleistungen: Jede Unterstützung sollte möglichst nur auf 14 Tage bewilligt werden.“ (Sachße/Tennstedt 1980, 215 f.)
Bezirke und Quartiere
Um diese Ziele zu erreichen, war die Stadt Elberfeld in Bezirke eingeteilt, die wiederum in Quartiere unterteilt waren. Jedem Bezirk stand ein ehrenamtlicher Vorsteher, jedem Quartier ein ehrenamtlicher Pfleger vor. Die 60 Quartiere waren so organisiert, dass jeder Pfleger nur 2–4 Fälle pro Hausbesuch und nach vorgedrucktem Fragebogen zu bearbeiten hatte (Hering/Münchmeier 2014, 30–31). Es entstanden die ersten allgemeinen Richtlinien (Vorläufer heutiger Sozial- und Fürsorgegesetze), die von der Verwaltung festgelegt wurden. Die Armenpfleger hatten diese Richtlinien dann in die Praxis umzusetzen (Belardi 1980, 40). Es ging bei diesen Überlegungen nicht darum, die Ursachen der Armut zu ergründen und sie zu bekämpfen, sondern Menschen aus der Armut zu befreien.
Die Wahl der Armenpfleger erfolgte auf Vorschlag der Kirchen. Die Armenpfleger waren im Hauptberuf Handwerker oder Industrielle. Bei der Armenpflege handelte es sich um ein Ehrenamt, das jeder Bürger für drei Jahre übernehmen musste (Kühn 1994, 5 f.).
Die Industriearbeiterschaft hat sich an der bürgerlichen Armenpflege nur in geringem Umfang beteiligt, weil sie das System als ein Instrument der bürgerlichen Gesellschaft ansah, das die soziale Ungleichheit und ihre Folgen nur verschleierte und grundlegende soziale Reformen verhinderte.
Das Elberfelder System verfolgte seine Ziele v. a. durch zwei Methoden:
■Arbeitsbeschaffung: Die Stadt Elberfeld versuchte Arbeiter zu vermitteln, indem sie den heimischen Unternehmern Aufträge erteilte. Wo dies nicht ausreichte, ordnete die Stadt eigene Tätigkeiten an (Straßenbau, Eisenbahnbau usw.).
■Arbeitsanweisungen: Nach dem Motto „Arbeit ist besser als Almosen“ mussten Hilfsbedürftige jede ihnen zugewiesene Arbeit annehmen. Sollte eine Arbeitsvermittlung nicht so schnell gelingen, bekam der Hilfsbedürftige eine Unterstützung. Diese war aber so knapp bemessen, dass er den Antrieb zur Arbeitsaufnahme nicht verlieren würde.
Das Elberfelder System war bezüglich des Abbaus der „Armenlast“ sehr erfolgreich. Die Zahl der Armen in der Stadt Elberfeld sank von etwa 4.000 auf 1.460 (über 50 %). Die Bettelei nahm rapide ab. Ähnliches wurde auch von anderen Städten gemeldet (Bremen, Krefeld, Leipzig, Dresden, Gotha u. a.), die das Elberfelder System übernommen hatten (Kühn 1994, 6).
1.3.3 Straßburger Quartiersystem (1905)