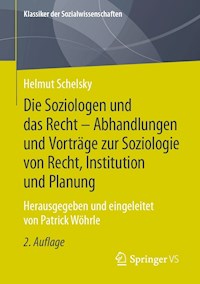14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
■ Sozial-anthropologische Grundlagen der menschlichen Sexualität ■ Die Institutionalisierung der Rolle der Geschlechter Die soziale Polarisierung der Geschlechter / Weitere soziale Differenzierungen der Geschlechterrollen ■ Eheliche und außereheliche Geschlechtsbeziehungen Die Ehe keine primär sexuelle Institution / Die Ehe als soziale Regulierung der Geschlechtsbeziehungen / Prostitution ■ Sexualmoral und Gesellschaft Über die Absolutheit sexueller Normen / Die Moral der Kinsey-Reporte / Die Abnormen und die Gesellschaft / Soziale Faktoren der Homosexualität ■ Die sozialen Neutralisationen der Sexualität Die Inzestverbote / Die geschlechtliche Askese und ihre Folgen für die Kulturentwicklung ■ Der Zeitcharakter der Sexualität Das geschichtliche Verständnis der Sexualität / Die Psychologisierung der Sexualität / Sexualität als Konsum ■ Enzyklopädisches Stichwort: Soziologie der Sexualität ■ Erklärung einiger Fachausdrücke ■ Literaturhinweise ■ Namen- und Sachregister Erstmals erschienen 1955.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Helmut Schelsky
Soziologie der Sexualität
Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
■ Sozial-anthropologische Grundlagen der menschlichen Sexualität
■ Die Institutionalisierung der Rolle der Geschlechter
Die soziale Polarisierung der Geschlechter / Weitere soziale Differenzierungen der Geschlechterrollen
■ Eheliche und außereheliche Geschlechtsbeziehungen
Die Ehe keine primär sexuelle Institution / Die Ehe als soziale Regulierung der Geschlechtsbeziehungen / Prostitution
■ Sexualmoral und Gesellschaft
Über die Absolutheit sexueller Normen / Die Moral der Kinsey-Reporte / Die Abnormen und die Gesellschaft / Soziale Faktoren der Homosexualität
■ Die sozialen Neutralisationen der Sexualität
Die Inzestverbote / Die geschlechtliche Askese und ihre Folgen für die Kulturentwicklung
■ Der Zeitcharakter der Sexualität
Das geschichtliche Verständnis der Sexualität / Die Psychologisierung der Sexualität / Sexualität als Konsum
■ Enzyklopädisches Stichwort: Soziologie der Sexualität
■ Erklärung einiger Fachausdrücke
■ Literaturhinweise
■ Namen- und Sachregister
Über Helmut Schelsky
Helmut Schelsky (1912–1984) war ein deutscher Soziologe.
Inhaltsübersicht
I. Vorwort
Über geschlechtliche Verhaltensweisen vor einer breiteren Öffentlichkeit zu sprechen oder zu schreiben, gehörte einmal zu den Dingen, die für einen Privatmann als ungehörig, für einen Gelehrten nur in ganz gewichtigen Ausnahmefällen als zulässig angesehen wurden. Die wissenschaftliche Erörterung der Probleme und Zusammenhänge der Sexualität erfolgte in kleinen Kreisen spezialisierter Fachwissenschaften, die sich zudem noch durch eine für den Laien kaum durchdringbare fremdwortreiche Fachsprache gegen ein allzu breites Verständnis ihres Gegenstandes abschirmten. Die Berechtigung einer solchen Einstellung gegenüber der Erörterung sexueller Dinge ist als eine gefühlsmäßige Hemmung heute noch weit verbreitet, gilt aber gerade unter den modernen, sich ihrer allseitigen Bewußtheit und unvoreingenommenen geistigen Offenheit sicheren Intellektuellen und in den Kreisen, in die ihr Einfluß reicht, als eine hoffnungslos altmodische Ansicht. Nachdem die Psychoanalyse zum interessanten gesellschaftlichen Gesprächsstoff, ja, schon zu einem Gesellschaftsspiel geworden ist und die Statistiken der Kinsey-Berichte einen Bestseller und ein jahrelang bevorzugtes Thema aller Tageszeitungen abgegeben haben, scheint jene Einstellung so veraltet und überholt zu sein, daß ihr Vorhandensein nur als Anzeichen eines nicht bewältigten Trieblebens und eines unfreien Charakters gedeutet und das Bekenntnis zu ihr als eine geistige Kastration oder als ein Verharren in muffig-kleinbürgerlicher Geistesenge angesehen werden kann. Schließlich gehören ja die Einsichten in die Verdrängung sexueller Antriebe heute zu dem geistigen Rüstzeug und dem Wortschatz, mit dem anerkannte geistige Führer, Kirchenleute und Politiker die Schlechtigkeit menschlicher Zustände öffentlich erklären und aller Welt den Weg zum jeweiligen Heil weisen.
Und trotzdem halte ich jene altmodische Ansicht für die einzig richtige.
Diese Versicherung muß in einem Buche über die Sexualität, das schon durch seine Erscheinungsweise mit einer breiteren Leserschaft rechnet, einigermaßen widerspruchsvoll erscheinen. Wir befinden uns heute traditionellen Verhaltensweisen gegenüber – und zu ihnen gehört die Tabuierung des Geschlechtlichen im öffentlichen Gespräch – aber in ebendiesem Widerspruch: ihr bloßes, naives und selbstsicheres Durchhalten ist kaum möglich, da sich alle gültigen Motive des öffentlichen Bewußtseins gegen sie wenden, ihre rationalisierende Aufklärung erzwingen und sie als auf bloßer Tradition beruhende Verhaltensformen vor dem Selbstbewußtsein des modernen Menschen diskriminieren. So in den Bereich des kritischen und planenden Bewußtseins des einzelnen Menschen und der Gesellschaft gezogen und der mehr oder minder offenen Diskussion ausgeliefert, verlieren aber diese Verhaltensweisen ihre sinnvolle und für Mensch und Gesellschaft gleich nützliche Funktion, die sie nur unterhalb der, wenn nicht Bewußtseins-, so doch wenigstens Wort- und Diskussionsschwelle auszuüben imstande waren. Ihre Bewußtmachung und deren Popularisierung hat allerdings, anstatt zum freien und beherrschten Leben zu führen, nur neue und weit schwerer greifbare und zu ertragende Notstände, Unsicherheiten und Krankheiten des menschlichen und sozialen Verhaltens geschaffen, als die Enge und Schranken der Traditionen sie verursachten. Wie gegenüber so vielen aufklärerischrevolutionären Emanzipationsbewegungen beginnen wir heute auch gegenüber der Emanzipation der Sexualität aus der hoch- und kleinbürgerlichen Prüderie der Jahrhundertwende zu ahnen, daß wir das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben. Die menschlichen und sozialen Folgen, die in der Popularisierung der an sich höchst wissenschaftlich spezialisierten Einsichten der Psychoanalyse und in solchen sexuellen Aufklärungswellen liegen, wie sie mit den Namen Vandervelde oder Kinsey verbunden sind, beginnen heute die Wissenschaften vom Menschen nicht minder sorgenvoll zu beschäftigen als einst die Aufklärer die ‹Unvernünftigkeiten› traditioneller Verhaltensmuster. Wir sind auf vielen wissenschaftlichen Gebieten gerade dabei, uns die funktionale Bedeutung der Traditionen durch Einsicht wieder zu erobern.
In diesem Vorgang einer Gegenaufklärung gegen die mangelnde Tiefe des Bewußtseins der Aufklärungszeiten und -bewegungen, in dessen Zusammenhang eine Besinnung über die gegenseitige Rolle von Moral und Sexualität in der Gesellschaft sicherlich zu den notwendigsten und folgenreichsten Aufgaben gehört, gerät nun aber das wissenschaftliche Bewußtsein in das oben genannte Dilemma: die Einsicht in die Bedeutsamkeit einer geschwundenen oder schwindenden traditionellen Verhaltensform stellt diese nicht wieder her; auf eine Konservierung oder Restaurierung von Traditionen durch Verbreitung der Einsichten in die Leistung und ihren Nutzen zu hoffen, erweist sich als eine leicht durchschaubare, aufklärerische Infektion des konservativen Bewußtseins. Umgekehrt bestärkt das Schweigen über solche Einsichten, ihre Hegung in esoterisch-wissenschaftlichen Zirkeln, die traditionszerstörenden Aufklärungsbewegungen nur noch, da diese ja einmal vom wissenschaftlichen Bewußtsein her in Gang gesetzt wurden und sich in ihrem gegenwärtigen Verlauf gegenüber dem Populärbewußtsein immer noch von dort her legitimieren. Auf unser Thema hin verdeutlicht, heißt dies etwa: die Einsicht und Aufklärung über den Schaden, den die umfassende Publizität der Kinsey-Berichte anrichtet, kann diesen nicht verhindern oder wiedergutmachen; umgekehrt würde eine im inneren Zirkel der Wissenschaft bleibende Kritik den Wirkungsgrad der Kinsey-Popularisierungen nur noch verstärken, da diese sich ja als die wissenschaftliche Wahrheit schlechthin dem öffentlichen Bewußtsein aufdrängen. Auch die über den Optimismus ihrer aufklärerischen Wirkung hinausgelangte Wissenschaft muß sich den Konsequenzen ihrer aufklärerischen Popularisierung stellen.
Weshalb reden und schreiben wir also hier so öffentlich über Sexualität und Moral, wenn wir doch der Meinung sind, daß ihr für den einzelnen und die Gesellschaft harmonischstes Verhältnis zueinander gerade unterhalb der öffentlichen Wort- und Diskussionsschwelle liegt? Offensichtlich weder in der aufklärerischen Hoffnung auf Fortschritt noch in der konservativen Hoffnung auf Restauration einer höheren Moral sexuellen Verhaltens, sondern aus Verantwortungsgefühl und der Einsicht, daß die Wissenschaft ihre eigenen Verführungen und Utopismen zurückzunehmen hat. Wenn wir hier die lebenswichtige Funktion der Moral im sexuellen Verhalten für den einzelnen und die Gesellschaft zu verdeutlichen suchen, so also nicht, weil wir hoffen, dadurch diese Moral selbst wieder schaffen und stabilisieren zu können, wohl aber in der Absicht, den Raum für moralische Entscheidungen und Verhaltensformierungen überhaupt erst wieder freizulegen gegenüber dem Nebel und Meinungszwang sowohl fortschrittlich als auch restaurativ planerischen Wissenschaftspopularisierungen. Wir stehen im Bereich der sexuellen Verhaltensweisen – wie in vielen Gebieten unseres sozialen Lebens – vor einer viel schwierigeren Aufgabe, als über veraltete Traditionen hinaus fortzuschreiten oder umgekehrt diese zu bewahren, wir stehen vor der Aufgabe, neue Traditionen zu begründen. Das kann keine Wissenschaft; aber sie kann mithelfen, ein allgemeines Bewußtsein zu schaffen, das diese schöpferische Leistung sozialer Stabilität nicht durch pseudowissenschaftliche Lösung behindert. –
Dieser Abriß einer sozialwissenschaftlichen Theorie der Sexualität versucht, den gegenwärtigen Stand des soziologischen Verständnisses der Geschlechtlichkeit festzuhalten und ihn in Zusammenhang mit den allgemeinsoziologischen Lehren über die Gesellschaft und die menschlichen Verhaltensformen zu bringen. Die Gesichtspunkte, unter denen diese Abhandlung steht, verdanken ihre Klärung nicht zuletzt vielen und eingehenden Gesprächen mit dem Psychiater HANS BÜRGER-PRINZ und dem Philosophen und Soziologen ARNOLD GEHLEN, denen ich dafür auch an dieser Stelle danken möchte. Als Vorarbeiten sind in diese Darstellung folgende Veröffentlichungen des Verfassers eingegangen: Die sozialen Formen der sexuellen Beziehungen, in ‹Die Sexualität des Menschen, Handbuch der medizinischen Sexualforschung›, hg. v.H. Giese, Stuttgart 1954; der Artikel ‹Sexualität› im Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 1954; Die Moral der Kinsey-Reporte, in Ztschr. ‹Wort und Wahrheit›, 9. Jg., Heft 6, 1954.
II. Sozial-anthropologische Grundlagen der menschlichen Sexualität
Die neueren sozialwissenschaftlichen Theorien der Sexualität wenden sich zunächst gegen die in der älteren Soziologie vielfach vertretene Ansicht, die Sexualität des Menschen stelle ein biologisch in seinem Ablauf so gesichertes Instinktverhalten dar, daß eine Soziallehre der Geschlechtlichkeit in ihr einen präsozial weitgehend festgelegten Verhaltenskomplex einfach aufzunehmen habe oder gar von ihm soziale Beziehungen und Formen in ihrer Struktur deduzieren könne. Die moderne Anthropologie und die auf ihr aufbauenden Kulturlehren, wie sie in den Werken von BRONISLAW MALINOWSKI, MARGARET MEAD, RUTH BENEDICT, CLYDE KLUCKHOHN, ARNOLD GEHLEN u.a. vorliegen, sehen in der Sexualität wie in anderen biologisch bedingten Antrieben des Menschen eher weitgehend unspezialisierte Grundbedürfnisse, die gerade wegen ihrer biologischen Ungesichertheit und Plastizität der Formung und Führung durch soziale Normierung und durch Stabilisierung zu konkreten Dauerinteressen in einem kulturellen Überbau von Institutionen bedürfen, damit die Erfüllung schon des biologischen Zweckes, so im Falle der Sexualität etwa die Fortpflanzung, sichergestellt ist.
Von dem in seiner Auslösung, seinem Ablauf und seinem Gattungszweck instinktgesicherten Sexualverhalten der Tiere, wie es vor allem KONRAD LORENZ in seinen tierpsychologischen Untersuchungen geklärt hat, unterscheidet sich die biologische Situation der menschlichen Geschlechtlichkeit in zwei wesentlichen Merkmalen, die zugleich die Grundlage ihrer sozialen Formung ausmachen: in einer weitgehenden Instinktreduktion, die mit der Bildung eines sexuellen Antriebsüberschusses Hand in Hand geht, und in der Ablösbarkeit des sinnlichen Lustgefühls vom biologischen Gattungszweck, womit die Lust als ein neuer Zweck des Sexualverhaltens unmittelbar intendierbar wird.
Eine der entscheidenden Abweichungen des menschlichen vom tierischen Geschlechtsleben besteht im Fehlen des jahreszeitlichen Rhythmus der sexuellen Antriebe (Brunstzeiten). Infolge der Daueraktualität des menschlichen Geschlechtstriebes, verbunden mit seiner Hypertrophierung unter einigermaßen günstigen Umweltbedingungen, entsteht ein sexueller Antriebsüberschuß, der nur in den seltensten Fällen in rein sexuellen Verhaltensweisen unterzubringen ist. Dieser Erhöhung der sexuellen Triebenergien steht nun auf der anderen Seite ein Abbau der organischen Kontrollen und Sicherungen dieses Verhaltens im Sinne biologischer Zweckmäßigkeit gegenüber: der Mensch verfügt weder im Einsatz noch im Ablauf seines Sexualverhaltens über eindeutige Instinktmechanismen oder feste ‹angeborene Schemata› (LORENZ) der Reizauslösung; obwohl zweifellos in der menschlichen Sinneswahrnehmung einige Reste sexueller Instinktschemata auffindbar sind (sexuelle Düfte, spezifische Formen des weiblichen und männlichen Körpers u.a.), hat die allgemeine Instinktreduktion doch zu einer fast universalen Plastizität (GEHLEN) des menschlichen Sexualverhaltens geführt. In diesem Antriebsüberschuß und der Instinktungesichertheit des menschlichen Sexualverhaltens steckt also eine außerordentliche Gefährdung des biologischen Wesens Mensch, die man als eine Tendenz zur Pansexualität und, sofern alles Sexualverhalten wesentlich auf Kommunikation zwischen mehreren Individuen zielt, als einen Zug zur ungeregelten Promiskuität bestimmen kann. (Die ältere Soziologie hat nie erkannt, daß die Vorstellung einer ungeregelten geschlechtlichen Promiskuität einen vorkulturellen Tatbestand, allenfalls einen Zustand des biologischen Verfalls des Kulturwesens Mensch meint und daher als Begriff einer Sozialform der menschlichen Geschlechtsbeziehungen in einer Kulturwissenschaft von vornherein illegitim ist.)
In dieser biologischen Gefährdung des menschlichen Trieblebens liegt nun aber zugleich seine kulturelle Chance: indem der Mensch dem Zwang der Umweltgebundenheit und der Instinktstarre entronnen ist, kann und muß er über seine Antriebe in bewußten Handlungen verfügen; daß das menschliche Triebleben auf kulturelle Führung und Regelung angewiesen ist, stellt die Grundeinsicht dar, die die neuere deutsche philosophische Anthropologie (MAX SCHELER, HELMUTH PLESSNER, ARNOLD GEHLEN) herausgearbeitet hat und die von der Humanbiologie heute als Grundlage angenommen ist (vgl. z.B. ADOLF PORTMANN, OTTO STORCH u.a.). Dieser Notwendigkeit der kulturellen Führung unterliegen insbesondere alle menschlichen Triebenergien, die auf ein Handeln unter mehreren Individuen zielen: die kulturelle Überformung der sexuellen Antriebe gehört sicherlich ebenso zu den ursprünglichen Kulturleistungen und Existenzerfordernissen des Menschen wie Werkzeug und Sprache, ja, es spricht nichts dagegen, in dieser Regelung der Geschlechts- und Fortpflanzungsbeziehungen des Menschen die primäre Sozialform alles menschlichen Verhaltens zu erblicken.
Die Leistungen des kulturellen Überbaus von Sozialformen gegenüber der geschilderten sexuellen Antriebsstruktur des Menschen gehen in zweierlei Richtungen: zunächst bedeutet die soziale Regelung der Geschlechtsbeziehungen eine Kontrolle und Zucht zur biologischen Zweckmäßigkeit, insofern das biologisch ungesicherte Sexualverhalten durch soziale Einschränkungen auf Dauerinteressen und Selektivität der Sexualziele eingestellt wird; ‹culture channels biological process› (CLYDE KLUCKHOHN). Dabei erweist sich die instinktschematisch ungesicherte Plastizität menschlicher Sexualbedürfnisse gerade als eine Chance zur Ausbildung einer höheren Selektivität der Sexualziele, die über den bloßen Gattungszweck hinausführt und die Einfügung von seelischen, kulturellen oder sozialen Differenzierungen in die sexuelle Antriebssphäre ermöglicht. Weiterhin bewirkt der kulturelle Überbau die Ablenkung der im Geschlechtsverhalten nicht unterzubringenden Energien auf nichtsexuelle oder pseudosexuelle Ziele. Indem sich aus den sozialen Institutionen, die das Triebleben regeln, institutionseigene Bedürfnisse entwickeln, die aber in ihrer Energiezufuhr auf sexuelle und andere primär biologische Triebquellen angewiesen sind, pendeln diese Institutionen in ihrer Entwicklung ständig in der Waage zwischen Ent- und Resexualisierung. Dies sowie die Tatsache, daß in den Formen dieses kulturellen Überbaus stets andere als sexuelle Grundantriebe zugleich mit aufgenommen und geregelt sind, macht die Analyse sozialer Gebilde in ihrer Beziehung zur Sexualität so außergewöhnlich schwierig.
Eine weitere Grundlage für die kulturelle Formung des sexuellen Verhaltens müssen wir darin sehen, daß die Lustempfindung des Triebverhaltens beim Menschen vom Gattungszweck ablösbar ist und zum eigenständigen Motiv bewußter Handlungen zu werden vermag. Indem die Sinneswahrnehmung des Menschen ihre organische Verwurzelung in bestimmten umweltgebundenen Funktionskreisen löst, gewinnt sie zugleich die Verfügbarkeit über das alles tierische Triebverhalten nur begleitende Lustgefühl, das jetzt, enthoben der biologischen Zweckmäßigkeit, zum Ziel dieses Verhaltens selbst werden kann. Diese Akzentuierung des Genusses hat O. STORCH (16[*], S. 23f.) für die Funktion der menschlichen Ernährung als Grundlage der menschlichen ‹Kochkultur› nachgewiesen: indem sich die Geschmacksqualitäten von der Funktion der bloßen Nahrungsaufnahme freisetzen lassen und um ihrer selbst willen erstrebt werden können, schaffen sie erst den eigentümlichen menschlichen Anreiz, Geschmacks- und Genußbedürfnisse um ihrer selbst willen zu verfolgen und diese daher als hohe kulturelle Differenzierung in die Formen der Nahrungsaufnahme einzubauen. So gehört das reine Genußmittel von vornherein ebenso zu den Wesenseigentümlichkeiten des Menschen wie die Verfolgung der bloßen geschlechtlichen Lust um ihrer selbst willen. Die primäre biologische Funktionslosigkeit dieser beiden autonomen Genuß- oder Lusttendenzen bedingt dann auch die in beiden angelegte Steigerung in den Rausch als eine nur vom Menschen anzustrebende Befindlichkeit. Von dieser Verselbständigung des Genusses her gesehen wird das menschliche Sexualverhalten mit Recht als Sinnlichkeit schlechthin bezeichnet. Dabei ist in Betracht zu ziehen, daß fast alle menschlichen Sinnesorgane im Dienst der Sexualität stehen und so – trotz der Verdichtung sexueller Lustempfindungen in den primär sexuellen Zonen des Leibes – die gesamte Leiblichkeit dem Menschen als Organ dieses Lustgewinnes zur Verfügung steht. Dieser realisiert sich nun in den sehr verschiedenen Abstufungen und Distanzverhältnissen leiblicher Sinneskommunikation zwischen den Individuen, zugleich aber als leibliches Selbstgefühl des Einzelnen im Hinblick auf dieses Kommunikationserlebnis.
Dieses im interindividuellen Kontakt auftretende, von der Bindung an einen biologischen Gattungszweck befreite leibliche Luststreben bildet als Bereich der Erotik eine stets vorhandene Schicht des menschlichen Sexualverhaltens, die ihrerseits nun genau so der sozialen Formung und Institutionalisierung unterliegt wie die primären Geschlechtsbeziehungen. Da dieser universal-leibliche Lustgewinn keineswegs an den Geschlechtsakt gebunden ist, sondern in jeder noch unmittelbar sinneshaften menschlichen Kommunikation erlebbar ist, besteht praktisch für alle sozialen Gebilde und Verhaltensformen, in denen die Menschen in leiblicher Gegenwart miteinander verkehren, die Möglichkeit der Erotisierung dieser Beziehungen. Eine Soziologie der Erotik sieht sich also von vornherein vor der Aufgabe, nicht nur die Anwesenheit erotischer Triebmomente in den verschiedenen personhaften Formen der sozialen Beziehungen zu diagnostizieren, sondern vorwiegend gerade das Ausmaß und die Art ihrer Neutralisierung und Hemmung als die spezifisch soziale und kulturelle Leistung zu verdeutlichen. Erst die von der leiblichen Präsenz der Person entbundenen abstrakten und großorganisatorischen Sozialbeziehungen der modernen Gesellschaft versagen sich grundsätzlicher dieser Erotisierbarkeit.
Die Ausdehnung dieser Art sexueller Lustimpulse auf jede Form der Sinneswahrnehmung des Menschen erklärt weiterhin, weshalb alle kulturellen Gebilde und Verhaltensformen, die auf der Kultivierung und Differenzierung sinnenhafter Ausdrucks- und Eindrucksweisen beruhen – wie jegliche Kunst, aber auch die Rituale des religiösen, des kämpferischen Verhaltens usw. – stets in erotischen Lustgewinn ausweitbar sind. Diese Erscheinung wird nun zum sozialen Tatbestand, insofern diese kulturellen Gebilde zu einem künstlichen Medium sinnlicher Kommunikation, zu einem Vehikel der Leiblichkeit werden und damit neue Bereiche und Formen zwischenmenschlicher erotischer Beziehungen schaffen, wie wir sie vor allem in den Auswirkungen der darstellenden Kunst, von den Frauenstatuetten der Steinzeit bis zur modernen Reklame, studieren können.
Schon diese kurze und durchaus fragmentarische Darstellung der anthropologischen Grundlagen der menschlichen Sexualität zeigt also eine biologisch notwendige Angewiesenheit des menschlichen Geschlechtstriebes auf soziale und kulturelle Formung, offenbart aber zugleich die Vielfältigkeit und Ausfaltung dieser sozialen und kulturellen Befriedigungs- und Kontrollmöglichkeiten. Die allseitige Durchdringung menschlicher Handlungsformen mit sexueller Aktivität wie umgekehrt die Entfremdung geschlechtlicher Antriebe in und durch andere Schichten und Impulse menschlichen Verhaltens[*], beides Vorgänge, die sich zudem in dauerndem Wechsel und dynamischem Widerspiel befinden, lassen daher eine präzise Bestimmung, was soziale Formen der Sexualität sind und was nicht, gar nicht zu; eine Soziologie der sexuellen Beziehungen wird daher wesentlich immer im Nachweis bruchstückhafter und wechselbarer sexueller Bezüge innerhalb funktional vielseitiger und umfassender sozialer Gebilde und Verhaltensformen zu bestehen haben.
III. Die Institutionalisierung der Rolle der Geschlechter
1. Die soziale Polarisierung der Geschlechter
Das soziale und kulturelle Leben aller Gesellschaften baut sich in seinen Formen weitgehend auf dem Unterschied der Geschlechter, der Verschiedenheit der Rolle von Mann und Frau, auf. Gemeinhin sieht man in dieser verschiedenen sozialen Rolle einen naturgegebenen biologischen Unterschied, aus dem der soziale und kulturelle Aufbau nur die unumgänglichen Folgerungen für die sozialen Rollen der Geschlechter gezogen hat. Tatsächlich scheint es aber weitgehend umgekehrt zu sein: gerade weil fast alle Gesellschaften in ihren sozialen Verhaltenskonstanten und Institutionen auf dem Unterschied von Mann und Frau beruhen, wird dieser Unterschied nun auch über seine biologische Festgelegtheit hinaus sozial fixiert und mit allen Mitteln der sozialen Sanktionierung und Tabuierung absolut gesetzt, um damit aus dem Bereich der verfügbaren Verhaltensveränderungen ausgeblendet zu werden. Der Glaube an die ‹Natürlichkeit› der Geschlechtsunterschiede und des daraus folgenden unterschiedlichen sozialen und kulturellen Verhaltens ist selbst nur eine spezifisch moderne Form der sozialen Sanktionierung der Grundlagen der eigenen Kultur und Gesellschaftsverfassung (vgl. S. 48ff.). Die wirklich vorhandenen biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind demgegenüber verhältnismäßig belanglos und mehr Anlaß als Ursache für die sozial verschiedenartige Formung der Rolle von Mann und Frau im sozialen und kulturellen Leben.
Diese Einsicht, daß jede Kultur in irgendeiner Weise die Rolle des Mannes und der Frau standardisiert und institutionalisiert, inhaltlich aber die Bestimmungen, was männliche und weibliche Verhaltensformen und Eigenschaften sind, in den Kulturen sehr verschieden, ja, in vielen Fällen durchaus gegensätzlich getroffen werden, hat vor allem MARG. MEAD (23 b, d) an einem umfassenden ethnologischen Material zu belegen versucht. Wenn sie sagt, daß ‹das Material uns die Behauptung nahelegt, daß viele, wenn nicht gar alle Wesenszüge, die wir als männlich und weiblich bezeichnet haben, mit der eigentlichen Geschlechtlichkeit ebenso schwach nur verknüpft sind wie die Kleidung, die Umgangsformen und die Art der Frisur, die eine Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt jedem Geschlecht vorschreibt› (23 b, p. 190), so unterbewertet sie dabei zwar die kulturell fundamentale Bedeutung der Institutionalisierung der Geschlechterrollen im Vergleich mit zeitlich schneller wechselnden Modeformen des Verhaltens, sieht aber richtig, daß diese Standardisierung der Geschlechtscharaktere und -verhaltenskonstanten im wesentlichen eine soziale ‹Superstruktur› darstellt, die in ihren jeweiligen Bestimmungen sich weit mehr aus den Gestaltungsprinzipien des betreffenden kulturellen Gesamtgefüges als von biologischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern ableiten und verstehen läßt. Der einzige fortführende Einwand gegen diese These hätte darin zu bestehen, daß bei der Abwehr des biologischen Dogmatismus in der Auffassung der Geschlechter hier nun eine falsche Betonung des ‹rein Sozialen› hörbar wird, die das ‹Geschlechtliche› doch wiederum, wenn auch als relativ bedeutungslos, dem ‹rein Biologischen› überläßt, während ja die Angewiesenheit auf die soziale Überformung gerade als biologisches Kennzeichen der menschlichen Geschlechtlichkeit aufzufassen wäre und die Ergebnisse MARG. MEADs dazu führen müßten, das Biologische und Kulturelle als untrennbar bereits in der Humanbiologie zu behaupten.
Da sich das Geschlechtliche des Menschen in alle kulturellen Handlungsschichten und Gebilde hin auszufalten vermag, reicht auch die soziale Differenzierung der Geschlechter in alle diese Bereiche hinein, so daß es müßig ist, die Gebiete, in denen diese Rollenverteilung zwischen Mann und Frau durchgeführt ist, einzeln aufzählen zu wollen: sie ist praktisch so universal wie die Sexualisierung menschlicher Handlungsformen überhaupt. Alle soziale und politische Betätigung sowie die sie regelnde Rechtsordnung, insbesondere der Erbgang sozialer Rechte, sind in allen Kulturen mehr und minder von der Unterschiedlichkeit der Rolle der Geschlechter her differenziert; das gleiche gilt für die religiösen, künstlerischen und geselligen Verhaltensformen, ja, diese Differenzierung reicht in manchen Kulturen sogar bis zur Entstehung eigener Frauensprachen, die die Männer nicht verstehen oder schicklicherweise nicht verstehen dürfen, während andererseits die ebenfalls bis ins Sprachliche gehende Geheimniskrämerei der Männer in ihren Männerbünden und -häusern die umgekehrte Aussonderung des anderen Geschlechtes darstellt.
Diese geschlechtlich zwiegespaltenen Verhaltensformen aller Kulturbereiche können damit zu unabdingbaren sexuellen Reizvoraussetzungen und zugleich sexuellen Befriedigungsmöglichkeiten im Verkehr der Geschlechter untereinander werden, wie sie umgekehrt wiederum auch die Form der Kontrolle und Führung des geschlechtlichen Verhaltens darstellen. Die umfassende Übernahme aller fundamentalen und traditionellen Verhaltensformen des gesamten jeweiligen Kulturgefüges durch die heranwachsenden jungen Menschen ist also die unmittelbarste Sexualerziehung und Prägung der Geschlechtsmoral, die es überhaupt gibt, da alle kulturellen Verhaltenskonstanten sich eben nur in der Form der jeweiligen Geschlechtskonformität erwerben lassen. Zugleich erkennt man von hier aus, daß alle Geschlechtsmoral in ihrem kulturellen Grundbestand immer ‹doppelte Moral› ist und sein muß, da es immer zwei Rollen zu stilisieren gilt, deren sozial bedingte Variabilität allerdings auch den Grenz- und Sonderfall möglich macht, diese beiden Verhaltensprinzipien annähernd gleichartig zu standardisieren. Wo die Tendenz dazu mehr ist als eine bloße Mäßigung extrem gegensätzlich gewordener geschlechtlicher Rollenverschiedenheiten, beruht sie fast immer auf einer künstlichen Absonderung und Verselbständigung der Geschlechtsbeziehungen von den übrigen Lebens- und Kulturgebieten, wobei dann allerdings auch immer die Problematik einer gesonderten Sexualerziehung, etwa als ‹sexuelle Aufklärung›, auftaucht. Wird die Gesamtheit kultureller Lebensformen unwirksam gegenüber dem geschlechtlichen Verhalten und dieses autonom, so führt das hier wie da zu einem Abbau von Geformtheiten, also zu Reprimitivisierungen.
Müssen wir die verschiedenartige Formung der geschlechtlichen Rollen als die normale Grundlage des kulturellen Gefüges ansehen, so zeigt uns doch jeder Kulturvergleich, daß der Inhalt dessen, was in einer Kultur als der Unterschied von männlicher und weiblicher Rolle gilt, nun wieder außerordentlich variabel ist; auch interkulturell können wir in all den genannten Lebensbereichen durchaus gegensätzliche soziale Standardisierungen der Geschlechtscharaktere des Männlichen oder des Weiblichen feststellen, so z.B. in der Rechtsordnung die Gegensätzlichkeit von Mutter- und Vaterrecht, die sich widersprechende Bedeutung der Frau oder des Mannes in den verschiedenen Religionen usw. Die Abstufungen des Unterschieds zwischen den Geschlechtern auf allen kulturellen Lebensgebieten und die interkulturelle Variabilität dieses Unterschiedes ergeben zusammen den Grundbestand einer bereits unübersehbaren Fülle sozialer Formen von Geschlechtsbeziehungen.
Nur auf einem Lebensgebiet wollen wir dieser sozialen Rolle der Geschlechter näher nachgehen: auf dem der Produktionsformen der Gesellschaft; gerade an der geschlechtlich differenzierten Arbeitsteilung lassen sich vielleicht am besten das Ausmaß und die Berechtigung dieser These von der sozialen Superstruktur des Geschlechtlichen verdeutlichen. Gegen die Behauptung der fast unbeschränkten sozialen Variabilität dessen, was eine Kultur als männlich oder weiblich standardisiert, könnte man schließlich den gleichen Einwand erheben, mit dem sich WILLIAM G. SUMNER in einem nüchternen Satz gegen den Versuch, die Rolle von Mann und Frau möglichst gleichartig zu bestimmen, wendet: ‹No amount of reasoning, complaining or protesting, can alter the fact that woman bears children and man does not›[*]. Gerade in den Arbeits- und Produktionsformen, in denen die körperliche Verfassung stets eine wichtige Rolle spielt, müßten die natürlichen Nachteile der Mutterschaft und Menstruation für das weibliche Geschlecht am klarsten in Erscheinung treten und daher zu einer in allen Kulturen annähernd oder wenigstens in den Grundzügen gleichartigen Verteilung der Arbeitsweisen auf die Geschlechter geführt haben. Ein Überblick über das vorhandene ethnologische Material, wie ihn etwa GOLDENWEISER (19) gibt, zeigt dagegen sehr bald, daß, wenn überhaupt, nur sehr wenige und keineswegs produktionsgrundsätzliche Beschäftigungen ausschließlich von dem einen oder dem anderen Geschlecht praktiziert werden. Die zweifellos vorhandene biologische Behinderung der Frau durch ihre Geschlechtlichkeit erweist sich als durchaus anpassungsfähig gegenüber einer bis in die Gegensätze gehenden Variation der sozialen Verteilung der Arbeits-Rollen; daß zudem diese Behinderung in unserer modernen Welt bei weitem überschätzt wird, zeigt jeder Vergleich mit der Arbeitsleistung und -kontinuität der Frau in vielen primitiven Gruppen oder rein bäuerlichen Gesellschaften und hängt vor allem mit der Lebensart zusammen, die unsere soziale Tradition und Sitte der Frau im allgemeinen, besonders aber der schwangeren Frau, auferlegt haben, wobei konstitutionelle Veränderungen in diesem Zusammenhang durchaus zugestanden seien.
So trägt bei Primitiven im allgemeinen die Frau die Last des Ackerbaus – vielfach mit der ideologischen Begründung, daß sie ‹von Natur aus› dazu bestimmt sei, da sie als Gebärerin allein etwas wachsen lassen könne –, während bei den europäischen und asiatischen Kulturvölkern die Verhältnisse meist umgekehrt liegen. Selbst in den gemeinhin als eigentümlich männlich angesehenen Beschäftigungen der Jagd oder der Kriegsführung oder umgekehrt der als spezifisch weiblich betrachteten des Kochens und der Haushaltsführung gibt es genügend sozial bedingte Ausnahmen: unter den Tasmaniern wird die schwierige Seehundsjagd durch Frauen betrieben, ‹sie schwammen hinaus zu den Seehundsfelsen, beschlichen die Tiere und erschlugen sie mit Keulen; die Tasmanierfrauen jagten auch das Opossum, wobei sie große Bäume erklettern mußten›[*]. In der Völkerkunde berühmt ist die sehr kriegerische und grausame Leibgarde des Königs von Dahomey, die aus Frauen bestand; umgekehrt finden wir bei Athenäus, einem griechischen Schriftsteller des 3. Jahrhunderts, den Ausruf: ‹Wer hat je von einer Frau gehört, die kocht›[*]! Allerdings haben gerade die industriell-bürokratischen Produktionsbedingungen wiederum einen großen Bestand an geschlechtlich neutralen Arbeits- und Berufsmöglichkeiten geschaffen und sind so ihrerseits zu einer Ursache der modernen Tendenz der Angleichung in der Rolle der Geschlechter geworden. Es bleibe dahingestellt, ob dies nicht eine Begleiterscheinung des Beginns aller großen, epochalen Produktionsveränderungen darstellt und ob daher mit der sozialen Verarbeitung dieser Revolution der Produktionsbedingungen nicht doch wiederum eine geschlechtlich unterschiedlichere Stilisierung auch dieser Art von Arbeitsformen zu erwarten ist.
Indem sich diese soziale Differenzierung der Geschlechter bis in die sublimsten seelischen und geistigen Haltungen hin verzweigt und auswirkt, begründet sie im wesentlichen auch den Gegensatz, den man gemeinhin als den psychologischen, geistigen oder gar metaphysischen Wesensunterschied und Charakter der Geschlechter anspricht. Für sehr viele Philosophen und Psychologen ist ‹das Männliche› und ‹das Weibliche› heute noch ein absolutes, inhaltlich eindeutig bestimmtes Wesensprinzip, das sich auf den verschiedensten Stufen menschlicher Wirklichkeit ausprägt oder gar in seinem Gegensatz das ganze All durchwaltet. An sich ist diese konstruktive Metaphysik der Geschlechter berechtigt als unbewußte geistige Sanktionierung der darin liegenden sozialen Fundamente unseres persönlichen und gesellschaftlichen Lebens; erstaunlich ist nur, wie sich die Denkformen dieses Glaubens auch dort noch blind durchsetzen, wo man ihm geistig entronnen zu sein glaubt und den Mut zu seiner Behauptung längst aufgegeben hat.