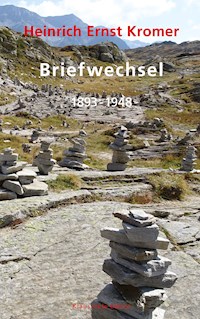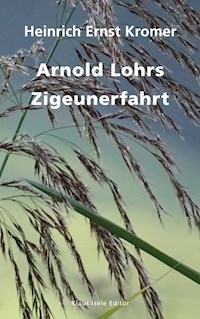6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Auswahl von späten Prosatexten des Schriftstellers und Malers Heinrich Ernst Kromer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Heinrich Ernst Kromer
Das literarische Werk
Herausgegeben von
Jürgen Glocker und Klaus Isele
Band 5
INHALT
Aus der Metmamühle
Die geheimnisvolle Krankheit
Der geröstete Student
Pfarrer und Bischof
Ein Merk’s
Der Narr in der Kirche
Leichter Verdienst
Die beiden Bescheidenen
Begegnung vor Tag
Der Konstanzer Narr
Mörikes Landstreicher
Pfarrer Hansjakobs Hauswurz
Das Musterbett
Torenlaunen
Eines Teppichs seltsames Schicksal
Wie Herr Ochsenbrink sein Stammschloß fand
Der Bauunternehmer von Singen
Das eigene Grab
Werkstattleben
A
NHANG
Nachwort
Zeittafel
Editorische Notiz
Aus der Metma-Mühle
An der Metma, dem starken Schwarzwaldbach, lag noch vor einem halben Jahrhundert in der Tiefe eines tannenbestandenen engen Tals eine alte Mühle, und wer sie zum ersten Mal dort unten entdeckte, mochte glauben, sie habe sich in diesem Loch vor den Menschen wie ein Klausner verborgen. Der die Mühle erbaute, hatte aber keine so weltflüchtigen Gedanken; er wertete das reiche Wasser des immer gleichen Quell-bachs als eine Kraft, die ihm ein großes Rad und die schweren Mühlsteine unermüdlich treiben konnte, dazu kaum vierzig Schritt abwärts auch noch Rad und Gatter eines bescheidenen Sägewerks. Und dieses sägte ihm mit den Jahren die ringsum ragenden Tannen in Balken und Bretter und versorgte damit die Dörfer ob dem Tale und in der Umgebung; dort dankten die Häuser mit ihren wetterbraunen Holzwänden unter den ungeheuren Strohdächern ihr Dasein dem kleinen Werk an der Metma und ihre Bewohner dann der einsamen Mühle auch des Lebens nötigste Speise, wenn sie im Vaterunser um das tägliche Brot beteten. Weil das Werk aber in diesem Waldloch lag, tauften es die Menschen ringsum Lochmühle, und der Name blieb, obschon seit Jahrzehnten die schöne alte Mühle einem kahlen Steinbau gewichen und auch das braune Sägewerk verschwunden ist, im Verfall allmählich vom Metmabach hinabgeschwemmt.
Sterben solche Werke aus geheimen Ursachen dahin oder werden vor Alter kraftlos, dann mag die alte Schnecke ihr Haus aufgeben und eine andre dreinlok-ken unter dem Vorgeben, es nähre seinen Bewohner und sei ihm ein währschafter Schutz über dem Kopf und noch auf Zeiten hinaus tauglich für Kind und Kindeskinder; und weil solches unbedenklich ein Mann glaubte, Martin des Namens nach seinem Geburtsheiligen, so zog er mit seinem Weib Line und vier Kindern in die alte Mühle. Denn in jenen Jahren stand ein Mahlwerk im größeren Nebental still, da sein Besitzer in Kalifornien dem Gold nachlief und die Mühlsteine neben dem Haus in Staub und Brennesseln versinken ließ. So mochte der Lochmüller auf seine laufenden Steine vertrauen, daß sie ihn um so gewisser ernähren würden, und als die feiernde Mühle feil und Martin von Weib und Verwandtschaft gestoßen wurde, sie zu kaufen, auf seinem bescheidenen Werk sitzen bleiben, so sehr auch die Müllerin dawiderwirken und -worten mochte.1
Und zum Unglück behielt sie recht: Die Zeiten nämlich leichterten nicht; zudem war eines Tages aus Amerika der Besitzer der anderen Mühle, der Rieder-steger, wieder auf seinem Haus, und dem Lochmüller verknappte sich Tag um Tag nicht nur sein Kornmehl, sondern seit einem Jahrzehnt wurde auch sein Sägmehl weniger und reichte ihm bald kaum noch, die Speckseiten damit zu räuchern. Die Sorgen und Klagen der Müllerin bekamen Oberwasser über Martins unter-schlächtige Räder, die der treuen Metma zum Trotz immer karger und verdrossener liefen; damit wurden aber in der Mühle die heranwachsenden Kinder entbehrlicher und für die bedrängten Eltern kostspieliger, und das Ende war, daß einstweilen der älteste Sohn Adolf, wie vor zehn Jahren der Riedersteger, nach dem goldenen Strohhalm griff, um die Mühle um einen verzweifelten Schwimmer leichter zu machen und, soweit es möglich werden wollte, den Eltern zu helfen.
Indes konnte sich Frau Line glücklicherweise sagen, daß der Entschluß ihres Sechszehnjährigen keinen sonderlichen Heldensinn verlangte. Seiner Mutter Bruder Dorus hatte in Kalifornien sein Glück gemacht; der zweite aber, der Vetter Donat, wie dort der Sprachbrauch gemeinhin den Mannsverwandten nennt, grub mit Erfolg auf dem Goldplatz weiter, den ihm zur Ausbeutung Dorus gerichtlich übermacht hatte. So griff Adolf entschlossen nach dem kalifornischen Rettungstau, und in der Mühle hatten sie nach einem Viertel-jahr Hin- und Herpost die erlösende Gewißheit, daß der Junge drüben willkommen und auch das Reisegeld für ihn bereit sei. Da meinte Frau Line füglich mit einem Seufzer der Erleichterung und wiederholte es sogar: Der Bruder Donat sei, wenn sie von Dorus absehe, von ihrer achten doch immer der Beste und Brävste gewesen.
Dies war im Frühjahr 1865. Hin- und Herschreiben der Beteiligten hatten die Entscheidung soweit hinausgezogen, und Mutter und Sohn waren eigentlich zufrieden mit der Galgenfrist, die ihnen mit der Verschiebung der Reise bis nach der Ernte gegönnt war. Aber noch ahnten beide nicht, daß darüber sich unverhofft Hindernisse einstellen konnten. Anfangs übersahen sie diese gutgläubig; dann aber fand Frau Line eines Tages doch, sie müsse ihnen ins Auge sehen. Und da meinte sie denn bei sich: Hätte der treue Metma-Bach plötzlich gegen seine Art mit dem Wasser gegeizt, es wäre für Rad und Mühlsteine nicht so gewichtig und fühlbar gewesen wie für sie und den Sohn diese anfangs kaum beachteten Dinge.
An einem Montag in der Frühe geschah es, daß Adolf gegen seine Gewohnheit später erwachte. Er hatte sich darauf kaum aus dem Bett erhoben und ein wenig die Augen ausgerieben, so lief er eilends zum Kalender, worin er sonst die Mühlenkundschaft führte, suchte darin den Tag und merkte ihn an; es war der 23. April. Dann warf er sich rasch in die Kleider und ging in die Stube hinunter, nachdenklich und ernst, ganz wider seine gewohnte muntere Art.
Um den runden Tisch im Herrgottswinkel saßen die Leute des Müllers beim Morgenessen: außer den Eltern die siebzehnjährige Tochter Friederike und ihre jüngeren Brüder Berthold und Gustav, und füllten nach dem Tischgebet ihre Teller mit Habermus; damals war Kaffee noch nicht das Frühstück des Wälder-bauern.
Da trat mit bedrücktem Morgengruß Adolf ein, nahm Platz, sprach leise das Tischgebet und schöpfte sich dann aus der rotbraunen mächtigen Schüssel seinen Teller voll, als gälte es Fünfen. Die Mutter sah ihren kraushaarigen Blonden schweigend von der Seite an, und dieser fühlte den Blick ihrer stahlblauen Augen in Erwartung ihres Tadels oder Spottes, ihrer üblichen Waffen, wenn sie mit der Haltung eines Kindes unzufrieden war.
Die Neugier und leichte Schadenfreude der Geschwister ließen dagegen Adolf gleichgültig; die konnte er ihnen eines Tages heimzahlen; aber das Schweigen der Mutter lag ihm so fühlbar auf, daß er eine Erleichterung empfand, als sie den Mund auftat. »Das will nun«, sagte sie, »unser Amerikaner sein und kann in der Frühe nicht zeitig zur Arbeit kommen. Der Vetter Goldgräber wird seine Freude an dir haben!«
Die Geschwister lächelten spöttisch zu diesen Worten, während der Getadelte mit dem Löffel im Habermus herumwerkte, als wolle er es worfeln statt abkühlen. Er war zu streng erzogen, um gegen die Mutter eine Erwiderung zu wagen; bei weiterem Tadel aber – und er rechnete damit – hoffte er Gelegenheit zu finden, schicklich einzuhaken.
»Bist wieder einem Traum nachgelaufen, alter Bibel-Josef, hm?« fragte die Mutter weiter.
Der Sohn erhob den Blick mit leichtem Lächeln und sah ihr frei in die Augen. »Ja, Mutter, einem Traum, und einem besonderen gar«, sagte er. »Wenn Ihr mir ihn nur deuten wolltet; aber Euch ist das ja Narrenkram.«
Er hatte das etwas trumpfend gesagt und lächelte jetzt nachsichtig gegen die Mutter, einer Erwiderung gewärtig; die Mutter aber schwieg. Sie blickte scharf vor sich hin aus dem strengen, kantigen Gesicht, unerbittlich wie eine Norne. Allmählich milderte sich ihre Miene, und sie saß nachsinnend. Es schien ihr mit einmal ungerecht, daß sie den Sohn als Träumer nahm, nur weil er die Gebilde seines Schlafes offen hinzulegen pflegte. Sonst griff er doch wach und entschlossen zu, wo er’s am Platze oder notwendig fand. Dann entsann sie sich auch einiger Begebnisse: Da hatten sich seine Träume zum Teil merkwürdig erwahrt, und sie hatte sich wohl geäußert, man möchte sie als erfüllt hinnehmen, wenn nicht alles doch nur Zufall wäre. Und dieser Träumer wollte nun mutig anpacken und der Mühle in ihrer Bedrängnis Rettung schaffen? Rettung – ja – so Gott wollte!
Aus diesen Gedanken weckte der Mann sie, indem er spaßend zu Adolf sagte, er sollte seinen Wundertraum halt zum besten geben; er sehe ja, wie ernst die Mutter dreinschaue, dieweil sie doch so gerne was zu lachen hätte.
»Will’s der Himmel, ist es zum Lachen!« warf Frau Line ein und sah auf den Sohn, ob er beginne. Aber diesem schien plötzlich der Traum zu ernst, als daß er ihn zum Spott Mutter und Geschwistern preisgeben durfte; und wen anders rührte der auch als ihn? Denn er konnte ihm das Ziel verrücken, fiel ihm ein.
Er verstockte sich aufs neue und fühlte sich verletzt, als jetzt der Vater, der sich sonst um die Auswanderung nicht aufregte, ihn wiederum anbohrte. Warum er denn seine Sache auf einmal so kostspielig mache, nachdem er allen den Wunderfitz gewetzt habe? »Die Mutter brennt ja auf dein Geheimnis«, fügte er hinzu.
Adolf forschte im Gesicht der Mutter; er sah darin Unmut und Vorwurf, und sie dauerte ihn.
»Dann kann ich’s ja sagen«, versetzte er widerstrebend, und begann zu erzählen, scheu, als müsse er eine Schuld beichten.
»Ja – das ist mir merkwürdig vorgekommen«, stakste er heraus, – »und ich kann nichts damit anfangen.«
In einem wildfremden Land sei er bei einem Hüttendorf an einem starklaufenden Bach gegangen und habe von fern den Vetter Donat erkennen können, mit einem Pickel auf der Achsel gleich dem Goldgräber auf Vetter Dorys Siegelring; aber plötzlich sei ein Fremder aus ihm geworden. Einer mit einem mächtigen Schlapphut auf dem Kopf und einem feuerroten Stoffgürtel um den Leib; dazu habe er einen Spitzbart gehabt, wie des Schmiedkobels droben im Dorf. Der Mann habe jetzt einen Brief aus der Tasche gezogen und eine Zeitlang gesonnen, ob er ihn lese, und als er das dann getan, das Papier in kleinen Fetzen im Bach wegschwimmen lassen. Darauf sei ihm der Mann drüben entgegengewandert und habe im Vorbeigehen mit der Rechten gefuchtelt, als wolle er ihm abwinken; der Bach sei in ein dünnes Wiesenwässerlein verschrumpft, der Fremde verschwunden, er aber auf die Suche nach Donat gegangen. »Und daran«, so schloß der Erzählende, »bin ich im hellen Morgen aufgewacht.«
Er hielt den Blick der Mutter zugewandt, ob sie ihm Bescheid gebe; sie schwieg indes.
»Und jetzt, Mutter: Meint Ihr nicht, das sei der Mann gewesen«, fragte er, »der beim Vetter Teilhaber werden möchte, und der will ihn nicht, schreibt er?«
Zuerst erschreckte diese Meinung die Mutter; sie verwies sie ihm denn auch: »Geh mir, am hellen Morgen Geister sehen! Kein Wunder freilich, daß dir solches Zeug im Hirn aufstößt, wo du bloß noch Gold und Amerika sinnst!«
Adolf wagte keinen Einwand mehr. »Was hast du nicht geschwiegen!« dachte er und erhob sich mit den andern und ging hinaus an die Arbeit. Von dem Traum war fürder nimmer die Rede; dem jungen Menschen aber ging er nach, und er besann ihn ernster, als er ihm zuweilen gut scheinen wollte.
Die Zeit ging schneckenhaft dahin in der einsamen Mühle und die Arbeit bei so kargen Aufträgen einförmig. Da waren die sieben oder acht Wochen sehr lang seit jener morgendlichen Aussprache zwischen Mutter und Sohn, und dieser, der kaum noch halb in das verlorene Tal gehörte, fand Muße, über seine Zukunft zu brüten. So stand er einmal wieder wie öfters am brüchigen Holzgeländer der kurzen Metma-Brücke vor der stilliegenden, zerfallenden Sägemühle und schaute in die Wirbel und kleinen Strudel des Bachs, wie sie immer gleichmäßig um die Steinblöcke gurgelten und dann im Schattendunkel des Tannentales verschwanden. Dem jungen Menschen tat das kräftige, rastlose Wasser leid; es reute ihn, weil es kaum halb beschäftigt unter der Mühle und völlig brach unter dem Rad des Sägewerkes wegfloß und den Menschen verächtlich den Rücken kehrte, die ihm keine Arbeit mehr boten. Geschlechterlang hatte es unermüdlich die Insassen der beiden Werke bedient und ernährt, und nun stand einer da und besann diese traurigen Dinge und war der erste, der dem getreuen Wasser nachlaufen und in der Hauptströmung, darin es unterging, rheinab fahren sollte, dem Meer zu, wohinter ein fremdes Land den Söhnen eines verarmenden Wäldertals das tägliche Brot und Fortkommen geben mußte. Ungerufen fiel ihm darob Kalifornien ein und der Vetter dort, der ihm eine Rettung sein wollte; auch daß dieser nach so vielen Wochen jetzt den letzten Bescheid aus der Lochmühle in Händen haben und wohl gar den eignen, wenn er rasch geantwortet, nahe am Metma-Tal vermuten konnte.
Da drang in sein Nachsinnen scharf die Stimme der Mutter: »Adolf, geh schaffen; träumst du wieder?«
Der Getadelte folgte. Unter der Haustür blieb er einen Augenblick stehen und wandte ohne besondere Absicht den Blick nach der Straße zurück, die sich links hinauf merklich steil in die Tannen wandte und verschwand. Da sah er es zwei-, dreimal rot zwischen den Stämmen schimmern und wieder verschwinden; kurz hernach aber bemerkte er einen dunkelgekleideten Menschen mit großem Schlapphut und brandrotem Gürtel aus dem Wald treten und staunte überrascht, ja erschrak und wandte sich schnell in den Hausflur.
»Mutter, weidlich!« rief er erregt: »Schaut hin, er kommt.« So eilig wie der Rufer hatte es die Gerufene nicht. Sie trat gemächlich aus der Küche, trocknete die Hände an der Schürze und fragte: »Was schreckst du einen! Siehst wieder Geister? Wer soll’s denn sein?«
»Schaut nur!« sagte Adolf außer Atem und nahm die Mutter bei der Hand. Aus meinem Traum – der Mann.«
Sie standen unter der Haustür. Der Fremde kam langsam auf die Mühle zu, mit forschendem Blick auf die beiden, die ihm als Unverhofftem neugierig entgegenstarrten. Er trug eine rote Tuchbinde als Gürtel, einen vertragenen dunklen Samtanzug und einen großen Schlapphut; als Adolf aber gar den Spitzbart gewahrte, befiel ihn ein leiser Schauder, und er flüsterte der Mutter zu: »Er ist’s!«
Der Fremde war herangekommen. Er brachte nachlässig zwei Finger der Rechten an den Hut und fragte, ob er richtig des Weges und das die Lochmühle sei.
Die Müllerin nickte schweigend; der Fremde schien etwas unsicher zu werden und nach schicklichen Worten zu suchen; darüber befiel aber Adolf der Eifer.
»Ihr kommt vom Vetter Donat, Herr?« fragte er überstürzt. Die Mutter verwies ihm’s; der Fremde aber sah verwundert drein; dann lächelte er leicht. »Wenn der junge Herr der Vetter Adolf ist« – sagte er forschend.
»Es ist mein Sohn, Herr, und Donat mein Bruder«, meinte die Müllerin ruhig. »Kommt Ihr von ihm?«
Der Mann zögerte. »Ich bin mit ihm zusammengekommen, und er sagte mir, einer seiner Verwandten wolle hinüber. Ich habe euch Grüße zu sagen«, fuhr er dann stockend fort, als überlege er alles erst.
»Brief hat er Euch – « fragte Adolf hastig; aber die Mutter hieß ihn schweigen; dann nahm sie selber die Frage auf: »Zwar ja – Brief hat er Euch keinen mitgegeben?«
Der Fremde verneinte. Er sei drüben überraschend weggereist und der Vetter gerade sehr beschäftigt gewesen, sagte er.
Die Müllerin bat den Fremden in die Stube, gab Adolf einen Wink und kam dann, als Apfelmost und Kirschwasser zum Rauchfleisch vor dem Gast standen und sie ihn zuzugreifen gebeten, wieder aufs Kalifornische.