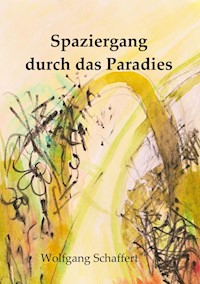
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Woher haben wir das Wissen aus dem Paradies von Gut und Böse? Ausgehend von der biblischen Erzählung Moses 1 bis 3 und punktuell 4- 6 wird die Schöpfungsgeschichte im Spaziergang erforscht: Anhand der Überschriften gehen wir verschiedene Stationen mit einzelnen Themen ab: Wie Adam und Eva ihr Wissen erwerben und damit die Grundlage für die intellektuelle Entwicklung der Menschheit legen, das sich alles um den Baum der Erkenntnis dreht oder das uns das Wissen über Sinn und Unsinn schon in die Wiege gelegt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
„Was gut, sinnvoll und gerecht ist, können wir erst erkennen, wenn wir wissen, was schlecht, was falsch und ungerecht ist. Wir müssen erst wieder an diese Zusammenhänge erinnert werden“
Wolfgang Schaffert
Ein vergnüglicher Gang durch die ersten sieben Abschnitte des 1. Buches Mose, besonders durch die darin enthaltene Erzählung vom Paradies
Die Stationen auf dem Weg
Einladung zum Spaziergang
Zu 1. Das Licht der Schöpfung
Die ersten Sätze
Zwei große Lichter
Freude
Zu 2: Das Paradies
Der Garten Eden
‚
Vor der Tür deines Herzens‘
Das Raubtier der Sünde
Ein Experiment
Die Szene unter dem Baum
Der Alltag im Paradies
Der Schlang
Der Baum der Erkenntnis
Zu 3: Das Erbe aus dem Paradies
Das Gute, das Böse
Wilhelm Busch, „Die Fromme Helene“
Virtus, die Tugend
Der Abend im Paradies
Die „verbotenen Früchte“
Die Gebote Gottes
Das Bild vom eifersüchtigen Gott
>Du sollst verflucht sein<
Über die Herkunft der Gewalt
Disteln und Domen
Das Feigenblatt
Eva
Röcke aus Fellen
Das Flammenschwert
Das Paradies der Kindheit
Zu 4: Die Brüder Kain und Abel
Rückblick auf das Paradies
Ungleiche Chancen
Das Opfer
Kränkung
Chimären und Fratzen
Fatalismus
Trotz
„Wo ist dein Bruder Abel?“
Das Mal auf der Stirn
Lamech
Das Auge Gottes
Zu 5: Die große Flut
Der Zimmermann Noah
Die rohe Naturgewalt
Die Arche
>Es wäre besser gewesen ...<
Der Bund
Der Bogen in den Wolken
Zu 6: Kunstgeschichtlicher Ausflug
Begegnung mit Werken der Bildhauer um 1500
Evas Lächeln (Adam Kraft u.a.)
Das Narrenschiff (Jürgen Weber)
Der Engelsgruß (Veit Stoß)
„ein unruwig haylosser burger“
Der angebissene Apfel
Fazit
Literarische Wegbegleiter
Einladung zum Spaziergang
Woher stammt das Wissen, das in der Erzählung vom Paradies eine so große Rolle spielt? Und das so viel Unmut und Ärger mit sich bringt?
Dieser Frage wollen wir einmal nachgehen. Wir machen dabei einen Ausflug in die sehr frühe Geschichte des Denkens, der menschlichen Intelligenz im allgemeinen, auch seiner Klugheit in praktischen Dingen. Denn die Erkenntnis von gut und böse macht klug, wie es im biblischen Text heißt. Kurz gesagt geht es darum, dass dieses Wissen schon vor der Aufzeichnung dieser Texte verbreitet sein muss, nicht nur in gebildeten Schichten. Das geht schon daraus hervor, dass die Bilder und Symbole, mit denen der Erwerb der Erkenntnis im Paradies angedeutet wird, sehr weit zurückgehen und durch eine lange Erzähltradition überliefert sind, bis sie schließlich aufgezeichnet worden sind. Sonst hätten die Menschen der Zeit nicht verstanden, worum es geht: Warum zum Beispiel die Frucht des Baumes zunächst unter Vorbehalt gestellt; weshalb es ein vorerst zurückgehaltenes, dann sogar verbotenes Wissen ist. Da es aber kein besonders gut behütetes Geheimnis darstellt, kann es schließlich vom Mensch erworben werden. Der „Baum der Erkenntnis“ und seine Frucht stehen so im Mittelpunkt der Paradiesgeschichte, nicht nur geografisch, sondern auch inhaltlich und symbolisch. Denn es geht um den Erwerb dieses Wissens, die Bedingungen dabei und die Folgen.
Was das Gute und was das Böse ist, glaubt heute beinahe jeder zu wissen. Aber seit wann genau haben wir das erkannt, und wie sind wir im Einzelnen dazu gekommen? Adam, der erste Mensch, weiß das, seitdem Gott im Paradies davon spricht. Es ist aber, obwohl von Gott vorgetragen, ein durchaus menschliches Wissen. Genau besehen macht es den Menschen erst zu dem, was er ist. Adam ist der erste Mensch, das heißt, er ist jemand, der diese Bezeichnung auch verdient hat. Eben dieses Prädikat steht auch Eva zu, beide werden unter dem Baum zusammengeführt. Gott aber steht nach allgemeiner Übereinkunft jenseits von gut und böse oder auch „darüber“, wie wir sagen. Er unterliegt auch nicht den Lebensbedingungen wie wir „auf der Erde“, auch nicht den Begrenzungen von Raum und Zeit wie wir Menschen.
Die Wesensverschiedenheit von Mensch und Gott zu akzeptieren fällt vielen bis heute schwer. Sie ist aber damit zu begründen, was wir den Faktor Zeit nennen. Dieser ist für Gott irrelevant aus Gründen, die nicht zur Entscheidung anstehen. Die Unabhängigkeit von der Zeit lässt sich schon aus dem Ersten Buch Mose, 1. Kapitel ableiten, wo von der Entstehung der Welt einschließlich des Paradiesgartens die Rede ist. Damit befassen wir uns im ersten Abschnitt des Spaziergangs unter der Überschrift: Das Licht der Schöpfung. Ursprünglich kommt die Schöpfung ohne zeitliche Vorgabe zustande. Der Zeitbegriff, die Vorstellung von den sechs Tagen, wird vielmehr durch den Berichterstatter hinzugefügt, der nicht mit seinem Namen genannt ist. Dadurch wird der Anschein erweckt, als sei er als Augenzeuge dabei und sozusagen vor Ort gewesen. Das kommt unseren Vorstellungen und unserem Verständnis sehr entgegen, weil wir den Faktor Zeit benötigen, um solche Vorgänge besser zu verstehen. Sie werden auch deshalb anschaulich vorstellbar, weil sie sich an der Naturerscheinung orientieren, dem Wechsel der Tageszeiten nach dem Stand der Sonne. Sechsmal wird der Satz wiederholt: „Es wurde Abend und wieder Morgen: ...“, sechsmal bricht sozusagen ein neuer Tag an. So wird das Vergehen der Zeit und damit der zeitliche Aufwand, verdeutlicht, ein Zugeständnis an den menschlichen Verstand.
Allerdings findet die zeitliche Einordnung des Geschehens nach Abschluss des Schöpfungsberichts keine Fortsetzung. Obwohl es auch im Paradies und danach den rhythmischen Abstand von „Abend und wieder Morgen“ geben muss, werden die Tage hier nicht gezählt, und auch die klimatischen Veränderungen durch den Wechsel der Jahreszeiten werden nur am Rande erwähnt. Hier setzt nun unser „Spaziergang“ an. Der Grundgedanke dabei ist, der Paradieserzählung eine zeitliche Struktur zu unterlegen und dadurch etwas zu ergänzen, was im Originaltext fehlt. Den Mut und den Antrieb dazu übernehme ich von den Vätern der biblischen Schriften selbst, die etwas Ähnliches tun, als sie dem zeit- und raumübergreifenden Werk der Schöpfung das Korsett der sechs aufeinanderfolgenden Tage anlegen. Welcher Maßstab der Zeitmessung wird hier bei der Vorstellung der Tage angewandt? Wieviele Tage, Wochen oder vielleicht Jahre hat andererseits das Menschenpaar tatsächlich im Paradies verbracht? Möglicherweise lässt sich die Dauer des Aufenthaltes dort gar nicht nach einem heute üblichen Zeitmaß angeben, und vielleicht ist das auch gar nicht erforderlich.
Bei dem Spaziergang, den wir vorhaben, gehen wir nun folgendermaßen vor:
Wir nehmen einzelne Handlungsschritte aus der Paradieserzählung und aus den darauf folgenden Abschnitten der Genesis heraus, die dann sozusagen zu Stationen des Spaziergangs werden. Als solche erhalten sie jeweils eine thematische Überschrift, aus der die gedankliche Verknüpfung hervorgeht. Diese Stationen verbinden wir außerdem durch eine fiktive Datierung. Diese besteht aus unterschiedlichen Wochentagen, die in unregelmäßigen Abständen aufeinander folgen und mit einem Datum versehen sind, allerdings ohne die Angabe des Jahres nach dem heute gebräuchlichen Kalender. Um das zu erläutern: der 20. Oktober ist ein Dienstag, das aber zufällig nur in diesem Jahr 2020. Diese Einschränkung wird aber nun weggelassen, sodass die Station des Spaziergangs die Kennzeichnung trägt: Dienstag, 20.10. Das ist nur ein Beispiel, die Übereinstimmung mit einem bestimmten Jahrgang wäre rein zufällig, auch wenn sie vielleicht häufiger vorkommt, als man denken möchte. Der Vorteil liegt jedoch darin, dass wir durch diese Form der Datierung ein übertragbares Modell des zeitlichen Verlaufs erhalten, das auch rückwirkend anwendbar ist, auch bis in die Anfänge der Zählung der Tage nach dem Kalender und auch im Zeitraum davor, als es noch keinen Kalender gab und man noch keine Namen beziehungsweise Ziffern für die Monate des Jahres kannte; also die Zeit, in der, wie wir heute wissen, die biblischen Erzählungen entstanden sind und als es in wiederkehrender Folge heißt: „es wurde Abend und wieder Morgen“.
Als Zeiteinheit hat die Summe der Tage, die wir aus Gewohnheit mit einem Monatsnamen benennen, ja schon immer bestanden, sie hatte nur noch keine Bezeichnung und damit keine Abgrenzung, wie wir das in der 7 - Tage Woche und den Monaten mit begrenzter Tageszahl kennen. Den Dienstag, 20.10. hat es als Zeiteinheit möglicherweise schon mehrfach gegeben, ausschließen lässt sich das nicht. Zuletzt traf das im gegenwärtigen Jahr 2020 zu. Aber das ist eben auch ein Zufall.
Diese modellartige Kombination von Wochentag und Datum ohne Jahresangabe hat aber nur bei dem vorliegenden Projekt des Spaziergangs Gültigkeit, für den es ursprünglich auch gedacht ist. Das Verständnis wird dadurch erleichtert, weil das gedankliche Fortschreiten auch durch die zeitliche Orientierung unterstützt wird, übrigens auch bei der Aufzeichnung beziehungsweise der Überarbeitung früherer Entwürfe in der jetzigen Fassung des Spaziergangs. Zuletzt war das in den Jahren 2018/19 der Fall, von denen ich auch die Datierung übernommen habe. Wer einen Spaziergang macht, will Abstand gewinnen. Vor allem sollte stets ein Zeitfenster vorhanden sein, ein Vorrat an Zeit. Man geht spazieren, wenn man Zeit und Muße hat, wie man sagt. Das bedeutet, ein Spaziergang erlaubt einen kreativen Umgang mit der Zeit. Auch deshalb bietet sich das Paradies als Ausgangspunkt an, weil es eine angenehme Landschaft und zunächst relativ bequeme Wege bietet. Etwas mühsamer und unwegsamer wird es erst, wenn das Ende des Aufenthalts der Menschen im Paradies ansteht und weil sich zugleich die Wetterlage und damit die Atmosphäre gravierend ändern.
Dennoch wollen wir aber den Spaziergang fortsetzen, auch wenn das Gelände etwas schwieriger wird und es gelegentlich etwas steilere Anstiege und steinige Übergänge gibt. Insgesamt ist es aber kein ungesichertes Gelände, das wir begehen, auch dann nicht, wenn wir die Generationen einbeziehen, die auf Adam und Eva folgen. Einen Spaziergang macht man gerne in Gesellschaft. Deshalb ist dies auch eine Einladung an den Leser und die Leserin! Sie dürfen dabei sein, wenn die Menschen die ersten Schritte im Paradies und aus dem Paradies heraus machen, gerade wenn Sie sich der jüngeren Generation zurechnen oder auch in fortgeschrittenem Alter noch jung genug geblieben sind, sich auf ein derartiges Abenteuer einzulassen.
Bei einem Spaziergang geht es schließlich auch um Bewegung an der frischen Luft.
Die Stationen auf dem Weg
1. Das Licht der Schöpfung
2. Das Paradies
3. Das Erbe aus dem Paradies (Das Feigenblatt, Der Ausgang aus dem Garten, Zorn, Trauer, Klage)
4. Die Brüder Kain und Abel
5. Die große Flut
6. Kunstgeschichtlicher Ausflug: Begegnung mit ausgewählten Werken der Bildhauer um 1500
BILD: Eva am Portal der Lorenzkirche, Nürnberg
1. Das Licht der Schöpfung
Die ersten Sätze
(Sonntag, 21.10.)
Die Lektüre der etwa 2 1/2 bis 3 Tausend Jahre alten Texte des Alten Testaments war immer schon ein spannendes Abenteuer und ist es auch heute noch. Diese Texte, meistens Erzählungen, die von Berichten unterbrochen werden, auch dialogartigen Redeteilen, haben in der langen Zeitstrecke ihrer Überlieferung nicht an Brisanz, auch nicht an Sprengkraft eingebüßt, bis heute nicht. Sie sind zeitübergreifend, wie man heute sagt, unabhängig von der Zeit, in der wir leben. Damit ist gemeint, dass sie dem Ablauf der Zeit von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, dem die Menschen unterliegen, enthoben und gewissermaßen herausgenommen sind. Sie unterliegen auch nicht irgendeiner Form von Datierung.
Das lässt sich bereits für die ersten Sätze des Schöpfungsberichtes, das Eingangskapitel im 1. Buch Mose behaupten. Hier werden natürliche Erscheinungen wie der Tagesanbruch, der Wechsel von Tag und Nacht, der 'Lauf' der Gestirne, das Pflanzenwachstum, die Lebewesen in der Luft, im Wasser und auf dem Land beschrieben; sodass ein Gesamtbild der Schöpfung entsteht, zunächst ganz ohne zeitliche oder räumliche Zuordnung. Die Abstraktion von der Zeit ist in der Tat das auffälligste Merkmal des Gottesbegriffs in der biblischen Erzählung. Es ist auch der Grund, weshalb wir uns so schwer in Ablauf und Begriff der Schöpfung hineinversetzen können. Der menschliche Verstand benötigt diese Kategorie, um sich zurechtzufinden. Dass etwas außerhalb der Zeit existiert, ist ebenso schwierig zu begreifen wie die Aussage, dass etwas ohne die Dimension der Zeit zustande gekommen sein könnte. Die Verfasser dieses Textes, der Genesis, scheinen diesen Umstand zu berücksichtigen, indem sie das Geschehen in die Zeit zurückholen, einem Zeitplan von 6 Schöpfungstagen unterordnen und somit die erforderliche Orientierung geben.
Der Ausdruck Genesis besagt ja, dass etwas aus einem Ursprung zum Entstehen kommt, der aber durch die natürlichen Bedingungen gegeben ist. Auch die eindrucksvollen Worte am Anfang dieses Berichts:
>Es werde Licht<
können in dieser Hinsicht interpretiert werden. Denn es beginnt mit diesem Satz etwas, was in der natürlichen Ordnung der Dinge begründet ist: das Tageslicht und damit der Tag. Man kann einmal den täglichen Sonnenaufgang unter diesem Aspekt verfolgen, um die Wucht dieses durch den umgangssprachlichen Gebrauch etwas abgeflachten Satzes zu erfahren. Dieser Satz, die Ur-Worte Gottes im Bibeltext, bezieht seine kreative Energie aus der bestimmenden Verbform von 'werden' sowie aus der Kürze des Ausdrucks. Die Formulierung in der Übersetzung Luthers, bis heute gängig und gebräuchlich, verbreitet eine ganz eigentümliche Aura. Gott tritt aus einer räumlich und zeitlich nicht näher bestimmten Umgebung hervor - der Unendlichkeit, wie man auch sagt - und spricht diesen Satz in einer Sprache, die den Wortschatz und den Stil der Schöpfung geprägt hat. Man kann sich vorstellen, dass diese Worte mit erhobener Stimme und sehr betonter Lautbildung gesprochen werden. Denn es sind die ersten Worte, die Gott spricht. Wer sie einmal gehört hat, wird sie nicht mehr vergessen. Er wird aus seinem Gedächtnis auch die Fortsetzung hinzufügen.
Diese Weiterführung:
„... und es ward Licht“
ist jedoch nicht in dem Redeteil einbezogen, der Gott zugeschrieben ist. Es ist vielmehr eine Ergänzung in berichtender Form, ohne dass ein Verfasser dafür angegeben wird. Wir können in diesem Zusatz eine Beglaubigung sehen, die hier am Beginn der biblischen Schriften für notwendig empfunden wird. Das unvermutete und unvermittelte Hervortreten Gottes muss irgendwie erklärt werden, sonst stellt es den Menschen vor unüberwindbare Schwierigkeiten. Das wird durch den Zusatz, die Bestätigung oder Ergänzung mit der abgeänderten Verbform geleistet. Das 'werde' des Originals wird durch die Vergangenheitsform 'ward' ersetzt. Dadurch wird quasi die zeitliche Dimension ergänzt, die in dem von Gott gesprochenen Original fehlt. Es sieht in der Tat so aus, als werde zweimal fast dasselbe gesagt. Dennoch liegen Welten zwischen diesen beiden Aussagen, weil die Einstellung zur Zeit sehr unterschiedlich ist, auch die Aussage, die in der Zeitform des Verbs liegt.
Für Gott ist weder der Anfang noch das Ende wesensbestimmend, auch nicht die Zeitdauer und die Zeitstufe, die den Abschluss eines Ereignisses angibt: die Vergangenheit.
Zwei große Lichter
(Donnerstag, 25.10.)
Bei der Himmelsbeobachtung, der Bewegung der Gestirne etc. scheinen sich die Berichterstatter des Schöpfungsgeschehens mehr auf den Augenschein zu verlassen sowie auf die Folgerungen, die sich davon ableiten lassen. Oberflächlich betrachtet geht es an diesem vierten Tag um die Möglichkeit der Orientierung bei wechselnden Konstellationen der Gestirne, von Sonne und Mond, die mit Namen genannt werden und die eine konkrete Funktion für die zukünftigen Bewohner der Erde haben:
"Er (Gott) machte zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu auch alle Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht geben, über Tag und Nacht herrschen und Licht und Finsternis trennen." (M.1,17-18)
Was hier auffällt, ist das Bemühen, das Wirken Gottes für die menschlichen Vorstellungen begreiflich zu machen und dabei die alltäglichen Beobachtungen aus der menschlichen Perspektive zu berücksichtigen: das Anbrechen und das Vergehen des Tages beziehungsweise der Nacht, die regelmäßige Abfolge von Tag und Nacht, die nur am Nachthimmel sichtbaren Sterne.
Die Aussage, dass Gott die Gestirne an das Himmelsgewölbe „setzte“, ist eine einzigartige sprachliche Geste. Sie wird aber zum Beispiel schon durch den Augenschein und durch den Sprachgebrauch bestätigt: Die Sonne/ der Mond „steht“ am Himmel, sie/ er „geht auf“, der Mond „wandert“ oder „geht stille“ durch den Nachthimmel, der Morgen „vertreibt“ die Nacht. Es ist dann auch nicht ungewöhnlich, wenn davon gesprochen wird, dass Licht und Finsternis „getrennt“ werden. Diese Sprachfigur, die bereits zu Beginn des biblischen Schöpfungsberichts zum ersten Mal auftritt, ist ein erstes Beispiel für das komplexe oder übergreifende Denken in der Entstehungszeit dieser Texte. Gott
„< trennte das Licht von der Finsternis“ (M.1,2.)
Auch dabei können wir an die Abfolge von Tag und Nacht denken, wie wir diese aus der täglichen Erfahrung kennen. Es kann nicht zugleich hell und dunkel sein. Das sagt und die Erfahrung, die mit dem Fortschreiten der Zeit rechnet. Wenn wir aber die zeitliche Orientierung außer Acht lassen, rücken Licht und Schatten ganz nahe zusammen wie zwei ungleiche Geschwister, unterschiedlich ausgestattet, aber dennoch miteinander verbunden.
Eine ähnliche Paarung beschäftigt uns im weiteren Verlauf des Spaziergangs insbesondere auch bei der biblischen Erkenntnis. Gut und böse sind in ihrer allgemeinen Bedeutung einander entgegengesetzt. In der biblischen Erzählung stehen sie nebeneinander wie zwei zerstrittene Brüder, nur mit „und“ voneinander getrennt. Aber in der „Erkenntnis“ werden sie miteinander verknüpft, sodass eines aus dem anderen hervorgeht – wie das Licht aus der Finsternis.
Wenn wir diese Verknüpfung im Auge behalten, werden wir den Schöpfungsbericht insgesamt besser verstehen und nachvollziehen können, worum es bei der „Erkenntnis von gut und böse“ geht.
Der Begriff der Schöpfung beinhaltet auch das, was auf natürliche Weise entsteht. Das Wort ´Schöpfung` selbst ist symbolisch verwendet, weil etwas zum Entstehen kommt, was in der Natur der Dinge oder in der Natur selbst liegt. Auf dieser symbolischen Ebene können wir auch die übrigen Ereignisse der Schöpfung einordnen, bei denen es heißt, dass Gott etwas zuließ, veranlasste oder ´machte`. Am zweiten und dritten wird die Landgewinnung durch natürliche Entwässerung beschrieben sowie die Wolkendecke, die sich durch Verdunstung des Wassers über der Erde bildet:
„Gott machte ein Gewölbe und trennte das Wasser über dem Gewölbe von dem Wasser, das die Erde bedeckte <. Dann befahl Gott: >Das Wasser auf der Erde soll sich sammeln, damit das Land sichtbar wird< < Ernannte das Land Erde, das Wasser nannte er Meer.“ (M.1, 8-10)
Dieser Teilbericht, der der Ansammlung des Wassers im Meer und der Bildung von Regenwolken in der Atmosphäre gilt, kann auch durch die Einwirkung der Sonnenenergie erklärt werden. Diesen natürlichen Vorgängen liegen Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die wir heute mit dem Vokabular der Physik beziehungsweise der Meteorologie beschreiben. Der wolkenverhangene Himmel und die damit verbundene Erwartung von Niederschlägen, das gehört zur beinahe alltäglichen Erfahrung. Als am dritten Tag die natürliche Vegetation zur Sprache kommt, sagt Gott:
>Die Erde soll grün werden, alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen darauf wachsen und Samen und Früchte tragen! << (M.1,12)
Das Wachstum sowie der Hinweis auf den Samen und die Frucht sind Ausdruck für das Hervorbringen oder Entstehen in oder durch die Natur. Auch wenn hier noch nicht das Werden und Vergehen thematisiert wird, so ist das Geschehen durchaus natürlich, da es sich um Kräfte handelt, die in der Natur liegen.
Wort und Begriff der Schöpfung werden oft in der Weise missverstanden, so als sei diese ohne die natürlichen Voraussetzungen geschaffen und sozusagen aus dem Nichts hervorgebracht. Als sich im Gefolge der Ideen von Charles Darwin viele Naturforscher von Gott abwandten, so geschah das möglicherweise aufgrund dieses Missverständnisses. Gott sieht die Wege der Natur voraus und bezieht sie in vielfacher Hinsicht in seine Schöpfung ein. Der Mensch spielt dabei vorerst keine Rolle, da er ja erst ganz zuletzt auf dem Schauplatz auftritt. Aber er wird darin einbezogen, sobald er seine natürlichen Anlagen und Fähigkeiten entwickelt. Gott baut nicht etwa Dämme oder Kanäle, um das Wasser von der Erde abzuleiten und Land zu gewinnen. Diese Aufgabe überlässt er der Natur, die durch Bäche und Flüsse für die Entwässerung sorgt. Gott ist auch kein Schneidermeister, als er von "Kleidern aus Fellen" spricht, die anzufertigen sind. Er sieht aber voraus, dass diese Form der Bekleidung einmal notwendig sein wird, wenn sich die klimatischen Bedingungen verändern. Das Anfertigen überlässt er den Menschen, ebenso wie sie Staudämme und Kanäle anlegen beziehungsweise bestehende Anlagen verbessern, Bäume pflanzen und Haustiere halten werden, um sich zu versorgen. Sie müssen nur die Notwendigkeit dazu erkennen und in eine Situation gebracht werden, in der das Bedürfnis entsteht, sich zum Beispiel durch Kleidung zu schützen. Solche Hinweise gehören zu den Botschaften des biblischen Berichts.
Die Schöpfung dient der Erhaltung des vielfältigen Lebens, der Fauna und Flora, die die Grundlage für die Ernährung bilden. Gott plant voraus, was für den Fortbestand und die Entwicklung des Lebens notwendig ist.
Freude
(Sonntag, 28.10.)
Freude ist eine vorwiegend menschliche Regung des Gemüts. Sie hat etwas Verbindendes und kann Gegensätze aussöhnen. Schiller nennt sie in seiner "Ode an die Freude" (entstanden 1785) einen "Götterfunken" und betont damit den göttlichen Ursprung. Beethoven übernimmt die Formulierung im Schlusssatz seiner 'Neunten'. Auch die Verfasser des biblischen Textes legen diese Bedeutung nahe, denn sie bestehen darauf, dass Gott nach abgeschlossener 'Arbeit' Freude zeigt. Das erinnert uns erneut an das Bemühen, die Distanz zwischen Gott und den Menschen zu überbrücken.
"Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte, und er hatte Freude daran: alles war sehr gut." (M.1,31)
Solche Aussagen dienen dazu, die Schöpfergestalt ganz nahe an das menschliche Empfinden heranzubringen. Freude verbindet man mit einem gelungenen Werkstück oder einer erfolgreichen Unternehmung. Gott erscheint uns in dieser Vergleichssituation als der Künstler, der etwas geschaffen hat, was ihn in hohem Maße zufrieden stellt einen unübertroffenen Wert besitzt.
Die Freude, von der der biblische Text hier spricht, ist allerdings nicht mit dem emotionalen Zustand zu vergleichen, den man mit anderen Menschen über einen Erfolg teilt. Wir sollten hier einen Unterschied machen. Wenn Gott Freude zum Ausdruck bringt, deutet das nicht in erster Linie auf eine heiter gestimmte Gemütsart, auch fehlt das Element der Berauschung, wie dies in Schillers Ode "An die Freude" anzutreffen ist. („wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum …“). Die Freude, die Gott zugeschrieben wird, ist nüchterner, eher verhalten, reserviert und abwartend. Denn die Elemente und Kräfte der Natur, die in der Schöpfung angelegt sind, können sich auch anders entwickeln als ursprünglich geplant. Sie können Zerstörung, Untergang und Tod bringen, wie das später durch die 'große Flut' demonstriert wird.
Die Aussage "< alles war sehr gut" stellt ein Werturteil dar. Eine derartige Bewertung kann nur getroffen werden, wenn auch das Gegenteil bereits bekannt ist, die unbarmherzige und tödliche Gewalt des Sturms kennt, der alles Leben auslöscht. Der Mensch braucht diese Gegensätze, und weil sie unvermeidbar sind, werden sie im biblischen Text entsprechend behandelt. Das Gute können wir uns erst vorstellen, wenn wir vom Bösen wissen und darüber belehrt werden. Deshalb ist die Abfolge der Texte in der Genesis so gewählt, dass zuerst von der Schöpfung berichtet wird, bei der alles zum Besten geordnet ist. Dann aber spricht der Text in schneller Folge von den Verfehlungen der Menschen und von den Härten und Katastrophen des Lebens in und mit der Natur.
Was das Gute ist, wird also erst im Rückschluss deutlich, weil wir das Schlechte so nachhaltig in Erinnerung behalten. Gott aber weiß davon im gleichen Augenblick, in dem er Freude über das gelungene Schöpfungswerk empfindet. Wir sollten Gott das zutrauen, da er ja die Vorgänge ohne die Bindung an den zeitlichen Verlauf vorhersehen kann. Der biblische Bericht versucht hier, entgegengesetzte Vorstellungen unter einen Hut zu bringen, insbesondere den Begriff der Zeitlosigkeit, der uns Probleme bereitet. Der Schöpfungsbericht hat Gott selbst in die Zeit und damit in die Geschichte eingeordnet. Gott ist nicht mehr in die Ferne gerückt, er zeigt sich in der Person des Schöpfers in der Nähe der Menschen und kümmert sich um ihre Bedürfnisse, obwohl er seinem Wesen nach außerhalb der Zeit steht und damit der menschlichen Ordnung entrückt ist. Er tritt aber hier aus der Anonymität der Zeitlosigkeit heraus und bleibt so nicht das absolut Unbegreifliche.





























