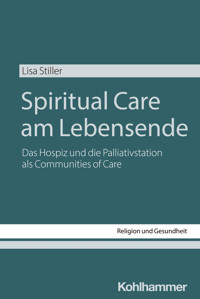
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Umgang mit Sterben und Tod hat sich verändert: von einer Gesellschaft, die den Tod verdrängt hat, zu einer, die wieder mit ihm umzugehen lernt. War das Sterben lange Zeit eine Angelegenheit, die primär Familie, FreundInnen und Nachbarn betraf und herausforderte, bestimmen gegenwärtig Professionalisierungs- und Institutionalisierungsprozesse die gesellschaftliche Entwicklung. Gestorben wird heute nicht nur im Krankenhaus und im Pflegeheim, sondern auch in Hospizen und auf Palliativstationen. Die Studie untersucht empirisch mithilfe leitfadengestützter ExpertInneninterviews, wie verschiedene Berufsgruppen in hospizlich-palliativen Einrichtungen spirituelle Sorge praktizieren. Dabei kommt die wachsende Professionalisierung genauso in den Blick, wie die Multidimensionalität der gelebten Sorgepraxis, die nicht nur von der Seelsorge, sondern ebenso von Pflegekräften, ÄrztInnen, TherapeutInnen und weiteren Professionen geleistet wird. Im Ergebnis ist der interprofessionelle Austausch ein entscheidender Schlüssel, die spirituellen Bedürfnisse der Kranken und Sterbenden zu verstehen und sie angemessen zu begleiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Religion und Gesundheit
Herausgegeben von
Dietrich Korsch und Cornelia Richter
In Zusammenarbeit mit Dorothee Arnold-Krüger, Franziska Geiser, Jochen Sautermeister und Verena Wetzstein
Band 5
Lisa Stiller
Spiritual Care am Lebensende
Das Hospiz und die Palliativstation als Communities of Care
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-046270-0
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-046271-7
epub: ISBN 978-3-17-046272-4
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Register
Vorwort
Bei der vorliegenden Monographie handelt es sich um meine im Sommersemester 2024 von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum angenommene Dissertation, die für die Publikation überarbeitet worden ist. Die mündliche Prüfung erfolgte am 15. Mai 2024.
Mein herzlicher Dank gilt an erster Stelle Prof. Dr. Isolde Karle, die dieses Dissertationsvorhaben angeregt hat und mich ermutigte, diese Arbeit anzugehen. Ihr Vertrauen, ihre beständige Begleitung und Motivation sowie ihre stets wohlwollend-konstruktive Kritik waren mir eine entscheidende Hilfe. Prof. Dr. Traugott Jähnichen danke ich für seine konstruktiven Anmerkungen und die Übernahme des Zweitgutachtens.
Solch eine Publikation entsteht immer im Austausch mit verschiedenen Personen. Ich danke dem Lehrstuhl für Praktische Theologie (Homiletik, Liturgik, Poimenik) und dem Institut für Religion und Gesellschaft der Ruhr-Universität Bochum. Dort konnte ich meine Ideen vortragen, offene Fragen benennen und Zweifel zur Diskussion stellen. Ich danke allen für ihre kritischen Nachfragen, für ihr aufmerksames Zuhören und für die engagierten Diskussionen, die mir oftmals ganz neue Perspektiven und Einsichten eröffneten. Mein besonderer Dank gilt PD Dr. Christine Siegl. Sie las meine Manuskripte Korrektur, hatte stets ein offenes Ohr, bestärkte mich in meinem Vorhaben und begleitete meine Forschung mit konstruktiven Anmerkungen. Danke schulde ich zudem dem Evangelischen Studienwerk Villigst, das meine Dissertation mit einem großzügigen Promotionsstipendium förderte. Insbesondere der interdisziplinäre Austausch innerhalb des Villigster Förderschwerpunkts »Dimensionen der Sorge« brachte mir oftmals überraschende Einsichten und erwies sich für meine Arbeit als sehr fruchtbar. Ich danke daher den Promovierenden und Betreuenden des Förderschwerpunkts für ihre Begleitung.
Diese Studie war von der Bereitschaft und Mitarbeit der Hauptamtlichen in Hospizen und auf Palliativstationen abhängig. Ich danke allen, die sich in diesem sensiblen Feld für ein Interview bereit erklärt und mir trotz zeitlich knapper Ressourcen ihre Zeit und Expertise zur Verfügung gestellt haben. Ihr Vertrauen und ihre Offenheit ermöglichten mir einen tiefen Einblick in die hospizlich-palliative Arbeit und in die spirituelle Begleitung der Betroffenen.
Abschließend gilt mein Dank den vielen Menschen aus meinem privaten Umfeld, die mir zugehört, mich immer unterstützt, meine Texte gelesen und mich ermutigt haben, an meinem Vorhaben festzuhalten.
Marl, im Februar 2025Dr. Lisa Stiller
1Einleitung
Der Umgang mit Sterben und Tod hat sich verändert: von einer Gesellschaft, die den Tod verdrängt hat, zu einer, die wieder mit ihm umzugehen lernt. Ein prominentes Beispiel für die Reaktivierung eines bewussten Umgangs mit Sterbenden und ihren besonderen Bedürfnissen ist die Spiritual Care. Die vorliegende Studie geht der Frage nach, wie spirituelle Sorge für Sterbende erfolgt und welche Deutungsschemata dabei leitend sind. Gegenwärtig befinden wir uns im Prozess einer Institutionalisierung des Sterbens und des Todes. Gestorben wird heutzutage vor allem im Krankenhaus und im Pflegeheim sowie in Hospizen und auf der Palliativstation, mithin nur noch zu einem kleinen Teil im häuslichen Umfeld. Da Hospize und Palliativstationen versuchen, sich weitestgehend den Bedürfnissen von Sterbenden anzupassen und möglichst optimal für sie zu sorgen, stehen sie im Zentrum der vorliegenden Studie.
Hand in Hand mit der Institutionalisierung geht eine immer stärkere Professionalisierung. Die Mitarbeitenden in den Hospizen und auf den Palliativstationen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Sterbende und ihre An- und Zugehörigen interprofessionell zu begleiten. Gerade im Kontext des Sterbens spielen unterschiedliche Professionen sowie die Frage nach der Zusammenarbeit in interprofessionellen Teams eine wichtige Rolle. Insbesondere die hospizlich-palliativen Institutionen bemühen sich um eine ›ganzheitliche‹ Versorgung der Betroffenen. Zudem zeigt »die medizinische Sterbebegleitung zunehmend an Fragen von subjektiver Lebensqualität Interesse«[1]. Dementsprechend stehen nicht mehr nur medizinische, pflegerische oder soziale Aspekte im Mittelpunkt, sondern auch spirituelle Themen und Fragestellungen. Spiritual Care schließt als ein Konzept, das ganzheitlich ausgerichtet ist, diese spirituelle Bedürfnisdimension systematisch mit ein und will die Lebensqualität der Kranken und Sterbenden damit verbessern.[2]
Den Ausgangspunkt der vorliegenden Studie bildet die im praktisch-theologischen Diskurs vertretene These, dass Spiritual Care eine Aufgabe ist, die allen zukommt, die in den Institutionen des Gesundheitssystems für Sterbende und ihre An- und Zugehörigen Verantwortung tragen, d. h. neben Seelsorger*innen auch Ärzt*innen, dem Pflegepersonal, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen, Therapeut*innen und weiteren Berufsgruppen. Mit der vorliegenden Studie wird untersucht, ob diese Annahme zutrifft und Spiritual Care tatsächlich eine Aufgabe aller Mitarbeiter*innen ist, die sich um Kranke und Sterbende sorgen. Daran schließt sich die Frage an, inwiefern sich diese Sorge in den jeweiligen Berufsgruppen unterscheidet oder auch, inwiefern es Überschneidungen und wechselseitige Bezugnahmen gibt.
Die leitende Forschungsfrage dieser Untersuchung ist deshalb zunächst die nach dem konkreten spirituellen Sorgehandeln der Mitarbeitenden in den Hospizen und auf den Palliativstationen.[3] Von den Seelsorger*innen wird selbstverständlich erwartet, für das religiöse bzw. spirituelle Wohlergehen der Betroffenen Sorge zu tragen. Wie aber verhält es sich mit den anderen Berufsgruppen? Welche Rolle spielen Spiritualität und Religiosität für die in der Sterbebegleitung tätigen Personen, die nicht Seelsorgende sind? Welche Rolle spielen sie für ihr jeweiliges professionelles Selbstverständnis? Wie beziehen die medizinischen/therapeutischen Berufsgruppen körperliche und seelische Faktoren der Sorge aufeinander? Beziehen alle Berufsgruppen den Aspekt der Spiritualität tatsächlich in ihr Handeln mit ein oder lassen sich berufsgruppenspezifische Unterschiede feststellen? Und: Was bedeutet dabei jeweils Spiritualität? Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang möglicherweise auch der Glaube mit seinem Menschenbild und seinen eschatologischen Vorstellungsgehalten? In diesem Zusammenhang ist zudem die Rolle und die spezifische Kompetenz der professionellen Seelsorge im Umgang mit Sterbenden und ihren Angehörigen sowie etwaige Sonderaufgaben, die ihr im Rahmen einer spirituellen Sorgepraxis ggf. zukommt, zu untersuchen und präzise zu konturieren.
Obwohl gegenwärtig viel über Hospize und über Palliative Care publiziert wird, werden bislang kaum empirische Studien in hospizlich-palliativen Einrichtungen durchgeführt.[4] An dieses Desiderat knüpft die vorliegende Dissertation an und untersucht mit Hilfe der qualitativen Sozialforschung die (spirituelle) Sorgepraxis der Mitarbeiter*innen. Die Studie leistet einen Beitrag zum praktisch-theologischen Diskurs, indem sie die Implikationen, Herausforderungen und Perspektiven, die sich aus den empirischen Erkenntnissen ergeben, für die Seelsorgetheorie und -praxis fruchtbar macht.
Die vorliegende Studie ist in fünf Hauptteile gegliedert. Nach dem einleitenden Teil in Kapitel eins werden im zweiten Teil die anthropologischen Grundaxiome Sterben und Tod in bibelwissenschaftlicher, soziologischer und theologischer Hinsicht perspektiviert. Die bibelwissenschaftliche Betrachtung zeigt zunächst, dass Sterben und Tod schon im Alten und Neuen Testament keineswegs eindimensional verstanden werden und die dort reflektierten Erfahrungen von Ort und Zeitpunkt des Sterbens sowie Fragen nach der Begleitung oder Isolation von Sterbenden mitunter bis heute relevant sind. Die soziologische Analyse hilft, die Institutionalisierung des Sterbens und das Aufkommen von Communities of Care in den hospizlich-palliativen Einrichtungen besser zu verstehen und zu kontextualisieren. Mittels der Systemtheorie wird zunächst die Ambiguität der Moderne im Umgang mit Sterben und Tod erläutert. Dazu wird sowohl die Entwicklung von der stratifikatorischen zur funktional differenzierten Gesellschaft skizziert als auch die These der Todesverdrängung diskutiert. Die funktionale Differenzierung der Gesellschaft führt zu einem Verlust hilfreicher und verbindlicher Todesbilder und -deutungen. Die mit der Differenzierung und der Institutionalisierung des Sterbens einhergehende Professionalisierung versucht, diese Leerstelle zu kompensieren. Zugleich führt sie dazu, dass Sterben und Tod aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand (in spezifische Institutionen) ausgelagert werden. Damit verknüpft ist eine große Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit des Sterbeortes, denn die meisten Menschen wollen nach wie vor zu Hause sterben. Sterben und Tod wieder stärker ins Bewusstsein und auf die Tagesordnung der Gesellschaft zu bringen, ist das Bestreben von Palliative Care, End-of-Life Care und Spiritual Care. Das nächste Teilkapitel beschreibt die großen Linien der Hospizbewegung vom Engagement Einzelner hin zu einer weltweiten Bewegung. Daran anschließend werden die für diese Studie relevanten Institutionen Hospiz und Palliativstation unter inhaltlichen, organisationalen und räumlichen Gesichtspunkten beleuchtet. Ferner wird der Spiritualitätsbegriff, seine Herkunft und Bedeutung im Kontext von Krankheit und Sterben reflektiert. Die daran anschließende Darstellung des Forschungsstands mit Blick auf Spiritual Care zeigt, wie die vorliegende Studie sich in die Diskussion einfügt und sie erweitert.
Kapitel drei expliziert das empirische Forschungsdesign der Studie. Nach der Darstellung des Samplings wird das Expert*inneninterview als geeignetes Mittel der Datenerhebung plausibilisiert, die Auswertungsstrategie mittels eines an die Grounded Theory angelehnten Kodierverfahrens erläutert sowie Aufbau und Herleitung des Interviewleitfadens begründet.
Der vierte Hauptteil ist das Herzstück der Studie mit den Kapiteln vier bis elf. Hier werden die empirischen Ergebnisse ausführlich dargestellt und erläutert. Kapitel vier informiert einleitend über die verschiedenen Berufsgruppen, die in Hospizen und auf Palliativstationen tätig sind. Es wird deutlich, dass die Zusammenarbeit über die Institution hinaus in einem ausdifferenzierten Netzwerk stattfindet und jede Berufsgruppe ihren Beitrag im Gesamtensemble leistet. Signifikant ist zudem, dass alle Mitarbeitenden für sich beanspruchen, auch spirituell für die Sterbenden sowie ihre Angehörigen Sorge zu tragen.
Kapitel fünf illustriert exemplarisch Spiritualitätsverständnisse der Mitarbeitenden, die die Polymorphie des Phänomens aufzeigen. Auffallend ist überdies eine Spannung zwischen der Bekanntheit des Begriffs im akademischen Bereich sowie bei Leitungspersonen einerseits und dem Nichtwissen um diesen Begriff – bei gleichzeitig selbstverständlicher Ausübung von Spiritual Care – an der Basis vor Ort andererseits. Wichtig ist den Mitarbeiter*innen, genau hinzusehen und auf das zu hören, was die Betroffenen kommunizieren.
Kapitel sechs arbeitet heraus, wie elementar die Kompetenz wahrzunehmen für die Mitarbeitenden ist, um sich spirituell um andere sorgen zu können. Es werden Anlässe und Möglichkeiten identifiziert, die eine spirituelle Ansprechbarkeit auf Seiten der Kranken wahrscheinlich machen. An die präzise Wahrnehmung schließen sich Aushandlungs- und Abwägungsprozesse, die das spirituelle Sorgehandeln der Mitarbeitenden begleiten, an.
Kapitel sieben zeigt, wie sich spirituelle Sorge als verbale Praxis artikuliert. Die Bandbreite spiritueller Themen ist groß und reicht über Fragen, die die Alltagsspiritualität betreffen, hinaus. Wie spirituelle Sorge im Gespräch in der konkreten Begegnung funktioniert, wird anhand dreier Typen verbaler spiritueller Sorge vorgeführt.
Kapitel acht widmet sich intensiv der spirituellen Sorge als einer dezidiert religiösen Praxis. Im Umgang mit den Gästen bzw. Patient*innen kommen traditionelle und individuelle religiöse Formen sowie kasuelle und sakramentale Handlungen zum Einsatz. Dabei zeigt sich, dass traditionelle religiöse Formen aufgrund ihrer überindividuellen Gültigkeit und ihrer distinkten Sinnformen insbesondere für die nichtseelsorglichen Berufsgruppen hilfreich sind, während die Seelsorger*innen vor allem individuell handeln sowie für Kasualien und Sakramente zuständig sind. Die religiös-spirituellen Angebote, die den Mitarbeitenden in ihrer Einrichtung gemacht werden, oszillieren zwischen expliziter Religion und impliziter Religion bzw. Spiritualität. Religiös-spirituelle Angebote für das Team sind von einem ständigen Austarieren zwischen diesen beiden Polen geprägt. Die von den hospizlich-palliativen Einrichtungen proklamierte religions- und weltanschauliche Offenheit wirft nicht zuletzt Fragen im Hinblick auf eine interkulturelle spirituelle Sorgepraxis der Mitarbeitenden auf. Es zeigt sich, dass das Team im Umgang mit Menschen aus anderen Religionen und Kulturen sehr sensibel ist. Ihre spirituelle Sorgepraxis unterscheidet sich insofern von der im Umgang mit Christ*innen, als dass sie vorwiegend im Hintergrund handeln und für die Familien die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, weil diese die spirituelle Begleitung ihrer Angehörigen in der Regel selbst verantworten.
Kapitel neun umfasst die Analyse künstlerisch-kreativer Praktiken als eine mögliche Ausdrucksform spiritueller Sorge. Die Annäherung über Kunst, Musik und Kreativität bietet großes Potential, Spiritualität zum Ausdruck zu bringen und zu bearbeiten. Insbesondere Mitarbeitende aus den nichtseelsorglichen Berufsgruppen nutzen diese Form der spirituellen Sorge, um den Kranken die Möglichkeit zu geben, sich selbstbestimmt und gestalterisch einzubringen. Nach der Analyse der spirituellen Praktiken beleuchtet Kapitel zehn die Gelingensbedingungen spiritueller Sorge auf Mikro-, Meso- und Makroebene und reflektiert Scharnierstellen bzw. Verknüpfungen zwischen den Ebenen. Kapitel elf fragt nach den potentiellen Wirkungen spirituellen Sorgehandelns für die einzelnen Mitarbeitenden, die Kranken, das Team sowie für die Institution.
In den beiden abschließenden Kapiteln werden die empirischen Ergebnisse zusammengefasst und Implikationen für den Diskurs in der Poimenik herausgearbeitet. Darüber hinaus wird ein Kompetenz- und Aufgabenmodell für spirituelles Sorgehandeln skizziert, Präzisierungen und Weiterführungen einer Theorie der Spiritual Care formuliert sowie eine Neuperspektivierung des Spiritualitätsbegriffs vorgenommen. Noch einmal wird deutlich, dass Spiritual Care eine Aufgabe aller Berufsgruppen im Hospiz und auf der Palliativstation ist. Auf je eigene Weise und in unterschiedlicher Intensität berücksichtigen die Mitarbeiter*innen die spirituelle Dimension der ihnen Anvertrauten. Zugleich agieren die verschiedenen Berufsgruppen unterschiedlich. Spirituelles Sorgehandeln lebt von der Diversität der Akteur*innen und ihrer Praktiken sowie von der zwischen den Beteiligten entstehenden Beziehungsdimension und ihrer Abstimmung miteinander.
Das Miteinander und die damit zusammenhängenden Aushandlungs- und Kooperationsprozesse sind zentrale Kategorien der Communities of Care im Hospiz und auf der Palliativstation. Es ist dabei elementar, die unterschiedlichen Kompetenzen auszuloten und eindeutige Rollen- und Aufgabenbeschreibungen zu formulieren. Seelsorger*innen sind ex professo für spirituelles Sorgehandeln ansprechbar, von ihnen ist eine religiös-spirituelle Deutung sicher erwartbar. Zugleich haben sie kein Monopol dafür. Die Studie zeigt darüber hinaus das spezifische Potential, das in religiösen Narrativen und Ritualen mit Blick auf die Begleitung Kranker und Sterbender liegt. Simon Peng-Keller ist zuzustimmen, wenn er schreibt: »Ohne Spiritualität wäre die Gesundheits- und Sozialversorgung ein sehr einsamer, leerer und dünner Ort für Kranke und Sterbende«[5]. Spirituelles Sorgehandeln schaut hinter den Vorhang und berührt die Menschen auf einer tieferen Ebene. Eine spirituelle Sorge kann Menschen in Hospizen und auf Palliativstationen Trost, Zuflucht und Hoffnung in Situationen schwerer Krankheit und schweren Leides bieten. Sie kann ein Ankerpunkt für die Seele sein.
Die Studie führt empirisch vor, wie vieldimensional Spiritualität und spirituelle Sorge in der Praxis verstanden wird und dass die Zusammenarbeit in interprofessionellen Teams trotzdem hervorragend gelingen kann. Die Angst, dass die professionellen Seelsorger*innen überflüssig werden, wenn andere Berufsgruppen sich an Spiritual Care beteiligen, erweist sich als unbegründet. Für die nicht professionell Seelsorgenden ist es elementar, dass sie bei ›schwierigen Fällen‹ und bei religiösen Fragen auf die professionell Seelsorgenden zurückgreifen können und sie an ihrer Seite wissen. In diesem Sinne sind die interprofessionellen Teams Communities of Care, die wissen, dass sie wechselseitig aufeinander angewiesen sind.
2Theoretische Grundlagen
Sterben und Tod sind komplexe Phänomene, denen seit Jahrzehnten aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven Aufmerksamkeit gewidmet wird. Neben explizit bibelwissenschaftlichen und theologischen Erkenntnissen schöpft das folgende Kapitel vor allem aus der Soziologie und thematisiert die Einsichten, die sich für die Auseinandersetzung mit der dieser Studie zugrundeliegenden Fragestellung als weiterführend erweisen.
2.1Biblische Sterbevorstellungen
Biblische Geschichten können in der spirituellen bzw. religiösen Begleitung Sterbender je nach Situation großes Potential entfalten und erweisen sich gerade im Kontext der christlichen Seelsorge als eine wichtige Ressource.[6] Insofern ist ein Rekurs auf die biblischen Sterbeerzählungen, -vorstellungen und -narrative unverzichtbar.[7]
Die Bibel spricht polyperspektivisch über Sterben und Tod, verzichtet aber auf eine systematisierte Gesamtdarstellung dieses Themenkomplexes.[8] Dennoch lassen sich markante Grundhaltungen, Einstellungen und Narrative nachzeichnen. Diesen wird im Folgenden zunächst im Hinblick auf das Alte Testament nachgegangen. Eine Reflexion der zentralen Sterbeerzählungen und -vorstellungen des Neuen Testaments schließt sich an.[9]
Nach einer kursorischen Durchsicht der zentralen biblischen Texte kristallisieren sich ambivalente Aussagen zu Sterben und Tod heraus.[10]
2.1.1Sterben und Tod im Alten Testament
Was sich für die gesamtbiblische Betrachtung abzeichnet, formuliert Alexander Fischer explizit in Bezug auf das Alte Testament: »Im Alten Testament kommt der Tod zwar in seiner ganzen Breite in den Blick, aber nirgends wird er selbst zum Gegenstand einer eigenen Betrachtung oder einer systematischen Abhandlung gemacht. Trotzdem lassen sich einige biblische Texte und Bereiche nennen, in denen ausdrücklich über Sterben und Tod reflektiert wird.«[11] Im hebräischen Text haben Sterben und Tod beide dieselbe Wurzel מות, wobei der Begriff des Sterbens einen Prozess und der Begriff des Todes das finale Ende dieses Prozesses zum Ausdruck bringt. Daneben finden die Verben גוע (sterben, verscheiden), הלך (im Nifal: dahinschwinden, sterben), אסף (im Nifal: umkommen, sterben) und שׁכב (sich legen) Verwendung. Diese lassen ein zunächst durchaus natürliches Verhältnis zum Tod als kreatürlicher Bestimmung menschlichen Lebens erkennen.[12] Durch Kriege, Krankheiten, Naturkatastrophen, Mangelernährung und Unfälle waren die Menschen zur Zeit des Alten Testaments täglich mit Sterben und Tod konfrontiert. Daher erstaunt es, dass in den Texten kaum Hinweise zu finden sind, wie der Sterbeprozess konkret abläuft, wie sich die Menschen in diesem Prozess verhalten und welche Symptome damit einhergehen.[13] Die Verfallserscheinungen, die den biologischen Prozess des Sterbens begleiten, sind zwar bekannt, spielen jedoch ebenso wie medizinische Kenntnisse und Diagnosen nur eine untergeordnete Rolle. Die Vergegenwärtigung des Sterbens und des Todes geschieht überwiegend in Form von Sprachbildern, Symbolen und Redewendungen.[14]
Die Sterblichkeit des Menschen wird mit seiner Sündhaftigkeit und der damit einhergehenden gestörten Gottesbeziehung begründet (vgl. u. a. Gen 2,17; Gen 3,3f.; Jer 31,30; Ez 3,18–20; Ez 18,4.13.17f.20f.24.26.28.32), wobei augenfällig ist, dass im ersten Schöpfungsbericht in Gen 1,1–2,4a Sterblichkeit und Tod noch nicht zur Sprache kommen. Die heute vielfach artikulierte Privatisierung des Sterbens ist dem biblischen Denken völlig fremd, stattdessen ist dem Umgang mit Kranken und Sterbenden eine zutiefst soziale Dimension eingeschrieben, die sich in einer treusorgenden Beziehung und einem sorgenden Ethos expliziert.[15] Der Sterbende wurde nicht aus dem Verkehr gezogen, sondern starb im Idealfall in seiner Heimat im Kreise seiner Familie und Angehörigen, die für Versorgung, Fürsorge und Pflege Sorge trugen. Wenn die Umstände es zuließen, versuchten alle Beteiligten diese Phase so bewusst wie möglich[16] mitzuerleben, mit der für den Sterbenden die letztmalige Gelegenheit verbunden war, Besitzverhältnisse und weitere Angelegenheiten zu regeln, d. h. »sein Haus zu bestellen«[17]. Problematisch war es, wenn keine Angehörigen oder Bekannten zur Verfügung standen, die diese Aufgabe der Sterbebegleitung übernehmen konnten. Lange Zeit galt es daher als großes Unglück, wenn Menschen einsam und allein, im Krieg oder in der Fremde sterben mussten. Diese für die Sterbebegleitung als Ideal erachtete familiäre Einbettung und Sterbebettgemeinschaft ist allerdings nur eine von mehreren Auffassungen im Alten Testament. Daneben treten weitere Vorstellungen und Narrative, von denen einige positive Darstellungen des Sterbens akzentuieren, andere sich jedoch stärker auf die Ambivalenz des Sterbens und der Sorge um Sterbende fokussieren.
In Jer 34,4f. spricht Gott zu Zedekia, dem letzten König von Juda, und verheißt ihm: »So höre doch, Zedekia, du König von Juda, des Herrn Wort! So spricht der Herr über dich: Du sollst nicht durchs Schwert sterben, sondern du sollst im Frieden [בְּשׇׁלוֹםתׇּמוּת] sterben« (Lutherübersetzung 2017). Dieser Vers verweist auf eine Idealvorstellung, die bis heute nichts an Attraktivität eingebüßt hat und in der Sterbebegleitung ein zentraler Topos ist: »Der Wunsch des Menschen ein Sterben in Frieden und Ruhe zu erfahren, ist tief gegründet. Das Annehmen dürfen der eigenen Endlichkeit gibt inneren Frieden und Freiheit, die ersucht wird. Nur wer sein eigenes Sterben annimmt, kann andere im Sterben begleiten.«[18]
Die Formulierung »alt und lebenssatt«[19] (זקןושבעימים) wird im Alten Testament verwendet, um eine weitere (Ideal-)Vorstellung des Sterbens aufzuzeigen, mit der der Wunsch assoziiert ist, zur rechten Zeit zu sterben. Diese Charakterisierung des Sterbens findet sich in der hebräischen Bibel bei Abraham (Gen 25,8), Isaak (Gen 35,29), David (1Chr 23,1; 29,28), Jojada (2Chr 24,15) und Hiob (Hi 42,17). Die tatsächliche Lebenserwartung der Menschen betrug damals selten mehr als 40 Jahre, d. h. die biblischen Altersangaben der oben genannten Personen sind symbolisch zu verstehen.[20] Neumann-Gorsolke stellt fest: »Die mythisch dimensionierte Lebenszeit wie die hohe Regierungszeit Davids mit ihrer symbolischen Dimension können als konstitutiv für das Motiv ›alt und lebenssatt‹ gelten.«[21] Mit diesem Motiv sind verschiedene inhaltliche Charakteristika verbunden. Bei Abraham (Gen 15,15; 25,8), Gideon (Ri 8,32) und David (1Chr 29,28) findet sich als weitere Umstandsbeschreibung des Todes die Aussage, ›in gutem Alter‹ (בְּשֵׂיבָהטוֹבָה) zu sterben. Dies impliziert, dass die wichtigsten Lebensaufgaben erfüllt, genug Nachkommen gezeugt und im Falle von David die Organisation von Reich und Tempel bzw. die Thronnachfolge geklärt wurden.[22] Die Bezeichnung ›alt‹ (זקן) ist in der Bibel eine verbreitete allgemeine Altersbezeichnung, die sich von physiologischen Gegebenheiten ableitet und zunächst das graue Haar (Hi 41,24; Spr 16,31; Hos 7,9), aber auch den alten Menschen als solchen (Dtn 32,35; Lev 19,32) meint. Die in der Redewendung ebenfalls enthaltene Wurzel שׂבע trägt die Bedeutung ›sich sättigen‹ bzw. ›satt sein‹ und bezeichnet vielfach das konkrete Stillen des Hungers. Die Sättigung wurde häufig als Gabe des Schöpfers (vgl. Ps 104,13.16.28 u. a.) und als Ausdruck seines Heilshandelns verstanden (Ex 16,8.12). In Ps 91 wird die Beziehung zwischen Sättigung und Lebenszeit hervorgehoben: »Ein Leben bis zur Sättigung, bis zur Fülle der Tage ist heilvolle Gabe Gottes.«[23] Die in einigen Sterbeerzählungen zusätzlichen Hinweise auf das Begräbnis (durch die Söhne – vgl. Gen 25,9f.; 35,29; 2Chr 24,15) und die Erwähnung der Nachfolge bzw. Nachkommenschaft fungieren als Verstärkung und Komplettierung der Aussage alt und lebenssatt:
»Die Erwähnung seines Nachfolgers trägt dazu bei, dass das Leben des Vaters als erfüllt und abgeschlossen gelten kann und der Tod nicht als vorzeitig erlebt wird, sondern zum rechten Zeitpunkt und ohne Schrecken das Leben beschließt.«[24]
Zur inhaltlichen Ausgestaltung der idealen Lebenssattheit gehören offenbar ein hohes Alter, materieller Wohlstand und zahlreiche Nachkommen, ggf. komplettiert durch Begräbnis und Nachfolge. Es scheint, als gäbe es für einen Israeliten ein ›gutes Sterbealter‹ nur im Greisenalter, »alles andere ist nicht Tod zur rechten Zeit, sondern unzeitiger Tod. Dem Tod eines lebenssatten Menschen entspricht die Vorstellung, dass es eine im Vorhinein festgelegte ideale Fülle an Lebenstagen als Gabe Gottes für einen Menschen gibt«.[25] Zwischen diesem Wunsch bzw. der Erwartung, alt und lebenssatt zu sterben und der Realität besteht jedoch vielfach keine Kongruenz, weshalb das Alte Testament auch explizit negative Erfahrungen und Auffassungen von Sterben und Tod thematisiert. So gibt es z. B. auch ausdrückliche Hinweise auf ein (mögliches) grausames und verzweifeltes Sterben im Greisenalter bei Jakob in Gen 42,38; 44,29.31 oder bei David in 1Kön 2,6.9, die – die Ambivalenz betonend – in Widerspruch neben den positiven Sterbeerfahrungen im Greisenalter stehen.[26]
Dem friedlichen Sterben alt und lebenssatt diametral gegenüber steht das im Alten Testament an vielen Stellen problematisierte unzeitige und unheilvolle Sterben. Dieses Narrativ gewinnt in unterschiedlichen Ausprägungen Gestalt: Bezeichnet wird damit sowohl das Sterben in der Mitte des Lebens eines Menschen (Jes 38,10), das Sterben vor der rechten Zeit (Koh 7,17) als auch das Sterben von Kindern (1Kön 17,17–24; 2Kön 4,18–37) oder das Sterben durch Krankheit bzw. Unfall. Zu diesem Narrativ zählen außerdem (Lebens-)Tage, die von Gott selbst verkürzt werden (Ps 102,24f.), sowie das Sterben von Menschen, die noch bei Kräften sind und ihr Leben noch genießen könnten (Sir 41,1).[27] Das unzeitige Sterben schneidet das Leben unmittelbar und unerfüllt ab, gilt als heimtückisch und unberechenbar, artikuliert sich in den Klagepsalmen häufig als eine Anfechtung an das eigene Gottesbild und wird an ausgewählten Stellen mit Bildern wilder Raubtiere (vgl. Jes 5,29; Mi 5,7; Ps 10,9) metaphorisierend dargestellt, die auf den plötzlichen und verschlingenden Charakter des Sterbens hinweisen.[28]
»Die Vorstellung der ›Hälfte resp. Mitte der Tage‹ impliziert, dass das Leben eigentlich ein Ganzes, Abgeschlossenes, in seiner Länge Vorgegebenes ist, das dem Menschen – von Gott her – gegeben wird, ja zusteht. Ziel menschlichen Hoffens ist es, nicht vorzeitig zu sterben, sondern die gesamte Fülle der Lebenszeit erleben zu können. […] Ein menschliches Leben ist idealerweise nach der ihm zugemessenen Anzahl der Tage (=Lebenszeit) ›erfüllt‹; wird es aber vorzeitig durch Gewalttat oder Krankheit beendet, fehlt ihm diese Fülle.«[29]
Im Zusammenhang seiner Klage Gott gegenüber und aus Furcht vor dem unzeitigen oder gewaltsamen Sterben lehnt sich der Prophet Habakuk gegen Tod und Unrecht auf (vgl. Hab 1,12). Daneben beklagen viele Psalmenbeter explizit die Flüchtigkeit und Kurzlebigkeit menschlichen Lebens. »Die Erfahrung, wie schnell und unerwartet ein Leben enden kann, lässt den Gedanken an die eigene Sterblichkeit deutlicher ins Bewusstsein treten und bildet den Ausgangspunkt einer biblischen Reflexion über die Flüchtigkeit und Kurzlebigkeit des Menschen.«[30] Vor diesem Hintergrund entpuppen sich Ps 39 und Ps 90 als eine Vergänglichkeitsklage par excellence, ebenso ausgewählte Stellen bei Koh (Koh 3,9; 5,15 u. a.). Auch wenn in diesen Texten nichts darüber ausgesagt wird, wie Sterbende konkret begleitet werden, lässt sich aus ihnen eine bis heute gültige Erkenntnis gewinnen: Da man vom Tod nicht direkt reden kann, bedarf es der Bilder und Symbole im Zusammenhang des Sterbens. Die facettenreichen biblischen Bilder vergleichen den Menschen unter anderem mit einer Blume, die aufgeht und verwelkt (vgl. Hi 14,1; Jes 40,6), mit Gras, »das am Morgen blüht und sprosst und des Abends welkt und verdorrt« (Ps 90,5f., Lutherübersetzung 2017) sowie mit einem dahinziehenden Schatten (Hi 14,1; Ps 144,4). Das Motiv des Windhauchs[31] begegnet ebenfalls häufig in den Vergänglichkeitsklagen und bezieht sich auf die Menschen (Ps 94,11 u. a.) und ihre kurze Lebensspanne (Ps 78,33; Hi 7,16). Für den Tod und auch für den Akt des Sterbens lässt sich resümieren: »Der Mensch versucht anhand der Bilder vom Tod, das Nicht-Wissen, worüber er aber eine Ahnung oder Vorstellung hat, bildlich auszudrücken und darzustellen, weil Bilder den Vorteil vor Begriffen haben, ein ›Mehr‹ ausdrücken zu können.«[32]
Nicht erst mit dem biologischen Tod, sondern sich mitten im Leben ereignend, tritt eine weitere Klassifikation des Sterbens ein, die als soziales Sterben bezeichnet werden kann. Formen der Isolation, des Beziehungsabbruchs zu anderen Menschen oder eine geminderte Existenz durch Krankheit, Not, Bedrohung durch Feinde oder Angst können unter diese Kategorie subsumiert werden. »Im Hintergrund steht die alttestamentliche Vorstellung, dass sich ein Mensch in Not, Krankheit und Feindeshand nicht nur vom Tod [ebenso vom Sterben] bedroht sieht, sondern bereits spürbar die Unterwelt ›berührt‹ (Ps 88,4f.).«[33] Die soziale und die physische Dimension des Sterbens korrelieren miteinander. Für die Menschen zur Zeit des Alten Testament war die Unterwelt – die Scheol – ursprünglich ein unterirdischer, von JHWH getrennter Bereich, in dem die Machtsphäre des Todes sichtbar zutage tritt und den Menschen seiner sozialen und leiblichen Bezüge beraubt.[34] Wie schon für das Sterben und die Vergänglichkeit illustrieren die biblischen Texte diesen Raum mit Bildern und Symbolen, die mit negativen Assoziationen in Korrelation stehen. Dieser Bereich wird beschrieben als »Tor des Todes« (Ps 9,14; 107,18; Hi 38,17), als »Grube« (Ps 16,10) oder »Grab« (Ps 88,12) und mit Begriffen wie »Stille« (Ps 115,17) und »Finsternis« (Hi 10,21) näher charakterisiert. In Beziehung zu anderen Menschen und besonders zu Gott zu stehen wird im Alten Testament gleichgesetzt mit Leben. Fehlen diese Beziehungen und erlebt sich der Mensch einsam, krank und isoliert, herrscht der Tod als Verhältnislosigkeit.[35] In diesen Situationen sind schon zu Lebzeiten Wirkungen des Todes und seiner Machtsphäre spürbar – der Mensch erfährt das soziale Sterben mitten im Leben.
In ihrer Radikalität einzigartig für das Alte Testament und dem Verständnis vieler Menschen dieser Tage erstaunlich nahe ist die Sicht auf das Sterben, die das Buch Kohelet formuliert. Koh 3,2 betont, dass das Sterben »seine Zeit« hat und die Lebenden wissen, »dass sie sterben werden« (Koh 9,5, Lutherübersetzung 2017). In nüchterner Klarheit beschreibt Kohelet die Nichtigkeit aller Dinge (Koh 2,13; 3,20; 6,6) und verweist in Koh 9,2 auf den Tod als ›großen Gleichmacher‹, der alle Menschen ausnahmslos ereilt – den Frevler wie den Gerechten – und durch seinen universellen Charakter jegliche Hoffnung zerstört (vgl. auch Sir 41,4; 2Sam 14,14). Nichts hat über das Sterben und den Tod des Menschen hinaus Bestand. In drastischer Unverblümtheit verweist Kohelet auf das Verlöschen des menschlichen Bewusstseins durch das Sterben und im Zuge dessen auf das Auslöschen der Existenz und der eigenen Individualität. Verankert im Rahmen des für das weisheitliche Denken charakteristischen Tun-Ergehen-Zusammenhangs plausibilisiert Kohelet die Möglichkeit, dass der Mensch seinen Tod durch sein Handeln sogar selbst verschulden kann (Koh 7,17).[36] Positiv gewendet wohnt den radikalen Formulierungen und der nichts beschönigenden Sicht auf Sterben und Tod das Potential inne, die menschliche Existenz zu erhellen: »Sie öffne[n] den Blick für das eigentliche Leben. Denn nur der Mensch, der um sein eigenes Sterbenmüssen weiß (Koh 9,5), kann sein Leben als ein besonderes Geschenk Gottes begreifen und ausschöpfen.«[37]
Die differenzierte Betrachtung der zentralen Sterbeerzählungen und -vorstellungen im Alten Testament zeigt: Polyperspektivische Aussagen über Sterben und Tod stehen nebeneinander, zum Teil stehen sie sich sogar diametral gegenüber. Wie zwei Brennpunkte einer Ellipse verhalten sich dabei die Idealvorstellung, friedlich (vgl. Jer 34,5), alt und lebenssatt (Gen 25,8 : u. a.) zu sterben, die mit Einsicht und Akzeptanz auf Seiten der Sterbenden in Korrelation steht[38], und die Infragestellung dieses Ideals, insofern die biblischen Texten zugleich vor Augen führen, dass viele Menschen nicht alt und lebenssatt, sondern plötzlich, grausam und unvermittelt in der Mitte ihrer Tage sterben oder den sozialen Tod mitten im Leben erleiden. Vor diesem Hintergrund kann besonders die nüchtern-realistische Sicht von Kohelet auch in der heutigen Seelsorge und Sterbebegleitung weiterführend sein. Sie hilft, Idealvorstellungen des Sterbens einem kritischen Blick zu unterziehen und sie zu relativieren.
2.1.2Sterben und Tod im Neuen Testament
Berichte vom realen und übertragenen Sterben finden sich auch im Neuen Testament, das wie das Alte Testament auf eine systematische Darstellung verzichtet und divergierende Aussagen zu Sterben und Tod enthält.[39] Auch hier stehen die konkreten Sterbeprozesse und die in diesem Zusammenhang auftretenden Symptome nicht im Zentrum des Interesses. Die zentralen Begriffe, die die neutestamentlichen Schriften für diesen Themenkomplex verwenden, sind ἀποθνῄσκειν(sterben), θνῄσειν(sterben), θνητός(sterblich) und θανατός(Tod).
Mit vielen Vorstellungen knüpft das Neue an das Alte Testament an, geht aber durch das Narrativ der Auferstehung Jesu an einem entscheidenden Punkt darüber hinaus und bietet damit eine für die christliche Theologie und Seelsorge neue Deutungs- und Umgangsmöglichkeit mit dem Sterben. In enger Verbindung zu alttestamentlichen Aussagen wird expliziert, dass das Sterben das Resultat der Sündhaftigkeit des Menschen ist und zugleich zur kreatürlichen Vergänglichkeit der Schöpfung gehört (1Kor 15,42–55). Krankheit hingegen wird vor allem in den synoptischen Evangelien vielfach durch das Wirken dämonischer Mächte erklärt. Ebenso wie im Alten Testament lässt sich – besonders verstärkt und hervorgehoben durch das Handeln Jesu – ein sorgender und fürsorglicher Umgang mit Kranken und Sterbenden erkennen (vgl. Mk 2,1–12; Mk 5,35–43; Joh 11,1–45). Der Idee der Ganzheitlichkeit verpflichtet zielt die Intention von Jesu Handeln auf das Heil der Menschen und die Wiederherstellung ihrer Würde. Im Modus der aufmerksamen und liebevollen Zuwendung reintegriert Jesus die Kranken und Sterbenden in die Gesellschaft (vgl. Lk 17,11–19; Mk 5,24–34 u. a.) und erneuert ihre Beziehung zu Gott.[40]
In den biblischen Texten wird augenscheinlich, dass die soziale Dimension, die in diese Texte eingeschrieben ist und mit Sterben und Tod in enger Verbindung steht, als bedeutsamer erachtet wird als medizinische Ursachen und Diagnosen. Der Artikulation von Gefühlen der Ohnmacht oder der Kraftlosigkeit der Menschen (vgl. Mt 8,5–13; Mk 7,24–30; Joh 5,1–18 u. a.) wird – im Gegensatz zu den Therapien oder dem Handeln der Ärzte, das in Mk 5,24–34 sogar negativ konnotiert ist, weil sie nicht helfen können – breiter Raum eingeräumt.[41] Aus Angst vor (kultischer) Verunreinigung fanden unbefangene Begegnungen mit kranken Menschen zur Zeit des Neuen Testaments nur selten statt. Umso bemerkenswerter ist es, dass Jesus konkrete Berührungen nicht scheut. Er nimmt Menschen an die Hand, richtet sie auf oder legt ihnen die Hände auf (vgl. Mk 5,35–43; Mk 7,31–37; Mk 8,22–26 u. a.).[42] Dennoch verliert sich auch das Neue Testament nicht einseitig in positiven Darstellungen und Idealen, sondern weiß um die Realität vieler Menschen, die in Krankheit und Sterben sich selbst überlassen sind (vgl. Joh 5,1–18) und stigmatisiert werden.[43]
Auf einer Linie mit dem Alten Testament wissen auch die neutestamentlichen Texte um ein Sterben, das sich zu früh ereignet und nicht akzeptiert wird. Hier ist besonders das Sterben von Kindern und jungen Menschen zu nennen, das – motiviert durch die Verzweiflung und Trauer der Hinterbliebenen – sogar rückgängig gemacht wird (vgl. Mk 5,35–43; Lk 7,11–17; Joh 11,1–45; Apg 9,36–43). Zweifelsfrei wird das unzeitige Sterben auch hier explizit als nicht wünschenswert klassifiziert. Verorten lässt sich in diesem Zusammenhang auch die bei Paulus auftretende Rede vom Tod als »Feind« des Lebens (1Kor 15,26) und Zerstörer der Gottesbeziehung. Unterstrichen wird diese Charakterisierung durch die Aussage, dass Jesus Christus durch seine Auferstehung den Sieg behält und dem Tod seinen Stachel gezogen habe (vgl. z. B. 1Kor 15,54–57). Auf eine Darstellung der von Paulus in seinen Briefen entwickelten Theologie des Todes wird an dieser Stelle verzichtet, da sie zu konkreten Sterbeszenen und Sterbenarrativen keine weiterführenden, sondern eher allgemeine theologisch-abstrakte Aussagen formuliert. Die unterschiedlichen Sterbeerzählungen von Jesu Sterben in den Evangelien illustrieren hingegen ein interessantes Neben- bzw. Gegeneinander verschiedener Aspekte, die auch für gegenwärtige Sterbebegleitung und Seelsorge Relevanz haben können.
Die Schilderungen des Sterbens Jesu unterscheiden sich je nach Evangelium. Sie unterstreichen das ambivalente Verständnis, das für die biblischen Einstellungen zu Sterben und Tod charakteristisch ist. Im Markusevangelium stirbt Jesus mit einem Schrei, der Klage, Verzweiflung und Leid in unüberbietbarer Weise zum Ausdruck bringt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« (Mk 15,34, Lutherübersetzung 2017; vgl. Ps 22,2). Am dunkelsten Punkt seines Lebens kommen in der Sterbeszene Jesu unverblümt Schmerz, Verzweiflung und äußerste Verlassenheit zum Ausdruck.[44] Jesu Klage ist abgrundtief, die durch sie entfaltete Dynamik möglicherweise ein Ausdruck des Protestes gegen seinen gewaltsamen und ungerechten Tod. Dadurch, dass Mk der Artikulation dieser Klage Raum gibt, nimmt er wahr und ernst, dass in dieser Situation ein Leben zerbricht und Jesu Sterben von Leid, Ohnmacht, Gewalt und Unrecht begleitet wird. In seinem bloßen Menschsein, nackt, verletzlich, zerbrechlich und ungeschützt, schreit Jesus nach Gott und muss – ebenso wie viele Sterbende bis heute – bitter erfahren, dass Gott schweigt. Auf den Schrei folgt keine Antwort. Verstärkt wird der Eindruck, dass die Sterbeszene Jesu von Widrigkeiten durchzogen ist, durch viele Turbulenzen und Wortbeiträge, die als Ausdruck der Geringschätzung dem Sterbenden gegenüber aufgefasst werden können und dem erstrebenswerten Ideal, ruhig und friedlich zu sterben, entgegenstehen.[45] Die Sterbebegleitung Jesu scheint völlig zu versagen: Von seinen Gegnern wird er verspottet und seine Jünger fliehen und lassen ihn im Stich. Sie begleiten ihn nicht in seinem Sterben, nur einige Frauen schauen aus der Ferne zu (Mk 15,40f.). In eindringlichen Worten hat Jesus schon vorher immer wieder betont, nicht allein sein zu wollen.[46] Er fing an »zu zittern und zu zagen« und sagte zu seinen Jüngern: »Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet!« (Mk 14,34, Lutherübersetzung 2017)[47]. Immer wieder unterbricht er im Garten Gethsemane sein Gebet »und geht zu seinen intimsten Jüngern, die gegen den Schlaf zu kämpfen versuchen, um wach zu sein, wenn sie [die Feinde] kommen, um ihren Meister festzunehmen«[48]. Aber auch hier zeigt sich, dass seine Jünger versagen und seiner Bitte nicht nachkommen. Bei Mk tritt Jesus als Mensch zutage. Mit anderen Menschen teilt er die Furcht vor dem Tod. In der Darstellung des Sterbens Jesu beschönigt oder verharmlost das älteste Evangelium nichts – das Sterben wird in seiner ganzen Grausamkeit sichtbar.
Der Verfasser des Matthäusevangeliums lässt Jesus am Kreuz ebenfalls mit einem Schrei der Verzweiflung und Gottverlassenheit sterben (Mt 27,46; vgl. Mk 15,34). Auch in dieser Darstellung stirbt Jesus allein, die Jünger finden keine Erwähnung. Die Sterbeszene gleicht der bei Mk, allerdings konstatieren Sabine und Klaus Bieberstein, dass Jesus bei Mt stärker als bei Mk als vorbildlich Sterbender dargestellt wird. Er geht den Weg eines Gerechten und wird damit für seine Nachfolger*innen zum Vorbild: »Der Sterbende ist derselbe, als der er als Lebender erkennbar geworden war.«[49]
Im Gegensatz zu Mk und Mt lassen sich im Lukasevangelium verschiedene Spuren des Nachdenkens über Sterben und Tod nachverfolgen, die einen anderen Schwerpunkt als den der Gottverlassenheit und Verzweiflung akzentuieren. Bevor das Sterben Jesu betrachtet wird, seien zwei kurze Hinweise zum Sterben bei Lk allgemein angeführt: Das Gleichnis vom reichen Kornbauern (Lk 12,16–21) illustriert die Notwendigkeit, sich des Nachdenkens über das eigene Sterben, die Kürze des Lebens und die Unerbittlichkeit des Todes nicht zu verschließen, sondern sich proaktiv mit dem Sterben als memento mori auseinanderzusetzen und sich auf das eigene Sterben vorzubereiten. Ferner kann auch die bei Lk dominante Theologie der Armut (vgl. Lk 16,19–31; Lk 18,18–27) als Hinweis dafür gelten, wie man im Angesicht des eigenen Sterbens und Todes leben sollte.[50]
Augenfällig ist bei Lk, dass die Sterbeszene Jesu abweichend zu Mk und Mt moduliert und konnotiert wird. Der die Sterbeszene in den anderen beiden synoptischen Evangelien dominierende Schrei Jesu am Kreuz fehlt, stattdessen kommt Jesus als Betender (Lk 23,34.43.46) in den Blick, der sich sogar in seinem Sterben den beiden Übeltätern, die mit ihm gekreuzigt werden (Lk 23,32f.), zuwendet. Diese beiden lassen angesichts ihres Sterbens zwei konträre Einstellungen dem Tod gegenüber erkennen: Die Gottesfurcht des einen steht der Verspottung und dem Sarkasmus des anderen gegenüber. Mit Blick auf die erste Reaktion des ersten Übeltäters lässt sich formulieren: »Die Einsicht in das eigene verfehlte Leben gibt dem Schächer die Kraft zur Bitte, die einer Antwort gewürdigt wird.«[51] Dem Schächer antwortet Jesus mit der Verheißung, noch heute mit ihm im Paradies zu sein (Lk 23,43). Zugespitzt könnte man formulieren: Jesus leistet in der Situation seines eigenen Sterbens selbst Sterbebegleitung und führt den einen Übeltäter zu einem versöhnten Sterben.
In eine ähnliche Stoßrichtung wie die Bitte Jesu an den himmlischen Vater, denjenigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben, zu vergeben (Lk 23,34), geht der von Stephanus in Apg 7,60 während seiner Steinigung zum Ausdruck gebrachte Wunsch »Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!« (Lutherübersetzung 2017). Diese Perspektive ermöglicht es Stephanus, versöhnt zu sterben.[52] Ein Aspekt, der zum versöhnten Sterben dazugehört, ist die erbetene und von Jesus geschenkte Versöhnung »mit sich selbst und denen, mit denen man bis zum Schluss gehadert hat«[53]. Das endgültige Sterbewort Jesu in Lk 23,46 nimmt den vertrauensvollen Ruf aus Ps 31,6 auf und bringt die unerschütterliche Nähe und das unzerstörbare Vertrauen Gott gegenüber zum Ausdruck. Die letzte Aussage Jesu lässt sich als performative Aussage verstehen: »Jesus spricht nicht erst und stirbt danach, sondern mit dem Sagen geschieht das Gesagte. Jesus stirbt, indem er seinen Geist in die Hände des Vaters legt.«[54] Alles in allem wohnt der Sterbeszene Jesu bei Lk dadurch ein Zug der »Entdramatisierung« des Sterbens inne, hervorgehoben und verstärkt durch die in seinen Äußerungen und Gebeten betonte Freiheit und Souveränität angesichts seines Sterbens. Wie schon bei Mt lassen sich Jesu letzte Worte auch in diesem Evangelium als eine zusammenfassende Deutung seines Lebens lesen.[55] Die lukanischen Aussagen über das Sterben bei Jesus betonen die Notwendigkeit, sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu sein (Lk 12,16–21) und nach Möglichkeit Versöhnung zu Lebzeiten anzustreben (vgl. Lk 23,34; Lk 23,42; Apg 7,60). Damit lassen sie Ansätze einer Ars Moriendi erkennen.[56]
Das Johannesevangelium hebt sich in der Schilderung des Sterbens Jesu noch einmal deutlich von den synoptischen Evangelien ab. Jesus erscheint bei Joh als Souverän des Geschehens, der sowohl als ›Regisseur‹ seines Lebens als auch seines Sterbens seine Lebens- und Sterberolle besonders gut ausfüllt und bis zum Schluss souverän bleibt. Auffällig ist, dass Jesus hier nicht allein sterben muss wie bei Mk oder Mt, sondern von seinen engsten Vertrauten umgeben ist. Das Ideal der Sterbegemeinschaft ist demnach erfüllt. Was heute noch für viele Sterbende bedeutsam ist, kommt bei Jesus explizit zum Ausdruck: Er regelt letzte Dinge und trifft Vorsorge für die Zukunft der Zurückbleibenden: Er vertraut seine Mutter und den Lieblingsjünger einander an und stiftet dadurch über seinen Tod hinaus neue verwandtschaftliche Beziehungen. Schließlich stirbt er in Joh 19,30 mit dem Ausspruch: »Es ist vollbracht« (τετέλεσται). Da er seine engsten Vertrauten zu Adressat*innen und Zeug*innen seiner letzten Worte und seines Sterbens werden lässt, hat die Sterbeszene durchaus einen »testamentarische[n] Charakter«[57]. Joh gelingt es so in beeindruckender Weise, in der Situation des Sterbens Jesu Zukunft und Leben zu formulieren – »für den Sterbenden und auch für die Zurückbleibenden«[58].
Zusammenfassend lässt sich sagen: Auch wenn die Begriffe Sterben und Tod in beiden biblischen Testamenten auffällig häufig verwendet werden, fehlt eine systematisch-zusammenhängende Darstellung und Reflexion. Es ist aber möglich, die für die Analyse herangezogenen einzelnen Sterbeaussagen und -szenen für die Begleitung Sterbender damals wie heute inhaltlich fruchtbar zu machen. Es ist evident, dass die biblischen Texte das Sterben in der Mehrzahl der Fälle nicht primär als gutes Sterben begreifen, sondern Ambivalenzen erkennen lassen. Dem Narrativ des guten Sterbens stehen eine Vielzahl von alternativen Wahrnehmungs- und Deutungsmöglichkeiten diametral gegenüber. Zu nennen sind u. a. das unzeitige oder unheilvolle Sterben oder das Narrativ des Kampfes des Lebens gegen den Tod, der im Neuen Testament explizit als ›Feind‹ charakterisiert wird und dessen Stachel gezogen werden muss. Traugott Roser ist insofern beizupflichten, wenn er resümiert:
»In den Passionsgeschichten verdichten sich die biblischen Vorstellungen im Sterbensschrei des Gottverlassenen (Mk 15,34). Insgesamt eignet den biblischen Texten ein nüchtern realistisches Verständnis des Sterbens. Endlichkeit wird zwar akzeptiert, stellt aber ein menschliches und theologisches Problem dar, das als Leid erfahren wird. Eine Befriedung und Befreundung mit dem Tod ist aus biblischer Perspektive nicht gegeben.«[59]
Abschließend sei auf die schon in der Bibel erkennbaren und bis heute für die Sterbebegleitung zentralen Motive hingewiesen: Es gilt, den letzten Worten Sterbender besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da sie als Quintessenz dessen gelten, »wofür der Sterbende stand und in der Erzählung steht, so dass man sie zugleich als Summa und verdichtete Deutung seines Lebenswerkes interpretieren kann«[60]. Im Zusammenhang von Sterben und Tod sei ferner nochmals auf die Verwendung der Symbolsprache verwiesen, die bereits im Alten Testament verankert und deren hohe Bedeutung im Kontext der Sterbebegleitung bis heute unbestritten ist. Das Motiv, alt und lebenssatt zu sterben, beinhaltet nach biblischem Verständnis die Gewissheit, dass die eigenen Lebensverhältnisse geklärt sind und geordnet hinterlassen werden können. Auch dieser Aspekt ist für viele Menschen bis heute wichtig. Traugott Roser bemerkt dazu:
»Hier kann Seelsorge im Verbund mit anderen Professionen, insbesondere der Sozialarbeit, einen Beitrag leisten, indem inmitten der medizinisch-pflegerischen Versorgungsstrukturen immer wieder Freiräume für die Klärung des ›Nachlasses‹ geschaffen werden. Explizit handelt Seelsorge ›lebenssättigend‹ in Form rituellen Handelns […].«[61]
Zu guter Letzt können gerade die realistische Perspektive, die partiell im Neuen Testament, besonders aber bei Koh zutage tritt, sowie die ambivalenten biblischen Aussagen und Schilderungen vom Sterben für die heutige Sterbebegleitung im Rahmen von Palliative Care[62] von Bedeutung sein. Sie schärfen den kritischen Blick dafür, ein gutes Sterben unter allen Umständen für machbar, herstellbar und zwingend erforderlich zu halten.[63]
2.2Sterben und Tod im Wandel
Sterben und Tod wurden je nach historischer Situation unterschiedlich gedeutet. Dies führte zur Ausbildung unterschiedlicher Praktiken im Umgang mit Sterbenden. Die folgenden soziologischen Überlegungen dienen einem besseren Verständnis gegenwärtiger Debatten um Sterben und Tod. Sie sind außerdem für eine gesellschaftstheoretische Verortung gegenwärtiger »Sterbeorganisationen« unerlässlich.
2.2.1Sterben und Tod zwischen gesellschaftlicher Verdrängung und Geschwätzigkeit
Die gegenwärtigen thanatosoziologischen Debatten sind geprägt von Diskussionen über die Frage, ob heute noch von einer Verdrängung des Todes gesprochen werden kann oder nicht vielmehr von einer allgemeinen Geschwätzigkeit, die zeige, dass Kommunikation über den Tod gerade deswegen notwendig ist, »weil er an sich der Erfahrung nicht zugänglich ist, nicht verstanden werden kann, angesichts des vorhandenen Deutungsbedarfs [aber] Sicherheit hergestellt werden muss«[64]. Der Soziologe Armin Nassehi hat sich über mehrere Jahrzehnte hinweg intensiv mit der Frage der Todesdeutung beschäftigt. Eklatant ist dabei eine Verschiebung bzw. Neujustierung seiner Sichtweise, die sich innerhalb seiner Publikationen niederschlägt. Zunächst war Nassehi Anhänger der Verdrängungsthese, dann rückte er im Laufe der Jahre von dieser These ab und diagnostiziert nun eine »Geschwätzigkeit des Todes«. Die Grundlinien dieser beiden für die derzeitige Thanatosoziologie relevanten Thesen sollen an seinen Ausführungen exemplarisch erläutert werden. Beide Theorien fußen auf derselben Grundlage: der Theorie der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft bzw. der Systemtheorie von Niklas Luhmann.[65] Grundzüge dieser Theorie werden zunächst expliziert, bevor sie auf die Interpretation des Todes angewandt wird.
Kennzeichnend für die vormoderne stratifizierte Gesellschaft war ihr vertikaler Aufbau mit einer streng hierarchischen Struktur. Die Schichtzugehörigkeit hatte zur Folge, dass jedes Individuum als ganze Person in das ihm zugehörige (Schicht-)System vollständig inkorporiert wurde. Trotz dieser Schichtzugehörigkeit teilten alle Menschen dasselbe Weltbild und orientierten sich an einem für die damalige Gesellschaft verbindlichen Zentralsinn, der durch die Religion vorgegeben war. Im Sinne eines funktionalistischen Verständnisses kam der Religion die Funktion der Kontingenzbewältigung zu. So bot sie eine Möglichkeit, Endlichkeit verständlich und aushaltbar zu machen.[66] Das für den Menschen individuelle Problem seiner eigenen Endlichkeit konnte auf diese Weise kollektiv aufgefangen und »vergesellschaftet« werden. Auch die Verankerung eines homogenen Todesbildes, das konstitutiv für den Sinnentwurf der Welt im Ganzen war, trug der damaligen Gesellschaftsstruktur Rechnung.[67]
Seit der Renaissance lassen sich jedoch Veränderungen wahrnehmen: »Quer zur stratifikatorischen Differenzierungsform [entwickeln sich] zunehmend funktionale Differenzierungsformen«[68], d. h., es differenzieren sich verschiedene funktionale Teilsysteme aus (Religion, Wirtschaft, Politik, Medizin, Familie, Recht usw.), die ausschließlich aus Kommunikation bestehen (nicht aus Individuen, Subjekten o. ä.). Diese Teilsysteme operieren autopoietisch, d. h. sie produzieren und reproduzieren sich in einem ständigen autopoietischen Prozess selbst, indem alle Kommunikationen immer wieder an den Code des jeweiligen Systems anschließen. Die weitgehend autonom operierenden Systeme folgen einer spezifischen binären Logik, die den Rahmen des systeminternen Prozessierens absteckt. Auf Grundlage der Annahme, dass es bestimmte Medien gibt, die Kommunikation wahrscheinlich machen, verfügt jedes Teilsystem über ein spezifisches symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. In der Politik bspw. ist dieses Medium die Macht, in der Wirtschaft ist es das Geld und in der Religion der Glaube.
Entscheidend ist, dass die funktional differenzierte Gesellschaft anders als die stratifikatorische nicht hierarchisch strukturiert, sondern polyzentrisch geworden ist. Da »viele differente, nicht aufeinander abbildbare Beobachtungsverhältnisse geschaffen [werden]«[69] und jedes Teilsystem »seine gesellschaftsinterne Umwelt dabei systemrelativ [beobachtet]«[70], gibt es keine allgemein verbindlichen Deutungsmuster mehr – das gilt auch mit Blick auf Todesbild und Todesverständnis. Die Auswirkungen für das Individuum sind evident: Es wird nicht mehr als Ganzes in die Gesellschaft inkorporiert, vielmehr erfolgt eine Aufsplitterung der Selbste eines Individuums in verschiedene Teilsysteme. Das Individuum ist damit nicht mehr Teil, sondern Umwelt der Gesellschaft. Dass es keinen verbindlich festlegbaren Zentralsinn mehr gibt, hat Konsequenzen für das Individuum: Diesem kommt nun die Aufgabe zu, eine eigene Identität auszubilden und sich selbst mit Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Denn auch die Sinngebung des Todes ist nun keine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mehr. Es kommt zu einer Abkopplung der gesellschaftlichen Funktionsbereiche von der existentiellen Perspektive einzelner Individuen. Damit fällt der Tod als existentielles Problem endlicher Menschen aus der Zuständigkeit gesellschaftlicher Teilsysteme heraus.[71] Jedes Individuum muss nun für sich selbst klären, was Endlichkeit bedeutet und wie mit dem existentiellen Problem des Todes (sinnvoll) umgegangen werden kann.
Die skizzierte Systemtheorie bildet neben der konstruktivistischen Wissenssoziologie von Berger und Luckmann[72] die Basis für die These von der Verdrängung des Todes. Armin Nassehi und sein Lehrer Georg Weber verstehen 1989[73] die Verdrängung des Todes als »Entlassung des Todes aus den Zentralinstanzen der Gesellschaft in Richtung individueller Bewältigung«[74], was jedoch nicht bedeutet, dass jegliche Kommunikation über den Tod unmöglich wäre. Nassehi spricht explizit von einer gesellschaftlichen Verdrängung des Todes. Gemeint ist insofern nicht »eine Ausschließung des Todes aus der Moderne, sondern vielmehr dessen Einschließung in die jeweilige konkrete Existenz«[75]. Kommunikation über den Tod als »Chiffre des Unbekannten und Unerfahrbaren«[76] beschränkt sich vor diesem Hintergrund auf Gesprächspartner, die für das Individuum von hoher Wichtigkeit sind.
Mit dieser Verlagerung der Auseinandersetzung von Sterben und Tod in die individuelle Existenz gehen Unsicherheit, Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit einher. Es fällt damit schwer, einen angemessenen Umgang mit und für Sterben und Tod zu finden. Der Historiker Philippe Ariés beschreibt in seiner »Geschichte des Todes«[77] eine romantisierend anmutende Sterbeszene in der vormodernen Gesellschaft, die illustriert, wie die Menschen mit Sterben und Tod umgingen: Starb ein Einzelner, betraf dies immer die ganze Gesellschaft. Sterben galt gemeinhin als öffentliches Phänomen, »das Zimmer des Sterbenden wandelte sich zur öffentlichen Räumlichkeit mit freiem Eintritt«[78]. Es war jedem gestattet, sich dem zum Sterbenden eilenden Priester anzuschließen. Zudem war es selbstverständlich, dass die Sterbebettgemeinschaft auch Kinder umfasste, die bereits früh mit den Ritualen auf dem Sterbebett vertraut wurden. Diese öffentliche Zeremonie des Sterbens wurde von den Sterbenden selbst organisiert und geleitet und ließ einen festgelegten Ablauf erkennen: Auf dem Krankenbett liegend erwartete der Sterbende den Tod. Dabei richtete er sein Gesicht zum Himmel, die Füße zeigten Richtung Osten nach Jerusalem, der Kopf nach Westen und seine Hände lagen verschränkt auf seiner Brust:
»So hergerichtet, kann der Sterbende den letzten Akten des vorgeschriebenen Zeremoniells Genüge tun. Er beginnt mit dem traurigen, aber zurückhaltenden Gedanken an geliebte Dinge und Wesen, mit dem auf wenige entscheidende Bilder reduzierten kurzen Abriß des Lebens«[79],
an dessen Ende sich der Sterbende seinem Tod fügt. Eine Bitte um Verzeihung an die Anwesenden schließt sich an, gefolgt von der Abschiednahme und dem Anbefehlen der Nahestehenden an Gott. Nachdem der Sterbende auf diese Weise seinen Abschied von der Welt vollzogen hat, empfiehlt er seine Seele Gott an. Er tut dies in Form eines Schlussgebetes, bestehend aus Schuldbekenntnis und commendacio animae. Nach diesem letzten Gebet bleibt schließlich nur noch das Harren auf den Tod.[80] Familie und Anwesende nehmen selbst die Trauerbekundungen vor. Augenfällig ist die charakteristische Einfachheit der Todesriten, die ohne Dramatik und ohne exzessive emotionale Regung vollzogen wurden.[81]
Im scharfen Kontrast dazu und die Hilfslosigkeit heutiger Menschen hervorhebend beschreibt Nassehi, welche typischen Mechanismen sich in unserer Gesellschaft beobachten lassen, wenn es um die Bewältigung der Krise des Todes geht. Um die Störungen der gesellschaftlichen Prozesse, die mit Sterben und Tod einhergehen, handhabbar zu machen, wird das Problem des Todes zunächst formalisiert, anschließend differenzieren sich funktionsspezifische Handlungsmuster aus und es erfolgt eine Professionalisierung der Handelnden.[82] Insofern ist für Nassehi die Professionalisierung der Sterbebegleitung eine direkte Konsequenz aus der gesellschaftlichen Verdrängung des Todes. Begleitung und Pflege werden nun überwiegend in die Hände (para)medizinischer Professionen gelegt. Sterben und Tod werden somit weitgehend medikalisiert, institutionalisiert und dadurch an den Rand der Gesellschaft bzw. in dafür eigens ausgebildete Organisationen gedrängt. Philippe Ariès beschreibt diesen für die moderne Gesellschaft charakteristischen Tod als den ins Gegenteil verkehrten Tod. Er stellt ihm das Todesverständnis der vormodernen Gesellschaft diametral entgegen:
»Zwei Hauptmerkmale springen selbst dem achtlosesten Betrachter ins Auge. Erstens die Neuartigkeit dieses Sterbens, das dem früheren Bild des Todes konträr entgegensteht und gleichsam dessen umgewendetes Abziehbild oder Negativ ist: die Gesellschaft hat den Tod ausgebürgert […]. Die Gesellschaft legt keine Pause mehr ein. Das Verschwinden eines einzelnen unterbricht nicht mehr ihren kontinuierlichen Gang. Das Leben der Großstadt wirkt so, als ob niemand mehr stürbe.«[83]
Die Ungeschicklichkeit der Trauer und der Verlust ritueller Sicherheit im Umgang mit dem Tod gehen mit dieser Entwicklung Hand in Hand.
Es ist bemerkenswert, dass diese These von der Verdrängung des Todes in den gegenwärtigen Diskursen immer noch kursiert, obwohl die Mehrheit der Soziologen sie nicht (mehr) für tragbar hält.[84] So hat auch Armin Nassehi seine ursprüngliche Auffassung korrigiert, was sich in Ansätzen bereits 1989 erkennen lässt, indem er konzediert, dass sich bereits eine neue Sensibilität für das Thema und ein zunehmend öffentlicher Diskurs beobachten lassen.[85] Hier klingt schon etwas an, auf das er später für seine These von der Geschwätzigkeit des Todes zurückgreifen wird.
Die Unerfahrbarkeit des Todes aufgrund der radikalen Immanenz allen Daseins bildet schließlich für Nassehi den Ausgangspunkt seiner These von der Geschwätzigkeit des Todes. Auch wenn mit dem Tod keine Erfahrung zu machen ist und wir nur aus dem Blickwinkel der Lebenden über den Tod sprechen können, versuchen Menschen seit jeher dieses Nichterfahrbare zumindest symbolisch oder sinnhaft begreifbar zu machen. Die Nichterfahrbarkeit des Todes »entfesselt Kommunikation«[86]. Da es außer dem Weg über die Kommunikation keine Möglichkeit gibt, sich der Nichterfahrbarkeit des Todes zumindest anzunähern, bezeichnet Nassehi den Tod als geschwätzig und paradox:
»Er ist geschwätzig, weil wir ihn nicht unmittelbar besichtigen können, ihn nicht zum Objekt von Beobachtungen machen können. Deshalb müssen wir ihm Kommunikation widmen, ihn deuten und verstehen. Paradox ist der Tod also, weil wir damit eine Erfahrung simulieren, mit der sich eben keine Erfahrung machen lässt.«[87]
Aller Nichterfahrbarkeit des Todes zum Trotz ist es ein unbestrittenes und unumgängliches Faktum, dass Menschen sterben (müssen). Und eben dieses fordert zu einem Umgang mit dem Tod und damit zur Kommunikation heraus. Die in diesem Kontext verwendete Metapher des Todes als Spur bzw. Geheimnis weist daraufhin, dass der Tod »seine Kommunizierbarkeit in erster Linie selbstreferentiell sichern muß«[88]. Da in der modernen Gesellschaft die Kommunikation über den Tod nur innerhalb der verschiedenen Teilsysteme mit jeweils unterschiedlicher Eigenlogik erfolgt, ist es evident, dass damit eine nicht zu unterschätzende Entlastung und Erleichterung für die in den jeweiligen Systemen Tätigen verbunden ist. So muss bspw. der Mediziner nur den Tod feststellen und den Totenschein ausstellen, während der Jurist klären muss, ob der Tod Anlass für eine juristische Untersuchung ist, wie sie bei nicht natürlichen Todesfällen durchgeführt wird. Ist jemand bspw. beim Verkehrsunfall verstorben, wird der Tod oft zum Anlass, eine besonders gefährliche Straßenverkehrssituation zu korrigieren. Mit der existentiellen Dimension des Todes ist jedoch keines dieser Teilsysteme wirklich konfrontiert. Der Polykontexturalität und den verschiedenen Professionen, die ganz unterschiedlich auf den Tod zugreifen, wird auf diese Weise Rechnung getragen. Pointiert und zugespitzt formuliert Nassehi: Geschwätzigkeit meint »öffentliche Debatten, in denen wissenschaftliche, medizinische, rechtliche, politische, ökonomische, pädagogische, religiöse und massenmediale Logiken aufeinandertreffen, aber stets in ihrer je eigenen Logik gefangen bleiben«[89]. Von einer Verdrängung des Todes kann demnach keine Rede sein, sondern vielmehr »von einer Verwissenschaftlichung, Politisierung, Ökonomisierung, Medikalisierung, Juridifizierung […] – neben und mit seiner Individualisierung, Privatisierung und Verinnerlichung, die heute eine Bandbreite an Todesbildern produziert, die kaum überschaubar ist«[90]. Die von Thomas Macho proklamierte neue Sichtbarkeit des Todes[91], die sich besonders in einer »Rückkehr« der Toten in der medialen und künstlerischen Inszenierung sterbender und toter Körper in Film und Fernsehen, Fotografie, Kunst oder Raum-Installationen niederschlägt, kann als weitere Kritik an der These der Verdrängung des Todes verstanden werden.
Der Umgang mit Sterben und Tod ist gegenwärtig vorwiegend dadurch ausgezeichnet, dass zwar keine aktive Verdrängung[92] stattfindet, die wahrnehmbare Vernischung und Verlagerung





























