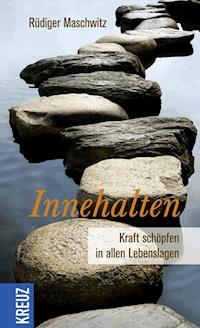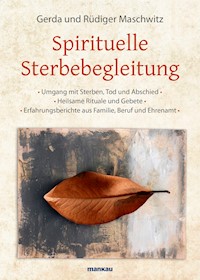
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mankau Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wir alle sind sterblich - eine so einfache wie erschütternde Erkenntnis. Dieses Buch lädt dazu ein, sich bewusst mit Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Einerseits möchte es die Angst vor dem Sterben nehmen und andererseits zu einem erfüllten Leben ermutigen. Gerda und Rüdiger Maschwitz regen dazu an, Menschen auf dem Weg des Sterbens zu begleiten. Dabei werden sowohl allgemeine Fragen der Sterbebegleitung als auch ihre spirituelle und damit geistliche Bedeutung behandelt. Einführend werden die neuen medizinischen Erkenntnisse und Überlegungen zum Sterben dargestellt; diese Informationen sind notwendig, um ein würdiges Sterben zu ermöglichen. Ebenso werden Hospizarbeit und Palliativpflege vorgestellt und erläutert. Im Mittelpunkt dieses Ratgebers stehen heilsame Rituale, die bei der Begleitung eines sterbenden Menschen hilfreich sind; besonders wertvoll sind dabei die evangelische, katholische und buddhistische Sicht spiritueller Sterbebegleitung, auf die das Buch eingeht. Berichte und Erfahrungen von Menschen, die in der Familie, im Beruf oder im Ehrenamt andere Menschen begleitet haben, runden dieses Buch ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Gerda und Rüdiger Maschwitz
Spirituelle
Sterbebegleitung
• Umgang mit Sterben, Tod und Abschied
• Heilsame Rituale und Gebete
• Erfahrungsberichte aus Familie, Beruf und Ehrenamt
Haben Sie Fragen an Gerda und
Rüdiger Maschwitz?
Anregungen zum Buch?
Erfahrungen, die Sie mit anderen teilen möchten?
Nutzen Sie unser Internetforum:
www.mankau-verlag.de/forum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gerda und Rüdiger Maschwitz
Spirituelle Sterbebegleitung
• Umgang mit Sterben, Tod und Abschied
• Heilsame Rituale und Gebete
• Erfahrungsberichte aus Familie, Beruf und Ehrenamt
E-Book (epub ): ISBN 978-3-86374-094-8
(Druckausgabe: ISBN 978-3-86374-092-4, 1. Auflage 2013)
1. Auflage März 2013
Mankau Verlag GmbH
Postfach 13 22, D-82413 Murnau a. Staffelsee
Im Netz: www.mankau-verlag.de
Internetforum: www.mankau-verlag.de/forum
Lektorat: Josef K. Pöllath, Dachau
Endkorrektorat: Dr. Thomas Wolf, MetaLexis
Gestaltung Umschlag: Andrea Barth, Guter Punkt GmbH & Co. KG, München
Typografie und Satz: Catherine Avak, München
Umschlagabbildung: © Elena Ray / shutterstock
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Hinweis für die Leser :
Die Autoren haben bei der Erstellung dieses Buches Informationen und Ratschläge mit Sorgfalt recherchiert und geprüft, dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Verlag und Autoren können keinerlei Haftung für etwaige Schäden oder Nachteile übernehmen, die sich aus der praktischen Umsetzung der in diesem Buch vorgestellten Hinweise und Ratschläge ergeben.
»Sterbende brauchen keinen Rat, keine Ermahnung, vielleicht nicht einmal ein tröstendes Wort. Sie brauchen nur unsere Präsenz, unser Ausharren, vielleicht unsere Hand, gewiss unser stilles Gebet. Wenn es nur viele Angehörige von Sterbenden wüssten, wie wenig notwendig ist, um Sterbenden nahe zu sein, anstatt vor ihnen zu fliehen, aber wie wichtig gerade dieses wenige ist.«
Günther Schulz /Jürgen Ziemer
Inhalt
Leben, um zu sterben –sterben, um zu leben
Die Herrin des Todes und ihr Patensohn
Sterben ist einmalig
Wann beginnt das Sterben?
Einmal noch will ich den Sonnenaufgang fangen
Medizinisch das Sterben begleiten
Medizinische Erkenntnisse der letzten Jahrezum Sterben
Das medizinische Wissen heute
Am Anfang des Sterbens
Der Prozess des Sterbens
Rechtliche und ethische Probleme am Lebensende
Zur Palliativmedizin
Sterbehilfe
Wann beginnt Sterbebegleitung?Wie lange dauert sie?
Überlegungen nach dem Bericht über die Begleitung von O.
Phasen des Sterbens
Würden Sie einen Sterbenden begleiten?
Die Aufgabe, einen Sterbenden zu begleiten
Wer bestimmt die Art und Weise der Begleitung?
Was mache ich, wenn ich um Begleitung gebetenwerde und eigentlich gar nicht will?
Welche Kompetenz ist für die Begleitungnotwendig?
Wie viel Wahrheit braucht und verträgtder Sterbende?
Begleitung bei Konflikten
Spirituelle Begleitung – was ist das?
Sterbebegleitung ist spirituelle Begleitung
Tod und Leben – eine der religiösen Grundfragen
Spirituelle Begleitung als geistliche Begleitung
Gott ist ein begleitender Gott
Höllische und heilsame Urbilder
Spirituelle Sterbebegleitung undchristliche Tradition
Begleitung als spiritueller Erfahrungsweg
Was können wir tun?
Für den Begleiter und die Begleiterin
Einübung in die Kunst des Sterbens
Annäherung
Friedvolles Sterben
Schritte eines möglichen Sterbeprozesses
Phasen des Sterbe- und Werdeprozesses
Betrachtungen zu den einzelnen Sterbephasen
Der Weg zum Tor der Geburt
Rituale und Übungen – Was wir tun können
»Nimm alles von mir, was mich hindert – zu leben und zu sterben!«
»Gib alles mir, was mich fördert zu Dir – zum Leben und zum Sterben«
»Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen Dir«
Ich sage Ja und Amen
Für und mit dem Begleiteten
»Sieh mich! Würdige mich! Lass mich!«
Kraftvolle Zeichen im Übergang, besonders in der katholischen Tradition
Orte und Möglichkeiten der Begleitung
Im Krankenhaus
Tätigkeitsfelder und Kompetenzen der Krankenhausseelsorge
Palliativarbeit
Palliativmedizin und Begleitung
Die Hospizarbeit
Was ist ein Hospiz?
Geschichte der Hospizarbeit
Fragen zur Hospizarbeit
Rituale: Ein Mensch verstirbt – Angebote im stationären Hospiz
Erfahrungen in der Begleitung im Hospiz – Spiritualität in der Sterbebegleitung
Begleitungen und Erfahrungen im Hospiz
Begleitung im Hospiz mit Zen- bzw. buddhistischer Prägung
Begleitung in und durch die Familie
Erfahrungen: Wenn ich an das Sterben meiner Eltern denke. . .
Bericht über eine Begleitung im häuslichen Umfeld
Besondere Begleitungssituationen
Demenz – das Krankheitsbild
Beginnende Demenz
Sterbebegleitung, bei der keine Sterbebegleitungmöglich war
Imagination – nach einer nicht möglichen Sterbebegleitung
Imagination des Abschiedes
Sterbebegleitung, Beerdigung und Trauer begleitung
Sterbe- und Trauerbegleitung
Sterbebegleitung und Beerdigung
Sonderfälle der Begleitung undAnregungen
Begleitung im Frühherbst
Meine erste Sterbebegleitung – Erfahrungsbericht
Nicht den Humor verlieren
Nach-Ruf
Anhang
Ausgewählte Literatur
Autorinnen und Autoren
Quellenvermerk
Stichwortverzeichnis
Hinweis
Der besseren Lesbarkeit
halber haben wir immer
nur ein grammatikalisches
Geschlecht verwendet –
also der Seelsorger oder
die Begleiterin –, um solch
mühsame Barrieren, wie zum
Beispiel der Seelsorger/die
Seelsorgerin verabschiedet sich
von seinen/ihren Kollegen/
Kolleginnen zu vermeiden.
Selbstverständlich ist immer
das andere Geschlecht mit
gemeint. Wir hoffen, Sie
haben dafür Verständnis,
denn es gehtschließlich nicht
um einen Gesetzestext oder
eine politische Verlautbarung.
Leben, um zu sterben – sterben, um zu leben
Alles auf der Erde hat seine Zeit,
geboren werden und sterben.
Prediger Salomo 3
Die Auseinandersetzungen mit dem Sterben und dem Tod begleitet uns seit vielen Jahrzehnten, sowohl aus privaten als auch aus beruflichen Gründen.
Nach vielen Beerdigungen, die Rüdiger in seiner Zeit als Gemeindepfarrer gestaltet und verantwortet hat, geriet in dieser Zeit langsam die Sterbebegleitung wieder in den Blickpunkt der Menschen. Anfang der achtziger Jahre erlebten wir Elisabeth Kübler-Ross bei einem Seminar in Lahnstein. Mir (Rüdiger) erging es ähnlich wie Michael de Ridder es in seinem Buch »Wie wollen wir sterben?« beschreibt. Am meisten irritierte mich die Information über die unterschiedliche medizinische und besonders medikamentöse Behandlung der Sterbenden in Deutschland. Ich recherchierte weiter und schrieb dazu einen kleinen Artikel im Gemeindebrief, der eine für ein solches Medium erstaunliche Resonanz erzeugte. Sterbebegleitung geschah in der pfarramtlichen Praxis damals eher selten. Sie erfolgte auf Anfrage und durch Mundpropaganda.
So sprach es sich schnell herum, dass der Pfarrer bereit sei, sich an das Bett eines sterbenden Menschen zu setzen. Die meisten Gespräche über das Sterben geschahen allerdings nebenbei, zum Beispiel bei Geburtstags- oder Hausbesuchen. Manche dieser Besuche sind mir nachdrücklich in Erinnerung. Sie zeigen die Schwierigkeit, über das Sterben zu reden. Ein Beispiel, das andere in ähnlicher Weise erlebt haben, ist symptomatisch für die damalige Einstellung zum Sterben.
Ich besuchte des Öfteren ein älteres Ehepaar. Bei einem Besuch, als der Ehemann auf die Toilette ging, teilte mir die Ehefrau leise mit, dass ihr Mann sterbenskrank sei und nur noch einige Wochen zu leben habe. Sie wollte ihrem Mann aber nichts verraten. Sie hatte die Aussage ihres Arztes so gedeutet: »Es ist besser, wenn ihr Mann nichts weiß.« Als die Frau kurz darauf in der Küche einen Tee bereitete, informierte mich der Mann flüsternd: »Ich bin sterbenskrank, aber meine Frau weiß nichts davon. Sie soll es auch nicht erfahren, sie macht sich sonst zu viele Sorgen.« Er hatte seinen Arzt so verstanden, dass es besser sei, seine Frau nicht zu informieren.
Ich saß da nun zwischen Hilflosigkeit, Ohnmacht und dem inneren Gefühl: »Das darf doch nicht wahr sein!« Ich hatte die Bitte beider im Ohr, dass ich den anderen nicht informieren sollte. Damit ging ich nach Hause. Die Supervision war noch in den Kinderschuhen und der Rat der Kollegen auch nicht hilfreich. Er schwankte zwischen dem Hinweis auf das Beichtgeheimnis und eigener Hilflosigkeit. So entschied ich mich zu einem zweiten Besuch. Ich wurde herzlich empfangen, und beide strahlten mich an. Ich weiß nicht, wer es zuerst sagte: »Wir haben uns miteinander ausgetauscht. Ihr Gesicht signalisierte uns, dass wir miteinander reden müssen.« Ich war erleichtert und erkannte, dass man auch ohne Worte das Wichtige und Richtige vermitteln kann. Bei der späteren Beerdigung nahm ich diese beiden Besuche in der Predigt auf, und dies erwies sich als eine hilfreiche Trauerbegleitung.
Eindrücklich war auch, dass die Lebensqualität der gemeinsamen Zeit (die doppelt so lang war wie der Arzt vermutete) einzigartig war. Beide tauschten sich über ihre gemeinsame Zeit und auch über ihre Ängste und Sorgen aus. Es geschah Abschied, es gab Schmerz und Traurigkeit – aber noch mehr Dankbarkeit.
Heute würde ich wahrscheinlich anders reagieren und bereits beim ersten Gespräch behutsam die Hinweise der beiden Ehepartner aufnehmen und thematisieren. Und ich würde so lange bleiben, bis ein Verständnis und ein Akzeptieren (einigermaßen) möglich wäre. Was besser wäre? Ich weiß es nicht; denn hier gilt: Alles hat seine Zeit!
Dieses Beispiel, in dem es um die Endphase im Leben eines Menschen ging, macht deutlich, dass es ein Leben vor dem Sterben und erst recht vor dem Tod gibt.
Wer die Chance hat, bewusst zu sterben, wird im Sterben leben. Wer lebt, ohne das Sterben mit in das Leben einzubeziehen, der stirbt schon im Leben.
Die Herrin des Todes und ihr Patensohn
Ein Märchen
In welchem Verhältnis stehen Leben und Sterben – Sterben und Leben zueinander? Eine sehr anschauliche Antwort darauf gibt das Märchen von der Herrin des Todes. Das Märchen ist eine Variante oder vielleicht sogar die Ursprungsversion von »Gevatter Tod« der Brüder Grimm.
Die Herrin des Todes und ihr Patensohn
Es war einmal ein armer Mann, der hatte zwölf Kinder. Es bereitete ihm große Mühe, sie alle zu ernähren. Nun gebar ihm seine Frau ein dreizehntes Kind, ein Knäblein.
Darüber war er voller Gram und Sorgen. Traurig ging er seines Weges und wusste nicht ein noch aus. Da begegnete ihm auf einmal eine hohe schöne Frau. Es war die Herrin des Todes. Diese fragte ihn: »Warum, mein Freund, bist du so traurig?«
»Ach, warum sollte ich nicht traurig sein, ich suche einen Paten oder eine Patin für mein neugeborenes Kind. Du musst wissen, ich hab noch zwölf Kinder und kann sie kaum ernähren. Wer kümmert sich nun um dieses, was soll aus ihm werden?«
Die edle Frau antwortete ihm: »Tröste dich, ich will die Patin dieses Knaben sein.«
So geschah es. Die Herrin des Todes hielt jenes Kind über die Taufe. Als der Knabe herangewachsen war, ließ die Patin ihn die Heilkunst lernen, denn er war ein kluger und geschickter Jüngling. Dazu schenkte sie ihm die Gabe, der beste aller Ärzte zu sein. Als er seinen ersten Kranken besuchte, sprach die Herrin des Todes zu ihm: »Mein Sohn, ich möchte dir nun ein Geheimnis anvertrauen: Immer wenn du an ein Krankenlager gerufen wirst, werde ich bei dir sein. Niemand außer dir aber wird mich sehen können. Wenn ich am Kopfende des Bettes stehe, so wird der Kranke nicht genesen. Siehst du mich aber am Fußende stehen, so wird der Kranke gesund, so schwer sein Leiden auch sein mag.«
Auf diese Weise gelangte der junge Arzt bald zu höchstem Ruhm. Er konnte alle Kranken heilen, von denen er sprach, dass sie gesund werden würden.
Eines Tages wurde die Tochter des Königs schwer krank. Der König, der von dem großen Ruf des jungen Arztes gehört hatte, ließ ihn herbeiholen. Er sprach zu ihm: »Wenn es dir gelingt, meine Tochter zu heilen, so sollst du sie zur Frau bekommen.«
Der junge Arzt wurde in das Gemach der Königstochter geführt. Als er an ihrem Krankenbett stand, war er ergriffen von ihrer großen Schönheit und gewann sie sogleich lieb. Aber er sah, dass die Herrin des Todes zu Häupten der schönen Prinzessin stand. Da wusste er sich keinen Rat. Lange dachte er nach, wie da zu helfen wäre. Endlich kam ihm der rettende Gedanke: Er ließ vier starke Männer kommen, und diese mussten das Bett mit der Prinzessin drehen, sodass die Herrin des Todes nun zu den Füßen stand.
So kam es, dass die Königstochter wieder zu Kräften kam und gesund wurde. Wie er es versprochen hatte, gab der König seine Tochter dem jungen Arzt zur Frau. Noch dazu überhäufte er ihn mit Schätzen. Das Paar lebte sehr glücklich.
Die Herrin des Todes aber, die getäuscht worden war, ließ ihren Patensohn zu sich rufen und nahm ihn mit in ihr unterirdisches Gewölbe. Dort, in jenem Gewölbe befinden sich die Lebenslichter aller Menschen. Der junge Arzt sah all die brennenden Kerzen. Die Herrin des Todes sprach: »Ich verzeih dir, denn es war die Liebe, die dich bewog, mich zu überlisten. Aber wenn du es noch einmal wagst, so werde ich dich wieder in mein Reich unter der Erde mitnehmen, dieses Mal aber wirst du dann sterben.«
Lange Jahre lebte der Arzt glücklich an der Seite der schönen Königstochter. Eines Tages aber wurde der König schwer krank. Er ließ seinen Schwiegersohn, den Arzt, kommen. Dieser sah, dass die Herrin des Todes am Kopfende des Lagers stand. Weil er aber seinen Schwiegervater retten wollte, achtete er die Worte seiner Patin nicht und ließ das Bett in gleicher Weise drehen, wie er es einst bei seiner Frau getan hatte. Da genas der König und gab dem Arzt die höchsten Ehren.
Die Herrin des Todes aber holte ihren Patensohn noch am selben Tage ab und führte ihn in ihr unterirdisches Reich. Sie sprach zu ihm: »Du hast dein Versprechen nicht gehalten und hast meine Güte missbraucht. Siehst du die Kerze, die fast abgebrannt ist? Dies ist dein Lebenslicht.«
Im selben Augenblick flackerte die Kerze ein letztes Mal auf und erlosch. Da musste der Arzt sterben. Wenn er auch reich und mächtig war, wenn er auch der Patensohn der Herrin des Todes war, so half ihm das doch alles nichts. Und so nimmt die Herrin des Todes alle Menschen zu sich, bis auf den heutigen Tag.
Übersetzt von Sigrid Früh
Bei diesem Märchen gibt es einige Veränderungen gegenüber der Version der Brüder Grimm. Die wichtigste wird schon in der Überschrift deutlich: Der Tod ist eine Frau. Dies nimmt dem Tod den Aspekt der männlichen Macht. Die Frau strahlt mütterliche Geborgenheit aus, aber auch sie verändert die letzten Spielregeln des Lebens nicht. Der Tod kommt. Für unseren Zusammenhang verdeutlicht das Märchen vier Aspekte:
Wer den Tod anschaut, wird leben
Das Patenkind erkennt genau, wer sterben muss und wer leben kann. Steht der Tod am Fußende des Bettes, und der Patient sieht ihn an, wird der Kranke leben. Wer den Tod nicht anschaut (der Tod steht schon hinter dem Menschen – welch Doppelsinnigkeit), wird sterben. Das Hinschauen des Menschen, das Betrachten des Todes verhilft zum Leben. Dieses Märchen enthält also die Einladung, im Leben dem Tod gegenüberzutreten. Wir leben oft so, als ob der Tod nicht existiere. Er wird verdrängt oder aus dem Leben ausgeklammert. In Wirklichkeit steht er – wie im Märchen – schon lange bei uns.
Wer liebt, kann die Bedingungen (manchmal) verändern
Das Patenkind dreht bei seiner großen Liebe das Bett um. Der Tod kann nun angeschaut werden. Auch hier ist spannend, dass der Mensch gesund wird und leben kann, wenn er dem Tod ins Gesicht sieht. Die Sterbebegleitung, die das Patenkind der Herrin des Todes (also der Arzt) übernimmt, konfrontiert den geliebten Menschen mit dem Tod, und dies wirkt sich heilsam aus. Wenn wir diese Situation einmal übertragen, bedeutet dies, dass wir auch geliebten Menschen das Wissen über Sterben und Tod zumuten dürfen und sollen. Die Liebe vertraut, hofft und verändert.
Der Begleitende lernt, den Tod wahrzunehmen
Was in diesem Märchen geschieht, erachten wir vielleicht als selbstverständlich. Das Patenkind, sprich der Arzt, muss den Menschen anschauen und den Tod wahrnehmen. Beides will gelernt und gewagt werden. In unserem Alltag ist dies keine durchgehende, allerdings eine mögliche Praxis. Mir ist es oft so gegangen, dass ich den Tod im Zimmer antraf. Dies war kein Sehen des Todes am Bett, sondern ein Wahrnehmen des Todes in Raum und Zeit, sprich im Gesicht des Menschen oder in der entsprechenden Atmosphäre im Raum. Viele Ärzte, viele Krankenschwestern, viele Begleiterinnen im Hospiz können von ähnlichen Erfahrungen berichten. Der Tod hat seine eigene Atmosphäre. Als meine Mutter starb, wies uns eine vertraute Schwester mit ihrer Kompetenz und ihrer Erfahrung auf den nahen Tod hin. Und sie hatte Recht. Uns half dies im Abschied.
Kein Mensch kann dem Tod entkommen
Der Tod lässt sich nicht austricksen. Weder mit Geld für die beste medizinische Behandlung noch mit Frömmigkeit, die alles tut was Gott vermeintlich will, noch mit der Verpflichtung gegenüber anderen Menschen. Der Patensohn fühlte sich vielleicht dem König verpflichtet, vielleicht war er ihm auch innerlich sehr verbunden und dankbar. Er wollte ihn vor dem Tod bewahren, er wollte ihn nicht gehen lassen und konnte ihn nicht freigegeben. Vielleicht wollte er auch seiner Frau einen Gefallen tun. Wer weiß? Aber der Tod kommt, unweigerlich, und erreicht jeden.
Sterben ist einmalig
Es gibt zwei Fragen, die zum Sterben immer wieder gestellt werden: Wie ist das Sterben? Wie wird mein Sterben sein? Die beiden Fragen sind ähnlich und werden von Menschen jeden Alters gestellt. Natürlich spitzen sich diese beiden Fragen in einer akuten Situation zu. Doch es gibt dazu nur eine Antwort: Sterben ist einmalig, ganz im Sinne des Wortes. Jeder Mensch stirbt einmal. Darüber hinaus ist jedes Sterben eines Menschen in seiner Art und Weise einmalig. Jedes Sterben ist einzigartig. Manchmal ähnelt sich etwas, im Grunde genommen lässt sich aber keine Art und Weise des Sterbens vorhersagen. Ich habe Menschen erlebt, da dachte ich, sie sterben in Frieden und völliger Gelassenheit, und dann war es ein schweres Sterben voller Kampf und Festhalten. Bei anderen Menschen erwartete ich eher diesen Kampf, und sie starben in Frieden und tiefer Stille.
Diese Erfahrung »Sterben ist einmalig und höchst individuell« gilt ganz unabhängig vom Glauben und vom Vertrauen zu Gott; sie gilt unabhängig von einer langen Meditationspraxis, und erst recht ist sie unabhängig von jedem Alter.
Dabei ist es wichtig, das eigentliche Sterben von den Sterbemöglichkeiten, die es im Leben immer wieder geben kann, zu unterscheiden. So können schwere Verletzungen durch Unfälle, Krankheiten wie Herzinfarkte, schwere Lungenentzündungen, Folgen von Thrombosen und Ähnliches mehr an den Rand des Todes führen. Dank der Fortschritte in der Medizin, aber auch aufgrund der inneren Kraft des vom Tode Bedrohten kann sich dies aber auch noch einmal wenden und der Mensch ins Leben zurückfinden.
So haben wir es erfahren, als meine Mutter nach einem Unfall im Sterben lag (→ Seite 46 ff.). Als wir bei ihr im Krankenhaus waren, rüttelte eine der Enkelinnen ganz erschüttert und heftig an ihrem Bett und rief: »Du darfst noch nicht sterben, du musst doch bei meinem Fest dabei sein.« Die Botschaft erreichte sie. Sie war mit einem Schlag hellwach und schaute ihre Familie an. Gegen alle Wahrscheinlichkeit gesundete sie. Von dieser Frau gibt es noch einen zweiten Bericht. Ein halbes Jahr bevor sie in aller Stille und in tiefem Frieden wirklich starb, drohte sie zu ersticken. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, und der leitende Chefarzt sagte auf Lateinisch etwas über ihren Zustand.
Vielleicht gebrauchte er das Wort »prämortal«. Die alte Frau konnte Latein, hörte dieses Wort und verstand es anscheinend. Sie zuckte zusammen und machte die Augen auf. Sie erholte sich, stand später wieder auf und lebte noch ein halbes Jahr.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass nicht jeder Sterbeprozess zum Tod führt. Menschen können Sterbeerfahrungen machen und dabei nicht sterben. Manche von ihnen haben in eindrucksvollen Berichten ihre Nahtod-Erfahrungen geschildert (Moody). Sie wussten danach etwas über den Sterbeprozess und konnten es mitteilen, aber über ihr letztes Sterben und den Tod sagte es nichts aus. Sterben ist und bleibt einmalig.
Wann beginnt das Sterben?
Eine weitere Frage, die immer wieder gestellt wird, lautet: »Wann beginnt das Sterben?« Meist ist damit auch eine Altersfrage verbunden: »In welchem Alter beginnt das Sterben?« Manchmal ist auch gemeint: »Kann man erkennen, wann bei einem Menschen der eigentliche Sterbeprozess einsetzt?« Dieser Frage gehen wir weiter unten nach.
Oft steht hinter der Frage: »Wann beginnt das Sterben?«, die Hoffnung, dass man das Leben von dem Sterben abgrenzen kann. Dahinter steht die Erfahrung, dass viele Menschen sich ab Mitte 50 und ab Anfang 60 mit dem Älterwerden beschäftigen. Wer akzeptiert, dass er älter geworden ist, wird sich meist auch mit dem Tod auseinandersetzen oder, als gegenteilige Möglichkeit, versuchen, ihn aus dem Leben herauszuhalten. Dann begegnen uns ältere Menschen, die in Kleidung und Styling nicht älter werden wollen. Die alte Spruch: »Von hinten Lyzeum (Schule), von vorne Museum«, trifft in vielen Fällen zu. Der Mensch will nicht älter werden, um nicht zu sterben.
Dabei beginnt das Sterben eigentlich schon vor der Geburt (→ Seite 28 ff.). Mit dem Geborenwerden gehen wir stetig auf den Tod zu. Das gilt für uns alle und ganz allgemein. Aber auch konkret kann uns der Tod jederzeit treffen. Viele Menschen haben Angst, nicht alt zu werden, etwas vom Leben zu verpassen. Dabei kann die Angst so lähmen, dass sie das Leben heute wirklich verpassen. Wer sich bewusst ist, dass allein durch unsere Umwelt, durch die Teilnahme am Straßenverkehr oder durch andere äußere und innere Faktoren der Tod jederzeit möglich ist, lernt den Tag schätzen. Die Zahl der Tage oder Jahre sagt nichts aus über unsere Lebensqualität.
Dag Hammarskjöld sagt in seinem Tagebuch: »Noch einige Jahre, und dann? Das Leben hat nur Wert durch seinen Inhalt – für andere. Mein Leben ohne Wert für andere ist schlimmer als der Tod.«
Trotzdem trifft es uns immer wieder besonders, wenn ein Mensch vor der Zeit gehen muss, vor allem wenn es noch ein Kind ist. Doch auch hier liegt der Wert des Lebens nicht in den gelebten Jahren. Natürlich muss ein Kind nicht wissen, dass es sterben kann. Es drängt nach außen und will die Welt erkunden, sich seinen Platz suchen, sich entwickeln und sich die Zukunft vorstellen. Dies ist die eine Seite. Auf der anderen Seite aber sind Kinder schrecklich realistisch. Meine Erfahrungen mit todkranken Kindern zeigen, dass die Kinder – egal wie die Eltern sich verhielten – von ihrem nahen Tod wussten.
Eine Geschichte beschreibt dies:
Einmal noch will ich den Sonnenaufgang fangen
Werner war zehn Jahre alt. Er hatte Krebs. Schon ein paar Mal war er für mehrere Wochen in der Klinik gewesen. Er bekam Spritzen, ihm fielen die Haare aus, er hatte Schmerzen, Angst und Hoffnung. Er fühlte sich allein, auch wenn er von seinen Eltern Besuch hatte.
Er hörte den Ärzten zu, wenn sie ihm erzählten, was sie tun wollten. Er tat nichts, was er nicht tun sollte. Schon lang spielte er nicht mehr Fußball, dabei war er vor einem halben Jahr noch der beste Stürmer seiner Mannschaft gewesen. Er wollte gesund werden und fühlte sich immer schwächer. Seine Ärztin tröstete ihn: »Halte durch, wir können es schaffen!« Aus seiner Klasse kamen ihn hin und wieder Kinder besuchen. Manche Kinder durften auch nicht kommen, sie sollten das Elend nicht sehen. »Ich bin kein Elend«, dachte Werner dann, manchmal wurde er richtig wütend. Seit gestern war er wieder in der Klinik. »Die Werte waren nicht gut«, hatten sie gesagt.
Er wollte raus hier, nur ein bisschen spazieren gehen. Leise verließ er das Krankenhaus, er kannte sich aus. Er hatte sein ganzes Geld dabei. Niemand achtete am Hinterausgang des Kinderkrankenhauses auf den Jungen. Still und leise verschwand er. Er lief die Straße entlang und stieg in den Bus, der gerade ankam. Werner sah alles an sich vorbeiziehen . . . So sah er den Bahnhof und stieg aus.
Jetzt wusste er, was er wirklich wollte: Er wollte das Meer sehen, den Sonnenuntergang am Meer. Zu Opa wollte er reisen und allein ans Meer gehen. Es war toll dort. Langsam ging abends rot die Sonne unter, bis sie am nächsten Morgen wieder aufging. Noch nie war er so lang wach geblieben, er wollte jetzt die ganze dunkle Nacht wachen und dem Mond zusehen.
Am Schalter holte er eine Viertel-Kinderkarte, wer noch zwei Schwestern hat, reist billiger. Sein Geld reichte. »Einmal Grömitz – erst Zug – dann Bus«, hatte er gesagt.
Der Beamte lächelte: »Du weißt ja Bescheid. Fährst du ganz allein?« Werner zögerte nicht: »Nein! Ich wollte nur die Karte selbst kaufen.« Und leise sagte er: »Können Sie mir den Bahnsteig und den nächsten durchgehenden Zug sagen, dann weiß ich genauso viel wie die anderen?«
Wie zwei Verschwörer tauschten sich die beiden aus. Werner ergatterte einen Fensterplatz und ließ die Landschaft an sich vorüberziehen. Es reichte gerade noch für den letzten Bus nach Grömitz.
Die Fahrerin weckte den Jungen an der letzten Station: »Sag mal, wer holt dich denn ab?«
Werner erschrak und stotterte: »Mein Opa – Telefon 7890.« Die Fahrerin benachrichtigte die Zentrale per Funk. Sie nahm den Jungen – so groß er schon war – in den Arm und wartete. Opa kam allein. Das war gut. Opa war schon alt, bald 70 Jahre, aber er war stark wie ein Bär.
Werner sah klein aus in seinen Armen, und die Arme waren fest und sicher. »Junge, was machst du denn allein hier?«, hörte Werner jemand sagen. Die Stimme war leise und brüchig. Werner staunte und sah Großvater an: »Ich wollte den Sonnenuntergang an deinem Meer sehen – einmal noch – auf unserem Platz. Und den Sonnenaufgang will ich fangen – ganz allein.«
Opa schaute Werner in die Augen, und Werner sah in Opas Augen Tränen. Werner drückte sich fest an ihn: »Du musst nicht um mich weinen, ich lebe noch ewig.«
Opa atmete tief aus.
Werner sah den feinen Atemhauch weiß in der Abendluft unter der Laterne. Und der Atemhauch löste sich auf. »So wie dem Atem geht es mir auch mal, Opa. Ich werde immer weniger. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe keine Angst.«
Opa schluckte und sah Werner wieder ins Gesicht: »Ich bin über jeden Tag froh, den du lebst.«
»Na klar, Opa – und morgen fange ich die Sonne. Sei nicht traurig – der Tod ist mein bester Freund. Manchmal spricht er abends mit mir. Aber verrate es nicht Mama, Papa, Oma, Kristin und Birgit. Das ist mein Geheimnis.«
Sterben geschieht mitten im Leben. Sterben ist altersunabhängig und jederzeit möglich. Dies vergessen wir verständlicherweise gern, weil wir leben möchten. Aber es gilt die alte Weisheit: Das einzig Selbstverständliche ist der Tod.
Der römische Brunnen
Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt
er voll der Marmorschale Rund,
die, sich verschleiernd, überfließt
in einer zweiten Schale Grund;
die zweite gibt, sie wird zu reich,
der dritten wallend ihre Flut,
und jede nimmt und gibt zugleich
und strömt und ruht.
Conrad Ferdinand Meyer
Medizinischdas Sterben begleiten
Medizinische Erkenntnisse der letzten Jahre zum Sterben
In den letzten Jahren haben sich neue und alte Erkenntnisse der Medizin zum Sterben langsam, aber sicher durchgesetzt. Vor über 20 Jahren, in meiner Zeit als Gemeindepfarrer, begegneten mir in den Gesprächen mit Krankenschwestern, Krankenpflegern und Ärzten oft noch Hinweise auf medizinische Notwendigkeiten, die heute als überholt oder gar falsch gelten.
Ein Arzt und Psychotherapeut verdeutlicht einige dieser neueren Erkenntnisse aus eigener Erfahrung:
Das medizinische Wissen heute
Raimund Hillebrand
Im Jahr 2012 starben innerhalb weniger Monate meine beiden Eltern. Mein Vater starb mit 81 Jahren an den Folgen einer rasch voranschreitenden Demenz. Meine Mutter war 73 Jahre alt, als sie kurz nach meinem Vater an einer Krebserkrankung verstarb, gegen die sie über mehrere Jahre angekämpft hatte.
Im Folgenden will ich versuchen, einige Erfahrungen aus dieser Zeit und das, was an medizinischem Wissen derzeit verfügbar ist, in einem kurzen Überblick zusammenzuführen. Dies ermöglicht das Verständnis für den körperlichen Prozess des Sterbens und kann dabei helfen, sich mit den Erfahrungen und den Entscheidungen, die in einer solchen Situation entstehen, auf andere Weise auseinanderzusetzen.
Es handelt sich jedoch nur um eine kurze Darstellung. Wer sich mit den medizinischen Aspekten ausführlicher befassen möchte, dem seien die Bücher von Gian Domenico Borasio oder Michael de Ridder empfohlen.
Am Anfang des Sterbens
Wann fängt das eigentliche Sterben an? In den siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde im Zusammenhang mit der Diskussion der gesetzlichen Regelungen der Abtreibung ausführlich darüber debattiert, wann das Leben beginnt. Mit der Geburt? Mit der Befruchtung der Eizelle? Mit der Einnistung der Eizelle in die Gebärmutter? Damals wurde schließlich mit der Fristenlösung ein Kompromiss gefunden, der dennoch nach wie vor Anlass zu Diskussionen gibt. Auch die Frage, wann ein Mensch als tot angesehen werden kann, gab und gibt Anlass zu Auseinandersetzungen sowohl im Rahmen der Transplantationsgesetzgebung als auch bei der Frage nach dem Umgang mit Menschen, die aufgrund schwerer Erkrankungen keine erkennbaren Lebensäußerungen mehr zeigen.
Aber wann beginnt das Sterben? Wann setzt der Prozess ein, an dessen Ende der Mensch für uns nicht mehr erreichbar ist, weil alle Vorgänge im Körper des Menschen zum Stillstand gekommen sind?
Als mein Vater Ende 2011 immer deutlichere Zeichen von Vergesslichkeit, Verwirrtheit und Unruhe zeigte und es schließlich zu einem Zustand kam, der zu Hause nicht mehr zu bewältigen war, blieb uns zunächst nichts anderes übrig, als ihn in einer geronto-psychiatrischen Klinik unterzubringen, auch in der Hoffnung, dass sein Zustand sich dort positiv beeinflussen ließe. Die folgenden Wochen waren geprägt von zum Teil hektischen Planungen. Zuerst dachten wir, die Versorgung des Vaters mithilfe eines Pflegedienstes zu Hause im gewohnten Umfeld leisten zu können. Wir nahmen Kontakt zu Krankenkassen und Pflegediensten auf. Dann, als der Zustand sich eher verschlechterte als verbesserte, die Einsicht in die Notwendigkeit der Unterbringung in einem Heim. Neue Kontakte wurden hergestellt, Heime angesehen: Welches ist geeignet, welches scheint uns weniger gut geeignet. Doch kaum schien hier eine Lösung in Sicht, kam es zu einer erneuten Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Mein Vater wollte nicht mehr essen, nahm allenfalls noch kleinste Mengen zu sich. Neue Überlegungen waren nötig: Soll der Vater eine Magensonde bekommen, künstlich ernährt werden. Lässt sich so sein Leben retten? Wir hatten uns, genau wie unsere Eltern, mit diesen Fragen nicht beschäftigt, keine Vorsorge getroffen. Schnell stand die Aussage im Raum: »Wir können ihn doch nicht verhungern lassen!«
Nach vielen Diskussionen, in denen wir Geschwister uns noch einmal sehr nahe kamen, konnten wir uns schließlich dazu durchringen, die Nahrungsverweigerung unseres Vaters, auch wenn er dement zu sein schien, als seine Willensäußerung anzusehen und zu respektieren. Ab diesem Zeitpunkt war uns allerdings klar, dass jetzt das Leben unseres Vaters zu Ende gehen würde.
Im Gegensatz dazu konnte meine Mutter wenige Monate später, nachdem alle Chemotherapien den Krebs in ihrem Körper nicht mehr aufhalten konnten, sehr bewusst sagen: »Ich kann nicht mehr, und ich will nicht mehr.« Das Sterben begann mit der Entscheidung, nicht mehr gegen die Krankheit ankämpfen zu wollen, sondern sie in ihrer Unvermeidlichkeit anzunehmen.