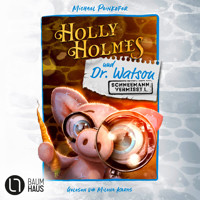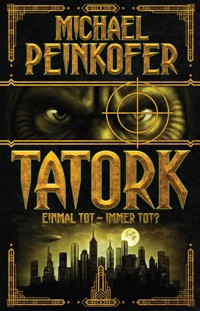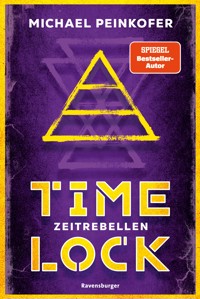9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mit den »Splitterwelten« führt Michael Peinkofer in eine Welt, die in unzählige Teile zersprungen ist. Menschen, Animale und magisch begabte Gildenmeisterinnen haben die Splitter besiedelt, die so fern voneinander liegen, dass Reisen zwischen den Welten nur mit mächtigen Schiffen möglich ist – und mit Magie. Doch umgibt alle Bewohner der Splitterwelten ein Geheimnis, das das Schicksal aller bestimmt. Und der Panthermensch Croy macht sich gemeinsam mit der abtrünnigen Gildenschülerin Kalliope und dem Krieger Erik auf den Weg, genau dieses Geheimnis zu entschlüsseln ... Gemeinsam mit Michael Peinkofer hat Christoph Dittert den langerwarteten neuen Band der Saga entwickelt und führt die Abenteuer um Croy und seine Gefährten fort.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ISBN 978-3-492-97886-6
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhaltsverzeichnis
Cover & Impressum
Lied vom Zerbrechen der Welt
Prolog
Vor sechzehn Zyklen
Buch 1:Mundus Glaciei
Kapitel 1: »Wir sind in Sicherheit« ...
Kapitel 2: Ein Schild ...
Kapitel 3: Das Schwert pfiff ...
Kapitel 4: Die große Halle ...
Kapitel 5: »Ein Schiff kapern«, ...
Kapitel 6: »Karnak sehen und ...
Kapitel 7: Eriks Finger zitterten ...
Kapitel 8: »Willkommen, Kalliope«, sagte ...
Kapitel 9: Aenigma war zufrieden ...
Kapitel 10: Kalliope schämte sich ...
Kapitel 11: Liiak stakste auf ...
Zwischenspiel:
Vor zwanzig Zyklen
Buch 2:Glacies Mundi
Kapitel 1: Kalliope zitterte. Obwohl ...
Kapitel 2: Ungern verließ Aenigma ...
Kapitel 3: Kalliope blendete den ...
Kapitel 4: Aenigma erkundigte sich ...
Kapitel 5: »Zwei Gesamtheiten von ...
Kapitel 6: Das grelle Licht ...
Kapitel 7: »Da ist etwas«, ...
Kapitel 8: Das Krachen, mit ...
Kapitel 9: Harona schwebte – ...
Kapitel 10: Unruhig wälzte sich ...
Kapitel 11: Kalliope atmete die ...
Kapitel 12: »Du möchtest den ...
Kapitel 13: Harona ging auf ...
Kapitel 14: »Wartet«, verlangte ein ...
Kapitel 15: »Stymphalos.« Erik sah ...
Epilog
Personenverzeichnis
Verzeichnis der wichtigsten Weltensplitter
Sieh nur im Schlaf,
die Kugel im schwarzen Seidenmeer.
Das ist gewiss
nur Narretei und Einfaltsträumerei.
Aus dem ›Lied vom Zerbrechen der Welt‹.Gesungen hinter vorgehaltener Hand, im Licht der tiefen Feuer.
Prolog
Vor sechzehn Zyklen
Mit Begeisterung erschuf der junge Mann Ringe von großer Kunstfertigkeit. Er war eher ein Künstler als ein Handwerker. Doch die Kunst allein konnte ihn nicht ernähren, also verdingte er sich damit, Waffen zu schmieden.
Und Schilde.
Vor allem darin brachte er es im Laufe der Jahre zu einer Meisterschaft, die ihresgleichen suchte. Er verfeinerte sie nicht nur im Aussehen und in der Widerstandskraft, sondern fügte nach und nach auch ein Element hinzu, das im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen sprengte.
Wenn es je einen Schildmacher gab, der ein Wunder hervorbrachte, so war er es.
Er wusste, dass er Schilde und Waffen bräuchte, um zu kämpfen – doch er entschied sich dagegen. Hätte er sich doch nur welche beschafft! Vieles wäre anders gekommen. Besser? Vielleicht. Möglicherweise jedoch auch noch schlimmer. Die Zeit der großen Kämpfe war noch nicht angebrochen. Die Bedrohung kroch gerade erst aus den Schatten und musste sich noch offenbaren.
Doch an jenem Tag, als das Licht das – ausnahmsweise geschlossene – Gitter vor seiner Eingangstür glänzen ließ, beschäftigten sich die Gedanken des Schmieds nicht mit Schilden und ihren wundersamen Wegen. Schließlich gab es so viel Wichtigeres.
»Du bist ein Wunder«, sagte er.
Ein Lachen antwortete ihm. Sein Blick fing sich in dem goldenen Haar, das über die Lehne des kargen Stuhles floss. Wie gern hätte er der Geliebten mehr als ein so einfaches Möbelstück geboten. Schließlich verdiente sie einen weichen Sessel, den besten des ganzen Weltensplitters.
»Warum?«, fragte sie schließlich. »Weil sich jedermann darüber wundern muss, wie dumm ich bin?«
»Kein Mann könnte so empfinden«, meinte er. »Höchstens die …«
»Ich weiß!« Sie stand auf. Das grünsamtene Kleid schmiegte sich an ihre Beine. Feine Goldfäden durchwirkten den Stoff. »Nur meine Gildeschwestern. Wobei wundern in ihrem Fall ein viel zu schwaches Wort wäre. Sie würden mich verachten. Oder mich …«
»… ausstoßen?« Die Frage klang ein wenig hoffnungsvoller.
»Mit einer Menge Glück. Allein der Tabubruch, den ich begehe, wenn ich dich auch nur ansehe, ist ungeheuerlich.« Und sie hatten mehr getan, als sich nur anzusehen. Weitaus mehr. Sie spürte es in ihrem Leib. »Der Codex ist in dieser Hinsicht eindeutig.«
»Er ist falsch!«
Sie sah aus, als hätte er sie geschlagen, nein, als wäre dieser Satz in ihrer Seele zu noch Schlimmerem fähig, als die Riemen einer Peitsche mit ihrem Körper anrichten konnten. »Der Codex irrt sich nicht«, sagte sie. »Die Gründerinnen unserer Gilde sind weise gewesen. Vielleicht haben wir nur einige ihrer Aussagen missverstanden. Der heutige Orden der Levitatinnen tradiert Dinge, die …«
»Still!«, unterbrach er und legte den Zeigefinger erst auf die Lippen, dann ließ er die Hand zu seinem Ohr wandern. Er lauschte mit einer übertriebenen Geste, um ihr klarzumachen, dass er es ernst meinte.
Sie bewegte sich nicht mehr, und das Einzige, das sie jetzt hörte, war ihr eigener Herzschlag. Einen Atemzug lang. Zwei Atemzüge. Der Rhythmus des Pochens beschleunigte sich.
Der Blick des Schmieds wanderte umher. Zuerst zum Ofen, als befürchte er, dass mitten aus dem gemauerten Rauchabzug ein Scherge in die glühenden Kohlen springen könnte. Danach zum Fenster und seinen geschlossenen hölzernen Läden, die nur winzige Ritze ließen. Schließlich entlang der Lichtstrahlen, in denen Staub irrlichterte, bis zur Tür.
»Das Gitter ist doch verriegelt?«, fragte sie leise. Sie konnte die Angst nicht abschütteln und fühlte sich noch mehr als sonst verfolgt. War es tatsächlich nur Einbildung, dass jemand sie beobachtete? Oder ein … etwas? Hatte sie tatsächlich jemand verfolgt, schon seit sie Ethera verlassen hatte, jene lichte Welt der Gilde, um die kurze Strecke zum Weltensplitter Zorane zu reisen?
Er nickte. »Niemand kann herein.«
»Wovor hast du also Angst? Was hörst du?«
»Nichts.«
»Aber …«
In seinen Augen lag Belustigung. »Ich wollte nur nicht, dass du weiter über die Gilde und deine Schwestern sprichst. Es ist nun mal kein Thema, an dem sich mein müdes Herz erfreut!«
Vor Verblüffung stand ihr Mund offen, als sie auf ihn zurannte und ihm gegen die Schulter boxte. »Du bist …«
»… derjenige, der dich liebt, das weißt du. Der euch liebt.« Sein Blick wanderte nicht mehr durch den Raum, sondern über ihren Körper und hin zu ihrem Bauch.
»Lass uns fortgehen«, bat er. »Für immer.«
»Das kann ich nicht. Ich bin eine Gildeschwester, und es ist meine Pflicht, das auch zu bleiben. Vielleicht können meine Erkenntnisse etwas verändern. Möglicherweise ist es meine Aufgabe, mit meinem Leben einen Unterschied zu machen. Die Wende einzuleiten. Ich sehe Dunkelheit am Horizont, und schon bald wird sie sich nähern. Alle müssen die Wahrheit hören, sonst stürzen die Weltensplitter des Sanktuarions ins Chaos!«
»Die Wahrheit? Niemand interessiert sich dafür. Keiner wird sie uns glauben!«
»Dann beweisen wir sie!«
»Wie sollen wir das tun, da wir sie selbst doch nur in Ansätzen verstehen?«
Für kurze Zeit schwiegen sie, lauschten allein dem Atem des jeweils anderen. Irgendwo neben ihnen knackte es im Holz der Schmiede. Eine kleine Echse huschte auf ihren sechs Beinchen über die Decke.
»Fühlst du den Frieden?«, fragte sie.
Er antwortete, indem er seine Stirn an ihre legte.
»Es lohnt sich, für die Wahrheit einzutreten«, sagte sie. »Zu kämpfen, wenn es nötig ist.«
Er löste sich von ihr und nahm einen Schlüssel aus der Kommode, die dem Schmiedeofen gegenüberstand. »Gehen wir.«
»Wohin?«
»Auf die Suche nach … mehr Wahrheit.«
»Es zieht dich zu deinem Schild?«
»Komm.« Er streckte die Hand aus.
Sie ergriff sie, hielt sie einen kostbaren Augenblick lang, ehe sie sich abwandte, leichtfüßig durch den Raum eilte und die unscheinbare graue Kutte nahm, die sie auch auf dem Weg zu ihm getragen hatte. Dann schlüpfte sie hinein. Der Stoff verbarg ihr edles Kleid vollständig, und nichts mehr erinnerte an die schlanke, elegante Gildeschwester, zu der nahezu jeder ehrfürchtig aufgesehen hätte.
Ihre Haarflut verschwand unter der ausgefransten Kapuze, und ein dunkles, breites Stirnband ließ kaum etwas von der hellen Gesichtshaut frei. Sie wirkte nun wie einer dieser schlichten Handwerker, die überall in der Stadt unterwegs waren, um Botengänge zu erledigen oder sich eine Arbeit für den nächsten Tag zu suchen – also wie eine der Gestalten, die niemand wahrnahm, weil niemand sie wahrnehmen wollte. Seite an Seite traten sie in die Gassen, ein Meister und sein Gehilfe, wie es aussah. Bald darauf wäre niemand mehr auf den Gedanken gekommen, sie könnten zusammengehören. Der Schmied ging voraus, die maskierte Gildeschwester folgte ihm in großem Abstand.
Wieder fühlte sie sich verfolgt und fragte sich, ob sie sich das nur einbildete.
Sie passierten die feinen Geschäfte und die gewundenen Brückenhäuser des edelsten Stadtteils, in dem goldene Zinnen die höchsten Türme krönten. Menschen in teuren Gewändern und mit kostbarem Schmuck flanierten zwischen Tischen, auf denen Waren aus zahllosen Weltensplittern feilgeboten wurden. Ritueller Haarschmuck der wichtigsten Clans von Drumlin, Schattenfrüchte aus Ayforas, Heilwasser aus den Klüften von Hydara, Kunsthandwerk aus Khorat … und es nahm kein Ende. Letztlich verdankte sich auch dieser Markt der Gilde, denn die Schwestern ermöglichten dank ihrer Gabe der Levitation überhaupt erst das Reisen zwischen den Splittern. Ohne sie wäre der Austausch von Handelsgütern und kulturellen Eigenarten gar nicht möglich gewesen.
Und vielleicht, dachte die Gildeschwester bange, wäre auch das dunkle Etwas nicht in der Lage, sich über alle Welten auszubreiten, wie ich es für die Zukunft erahne.
Sie schalt sich selbst für diese frevlerische Überlegung. Gewiss, indem sie sich einem Mann in Liebe zuwandte, brach sie eine der wichtigsten Regeln des Codex … aber dadurch geriet ihr eigenes Gleichgewicht nicht aus dem Takt, im Gegenteil, es bewahrte ihre Balance sogar in vollendeter Harmonie. Ohne diese Liebe wäre sie niemals so ausgeglichen und stark. Nicht umsonst galt sie als eine der talentiertesten Levitatinnen dieser Generation.
»Frisch aus Pilar!«, hörte sie, während eine schmalfingrige Hand an ihrer Kutte zupfte. »Von Steinmetz Shoran persönlich! Du hast gewiss noch nie von ihm gehört, womöglich aber dein Herr, dem du …«
Sie riss sich los und eilte davon.
»He!«, rief ihr der Händler hinterher. »Bursche, was erlaubst du dir?«
Bursche. Großartig. Der allzu aufdringliche Verkäufer hielt sie für einen Mann. Er würde diese kleine Begegnung vergessen, sobald er sich seinem nächsten Kunden widmete. Er wäre erstaunt gewesen, wenn er wüsste, dass dieser Bursche sogar schon Pilar besucht hatte – einen eher kargen Weltensplitter voller Steinbrüche, die den herrlichsten Marmor bargen: weiß und schwarz verflochten, mit braunen Adern, aus denen sich die wunderbarsten Figuren formen ließen.
Ihr Blick huschte so lange hin und her, bis sie den Geliebten wiederfand, der gerade um eine Ecke bog und damit den Markt und seine tausend Besucher hinter sich ließ. Erst als die vielen Düfte und der rauschende Lärm weit zurückblieben, wurde der Gildeschwester klar, wie herrlich ruhig es hier war.
Eine Wohltat.
Ihr Geliebter erreichte ein steinernes Gebäude, in das seine Schmiede ein Dutzend Mal hineingepasst hätte. Ein winziger Teil davon gehörte ihm – eine Halle, in der er Rohmaterial, aber auch so manche bereits gefertigte Lanze lagerte.
Die Gildeschwester kannte diesen Raum bereits seit ein paar Wochen. Sie dachte nach. Ja, es war gut möglich, dass das neue Leben in ihr bei ihrem ersten Besuch an diesem Ort entstanden war.
Er schloss auf, trat ein und lehnte die Tür hinter sich nur an. Wenige Sekunden später schlüpfte sie ebenfalls hindurch.
»Hier?«, flüsterte sie. »An einem so ungesicherten Ort versteckst du den Schild? Ist das nicht zu riskant?«
»Niemand weiß doch um seine Bedeutung. Selbst die Erhabene Mutter und alle Numeratae der Gilde gemeinsam würden nicht erkennen, was vor ihnen liegt, wenn sie den Schild vor Augen hätten.«
»Bist du sicher?«
Er zögerte. »Ich hoffe es. Woher sollten sie …«
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Zeig ihn mir doch.«
Er führte sie an das Ende seines Lagerraums, schob Kisten beiseite und kramte in einem Berg aus misslungenen Schwertern. Oder solchen Stücken, die er für misslungen hielt – andere Schmiede hätten sie wohl als Waffen erster Güte veräußert. Metall und Eisen klirrten, und ein schweres Kettenhemd rasselte auf dem Boden.
Darunter lag der Schild, so groß, dass er eines bulligen Mannes Brustkorb schützen konnte. Doch er war gar nicht für den Kampf gefertigt. Vollkommen gerundet und nach oben gewölbt, zierte ein goldenes Symbol seine Vorderseite: zwei Halbkreise, deren Außenseiten sich an einem Punkt berührten, den wieder eine Linie durchschnitt.
Das blanke Metall glänzte, und ein kaum merkliches Summen ging davon aus. Es war so leise, dass sich die Gildeschwester unwillkürlich fragte, ob sie es sich nur einbildete, weil sie es zu hören erwartete. Der Schild war dermaßen glatt poliert, dass sie sich wie in feinstem Glas darin spiegelte. Doch vor allem sah sie ihren Geliebten, seine starken Wangenknochen, die dünnen Lippen und das wenige Haar, das ihm trotz seiner jungen Jahre geblieben war.
»Schön«, sagte sie.
»So?« Der Schalk sprach bereits aus diesem einen Wort. »Du findest mich also schön? Oder sprecht Ihr von Euch selbst, hehre Schwester?«
»Du bist …«
»Ich weiß«, unterbrach er schnell. »Und gern würde ich mit dir hier zurückbleiben und scherzen, aber ich muss jetzt gehen.«
»Warum die plötzliche Eile?«
»Nicht nur du hast mich verfolgt.«
»Was?« Mit einem Mal war wieder die Bedrückung da, die Angst.
»Ich weiß nicht, wer es gewesen sein mag«, gab er zu. »Doch da war jemand. Oder … etwas? Als hätte ein Raubtier meine Witterung aufgenommen. Oder ein Animale, der sich auf das Jagen versteht.«
»Du wirst durch den Schild gehen?«
»Sind wir nicht deshalb hierhergekommen?«, fragte der Schmied. »Ich würde dich gern mitnehmen, aber deine Entscheidung ist gefallen, das ist mir klar. Doch ehe du zurück in deine Heimat gehst – in die Gilde –, versteck den Schild. Sorgfältig! Bring ihn an einen Ort, wo niemand Zugriff hat, der es nicht wert ist. Auch wenn keiner weiß, wie wertvoll er ist, hier im Lager sollte er auf keinen Fall bleiben.«
Nun erst entdeckte sie den Wasserschlauch in seinen Händen, gefertigt aus dem besten Leder und dabei so groß, dass ein Mensch ein oder zwei Tage darin ausreichend Flüssigkeit finden würde. Er öffnete ihn. »Dreh den Schild«, bat er.
Sie gehorchte und legte die gewölbte Seite nach unten, sodass er das Wasser wie eine Schüssel aufzunehmen vermochte, das der Schmied in ihn hineingoss.
Es knackte, draußen vor der Tür. Ein schrilles, kreischend keckerndes Geräusch erklang, gefolgt von einem düsteren Wort voller tödlich dunkler Bedrohung: »Hier …« – »Gut«, herrschte eine klare, weibliche Stimme das Wesen an, das den Laut ausgestoßen hatte. »Geh nun.« Das Scharren und Trippeln vieler Beine folgte.
Während sich die Gildeschwester umdrehte, um zu lauschen, verlor der Schmied diese kostbaren Sekunden nicht. Als sie sich ihm zuwandte, war er bereits bis zur Hüfte im Schild verschwunden. Der Tunnel waberte um ihn herum und verschlang ihn ebenso wie das Wasser, das die Verbindung offen hielt.
»Du weißt, was du zu tun hast«, hörte sie noch, ehe sich ihr Geliebter endgültig fallen ließ.
Sie blickte in die gähnende Öffnung, die sich tief in die Innereien dieses Weltensplitters zu erstrecken schien. In Wirklichkeit führte sie an einen ganz anderen Ort. Der Schmied hatte die weite Reise angetreten.
Der letzte Wassertropfen verschwand in dem unergründlichen Abgrund, und der Tunnel schloss sich.
Der Schild blitzte im Licht, das durch die Tür fiel, die plötzlich aus den Angeln flog. Eine junge Frau trat herein, die offenbar von jener Kreatur geführt worden war, die sich die Gildeschwester nicht vorstellen wollte – wenngleich das eine Wort, der bösartige Laut noch immer in ihrem Kopf widerhallte: »Hier …«, hervorgestoßen aus einer Kehle, die einem Animalen oder etwas noch viel Schlimmerem gehören mochte.
»Wo ist er?«, rief die Frau voller Wut.
Natürlich erkannte die Gildeschwester sie sofort, war sie doch eine ihrer Schwestern, und sie wusste, dass sie einige Erklärungen abgeben musste. Aber das schreckte sie nicht. Alles war plausibler als das, was sich soeben tatsächlich ereignet hatte. Sie schlug die Kapuze zurück. »Von wem redest du, meine Liebe?«, fragte sie. »Und was treibt dich an diesen Ort?«
»Lass das! Wo – ist – er?«
Sie wandte den Blick von dem Schild, schließlich durfte sie die andere nicht erst darauf aufmerksam machen. Er musste ein beliebiger Gegenstand sein, so wie die hundert oder tausend übrigen in der Lagerhalle auch. »Noch einmal: Von wem redest du?«
Die eben erst erschienene Gildeschwester kam noch etwas näher und jetzt funkelte Zorn in ihren eisfarbenen Augen. Schwarze Federn zierten ihr dunkles Gewand. »Ich werde die Wahrheit herausfinden!«
»Die Wahrheit?« Sie dachte an das Gespräch, das sie mit ihrem Geliebten geführt hatte, ehe er durch den Schild entschwunden war, auf die andere Seite. »Oh ja, an der Wahrheit ist mir auch gelegen, liebste Harona.«
Buch 1:
Mundus Glaciei
»Wenn der Sohn beider Welten offenbar wird
und der Untergang im Sturmwind kommt,
beginnt der Kampf,
der über das Schicksal bestimmt.
Der Sohn
und der Große,
nur einer soll leben
und herrschen.«
Aus dem steinernen Buch
Kapitel 1
»Wir sind in Sicherheit«, sagte Erik, der Prinz von Jordråk. Kalliope fand, dass er nicht so klang, als würde er an seine eigenen Worte glauben. »Wir haben es geschafft.« Er sah müde aus und in einer solchen Umgebung hätte man keinen Prinzen erwartet: Es war dunkel, unbequem und elendig kalt.
Grob behauenes Gestein bildete in diesem Geflecht aus versteckten Gängen und Tunneln den Boden, die Wände und die Decke. Kalliope stand dicht bei Erik, dem Einzigen in der Runde, den sie kannte. Falls sie ihn wirklich kannte. All die anderen waren auf unbegreifliche Weise an diesen Ort gekommen – durch den Schild, den Erik und sein Vater, Fürst Thor Magnusson, in einer verborgenen Höhle als wertvollen Schatz gehütet hatten, und zwar inmitten einer Eissäule.
Von den Neuankömmlingen wusste Kalliope wenig mehr als die Namen, und sie hoffte, ihnen vertrauen zu können. Es blieb ihr allerdings kaum eine andere Wahl, und zumindest im Fall des Menschenjungen Kieron fühlte sie, dass sie es durfte. Zugleich zweifelte sie jedoch daran, dass ihre Gefühle einen guten Wegweiser bildeten. Zu oft war sie gerade durch sie in letzter Zeit in eine heillose Verwirrung gestürzt. Trotzdem wiederholte sie leise Eriks Worte, wie um sich selbst Mut zuzusprechen: »Wir haben es geschafft!«
»Ja«, stieß der kleine Chamäleonide namens Jago hervor. »Total und vollkommen großartig hier, da hast du recht! Wir sind im heimeligsten Teil aller Weltensplitter angekommen, es geht uns richtig gut!« Er sah seine Begleiter nicht an, sondern suchte die Wände ab. Eine graue Schabe krabbelte darüber. »Sogar das Essen ist äußerst delikat!« Seine lange Zunge schnellte heraus, klatschte zielsicher auf das Insekt, dessen schwarze Beinchen wimmelten, als das nun zusammengerollte Organ im Mund verschwand. Danach knackte es, einmal, zweimal, und Jago stieß einen Seufzer aus. »So tief bin ich gesunken! Was soll’s, der Hunger treibt’s runter.«
»Hast du keine anderen Sorgen?«, fragte Kieron verärgert. »Erik und Kalliope haben recht! Ohne unsere Flucht hierher wären wir von den Schergen der Kaiserin abgeschlachtet worden! Klingt das in deinen Ohren besser?«
»Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass …«, setzte Jago an. Doch Kieron, der bis vor wenigen Augenblicken schweigsam und blass wie ein frisch an der Sonne gebleichtes Bettlaken neben dem Schild gekniet hatte, unterbrach ihn unerwartet heftig: »Sei still! K-kkeinen interessiert deine Meinung!«
»Und w-w-w-w-er sagt das?«, spottete der Chamäleonide, wobei er das leichte Stottern des Jungen in seiner Imitation maßlos übertrieb. »Du bist mein Sklave gewesen, vergiss das nicht! Eigentlich bist du es noch immer! Nur weil du geflohen bist und wir in dieses ganze haarsträubende Abenteuer verwickelt worden sind, habe ich dich noch lange nicht freigegeben!« Seine Augen ruckten zur Seite. Eine weitere Schabe. Klatsch. Auch dieses Insekt entkam der klebrigen Zunge nicht. Nach der neuerlichen kleinen Mahlzeit grinste Jago und spuckte einen Teil des geborstenen Chitinpanzers wieder aus.
Kalliope trat einen Schritt vor und machte eine umfassende Handbewegung. »Lasst jetzt die Streitereien!« Sie fühlte sich so erstaunlich ruhig, als befände sie sich in einem Schiff, das auf dem Weg zwischen den Weltensplittern in einen tobenden Sturm aus tastenden Ausläufern des Nox geraten war … und als wüsste sie zugleich, dass sie sich nicht sorgen musste. Und dies nicht etwa, weil sich eine höhere Macht oder auch nur eine erfahrene Meisterin der Gilde darum kümmerte, sondern weil sie selbst, Kalliope, die Situation im Griff hatte.
Sie empfand eine geradezu unheimliche Gelassenheit. Alles würde gut werden. In diesem Augenblick war sie eher dazu bereit, das zu glauben, als seit vielen Wochen. Obwohl sie kaum etwas von den Ereignissen der letzten Stunden verstand. Oder war es vielleicht genau deswegen? Nicht zuletzt fragte sie sich, wie all diese … Wesen durch den Schild zu Erik und ihr gekommen waren.
Was hatte es mit diesem Artefakt auf sich, das drei Menschen und zwei Animale in die unterirdischen Gänge des Palastes von Thulheim geholt hatte? Handelte es sich um Magie? Die Frage lag ihr auf der Zunge: Sind Kieron und seine Begleiter mit Zauberei hierher versetzt worden? Doch sie sprach es nicht aus. Sie sparte sich diese Ketzerei.
Es fiel ihr schwer, das zu glauben. Auch nach dem, was sie gesehen und erlebt hatte.
Was wir nicht verstehen, hatte man sie gelehrt, folgt dennoch der Ordnung der Dinge und den Gesetzen des Sanktuarions. Ein ebenso verborgenes wie wunderbares Muster webt das Netz des Lebens. Dass seine Fäden in höhere Gefilde reichen als menschlicher Verstand, liegt nicht an den Fäden, sondern an unserer mangelnden Weisheit. Daher strebt die Gilde seit jeher nach größerer Erkenntnis, um die Wahrnehmung zu erweitern. Es gibt Bereiche, in die selbst wir niemals geschaut haben.
Wenn Kalliope doch nur wüsste, ob sie den Lehren, auf die sich ihre ganze Existenz gründete, auch nur ein klein wenig trauen konnte. Ob sie es auch jetzt noch durfte, nach all ihren Erlebnissen. Nachdem sie den Boden unter den Füßen verloren und die Wahrheiten erkannt hatte, die sie nie sehen wollte. Nur scherte sich offenbar niemand darum, was ihren Wünschen entsprach.
Und obwohl ihre Welt zusammengebrochen war, trotz der tödlichen Gefahr, die in Gestalt der Soldaten nur wenige Dutzend Meter entfernt nach wie vor lauerte, empfand sie diese Ruhe, diesen inneren Frieden.
Hing es mit Erik zusammen? Damit, dass er sie geküsst und ihr seine Liebe gestanden hatte? Musste ihr das nicht Halt geben? Aber wie könnte es das? Schließlich verstand sie ihre Gefühle für ihn nicht. Was … durfte sie empfinden?
Allerdings fragte sie sich, ob sie sich nicht selbst etwas vormachte. Ob nicht längst klar war, was sie empfand, mochte sie sich das nun erlauben oder nicht. Dies war das Wesen starker Gefühle: Sie kamen ungefragt und brachten alles durcheinander, wenn der Verstand sie nicht gefangen nahm und über sie herrschte.
Wieder dachte sie an den Codex des Ordens, in dem sie aufgewachsen, der ihre Heimat gewesen war und den sie verlassen hatte, weil sich verdorbene Machtgier darin ausbreitete … und ausgerechnet ihre einstige Freundin Prisca und deren Meisterin Harona verkörperten all dieses Böse und schmiedeten verderbliche Intrigen.
Das Zitat aus dem Codex kam ganz von selbst, denn er bildete seit jeher die Richtschnur ihres Daseins: Gefühle dürfen uns nicht lenken; sie sind trügerisch. Nur die Erkenntnis bringt uns auf einen klaren Weg und in eine geordnete Zukunft für alle Weltensplitter.
Kalliopes Blick wanderte zu dem Jungen, der durch den Schild gekommen war: Kieron. Beruhte ihr innerer Frieden auf der Tatsache, dass er sich in ihrer Nähe befand? Sie fühlte sich auf eine seltsame, unerklärliche Weise zu diesem völlig Fremden hingezogen, der ihr so unbegreiflich ähnelte. Sie nahm sogar hin, dass er seinerseits den Tiermenschen an seiner Seite vertraute, den Animalen, die sie schon immer verachtete, weil sie keine vollwertigen Persönlichkeiten besaßen. Der Orden der Levitatinnen lehrte nämlich, dass Tiermenschen nicht zum Schöpfungsplan gehörten und daher widernatürliche, niedere Kreaturen darstellten, ohne eine echte Seele.
Erst nach einigen Atemzügen bemerkte Kalliope, dass alle sie anstarrten, auch die Fremden, ja selbst das kleine Echsenwesen.
Was ist mit ihnen?
Was erwarten sie von mir?
Ausgerechnet von mir?
Der Panthermann, dem eine seiner …
… sie stockte, denn sie wusste nicht, wie sie es nennen sollte. Pfoten? Klauen? Hände …
… fehlte, beugte sich zu ihr. Sein Atem roch heiß und fiebrig. Es war der eines Raubtiers. »Du hast etwas Gutes gesagt. Wir sollen die Streitereien beenden. Das müssen wir auch. Uns droht Gefahr, das ist wichtiger als unsere Bequemlichkeit und die kleinlichen Befindlichkeiten.«
Kalliope ignorierte den Gestank, der von ihm ausging. Er schien vernünftig zu sein, obwohl er ein Animale war. Er wirkte wild, angriffslustig – aber ihr entging nicht, dass Kieron inzwischen sogar dicht neben ihm stand, als suche er ausgerechnet bei ihm Schutz. Der Junge vertraute diesem Pantheriden, also tat sie es ebenfalls. »Du hast recht«, stimmte sie zu. »Und darüber müsst ihr Bescheid wissen, weil wir offenbar zusammengeführt worden sind.« Wesentlich leiser ergänzte sie: »Von wem auch immer.«
Seit dem verblüffenden Auftauchen der Fremden war kaum für mehr Zeit geblieben als dafür, dass alle ihre Namen nennen und sich versichern konnten, dass sie sich nicht gegenseitig angreifen wollten. Also saßen sie als eine bunt zusammengewürfelte Gruppe in diesem geheimen Gängesystem des Palastes von Jordråk, froren, fragten sich, was soeben geschehen war, und freuten sich, am Leben zu sein.
Damit ging ein jeder auf seine eigene Weise um.
Kalliope suchte innere Ruhe und Ausgeglichenheit.
Erik nahm ständig die Umgebung in den Blick.
Die menschliche Frau Shen, die nur noch ein Auge hatte, tat es ihm gleich.
Darg blieb an ihrer Seite und schien ausdruckslos ins Leere zu starren, wobei sie nicht daran zweifelte, dass dieser hünenhafte Mann hochkonzentriert war.
Jago hielt verbissen nach einem weiteren Insekt Ausschau und fraß es knirschend.
Der Panthermann Croy stand unbewegt und wachsam da, während er – genauso wie Kalliope – versuchte, eine Stimme der Vernunft zu bilden.
»Also«, riss Kieron sie aus den Gedanken. »Sprechen wir über den Schild. I-ihr werdet mich vielleicht auslachen, weil ich es nicht verstehe, aber ich wüsste gern mehr. Wie habt ihr uns damit z-zu euch geholt?«
Kalliope erschrak, als sie diese Worte hörte. Glaubten ihre geheimnisvollen Besucher denn, es wäre das Werk von Erik und ihr? Dabei konnten sie über die Verbindung durch den Schild kaum stärker überrascht sein als Kalliope selbst. Doch wie sollte sie reagieren? Ganz ehrlich mitteilen, dass sie nicht die geringste Erklärung für die Vorgänge hatte? Gewiss, sie vertraute den anderen, zumindest teilweise, und eigentlich müsste ihre verblüffte Reaktion aussagekräftig genug sein. Trotzdem …
»Ihr täuscht euch«, nahm Erik ihr die Entscheidung ab. »Wir wissen nicht, auf welchem Weg und warum ihr durch den Schild zu uns gekommen seid.« Er streckte den Arm aus, an dessen Ende Kalliope die Wolfsklaue statt einer Hand wusste – allerdings verborgen unter einem Handschuh. Sie hatte es für das Stigma seiner Schande gehalten, eine Chimäre zu sein, ein Mensch mit dem Merkmal eines Tieres, Sohn des Fürsten … oder auch nicht. Doch Erik selbst schämte sich deswegen keinesfalls, und nun wagte sie ebenfalls nicht mehr, es zu beurteilen.
»Ich weiß nur«, fuhr der Prinz von Jordråk fort, »dass dieser Schild ein wertvolles Artefakt ist, eine Hinterlassenschaft, die mein Vater und ich lange in der Eishöhle gehütet haben. Uns war klar, dass der Tag käme, an dem dieser Schild seine Macht offenbaren würde. Und uns den Weg in die Zukunft wiese. Aber wir wussten nicht, auf welchem Weg das geschehen sollte.« Er sah einen nach dem anderen an. »Nun, es sieht so aus, als hätte diese Zukunft mit euch zu tun.«
»Jaja«, krächzte Jago, das Echsenwesen. »Ich hab’s begriffen. Ein Artefakt, auf dem ein tolles, mysteriöses Zeichen eingraviert ist. Ist das richtig? Zwei Halbkreise, die sich im Scheitel berühren, dazu ein Strich, der sie senkrecht durchläuft. Glaub mir, das musste ich lange und oft genug hören. Croy hat es wieder und wieder gesagt, dass es ach so wichtig ist für alle Weltensplitter. Sogar der Geheimdienst ist dahinter her, und das heißt, die Kaiserin selbst! Und die Wirtschaftsgilde und was weiß ich wer sonst noch. Das haben wir ja deutlich gespürt.« Die Zunge schnellte hervor und pendelte vor dem Maul. »Bla, bla. Interessiert mich nicht! Ich will in mein Leben zurück. Ich führe ein tolles Gasthaus, klar? Ohne mich ist da wahrscheinlich schon längst das Chaos ausgebrochen! Meine Gäste verlassen sich auf mich!«
»D-deinen Gästen«, rief Kieron, »ist es doch völlig gleichgültig, wer ihnen den billigen W-w-w…«
»Das Zeichen«, unterbrach Erik und seine ganze Körperhaltung wirkte plötzlich angespannt. »Was wisst ihr darüber?« Die Worte kamen schärfer als jede noch so fein geschliffene Klinge.
Kalliope sah ihn ebenso nachdenklich wie erschrocken an. Fast erwartete sie, dass sich die Krallen seiner Wolfsklaue durch den Handschuh bohrten, dass er sich auf Jago stürzen, ihn schütteln würde …
Sie fühlte sich schwindelig. Die Welt, die zurzeit nur aus dem engen, kahlen Fels rundum bestand, über den ein Fackelschein geisterte, drehte sich um sie. Sie versuchte, Ruhe zu finden. Stabilität. Gleichgewicht. Doch sie konnte ihre Gefühle nicht beherrschen, sondern kam sich vor, als wollten diese sie packen und mit sich reißen, hinein in das Chaos eines zusammenbrechenden Sanktuarions.
»Jetzt werden wir alle mal ganz still«, forderte der Pantheride. »Ich wüsste zunächst gern, wo genau wir hier überhaupt sind.«
»Dies ist die Festung von Thulheim«, erklärte Erik. »Besser gesagt ein System von Geheimgängen darunter. Mein Vater herrscht von dem Palast aus über den Weltensplitter Jordråk, eine Winter- und Eiswelt.«
»Hm«, machte Croy. Seine gelben Augen weiteten sich, als er den Kopf wandte und in die Dunkelheit starrte. »Jor-track«, wiederholte er mit einer seltsamen Betonung. Es mochte so klingen, wie wenn jemand ein ihm völlig fremdes Wort aussprach.
»Das haben wir alle kapiert«, gab Jago zum Besten. »Dein Vater ist hier der Boss. Schön und gut. Warum sitzen wir dann im Kalten und verkriechen uns bei den Schaben?«
Erik schwieg. Kalliope sah, dass seine Kiefermuskeln arbeiteten. Die Zähne knirschten aufeinander. Sie übernahm die Antwort für ihn. »Wir sind ebenso Gejagte wie ihr. In der Gilde der Levitatinnen ist nichts mehr wie früher. Eine der Numeratae hat einen dunklen Pfad gewählt. Die Inquisition erhebt sich neu. Die Soldaten stehen unter ihrem Befehl. Sie haben Eriks Vater entmachtet und uns …«
»Habe ich es nicht gesagt?«, unterbrach Jago. »Das interessiert mich nicht. Überhaupt nicht!«
Kalliope nickte, langsam und bedächtig. Während ihrer Worte hatte sie genau auf die Reaktionen der anderen geachtet. Den Chamäleoniden nahm sie dabei weniger ernst als Shen und Darg und vor allem Kieron und Croy. Und sie war überzeugt: Keiner von ihnen konnte auch nur das Geringste mit ihrer Erklärung anfangen. Sie wussten nichts von der Gilde. Das war undenkbar. Jeder kannte den Orden der Levitatinnen, denn sie waren die Einzigen, die das Reisen zwischen den zahllosen Weltensplittern des Sankturarion ermöglichten!
Wir Gildeschwestern … und der Schild. Kalliope erschrak vor diesem Gedanken, aber so ungeheuerlich er auch sein mochte, sie spürte doch, dass noch mehr dahintersteckte. Viel mehr.
»Es scheint mir ganz offensichtlich zu sein, was hier vorgeht«, sagte Croy.
»Ach ja?« Das war das Erste, was der hünenhafte Darg seit seiner Ankunft sprach. Sogar seinen Namen hatte er vorhin nicht selbst genannt, sondern die Vorstellung seiner Begleiterin Shen überlassen.
Der Pantheride schenkte ihm keine Aufmerksamkeit. »Wir alle sind von unserem Zusammentreffen völlig überrascht worden. Meine Gruppe ebenso wie ihr beide.« Er deutete mit dem Armstumpf auf Kalliope und Erik.
»Hey«, zischelte Jago. »Das ist nicht deine Gruppe! Ich gehöre nicht zu …«
»Schon gut«, unterbrach Croy erstaunlich sanft. »Darauf kommt es nicht an.«
Die Nickhäute schoben sich vor die Augen des Echsenmanns. Ansonsten blieb er still und unbewegt. Wahrscheinlich überlegte er, ob er eine gepfefferte Erwiderung geben sollte, entschied sich jedoch dagegen.
Croy trat einen Schritt vor und richtete sich zu seiner vollen, imposanten Größe auf. Jede seiner Bewegungen wirkte geschmeidig und elegant, wie Kalliope fast widerwillig zugeben musste. Immerhin war er ein Animale. Ein Tierwesen! Bis vor Kurzem war sie zutiefst davon überzeugt gewesen, dass jemand, dass soetwas wie er kein echtes, intelligentes Lebewesen sein konnte, sondern nur ein lebendiges Ding ohne Seele.
»Niemand von uns weiß mehr über die Hintergründe der Schilde«, sagte der Pantheride.
»Moment!« Das war Erik. »Die Schilde? Dann weißt du also nicht nur von einem?«
»Ist das nicht offensichtlich?«, fragte Kalliope. »Ihr hattet doch ebenfalls einen Schild, oder? Und ihr seid in euren hineingestiegen und bei uns …«
»Ganz genau«, fiel Shen ihr ins Wort. »Ein Tunnel, von einem Schild zum anderen.«
Croy wandte sich an den Prinzen. »Du hast gesagt, euer Artefakt war seit langer Zeit von dir und deinem Vater verborgen worden. Wir hingegen haben unseres … gestohlen. Doch nicht nur wir suchten danach. Auch die Kaiserin. Ihr Geheimdienst hat uns verfolgt und uns sogar schon fast gestellt, als wir zu euch fliehen konnten.«
Es fiel Kalliope schwer, die Fragen zurückzuhalten, die mit Macht in ihr hochstiegen.
Kaiserin?
Wer sollte das sein?
Wovon redete der Panthermann?
Ein ebenso seltsamer wie verrückter Verdacht stieg in ihr hoch. Dazu passte, dass Kieron unmittelbar nach ihrer Ankunft gefragt hatte, ob er sich in Bazarra befinde – ein Name, der ihr völlig unbekannt war. Umgekehrt reagierten die Fremden verwirrt und unwissend auf die Erwähnung von Jordråk und der Gilde.
Gut – das Sanktuarion bestand aus vielen Weltensplittern und Kalliope kannte womöglich nicht alle ihre Bezeichnungen. Von Jordråk hatte zweifellos auch nicht jeder gehört … aber die Gilde? Sämtliche intelligenten Wesen wussten von dem Orden der Levitatinnen!
Allerdings schienen die Neuankömmlinge mit derselben Sicherheit davon auszugehen, dass sie die von ihnen erwähnte Kaiserin als die oberste Herrscherin kennen müssten. Jedoch war es keine Frau, sondern ein Mann, der über die Weltensplitter herrschte, unabhängig von den Regierungen der einzelnen Teilwelten! Gewiss, König Ardath war schwach und von der neuen Inquisition, die die Gilde unterwandert hatte, mittlerweile gewiss beeinflusst – aber er war der König, er regierte auf Tridentia!
Ihre Gedanken überschlugen sich, und je länger sie darüber nachdachte, umso mehr verschwand die innere Ruhe. Sie verlor bereits wieder ihr Gleichgewicht, das sie so mühsam errungen hatte.
Sie sah, dass Croy weiterredete, doch sie hörte seine Worte nicht. Sie übertönten nicht das Pochen ihres Herzens und die dröhnende Unfassbarkeit ihrer Überlegungen.
Kalliope schloss die Augen und sah das Symbol auf dem Schild vor sich.
Zwei Halbkreise, die sich in ihrem Scheitelpunkt berührten, während sie von einer Linie durchstoßen wurden.
Zwei getrennte Gefäße und nur die Linie erschuf eine Verbindung.
Zwei isolierte Welten, zwischen denen es nicht mehr als eine einzige Brücke gab.
Ihre Lippen zitterten.
Das konnte nicht sein!
Das Sanktuarion war …
Etwas ergriff sie an der Schulter. Heißer, stinkender Atem fuhr ihr ins Gesicht.
Sie riss die Augen auf und starrte in die Fratze des Panthermanns mit seinen scharfen, tödlichen Zähnen.
Kalliope erwartete den Biss und den Tod, der ihr im letzten Augenblick klarmachen würde, dass das alles eine gigantische, verhängnisvolle Täuschung ihrer Gegner war. Eine List ihrer einstigen Freundin Prisca, die nun selbst eine Inquisitorin, eine ausführende Hand böser Mächte war.
»Wir müssen hier fort!«, hörte sie Croys Stimme, und sie begriff, dass der Panthermann sie nie hatte angreifen wollen. Er hatte sie nur aus ihren Grübeleien gerissen, und das war auch bitter nötig.
Sie hörte das Klirren von Klingen!
Die Soldaten, die im Auftrag von Harona und Prisca und als Schergen der Inquisition Jordråk überrannten, drangen in die Geheimgänge ein!
Erik stand über einem reglos am Boden liegenden Gegner und riss ihm in diesem Augenblick das Schwert aus der leblosen Hand. Damit parierte er den Hieb eines Angreifers, auf dessen stumpfgrauem Kesselhelm das Licht der Fackeln tanzte. Das Eisen der Klingen kreischte schrill bei der Berührung.
Der feindliche Soldat schrie auf, wild und aggressiv, während er alle Kraft in einen weiteren Schlag legte. Kalliope sah es wie in Zeitlupe. Die Wucht dieser Attacke musste Eriks Widerstand beiseitefegen, ihn zurückdrängen, mehr noch, er musste ihm das zur Abwehr erhobene, eben eroberte Schwert in den Leib treiben. Niemand konnte einen mit solch primitiver Gewalt geführten Angriff parieren.
Darum versuchte es Erik nicht einmal. Alles ging rasend schnell. Er warf sich zu Boden und rollte sich in einer einzigen, geschmeidigen Bewegung ab. Die Klinge des Angreifers kreischte auf die Felswand, dass die Funken davonsirrten; die Arme wurden nach oben gerissen, seine Waffe rutschte klirrend herab. Der ganze Körper des Soldaten bog sich nach hinten durch, verkrampfte sich, und doch wirbelte er herum und riss einen Dolch aus einer verborgenen Scheide, um Erik trotzdem noch zu töten.
Da startete der Prinz von Jordråk einen Gegenangriff. Er führte das Schwert in einer bogenförmigen Bewegung nur kniehoch über dem Boden – und traf. Sein Feind stürzte auf eine unfassbar groteske Art und in einer Fontäne aus Blut.
Doch schon jagten andere hinterher.
Darg warf sich ihnen entgegen, wich einem Schwerthieb aus und rammte einen der Gegner mit voller Wucht. Der taumelte zurück und riss einen zweiten Soldaten zu Boden. Die beiden blockierten den engen unterirdischen Gang.
Nur einer der Angreifer kam noch durch, stürmte vor und hob sein Schwert zu einem brutalen Schlag. Wie eine Axt ließ er es auf Shen niedersausen.
Die Kriegerin wich aus, die Waffe pfiff an ihr vorbei und schrammte kreischend über den Steinboden. Shen schrie wild auf und warf sich auf ihren Gegner. Sie rammte ihn und die Wucht riss ihn zur Seite. Er prallte gegen die Wand. Shen bewegte sich rasend schnell, packte den Waffenarm und zerrte ihn hoch. Etwas knackte. Die Klinge fiel ihm aus der Hand und dem Knacken folgte ein schreckliches Krachen und Reißen. Der Soldat flog in einer bizarren Rolle hintenüber. Shen griff sich sein Schwert und stieß es ihm noch in der Luft in den Leib. Eine Blutfontäne spritzte.
»Weg hier!«, rief Croy.
»Los!« Erik schnappte sich den Schild, das Artefakt, das er so lange gehütet hatte, und wies in die entgegengesetzte Richtung. »Dort können wir uns verbarrikadieren!«
Die vor so kurzer Zeit unverhofft zusammengewürfelten Gefährten rannten los – Shen jedoch erst in dem Augenblick, als sie sah, dass sich auch Darg der Flucht anschließen konnte. Ihr Bein war an den Stellen rot verschmiert, wo das Blut des Soldaten auf sie gespritzt war.
Jago wuselte zwischen Croy und Kieron umher, während sie so manche Kurve nahmen und um Ecken hasteten. Die Welt hier unten bildete ein enges, verwinkeltes, aber erstaunlich weitläufiges Labyrinth.
Kalliope fühlte, wie Erik ihr den Schild übergab und wie seine Hand ihren Arm umschloss, als wolle er sich vergewissern, dass sie keinesfalls zurückblieb. Seine Hand, dachte sie. Nicht seine Wolfsklaue. Mit der Klaue hielt er das Schwert.
Kieron trug eine lodernde Fackel; geistesgegenwärtig hatte er sie gepackt und mit sich genommen.
Vor ihnen lag eine Abzweigung, doch der Gang verzweigte sich nicht zu den Seiten. Einerseits lief er geradeaus weiter, führte aber auch über Durchgänge in der Wand in die Höhe und Tiefe.
»Der Weg nach oben würde uns bloß zu den Gefängniszellen bringen«, erklärte Erik hastig. Kalliope wusste nur zu gut, was er meinte – schließlich hatte er sie daraus befreit. »Wir müssen nach unten!« Er ließ Kalliope los, riss eine vor Langem erloschene Fackel aus einer eisernen Wandhalterung und reichte sie ihr. »Dieser Weg führt aus dem Bereich der Festung heraus! Dort gibt es auch ein Tor, das wir verriegeln können!«
Natürlich hatten die Soldaten inzwischen das Hindernis ihrer gestürzten Kameraden überwunden und folgten nun den Flüchtenden. »Im Namen von Inquisitorin Prisca!«, rief ihnen einer hinterher, als würde das irgendetwas ändern. Die Stimme hallte um Ecken, erzeugte leise Echos und verlor sich fast in der Düsternis. Als Kalliope an ihre einstige Freundin dachte, entfachten die Worte nur noch mehr Wut in ihr.
Jago huschte als Erster in die dunkle Tiefe, während Kieron Kalliopes Fackel mit seiner entzündete. Sein Gesicht kam ihrem dabei näher als je zuvor, und der rötliche Schein des Feuers ließ seine entschlossenen Züge tanzen. Seine Pupillen waren winzig, und die Augen kamen ihr wie ein Abbild ihrer eigenen vor.
Croy folgte dem Chamäleoniden hinab. »Jetzt du«, forderte Shen Darg auf, doch der schüttelte nur unmissverständlich den Kopf, packte die Kriegerin und schob sie in die Öffnung. Sie fügte sich und verschwand außer Sicht.
»Ihr verschließt das Tor hinter euch«, sagte Erik zu Kalliope und dem Hünen, während nun auch dieser hinabstieg. »Und geht immer weiter geradeaus, verstanden? Ihr kommt dann irgendwann ins Freie, vor dem Teil des Palastes, der von der Außengrenze des Weltensplitters abgewandt ist. Bleibt am Ausgang aus dem Höhlenlabyrinth! Auf der anderen Seite der Festung fallen die Felswände in einen ewigen Abgrund ab – dort gibt es nichts als den Rand der Welt und den Sturz ins Sanktuarion! Wartet eine Stunde. Wenn ich dann noch immer nicht aufgetaucht bin, verschwindet ihr und denkt nicht mehr an mich.«
Kalliope hob die Fackel, sodass Eriks Gesicht vollständig beleuchtet wurde. »Das ist nicht dein Ernst! Du willst zurückbleiben und …«
»Es ist keine Zeit!«, schnitt er ihr das Wort ab. Der Lärm der näher kommenden feindlichen Soldaten nahm zu. Schwere Schritte – das metallische Klirren von Rüstungsteilen oder Waffen. »Sie kommen! Bring dich und den Schild in Sicherheit. Ich bleibe! Jemand muss sie ablenken!«
»Und das werden wir sein!« Kalliope wandte sich von dem Abstieg ab. »Ich lasse dich nicht allein.« Als sie losging, konnte es nur eine Richtung geben. Weder nach oben zu den Zellen noch nach unten zu den Gefährten. Also geradeaus weiter.
»Du …«
»Es beibt keine Zeit, hast du das nicht selbst gesagt?« Hastig drehte sie sich um. Er verharrte vor dem Abstieg in den tieferen Bereich. Sie spürte Tränen auf ihren Wangen und wusste nicht, ob sie vor Zorn oder Angst flossen oder aufgrund einer Mischung von Gefühlen, wie sie sie nie zuvor empfunden hatte. In einer hilflosen Geste streckte sie ihm die Hand entgegen. »Erik!«
Endlich erwachte er aus der Erstarrung. Ein letzter, kurzer Blick in die Öffnung an der Wand, und er kam zu ihr. Gemeinsam gingen sie einige Meter weiter, ehe er stehen blieb. »Wir müssen warten.«
»Was? Sie kommen!« Kaum waren die Worte gesprochen, begriff sie, was er meinte. Natürlich. Dieses Ablenkungsmanöver verlor jeden Sinn, wenn sie den Verfolgern nicht unmissverständlich klarmachten, dass sie diesen Weg geradeaus genommen hatten. Kalliope ärgerte sich über sich selbst, weil die Finger, die sich um den Griff der Fackel klammerten, zitterten. Die Wärme leckte über ihr Gesicht. »Wir dürfen nicht zu lange warten«, flüsterte sie.
»Ich weiß, wo ich uns hinbringe«, sagte Erik. »Das Ende der Gänge … ein Ausgang in einem leer stehenden Lagerhaus. Früher …«
Weiter kam er nicht.
Ihre Gegner waren hier.
»Dort!«, schrie einer der Soldaten. Sein blauer Rock war blutverschmiert. Sechs, sieben Männer drängten sich voran, vielleicht noch mehr. Kalliope konnte sie nicht sehen. Sie hielten Schwerter und Fackeln.
Sie eilte los, mit Erik an der Seite. »Los, Jago!«, rief er, und einen Augenblick lang war sie verwirrt, ehe sie sogar in dieser schrecklichen Situation über seine List lächeln musste: Ein flüchtiges Gefühl, das schneller verwehte als die Flamme einer einsamen Kerze in einem Sturm.
Gemeinsam rannten sie, während ihnen die Verfolger auf den Fersen blieben. Kalliope floss der Schweiß kalt den Rücken hinab. Ihr Atem ging schwer. »Nicht mehr weit«, presste Erik hervor.
Plötzlich endete der Gang. Die letzten Meter bestanden nicht mehr aus natürlichem Felsengestein, sondern aus gemauerten Steinen.
Eine massive Tür versperrte den Weg. Eisenbeschläge verliefen rund um das Blatt aus dunklem, beinahe schwarzem Holz. Quer über die gesamte Breite lag ein armbreiter Balken dicht unter einer dicken Klinke.
Kalliope stand auf einem rostigen Eisengitter. Darunter schimmerte es feucht. Vielleicht sammelte sich abfließendes Wasser dort, oder … es konnte auch ein Brunnenloch sein.
Erik tastete die Wand neben der Tür ab. »Halt dich am Tor bereit!«
Sie stellte keine Fragen, verlor keine Sekunde. Sie gehorchte und eilte die letzten Meter zum Tor.
Der erste Soldat war nicht mehr weit entfernt. Er schien schneller als seine Kameraden zu sein. Etliche Schritte weiter schrie er ihnen etwas entgegen.
Endlich fand Erik, wonach er gesucht hatte. Aus einem offenbar verborgenen Fach nahm er einen handlangen Schlüssel und warf ihn Kalliope zu. Sie ließ die Fackel fallen, fing den Schlüssel auf. Gleichzeitig wirbelte Erik herum, riss seine Waffe hoch und eilte auf den Angreifer zu.
Kalliope hörte Schwerter klirren, während sie den Schlüssel ins Schloss steckte. Sie zwang sich dazu, sich ausschließlich auf ihr Ziel zu konzentrieren. Trotz dieses Gefühls, ganz und gar ungeschützt zu sein, und trotz der Angst, dass sich jeden Augenblick eine Klinge in ihren Rücken bohren konnte, durfte sie sich nicht umdrehen. Es hätte ihr ohnehin nichts geholfen und an dem tödlichen Ende geändert.
Sie drehte den Schlüssel.
Etwas im Schloss stockte.
Sie nestelte so lange, bis sie ihn tiefer hineinstecken konnte, und dann griff er endlich. Es klackte. Sie riss die Tür auf und nahm den Schlüssel wieder heraus. Die Tür schwang nach außen, von ihr weg. Staub wölkte von den Angeln auf.
Sie drehte sich um. »Erik!«
Er kämpfte noch mit dem ersten Soldaten, doch zwei weitere waren fast herangekommen.
Und im Bruchteil eines Atemzugs begriff sie, was sich nur wenige Schritte entfernt abspielte.
Es war zu spät.
Erik hatte keine Chance mehr.
Das rostige Schwert seines Gegners raste auf seinen Kopf zu. Er konnte unmöglich noch ausweichen.
Kapitel 2
Ein Schild.
Das also war es? Das war die Beute, das Ergebnis all der Mühen? Ein Schild inmitten einer verlassenen Höhle?
»Nüsse«, forderte Aenigma vom Rücken seines Trägers.
»Wie bitte?«, fragte der Schakalkrieger rau und bellend, wie es bei seiner Art üblich war.
»Nüsse«, wiederholte der kleine Affenmann, als spräche er zu einem unverständigen Kind – was in gewisser Weise ja auch zutraf. Diese Geschöpfe mochten stark sein, aber sie waren auf jeden Fall dumm. »Ich brauche sofort Nüsse!« Seine Stimme erklang leise, durchdringend und scharf, oder mit einem Wort: gefährlich.
Sein Träger war wenigstens klug genug, das zu bemerken, auch wenn er nicht zu den Goroptera, zur Eliteeinheit der kaiserlichen Legion gehörte. Doch er kannte Aenigma und seine machtvolle Position im Geheimdienst so gut, dass er nicht den Fehler der Unwissenden beging, ihn für ein zwar possierliches, aber schwaches Wesen zu halten. »Seid ihr taub?«, rief der Schakalmann seinen Kameraden mit einer dumpf bellenden Stimme zu. »Schafft Nüsse herbei!«
»Woher sollen wir …«, setzte einer an.
»Sofort!«
Es herrschte Schweigen. Ein paar der Krieger sahen sich ratlos an, ehe sie sich aus der Höhle zurückzogen. Vielleicht hofften einige darauf, ganz verschwinden zu können … unauffällig.
Aenigma sprang von dem pelzigen Rücken und landete gleich neben dem Schild. Er starrte das glatte, gebogene Metall an, als könnten seine Blicke tiefer durchdringen.
Sollte es tatsächlich stimmen?
Entsprachen die Geschichten der Wahrheit? Wobei die Gerüchte nicht nur verworren waren, sondern geradezu verboten, im Untergrund geraunt und im Dunkeln geflüstert. Kaum jemand kannte sie. Aenigma waren sie jedoch nicht entgangen. Natürlich nicht. Der kaiserliche Geheimdienst hatte seine Augen und Ohren überall, und allen voran er selbst.
Der Affenmann ließ sich direkt vor dem Schild auf alle viere nieder, streckte den Kopf und atmete tief ein, als könne er riechen, was sich an diesem Ort abgespielt hatte. Doch ein scharfer Gestank überlagerte ohnehin jede Duftspur – offenbar hatte ein Tier in einem Winkel der Höhle nicht nur ein Mal seine Exkremente hinterlassen. Vielleicht hatten sich auch die Flüchtigen hier erleichtert: der Pantheride, der Echsenmann und die drei Menschen.
Menschen!
Pah!
Das ärgerte Aenigma am meisten, dass nichtsnutzige, dumme Menschen ihm hatten entkommen können, obwohl doch allen klar war, dass sie den Animalen in jeder Hinsicht unterlegen waren.
Der Affenmann hörte, wie der letzte Schakalkrieger, der in der Höhle verblieben war, sein Träger, sich bewegte. Da war das Rascheln von Fell an der Metallrüstung auszumachen, das Knirschen des Helms auf der Schulterpanzerung. Aenigma wirbelte herum. »Raus hier! Und komm mir erst wieder unter die Augen, wenn du mir endlich die Nüsse bringst!«
Einen Augenblick lang glaubte er es im Gesicht des Kriegers, der um ein Vielfaches größer war als er selbst, zornig aufblitzen zu sehen. Doch wahre Macht hatte nichts mit körperlicher Stärke zu tun, und Aenigma stand so hoch über diesem Soldaten, dass dieser es sich nicht einmal annähernd vorstellen konnte. Sein Träger gehorchte und zog sich wortlos zurück.
Endlich war er allein. Die Ursiden und die Vogelmänner hatte er längst weggeschickt, sämtliche Goroptera sich zurückziehen lassen. Nur die Schakalkrieger hatte er bei sich gehalten, als ein einfaches Hilfspersonal, und auch diese störten ihn nun nicht mehr.
Aenigma dachte nach, und wie meistens bewegte er seine kleinen Händchen dabei hastig. Die Finger verschränkten sich ineinander. Er kratzte sich. Wenn er ein wenig Schmerz fühlte, so half ihm das, seine Gedanken zu klären.
Die Flüchtigen waren verschwunden. Das stand ohne Zweifel fest. Er hatte sie gejagt, bis in diese Höhle hinein, in der sie sich verkrochen und wie in die Enge getriebene Beutetiere verschanzten. Es gab keinen Ausgang außer dem, der an den Kriegern und an ihm selbst vorbeigeführt hätte.
Und doch hatten sie triumphiert.
Und doch war ihnen die Flucht gelungen.
Und doch lag auf dem Boden nichts weiter als dieser Schild.
Der Affenmann berührte das Metall. Es fühlte sich … unauffällig an. Kühl. Also genauso, wie es sein sollte. Bedeutungslos. Ein Schild, wie es ihn auf jedem Schlachtfeld tausendfach gab, wenngleich dieser hier ästhetisch gerundet und geschmiedet war – ein besonders schönes Stück. Die Kunstfertigkeit nahm Aenigma sehr wohl wahr. Der Schmied musste ein wahrer Meister gewesen sein.
Aber das war nicht alles – dieser Gegenstand war viel mehr, als er zu sein schien. Zumindest hoffte Aenigma das. Seine ganzen Mühen durften nicht umsonst gewesen sein!
Der kleine Affenmann packte mit beiden Händen zu. Seine Arme reichten nicht aus, den Schild vollständig zu umfassen. In der gebogenen, glänzenden Oberfläche spiegelte sich sein Gesicht – auf dem Kopf stehend. Die roten Augen glitzerten, als ein einsamer Wassertropfen über die Spiegelung rann.
»Ich bringe dich zur Kaiserin«, flüsterte er, und ihm schien, als wollte sein Spiegelbild erwidern: »Wirklich? Willst du das tun, ehe du mein Geheimnis kennst?«
Aenigma dachte nach, eindringlicher als zuvor.
Die Rebellen waren fort, verschwunden, und die einzig mögliche Antwort war, dass ihnen dieser Schild die Flucht ermöglicht hatte. »Wie in den Legenden«, sagte er.
»Legenden?«, fragte sein Spiegelbild. Die ohnehin großen Augen weiteten sich noch mehr. Das grauweiße Fell sträubte sich. »Oder sind es Berichte? Überlieferungen?«
Aenigma ließ den Rand los, kratzte mit den Nägeln über das Metall, fuhr das Symbol nach: zwei Halbkreise, die sich im Scheitelpunkt berührten, durchstoßen von einer Linie. »Aber wie? Wie hast du sie verschwinden lassen?«
»Finde es heraus. Enträtsele mich auf dem Weg zur Kaiserin, und dann werde mächtiger, als sie es jemals war.« Das Spiegelbild lächelte. »Am Ende kann sie eine Puppe sein und du der Marionettenmeister.«
Aenigma lächelte zurück und wandte sich ab.
Marionettenmeister. Ein guter Gedanke. Die Vorstellung gefiel ihm.
Er hätte zum Ausgang der Höhle gehen können, doch er fühlte sich so übermütig wie in seiner Jugend und machte zwei, drei tollkühne Sprünge, ehe ihn ein weiteres Abstoßen ins Freie brachte.
Das Licht hier auf Bazarra war hell – und wenn es nach seinem Geschmack ging, sogar zu hell. Er mochte diese Wüstenwelt nicht, obwohl sie als Handelswelt eine sehr wichtige Rolle einnahm und schon so manche auf dem ewigen Basar gewonnene Information seinen Aufstieg im kaiserlichen Geheimdienst befördert hatte.
Im Grunde seines Herzens sehnte er sich danach, zum Weltensplitter Kaish zurückzukehren, wo er geboren worden war. Aber noch wartete er damit, denn er wollte im Triumphzug dorthin kommen. Er, das verstoßene, heimliche Balg des Affenfürsten, ausgesetzt weit jenseits der Affenburg, verhöhnt, geschlagen und getreten. Oh ja, er freute sich auf Kaish. Auf die Burg. Und vor allem auf das Messer, mit dem er seinem Vater die Kehle durchschneiden und ihn ausweiden würde. Die Klinge war schon seit Jahren geschärft.
Wut stieg in Aenigma hoch, und dann fiel es ihm schwer, sie zu kontrollieren. Aber er dachte wieder an sein lächelndes Spiegelbild und an das, was wenige Meter hinter ihm lag.
Der Schild.
Seine Möglichkeit, höher aufzusteigen als jeder andere.
Aber zugleich lag eine gewaltige, eine entsetzliche Gefahr darin verborgen. Was, wenn ihn die flüchtigen Rebellen irgendwie getäuscht hatten und der Schild nichts weiter als ein Stück wertloses Metall war? Wenn er sich mit seinen Untersuchungen und Hoffnungen zum Tölpel machte?



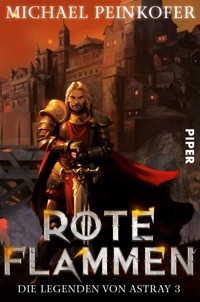
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)