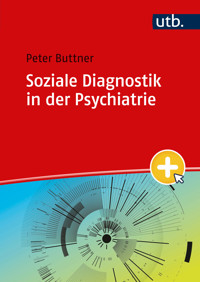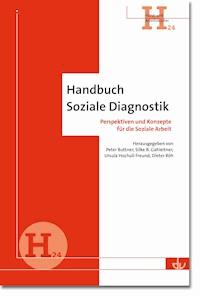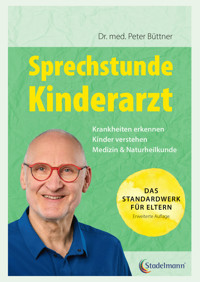
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stadelmann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Gesundheit – Krankheiten erkennen und behandeln Beziehung – Kinder verstehen und unterstützen Medizin & Naturheilkunde Entwickelt es sich normal? Was kann ich tun, damit es glücklich ist und es gut haben wird? Eltern machen sich Sorgen um ihr Kind. Meist sind es verblüffend einfache Antworten, die diese Sorgen nehmen. Dr. med. Büttner, erklärt, wie Sie Krankheiten erkennen, welchen natürlichen Verlauf sie meist nehmen und was Sie selbst tun können, damit es Ihrem Kind schnell wieder gut geht. Als Schulmediziner und Homöopath beschreibt er die konventionelle Therapie und nennt Alternativen aus der Naturheilkunde. Der zweite Teil des Ratgebers beschäftigt sich mit Themen rund um die Erziehung. Familie, Schule und Gesellschaft stellen viele Ansprüche an Sie als Eltern – hinzu kommen eigene Vorstellungen und Ideale. Das alles umzusetzen, kann ganz schön anstrengend sein. Dieser Ratgeber möchte Sie in Ihrer Erziehungskompetenz stärken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. med. Peter Büttner
Sprechstunde Kinderarzt
Das Standardwerk
Für all die Eltern, die täglich die schöne und anspruchsvolle Aufgabe annehmen, ein Kind zu erziehen.
Wichtiger Hinweis
Die Gedanken, Methoden und Anregungen in diesem Buch stellen die Meinung bzw. Erfahrungen des Verfassers dar. Sie wurden vom Autor nach bestem Wissen zusammengestellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für persönlichen und medizinischen Rat. Jede Leserin, jeder Leser ist für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbst verantwortlich. Die hier bereitgestellten Informationen sollten niemals als alleinige Quelle für gesundheitsbezogene Entscheidungen verwendet werden. Sie dienen auch nicht als Grundlage für eigenständige Diagnosen und den Beginn, die Änderung oder Beendigung der Behandlung von Krankheiten. Behandlungsvorschläge und Medikamente sind dann aufgeführt, wenn sie einerseits einfach durchzuführen sind und sich andererseits über viele Jahre mehrfach bewährt haben.
Der Autor kann für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, keine Haftung übernehmen.
Dieses Buch enthält Hinweise auf Webseiten und Bücher, auf deren Inhalt der Autor keinen Einfluss hat. Deshalb kann er für fremde Inhalte auch keinerlei Haftung übernehmen. Es ist dem Autor nicht in allen Fällen gelungen, die Verfasser der Zitate ausfindig zu machen. Sofern diese ihn aber in Kenntnis setzen, ist er selbstverständlich bemüht, den Inhaber der Rechte in künftigen Ausgaben namentlich zu nennen.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verfassers.
4. Auflage 2024
ISBN: 978-3-943793-78-9
© 2024 Stadelmann Verlag
Nesso 8, 87487 Wiggensbach
Fax: 0 83 70-88 96
www.stadelmann-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Umschlagmotiv: Dorothee Büttner, München
Illustrationen: Dorothee Büttner, München
Lektorat: Frauke Bahle, Freiburg
Satz: Eberl & Koesel Studio, Kempten
Die Bedeutung von Inklusion und einer geschlechtersensiblen Sprache ist für die vorliegende Arbeit zentral. Um die Lesbarkeit und das Verständnis zu fördern, wurden an einigen Stellen nicht alle grammatisch möglichen Formen verwendet, jedoch sind stets alle Geschlechter gemeint. Dies gilt auch im Hinblick auf die Vielfalt von Partnerschafts- und Familienmodellen.
Ein Markenzeichen kann warenzeichenrechtlich geschützt sein, auch wenn ein Hinweis auf etwa bestehende Schutzrechte fehlt.
Inhalt
Vorwort
Wissen gibt Sicherheit – Eltern werden kompetent
Teil 1 – Was fehlt meinem Kind?
Krankheiten sind meist gut erklärbar
Krankheitserreger – Viren, Bakterien, Pilze?
Umweltbedingungen und Jahreszeiten
Krankheiten kommen meist zur falschen Zeit
Reiseapotheke
Therapieverfahren: Kinderheilkunde ist mehr als Schulmedizin
Aromatherapie
Pflanzenheilkunde
Homöopathie
Weitere komplementäre Therapieverfahren
Anwendungen
Wegweiser durch die Behandlungsoptionen
Fieber
Fieberkrämpfe: Erschreckend, aber meist harmlos
Schmerzen
Allgemeine Maßnahmen bei Schmerzen
Schmerz- und Fiebermittel: Wie dosiere ich richtig?
Kopfschmerzen – bei Kindern gar nicht so selten
Augen
Schwierigkeiten beim Sehen – Fehlsichtigkeit
Schielen
Rote Augen: Bindehautentzündung und Gerstenkorn
Ohren
Mittelohrentzündung: Meist im Herbst und Winter
Paukenerguss und Polypen
Badeotitis: Der Gehörgang ist entzündet
Mund
Mundsoor: Pilzinfektion im Mund
Lippenherpes, Aphthen und Mundfäule
Zahnen kann wehtun
Gesunde Zähne
Hals
Halsschmerzen und nicht eitrige Mandelentzündung
Eitrige Mandelentzündung: Streptokokken und Scharlach
Pfeiffersches Drüsenfieber
Verdickte Lymphknoten
Atemwege
Erkältung – grippaler Infekt – Grippe
Infektanfälligkeit
Schnupfen: Alle Jahre wieder
Sinusitis: Wenn die Nasennebenhöhlen schmerzen
Husten und Bronchitis
Obstruktive Bronchitis und Asthma
Lungenentzündung
Pseudokrupp: Frische Luft hilft
Magen und Darm
Wenn der Bauch wehtut
Dreimonatskoliken: Schreien bei Säuglingen
Magen-Darm-Grippe: Durchfall und Erbrechen
Verstopfung: Den Darm auf Trab bringen
Gastritis – Entzündung der Magenschleimhaut
Darm- und Hautflora: Das Mikrobiom
Psychogene Bauchschmerzen
Reiseübelkeit
Einkoten: Etwas ist in die Hose gegangen
Harnwege – Blase – Nieren
Entzündungen der Harnwege und der Blase
Einnässen: Blasenkontrolle noch nicht perfekt
Vorhautverengung bei Jungen
Verklebung der kleinen Schamlippen bei Mädchen
Scheidenausfluss (Fluor vaginalis) – Vulvovaginitis
Lichen sclerosus et atrophicus – narbige Scheidenveränderung
Haut
Atopische Dermatitis (Neurodermitis) und seborrhoische Dermatitis
Wangenekzem durch Speichel und Nahrungsreste
Helle Flecken auf der Haut
Windeldermatitis und Windelpilz: Wund am Po
Analfissuren – Risse im Anus
Nesselsucht und Quaddeln
Warzen: Abwarten, selber behandeln oder entfernen lassen?
Blutschwamm bei Säuglingen (infantiles Hämangiom)
Sonne, Sonnenschutz und Sonnenbrand
Läuse, Würmer, Zecken
Läuse: Sechsbeinige Untermieter
Würmer im Stuhl
Zecken: Überträger von FSME und Borelliose
Skabies (Krätze)
Kinderkrankheiten
Ringelröteln: Kringel auf der Haut
Dreitagefieber: Erst Fieber, dann Flecken
Hand-Fuß-Mund-Krankheit
Verletzungen und Unfälle
Auf den Kopf gefallen
Nasenbluten: Feste drücken
Steifer Hals, Rückenschmerzen, Hexenschuss
Kleine Wunden: Gut versorgt
Eitrige Infektionen der Haut
Blasen als Folge einer Hautreizung
Prellungen, Zerrungen, Sportverletzungen: PECH gehabt
Muskelkater: Lieber einen Gang runterschalten
Blaue Flecken
Verbrennung und Verbrühung: Hitzeschäden auf der Haut
Erfrierungen
Vergiftung: Wo Gefahren lauern
Wespen- und Bienenstiche
Allergien und Unverträglichkeiten
Wenn das Immunsystem überreagiert
Allergien nehmen zu! Warum?
Das Allergierisiko senken
Heuschnupfen: Wenn die Pollen plagen
Kreuzallergie: Pollen- und Nahrungsmittelallergie
Hausstaubmilbenallergie
Tierhaarallergie
Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten
Penicillinallergie und andere Arzneimittelallergien
Immunsystem
Auch das Immunsystem muss lernen
Kinderkrippe – Kindergarten – krank!
Impfen
Wachstum
Wachstumskurven – Kurven der Entwicklung
Wachstumsschübe – plötzlich sind die Hosen zu kurz
Wachstumsschmerzen – Wachsen kann wehtun
Schmerzen an den Ansatzstellen der Sehnen
Stellung der Beine und Füße
Körperhaltung: Am liebsten aufrecht
Skoliose: Wirbelsäulenverkrümmung
Niedriger Blutdruck: Mir ist immer so schwindlig
Ernährung
Das erste Lebensjahr
Nach dem ersten Lebensjahr
Süßigkeiten sind etwas Besonderes
Trinken: Am liebsten Wasser
Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine
Ernährungsformen: Mischkost, vegetarisch, vegan
Übergewicht – Adipositas
Fake Science
Vorsicht vor unseriösen Informationsquellen
Teil 2 – Beziehung und Entwicklung
Beziehung ist wichtiger als Erziehung
Vorleben ist Erziehung
Das Beste für das Kind
Wer erzieht wen?
Das Leben mit anderen Augen betrachten
Bindung schafft Sicherheit
Kommunikation und Sprache
Vorlesen – Gemeinsames Lesen
Streitfälle im Familienalltag
Kinder und Tod
Säuglinge: Das erste Lebensjahr
Schnuller – Daumenlutschen – Nägelkauen
Tragetuch, Tragehilfen oder Kinderwagen?
Schlafen: Alleine oder bei den Eltern?
Beißen – tut ziemlich weh
Kleinkinder: Zwischen Begeisterung, Neugier und Widerstand
Bockig, trotzig, stur, verweigert: Wenn alles zu viel wird
Abgrenzung: Ich will aber!
Zu viele Entscheidungen, zu viele Fragen
Bei dir ist unser Kind nicht so frech! Was mache ich falsch?
Grenzen geben Sicherheit – Regeln helfen im Zusammenleben
Gefühlsstarke Kinder
Besondere Kinder – Vorbereitung auf das Leben
Dem Spieltrieb freien Lauf lassen
Unterstützen ja – Miterziehen nein danke!
Tic-Störungen als Zeichen innerer Anspannung
Schimpfwörter: Unbeabsichtigte Erweiterung des Wortschatzes
Einschlafen – manchmal nicht so einfach
Schulkinder und Jugendliche
Schulangst und Schulverweigerung
Pubertät: Zwischen Chillen und Vollgas
ADHS/ADS: Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität
Hochsensitivität – erhöhte Neurosensitivität
Mobbing – verletzt und verängstigt
Rückendeckung bieten
Medien: Computer, Tablet, Smartphone
Mein Smartphone ist wichtiger als du!
Medien und Selbsteffektivität: Ich bewirke etwas
Informationsflut – Kinder bekommen alles mit
Neue Medien: Tipps für eine gesunde Balance
Zu viel Medienkonsum hat Nebenwirkungen
Handystrahlung – Mobilfunk
Entwicklung des Gehirns: Lernen, wissen, entscheiden
Das Gehirn wächst mit seinen Aufgaben
Die Regionen des Gehirns und ihre Funktionen
Gefühle – kleiner Unterschied bei Mädchen und Jungen
Leichter Lernen
Sport macht schlau
Stress: Wenn Kinder überfordert sind
Akuter Stress – zwischen Herausforderung und Überlastung
Chronischer Stress – Bedrohung für die geistige Entwicklung
Die Zukunft unserer Kinder und die (Um)Welt, die wir ihnen übergeben
Ein Wunsch zum Schluss
Anhang
Zum Lesen, Hören, Ansehen
Notrufnummern
Danksagung
Der Autor
Bildnachweis
Register
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Gesellschaft befindet sich in einem großen Wandel. Die familiären Strukturen haben sich verändert und das Wissen voriger Generationen geht allmählich verloren. Daraus ist eine enorme Unsicherheit bei Eltern im Umgang mit ihren gesunden wie kranken Kindern entstanden. Die Medienwelt ist hierbei temporär „mehr Fluch als Segen“, denn die enorme Informationsflut via Internet macht es den Eltern schwer bis unmöglich, eine klare Antwort auf ihre Fragen zu erhalten. In den Praxen der Kinder- und Jugendärzt*innen gehört es mittlerweile zum täglichen (zeitaufwändigen) „Brot“, die unterschiedlichen Infos der Eltern zu selektieren.
Im Gegensatz dazu setzt Dr. Peter Büttner – als empathischer, kompetenter Kinderarzt und dreifacher Familienvater – mit diesem Buch ein Zeichen. Der Autor hat ein hervorragendes und umfassendes Nachschlagewerk für Eltern verfasst, das im ersten Teil die häufigen Erkrankungen bei Kindern und den Umgang mit ihnen klar beschreibt. Dr. Büttner erklärt auch komplementäre Therapieverfahren, wobei er sich bei den einzelnen Krankheitsbildern auf die vier Säulen Aromatherapie, Phytotherapie, Homöopathie und Schulmedizin stützt.
Der zweite Teil befasst sich sehr wertschätzend mit dem Thema „sichere Bindung“ zwischen Eltern und Kind und Jugendlichen – mit klarem Fazit: Bindung vor Bildung (Dr. Brisch). Wie gelingt es Eltern, eine sichere Bindung zu ihrem Kind aufzubauen und umgekehrt? Feinfühligkeit, Empathie, zuverlässige Verfügbarkeit und uneingeschränkte Aufmerksamkeit seien hier genannt. Dr. Büttner beschreibt sehr achtsam häufige Konflikte im Alltag – zum Beispiel Aufräumen, Einkaufen, Einschlafen – und nennt Möglichkeiten, diese mithilfe von bindungsorientiertem Know-how zu vermeiden.
Wie kann ich die Signale meiner Kinder erkennen und richtig interpretieren? Dies bleibt eine tägliche Herausforderung. Ein kleiner Trost: Kinder spüren auch das Bemühen ihrer Eltern, was oft schon ausreicht.
Dr. Büttner trägt mit seinem Buch dazu bei, dass liebende Eltern einen sicheren Umgang mit ihren Kindern, egal ob gesund oder krank, erlernen und deswegen kann ich das Buch Eltern uneingeschränkt ans Herz legen.
Kempten im Oktober 2019
Dr. Wilhelm Rauh
Wissen gibt Sicherheit – Eltern werden kompetent
In der Praxis erhalten die Eltern eine Fülle von Informationen, die oft gar nicht alle zu merken sind. Manchmal werfen diese Informationen im Nachhinein sogar neue Fragen auf. Dieses Buch kommt dem Wunsch vieler Eltern nach, zu Hause noch einmal genauer über die jeweilige Krankheit nachlesen zu können.
In den vielen Jahren der Beratung im Rahmen meiner Tätigkeit als Kinder- und Jugendarzt sind immer wieder dieselben Themen aufgetaucht, die Eltern beunruhigen. Meist fehlte es an Wissen über die entsprechenden Krankheiten und Erziehungsfragen. Oft waren es aber einfache Antworten, die den Eltern die Sorge nahmen. Daraus entstand die Idee, die Antworten in diesem Buch kurz, prägnant und übersichtlich zusammenzufassen. So ist ein schnelles Nachschlagen möglich und das Wesentliche kann einfach erfasst werden.
Dieses Buch ist in zwei Abschnitte gegliedert:
Teil 1 beschäftigt sich mit der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Hier finden sich viele Informationen über häufige Krankheiten und Krankheitszusammenhänge, über Verletzungen, das Wachstum von Kindern und Jugendlichen und über die Ernährung. Teil 2 bietet unter dem Stichwort Beziehung eine Auswahl an Themen rund um Erziehung, Entwicklung, Verhaltensweisen, Medien usw.Es ist eine große Aufgabe, ein Kind beim Heranwachsen zu begleiten.Oft geht es einfacher, als das im ersten Moment erscheint. Mit diesem Ratgeber möchte ich Ihnen helfen, Ihr Kind auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Viele Ansprüche werden von Familie, Gesellschaft und Staat an Sie, die Eltern, gestellt und auch Sie haben viele Vorstellungen und Ideale in der Erziehung. Die Umsetzung kann daher ganz schön anstrengend sein. Aber manchmal ist es einfacher, als Sie denken. Es ist die Aufgabe von uns Kinder- und Jugendärzt*innen, Sie zu beraten, wenn Sie Fragen haben und einen Rat brauchen. Mit diesem Ratgeber möchte ich Sie in Ihrer Erziehungskompetenz unterstützen.
Unzählige Fortbildungen in Bereich Sozialpädiatrie, in Gesprächsführung (Transaktionsanalyse) und insbesondere die über 30-jährige Berufserfahrung als Kinder- und Jugendarzt bilden die Basis für dieses Buch. Niedergelassene Kinder- und Jugendärzt*innen haben eine breit gefächerte Ausbildung. Sie besitzen neben ihrer Tätigkeit in der Praxis auch eine Lotsenfunktion in allen Belangen rund um Kinder und Jugendliche. Zögern Sie nicht, um Rat und Hilfe zu bitten. Allem voran plädiere ich für eine bessere Vernetzung der Berufe – Kinderarzt, Erzieher, Lehrer, Psychologen –, denn dann profitiert das Kind.
Alle Informationen sind von mir nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht und zusammengestellt, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Sie basieren zum einen auf wissenschaftlichen Quellen. Ein vollständiges Verzeichnis kann auf der Internetseite des Verlages heruntergeladen werden. Zum anderen bilden Vorträge, Fortbildungen, Expertenmeinungen und nicht zuletzt meine eigenen Erfahrungen, Meinungen und Beobachtungen die Basis.
Ich habe mich bemüht, eine verständliche Sprache zu wählen, die dennoch medizinisch genau ist. Vieles ist sehr detailliert erklärt, wenn es für das Verständnis von Zusammenhängen von Vorteil sein kann. Dieses Buch soll damit auch eine klare Gegenposition zur „Fake Science“ darstellen – Berichten, in denen unseriöse pseudowissenschaftliche Erkenntnisse als seröse Wissenschaft dargestellt werden (siehe Seite 323). Und nicht zuletzt bin ich fasziniert von der beeindruckenden Entwicklung, die die Kinder über die Jahre durchmachen, und dem Meisterwerk – unserem Körper – das uns die Natur geschenkt hat.
Bilden Sie ein Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin
Ihr Arzt braucht Ihre Mitarbeit! Sie kommen mit Ihren Fragen, Gedanken, Vorstellungen und Beobachtungen in die Praxis. Durch Zuhören und Nachfragen, durch Untersuchungen kann der Arzt zusammen mit seinem Fach- und Erfahrungswissen in den meisten Fällen eine Diagnose stellen – oder er leitet Sie an einen anderen Spezialisten weiter. Aber im weiteren Verlauf benötigt er Ihre Mitarbeit, während Sie die Therapie anwenden und Ihr Kind aufmerksam beobachten.
Teil 1 – Was fehlt meinem Kind?
Krankheiten sind meist gut erklärbar
Für uns Kinder- und Jugendärzt*innen ist die Krankheit und alles, was dazugehört, meist klar – die Zusammenhänge haben wir im Lauf der Jahre wieder und wieder erklärt. Für die Eltern unserer Patient*innen ist es aber oft das erste Mal, dass sie von einer bestimmten Krankheit hören oder mit ihr konfrontiert sind. Allein der Name der Krankheit, die Diagnose, jagt manchen Eltern einen Schreck ein, vielleicht weil sie die Diagnose schon in einem anderen, unangenehmen Zusammenhang gehört haben. Möglicherweise tauchen auch eigene schmerzliche Erfahrungen auf. Die Folge: Das Problem erscheint im ersten Moment größer, als es in Wirklichkeit ist. Zum Beispiel haben viele Menschen Angst vor einer Lungenentzündung, obwohl sie heutzutage bei Kindern mit Antibiotika meist gut zu behandeln und daher eigentlich kein Grund zur Sorge ist.
Oft sind es die ganz normalen Krankheitsstadien oder die Dauer der Erkrankung, die den Eltern Anlass zur Sorge geben, obwohl sie eigentlich harmlos sind oder zum normalen Verlauf der Krankheit dazugehören (Tab. 1). Auf diese Stadien wird daher an vielen Stellen besonders eingegangen. Gleiches gilt für die normale Entwicklung, die die Kinder durchmachen, denn auch manche dieser normalen Veränderungen beunruhigt viele Eltern.
Durchschnittlicher Verlauf
Langer Verlauf
Hochfieberhafter Infekt bei Kindern
3 Tage
Bis 5 (–7) Tage
Husten
3 Wochen
Bis 4 Wochen
Pseudokrupp
3 Tage
Schnupfen
15 Tage
Halsschmerzen
5 Tage
Magen-Darm-Grippe
7 Tage
Bis 10 (–14) Tage
Muskelzerrung
2 – 3 Wochen (bei Schonung)
Muskelkater
4 Tage
Bänderzerrung
2 – 3 Monate
Kopfschmerzen bei Gehirnerschütterung
10 Tage
Bis 3 Wochen
Tab. 1: Krankheiten: So lange kann es dauern
Die unterschiedliche Lebensdauer der etwa drei Milliarden Körperzellen hilft zu verstehen, wie lange es dauern kann, bis sich Zellen nach einer Verletzung erneuern. Andererseits zeigt eine kurze Lebensdauer die hohe Verletzlichkeit der Gewebe an. So kann man sich zum Beispiel anhand der Lebensdauer von Hautzellen gut vorstellen, dass die Haut nach einer Verletzung bis zur endgültigen Heilung drei bis vier Wochen benötigt. Das lange Leben der Fettzellen ist vielleicht auch ein Grund, warum kurze Diäten keinen nachhaltigen Erfolg haben, denn die Fettzellen (Speicherzellen) lassen sich nicht so leicht aushungern (Tab. 2).
Zellart
Lebensdauer (durchschnittlich)
Leukozyten
1 – 5 Tage
Rote Blutkörperchen
4 Monate
Gehirnzellen
Von der Geburt bis zum Lebensende
Hautzellen
3 – 4 Wochen
Luftröhrenzellen
1 – 2 Monate
Lungenzellen
8 Tage
Herzzellen
10 – 20 Jahre
Leberzellen
6 – 12 Monate
Dickdarmzellen
3 – 4 Tage
Dünndarmzellen
2 – 4 Tage
Fettzellen
8 Jahre!
Tab. 2: Wie lange leben Körperzellen?
Bei der Beschreibung der Krankheiten und Gesundheitsstörungen habe ich versucht, Wesentliches und Wichtiges auf den Punkt zu bringen, auf Basis eines soliden Fach- und Erfahrungswissens. Es finden sich auch viele Faustregeln als ungefähre Anhaltspunkte, die es Ihnen einfacher machen sollen, Krankheiten, Verhaltensweisen oder sonstige auftretende Probleme einzuordnen. Dennoch: Der individuelle Verlauf kann zum Teil erheblich abweichen.
Krankheitserreger – Viren, Bakterien, Pilze?
Für die Diagnose und die Therapie, aber auch für die Vorbeugung ist es wichtig zu wissen, von welchem Krankheitserreger eine Krankheit ausgelöst wird. Die meisten Erreger hierzulande gehören einem von drei Typen an: Viren, Bakterien und Pilze. Ob die Kinder bei Kontakt mit einem Krankheitserreger tatsächlich krank werden, hängt aber von weiteren Faktoren ab, zum Beispiel von ihrem Immunsystem, ihrer Konstitution oder der Jahreszeit.
Virusinfektionen machen den größten Anteil aller infektiösen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen aus. Mit den allermeisten Virusinfektionen kommt der Körper gut zurecht. Bei einer Virusinfektion nützt die Behandlung mit einem Antibiotikum in der Regel nicht. Allerdings gibt es wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Infektionen mit bestimmten Herpes- oder Hepatitisviren. Bestimmte Virusinfekte verursachen teils schwere Erkrankungen, jedoch ist es gelungen, Impfstoffe gegen viele dieser Erreger herzustellen (z. B. Kinderlähmung, Mumps, Masern, Röteln; siehe Seite 268). Bei etwa 10 – 15 % der viralen Infektionen entwickelt sich in der Folge eine bakterielle Infektion.
Viren umgeben uns in einer unvorstellbar großen Menge. Die meisten sind für uns Menschen ungefährlich, unser Erbgut besteht sogar zu 47 % aus Virusbestandteilen. Allein 1 ml Meerwasser enthält 100 Millionen, 1 ml Speichel 25 Millionen Viren. Eine Zelle, die von einem Virus befallen wird, produziert etwa 100 neue Viren.
Bakterielle Infektionen (eitrige Infektionen) kommen seltener vor. Wie auch bei den viralen Infektionen sind starke jahreszeitliche und auch wetterbedingte Schwankungen zu beobachten. Üblicherweise bei Kindern und Jugendlichen vorkommende eitrige Infektionen, wie zum Beispiel eitrige Bronchitis, Streptokokkenerkrankungen und Lungenentzündungen, sprechen gut auf Antibiotika an. Leichtere bakterielle Infektionen kann der Körper sehr gut selber bekämpfen. Bakterien produzieren häufig Gifte. Diese sind der Grund dafür, warum der Körper bei bakteriellen Infektionen so geschwächt ist.
Antibiotika
Es gibt Krankheiten, bei denen Antibiotika unverzichtbar sind und einen wirklichen Segen für die Gesundheit unserer Kinder bedeuten. Kinder- und Jugendärzt*innen verordnen Antibiotika aufgrund ihrer Ausbildung sparsamer bei Kindern und Jugendlichen als Kolleg*innen anderer Fachgruppen. Dies aus gutem Grund: So ist beispielsweise bekannt, dass die Einnahme von Antibiotika in den ersten sechs Monaten das Risiko für allergische Erkrankungen steigert. Auch das Auftreten einer Zöliakie oder einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung kann durch Antibiotikagabe gefördert werden.
Pilzinfektionen kennen die meisten Menschen als oberflächliche Infektionen der Haut. Sie sind mit entsprechenden Salben gut zu behandeln. Schwere innerliche Infektionen mit Pilzen sind bei Kindern und Jugendliche eine Ausnahme.
Umweltbedingungen und Jahreszeiten
Bekannt für eine „Schnupfennase“ und Husten aufgrund von Virusinfektionen sind Frühjahr und Herbst. Auch die typische Zeit der Grippewelle zwischen Dezember und Februar kennen alle. Die Ursache ist unter anderem, dass wir uns in dieser Zeit häufiger in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen aufhalten. Paradebeispiel: Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen. Hinzu kommt ein sinkender Vitamin-D-Spiegel wegen der fehlenden Sonne (siehe Seite 313).
Darüber hinaus sind bei einem Wetterumschwung gehäuft Ohrenschmerzen zu beobachten, vermutlich ist es die Veränderung des Luftdrucks im Zusammenhang mit einer verengten Eustachischen Röhre (siehe Seite 74). In Phasen mit stabilem Hochdruck mit einer lang anhaltenden Wärme- oder Kälteperiode treten gehäuft eitrige Infektionen auf. Die lange „dunkle“ Periode, vor allem Dezember bis März, ist bekannt für wiederkehrende Infekte unterschiedlichster Art.
Krankheiten kommen meist zur falschen Zeit
Das gesellschaftliche Vorbild: Alles muss perfekt sein, alles wird größer, schöner, schneller und billig, 24/7 – immer erreichbar, Mausklick-bestellt-geliefert … Da hat Krankheit keinen Platz.
Die meisten Krankheiten sind lästig und kommen zur Unzeit, manche hinterlassen Spuren und wenige zwingen zu deutlichen und schmerzhaften Einschnitten. Aber viele Menschen sagen auch, durch die Krankheit etwas gelernt oder eine Erkenntnis gewonnen zu haben. Manche Kinder können nach einer Krankheit etwas, das sie vorher nicht konnten, sie wirken irgendwie reifer.
Aus medizinischer Sicht sind einige Krankheiten unvermeidbar, zum Beispiel Infekte beim Eintritt in Kinderkrippe und Kindergarten. Dabei setzt sich der Körper mit der Umwelt auseinander und trainiert das Immunsystem. Auch an den vielen kleinen Verletzungen und Stürzen, vor allem bei Kleinkindern, führt kein Weg vorbei. Auf diese Weise lernt das Gehirn die Umwelt und lauernde Gefahren kennen.
Wichtig ist, wie man mit den Krankheiten und Verletzungen umgeht. Zwei Faktoren sind wesentlich: das elterlichen Vorbild (und evtl. der älteren Geschwister) und die emotionale Veranlagung des Kindes.
Kindern lernen von den Eltern
Reagieren Sie als Eltern gelassen bei hohem Fieber oder einer blutenden Knieverletzung, dann wird auch Ihr Kind gelassen bleiben. Wirkt Ihr Blick sorgenvoll oder klingt Ihre Stimme ängstlich, dann wird sich Ihr Kind echte Sorgen um seine Gesundheit machen, vielleicht sogar Angst spüren.
Ihr Kind hat zunächst mit Krankheit, Verletzung und Schmerzen kaum eigene Lebenserfahrung und benötigt Hilfe, um die Schwere richtig einzuordnen, die passenden Worte zu finden und mit der Situation richtig umzugehen. Die Möglichkeit, die eigene Krankheit mit dem Verstand zu analysieren, entwickelt sich erst im Laufe vieler Jahre. Das kann bedeuten, dass Kinder die Angst womöglich noch viel tiefer und lebensbedrohlicher empfinden als wir Erwachsenen.
Sieht das Kind, dass Mama und Papa, die „allwissenden Eltern“, immer irgendwie eine Lösung finden, dann empfindet es Sicherheit und Zuversicht: Alles wird gut! Das Kind erlebt: „Wenn es mir schlecht geht, dann sind Menschen da, die sich liebevoll um mich kümmern, denen ich wichtig bin.“
Gelingt es Ihnen als Eltern, der Krankheit etwas Positives abzugewinnen, zum Beispiel indem sie die Zeit der Ruhe und Genesung als Geschenk bezeichnen, dann ist das für Ihr Kind eine gute Hilfe, die Krankheit besser zu verarbeiten.
Emotionale Veranlagung des Kindes
Kinder verhalten sich generell sehr unterschiedlich, so auch bei Schmerzen und Verletzungen. Die einen benötigen bei jedem kleinen Kratzer Trost, die anderen stürzen auf Kopf und Nase und rennen danach los, als wäre nichts geschehen. Wie Sie als Eltern auf Krankheiten und Verletzungen reagieren sollten, richtet sich daher auch nach dem Bedürfnis des Kindes. Wer Trost und Zuwendung benötigt, bekommt sie auch.
Das können Sie tun
Oft ist es sinnvoll, den Selbstheilungskräften zunächst die Arbeit zu überlassen und die so entstandene „erzwungene“ Pause und das Durcheinander erst einmal anzunehmen. Mit der Zeit entwickeln sich Lösungsideen und neue Möglichkeiten tun sich auf.Bei Krankheit ergibt sich häufig die Möglichkeit für Zuwendung, Kontakt, Gespräche und gemeinsame Zeit.Auf jedem Fall beschleunigt es die Heilung, wenn Sie Ihrem Kind Zuversicht vermitteln können.Positive Gedanken helfen: „Ich darf Pause machen!“, „Ich muss nichts für die Schule lernen!“, „Ich darf mich verwöhnen lassen!“, „Das ist eine geschenkte Zeit!“, „Ich kann Sachen machen, für die ich nie Zeit habe.“Auch Fragen helfen: „Was kann ich durch die Krankheit lernen?“, „Will mir mein Körper damit etwas sagen?“Krankheiten eröffnen dem Gehirn die Möglichkeit, neue und kreative Gedanken zu entwickeln.Reiseapotheke
Was ins Reisegepäck gehört, hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise von dem Urlaubsziel, der Dauer, der Jahreszeit, Anzahl und Alter der Kinder und von den besonderen Bedürfnisse der einzelnen Familienmitgliedern. Wenn ein Kind zum Beispiel oft eine Augenentzündung hat, dann gehören Augentropfen ins Gepäck, bei empfindlicher Haut die entsprechenden Cremes. Im Folgenden sind Beispiele für Medikamente genannt, die sinnvollerweise in die Reiseapotheke gehören. Die Auflistung ist an die Empfehlung des Centrums für Reisemedizin angelehnt (www.crm.de).
Immer dabei:
Schmerz- und Fiebermittel: Ibuprofen Saft/Tabletten und/oder Paracetamol Saft/Zäpfchen/TablettenErbrechen und Übelkeit: MCP-Tropfen (ab 2 Jahren) oder Vomex Zäfchen/Saft (ab 3 Jahren)Desinfektionsmittel: Octenisept SprayDesinfektionssalbe: Bepanthen Antisept Creme oder JodsalbePflaster, elastische Bandage/BindeWundcreme: zum Beispiel Cistrosencreme von Stadelmann, Rosatum Heilsalbe von Wala, Calendula Creme von Weleda, Bepanthen Wund- und HeilsalbeKurze Reisen:
Pinzette, Schere, EinmalhandschuheSonnenbrand: Wund- und Brandgel von Wala oder Fenistil Gel (siehe Seite 188)Lippenherpes: Melissenbalsam von Stadelmann oder Aciclovir CremeNasentropfen: Nasivin (auf die Altersdosierung achten – siehe Seite 112)Augentropfen: Euphrasia, ggf. Ofloxacin (Antibiotikum)Ekzem: entsprechende Pflegecreme und Kortison Creme, falls es einen Schub gibt (siehe Seite 177 – 179)Juckreizblocker: Innerlich: Desloratadin Saft/Tabletten oder Cetirizin Saft/TablettenÄußerlich: Wund- und Brandgel von Wala oder Fenistil GelFlugreisen – Handgepäck:
Einen Teil der Medikamente ins Handgepäck nehmen, falls es Probleme mit dem Koffer gibt.Medikamente für Kinder, ebenso Schmerzmittel.Besondere Reiseziele:
Durchfallblocker: Loperamid (ab 2 Jahren) – nur kurzzeitig anwenden (siehe Seite 142).Elektrolytlösung: Apfelsaft 1:1 verdünnt mit Wasser für die ersten Stunden.Oralpädon oder Elotrans (einige Beutel).Mückenschutz: Sehr effektiv bei gefährlichen Mücken sind:Anti Brumm Forte (ab 3 Jahren) oder Nobite Hautspray (ab 1 Jahr): mit DEET.Autan Protection Plus Multi Insektenschutz (ab 2 Jahren), Doctan Classic Spray Lotion (ab 2 Jahren): mit Icaridin.Anti Brumm Naturel (ab 1 Jahr) oder Zedan Natürlicher Insektenschutz (keine Altersangabe): beide mit natürlichem Wirkstoff aus Zitroneneukalyptusöl.Ream Quartett Anti Mücke Hautspray (keine Altersangabe): mit EBAAP, bei empfindlicher Haut, wirkt weniger lang.MückennetzMalariaschutz: Infos zu Tabletten und anderen Maßnahmen wie Moskitonetz finden sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit e. V. (www.dtg.org).Besondere Medikamente:
Dafür benötigen Sie ein Attest vom Arzt: zum Beispiel für Methylphenidat, Elvanse oder andere Medikamente, die auf speziellen Betäubungsmittel-Rezeptformularen verordnet werden.Tipps für den Aufenthalt in Ländern mit eingeschränkter Hygiene:
Fürs Essen gilt: „Schäle es, koche es oder vergiss es!“Trinken: Wasser nur aus original verschlossenen Flaschen, auch zum Zähneputzen.Handhygiene ernst nehmen.Informieren Sie sich vor Antritt der Reise, welche Impfungen sinnvoll sind, ob und wie Sie sich und Ihr Kind vor Insekten und anderen (giftigen) Tieren schützen müssen. Informationen finden Sie unter anderem im Internet unter: www.auswaertiges-amt.de oder www.dtg.org, www.tropeninstitut.de.
Fieber
Der erste Fieberschub, den Eltern mit ihrem Kind erleben, ist meist mit viel Aufregung verbunden. Fieber ist eine ausgezeichnete Abwehrreaktion des Körpers gegen Krankheiten. Gesteuert von der Temperaturzentrale im Gehirn (genauer: im Hypothalamus) steigt die Körpertemperatur. Ab 38,5 °C sterben viele Viren ab und das Bakterienwachstum verlangsamt sich. Auch im Tierreich entwickeln alle Warmblüter bei Infektionen Fieber, wechselwarme Tiere (z. B. Eidechsen) suchen bei Krankheit einen warmen Ort auf – hindert man die Tiere daran, sterben sie häufiger an den Infektionen.
Der Körper hat mit dem Fieber einen Vorteil bei der Bekämpfung der Erkrankung, die Abwehr wird durch das Fieber verbessert. Schon durch einen Anstieg der Temperatur von 37 °C auf 38 °C wird die Anzahl der Abwehrkörper um das 1000-Fache gesteigert. Um Fieber zu erzeugen, setzt der Körper viel Energie ein, pro Grad etwa 12 % seines Grundumsatzes.
Weitere Vorteile wurden gefunden. Hatten Kinder im Kleinkindalter häufig Fieber, so traten im späteren Leben seltener Asthma und Krebserkrankungen auf. Durch liebevolle Zuwendung während der Krankheitsphase wird die Bindung (siehe Seite 331) gestärkt, diese Kinder sind später im Leben körperlich und emotional gesünder.
Bei Fieber gilt: Der leidende Mensch wird behandelt – nicht das Fieber.
Schüttelfrost: Wenn der Körper das Fieber schnell ansteigen lassen will, dann erzeugt er über Zittern zusätzliche Wärme. Schweiß: Dieser wird ausgeschieden, wenn der Körper sich abkühlen will.Gliederschmerzen: Sie treten häufig auf und sind ein Zeichen, dass der Körper bereits sehr aktiv gegen die Krankheit arbeitet. Ich bin überzeugt, dass es das Signal des Körpers ist: Mach Pause, schon dich, ich brauche Zeit mich zu erholen!
Mit dem Fieber reagiert der Körper auf Viren oder Bakterien. Vor allem bei Kindern ist ein Infekt der oberen Luftwege – verursacht durch Viren – mit Abstand die häufigste Ursache für Fieber. Darunter fallen Hals- und Rachenentzündungen, Schnupfen, Bronchitis und Infektionen durch Grippeviren. Über die Atemwege findet der häufigste Kontakt zur Umwelt statt (siehe Seite 101).
Grobe Hinweise auf den Auslöser liefern der Verlauf und die Reaktion auf Fieber senkende Medikamente:
Ein Virusinfekt hat einen wellenförmigen Fieberverlauf und spricht gut auf Fiebersenker an: Das Fieber sinkt deutlich und das Kind wirkt wieder relativ fit.Bei einer bakteriellen Infektion ist der Fieberverlauf relativ gleichmäßig. Sie spricht weniger auf Fiebersenker an: Das Fieber sinkt wenig und das Kind wirkt weiterhin krank.Bis zum Alter von drei Monaten gilt: Je höher das Fieber, desto schwerer ist die Erkrankung. Nach dem dritten Lebensmonat gibt es keinen Zusammenhang mehr zwischen der Höhe des Fiebers und der Schwere der Erkrankung.
Das können Sie tun
Behandlungsmöglichkeiten für grippale Infekte finden Sie im Kapitel Atemwege (siehe Seite 101). Grundsätzlich gilt aber, dass bei Fieber immer nach der Ursache geforscht werden muss, um diese dann zu behandeln. Manchmal mag jedoch ein Fiebermittel sinnvoll sein. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Schmerz- und Fiebermittel“ (siehe Seite 52).