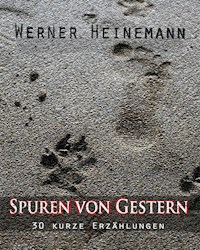
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese ausgewählten 30 Kurzgeschichten erzählen vom Alltag, der durch vielfältige Begebenheiten zum besonderen Alltag wird. Da taucht der Juden Max auf, wir treffen eine bügelnde Nazi Schlampe, erleben eine verliebte Zweisamkeit auf dem Balkon, erfahren von teuflischen Morden, hören den ewigen Gesang der Nachtigall, spüren den Lebenshunger vor schwerer Operation, werden zu Janik in ein Problemviertel versetzt, beobachten alte Männer im Park, besuchen Erik am Sonntagvormittag, vernehmen ein Wort zu Elisabeth Ritter und noch vieles mehr. Alles Geschichten, die für Frauen und Männer gleichermaßen interessant sein dürften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Heinemann
Spuren von Gestern
30 kurze Erzählungen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Werner Heinemann
Am Staketenzaun
Auf dem Balkon
Blues
Blumenstiel
Das Treffen mit Hildchen
Der Hauptmann der NVA
Der Juden Max
Der kleine Klausemann
Der kunstlederne Koffer
Die Beerdigung
Die Grillparty
Die himmlische Königin der Unterwelt
Die Wut der alten Männer
Ein Wort zu Elisabeth Ritter
Eric am Sonntagvormittag
Hermann Löns, die Heide brennt
Hollmann im Hotelzimmer
Janik
Lebenshunger
Leichengeruch
Mama hat Geburtstag
Nachrichtenmacher
Nazi Schlampe
Probleme und solche Dinge
Reisebericht für Karlina
Sille, Torben und der Prediger
Teuflische Morde
Und ewig singt die Nachtigall
Unter Dampf
Zurück im Dorf
Impressum neobooks
Werner Heinemann
Spuren von Gestern
30 kurze Erzählungen
Am Staketenzaun
Ria saß auf der Bank am Wohnhaus im Vorgarten, der zur schmalen Straße und der Hofeinfahrt von einem Staketenzaun begrenzt war. Vor ihren Füßen lag Rambo, der sehr gern döste. Sie war gelangweilt und hoffte, dass einmal etwas passieren würde. Aber wohin sie ihren Blick auch wendete, ob geradeaus über die weiten Getreidefelder, rechts den geteerten Weg entlang, der zur Landstraße oder in linker Verlängerung als Feldweg bis zu den Fischteichen führte, es tat sich nichts. Bis auf die Lerche, die vor ihr hoch in der Luft stand und ihr Liedchen schmetterte.
Sie hing ihren Gedanken nach, darüber, dass hier draußen nie was los ist und über Sven, der mit ihr etwas losmachen will, aber sie nicht mit ihm. Und sie dachte an Papa, der mit Leib und Leben Bauer war und trotzdem wenigstens einmal am Tag mit seinem Schicksal haderte: „Diese Maloche, diese verdammte Maloche!“
Mama, die arme, immer kranke Mama, die den chronischen Husten nicht loswurde, obwohl die ratlosen Ärzte sogar schon mehrmals dreiwöchiges Reizklima verordnet hatten. Ihre Geburt soll Mama beinahe das Leben gekostet haben, hatte Mama ihr eröffnet und anschließend heftig gehustet. Oma hatte ihre eigene Einstellung zu Mamas Krankheit: „Früher haben die Menschen viel gehustet und sogar öfter Blut gespuckt, aber heutzutage hustet man nicht mehr so viel und Blutspucken ist ganz aus der Mode. Die beste Medizin ist Arbeit, die lenkt vom Husten ab.“
Und Opa, ja, der war cool und immer parteiisch ganz auf Rias Seite. „Nun lasst doch das Mädchen mal in Ruhe!“, forderte er schon präventiv, bevor Ria überhaupt einer Kritik ausgesetzt war.
Rambo hob leicht den Kopf und war urplötzlich hochkonzentriert. Schon klar, dachte Ria, für Rambo ereignet sich mal wieder extrem Wichtiges; aber leider auch nur für ihn. Sie sah trotzdem in seine Blickrichtung, den geteerten Weg entlang. Ja, da kam jemand, aber der war noch schwer zu identifizieren. Rambo blieb hellwach.
Opa hegte und pflegte den uralten Staketenzaun. „Denn hier“, so Opa, „hatte es sich entschieden zwischen mir und Oma. Sie stand im Vorgarten hinter dem Zaum und ich kam vom Feld, hielt auf der anderen Seite an und tat als ob mein alter Fendt zickig wäre. Und weil Oma am Zaun blieb und mir zusah, fragte ich sie, ob sie auf der Kirmes mit mir tanzen wolle. Ja, aber ich solle mir darauf nichts einbilden, hatte sie geantwortet. So einfach war das. Wenn es bloß mit ihr auch so einfach geblieben wäre.“
Rambo knurrte leise. Ria wandte den Kopf in Richtung jemand. Es war ein Mann, der ein Fahrrad schob. Es war ein junger Mann. Rambo wurde unruhig, ihm war ein junger Mann, der ein Fahrrad schob, äußerst verdächtig. „Schhh!“, Ria zog den Laut aus drei Buchstaben beschwichtigen lang. Rambo verstand, behielt aber aufmerksam den jungen Mann im Auge.
„Deine Mutter“, hatte Opa gesagt, „das arme Mensch, war schon krank, als sie hier ankam. Ich sagte noch zu deinem Vater: Junge, sagte ich, das Mensch ist nicht gesund und eine Bauersfrau wird die nie. Man gut, dass dein Vater so ein Eigenbrötler, so ein Sturkopf ist, denn sonst hätten wir dich nicht, mein Kind.“
Ria erinnerte sich plötzlich an ihre Konfirmation im diesjährigen April. Mama hatte verzückt geschwärmt: „Wie hübsch sie aussieht. So hübsch!“
Und Opa hatte bestätigt: „Ja, meine Kleine hat sich ganz schön rausgemacht und wenn sie erst das Brautkleid anhat, dann werde ich auch noch mal jung.“
Oma konterte darauf: „Wozu das denn?“
„Damit ich noch einmal mit der schönsten Braut tanzen kann“, hatte Opa stolz und überzeugt geantwortet.
Rambo knurrte und brachte Ria in die Jetztzeit zurück. Er war aufgestanden und angriffslustig. „Schhh“, beruhigte ihn Ria. Der junge Mann, der ein Fahrrad schob, war nur noch wenige Meter von ihnen entfernt und als er ihre Höhe erreicht hatte, blieb er hinter Opas Staketenzaun stehen.
„Guten Tag“, sagte er, „hier geht’s doch zum Landgasthaus Schöne Aussicht.“
Ria erhob sich, Rambo machte neben ihr Sitz. „Nein“, bedauerte Ria, „hier geht’s zu den Fischteichen und danach ist Schluss“. Sie dachte, was er doch für schöne weiße Zähne hat, eine gesunde braune Haut und diese Augen, die sie so ansahen.
„Au Mann“, sagte er, „heute ist nicht mein Tag!“
Ihr war nicht richtig bewusst, dass sie auf den kleinen Steinplatten direkt auf ihn zuging. Rambo, ganz Herr der Lage, schritt dicht an ihrer Seite. Zwischen ihnen der Zaun. Sie musste ein wenig zu ihm aufsehen, als sie erklärte: „Nach der Ortsausfahrt hättest du – ich meine Sie – gleich die erste Abfahrt nehmen müssen, dort ... und dann bergauf im Wald ... ich meine da drüben ... das ist die Schöne Aussicht.“
Er sah in die Richtung, entdeckte sein entferntes, verfehltes Ziel und stellte trocken fest: „Na, dann habe ich ja noch was vor mir.“
Rambo machte Sitz und verfolgte das Geschehen aufmerksam.
Ria hatte die Augen gesenkt und ging mit sich selbst ins Gericht. Was stammelte sie nur für ein wirres Durcheinander? Warum stand sie hier am Zaun? Was war los mit ihr? Und was er für schöne, gepflegte Hände hatte. Diese tiefe Stimme, die stoisch feststellte: „Na, dann habe ich ja noch was vor mir.“ War ihr heiß oder kalt? Sie wollte ruhiger atmen als ihr Herz schlug. Das gelang ihr nur, weil das Herz zu rasen begann.
Als sie ihn reden hörte, hob sie wieder ihre Augen. Sie hörte wohl, aber verstand ihn nicht. Er musste sie für blöd halten. Sie stellte fest, dass sie bejahend mit dem Kopf nickte. Oh, wie peinlich! Das Fahrrad, was war mit dem Fahrrad? Ach, er hatte einen Platten. Dieses uralte Fahrrad hatte mit Sicherheit nicht den ersten Platten. Sie musste ihm helfen. Er durfte unter keinen Umständen mit einem platten Reifen wieder davon schieben.
„Ja, ja. Natürlich, ich hole Ihnen Wasser“, brachte Ria immer noch ganz neben sich heraus.
Aber er hielt sie zurück: „Wir waren doch eben schon beim Du.“
Beim Du? Ja, sie hatte öfter zustimmend mit dem Kopf genickt. Ja, ja, sagte sie sich, tausendmal Ja! Und sie stammelte: „Oh ja“.
„Übrigens, ich heiße Jonas“, sagte er und sah sie dabei mehr lieb als nur freundlich an.
Er heißt Jonas, schoss es ihr durch den Kopf. Und innerlich flehte sie: Bleib hier, ich hole dir Wasser. Aber er ließ sie nicht gehen. „Und? Und wie heißt du?“, wollte er wissen.
„Ria“, sagte sie und dachte: Jonas, ich heiße Ria.
Jonas glaubte: „Ria ... das ist schön kurz, das kann ich mir merken.“
Sie sahen sich an. Und sie sahen sich ganz bewusst in die Augen. Ria glaubte sich in seinen zu verlieren. Sie rettete sich gerade noch: Das Wasser, das Wasser. Ich muss Jonas in einer Schüssel das Wasser holen, damit er nicht mit einem platten Reifen wieder davonziehen muss.
Ria lief davon und rief in sich hinein: Das ist sie. Das ist die Liebe. Ich bin verliebt. Ich liebe Jonas.
Rambo entschied sich, den Kerl auf der anderen Zaunseite weiter streng zu beobachten. Jonas war so klug, die Staketen nicht zu berühren, denn Rambo hätte die schwere Grenzverletzung aggressiv beantworten können. Er holte stattdessen aus der kleinen ledernen Tasche am Fahrradsattel das Flickzeug.
Alles wird jetzt anders sein, Ria, sagte sich Ria. Wie schnell doch das mit einem passiert. Und wie völlig neben sich der Verstand gerät. Nur noch diese Gefühle im Bauch, im Kopf, im Herzen, sie alle jubilieren Jonas, Jonas, Jonas. Ja, Liebe hat etwas von glücklich sein.
Aber auch Ria erfuhr schnell, wie die Sorge um das Glück aller Liebe einen bittersüßen Beigeschmack untermischte. Kann sie sich denn seiner Liebe überhaupt sicher sein? Nein, seine Liebe zu ihr setzte sie voraus und seine Blicke will sie falsch verstehen, glaubte sie. „Aber er sieht mich doch so an, so ... ich weiß nicht wie. Da irre ich mich nicht“, sagte Ria halblaut und wenig überzeugt zu sich selbst.
Was aber, wenn Jonas den Fahrradschlauch reparierte, sich für die Hilfe bedankte und auf Nimmerwiedersehen davonradelte? Ria beschwor sich: Das muss ich verhindern. Ich muss ihm zeigen, wie gern ich ihn habe, obwohl ich ihn doch erst seit ein paar Minuten kenne. Er wird mich verstehen, er muss mich verstehen. Und er sieht mich doch auch so an.
Die Befürchtung, dass er schon eine Freundin hat, ließ nicht lange auf sich warten. Es schmerzte schon, bevor es überhaupt sicher war, dass er vergeben war. Nein, ich will nicht dran denken. Ich will, das Jonas mir gehört, sagte sich Ria entschlossen und fügte flüsternd an: „Ich kämpfe um ihn.“ Dabei ballte sie eine kleine Faust.
So ungeschickt hatte sie sich selbst noch nicht erlebt. Beinahe hätte sie das Wasser vergossen. Ria stellte die Schüssel ab. Jonas war schon fertig und pumpte den Schlauch auf. Rambo strich hinter dem Zaun auf und ab. Die Lage hatte sich anders entwickelt, als er angenommen hatte. Zudem war Ria zu dem Kerl auf der anderen Seite des Zauns gewechselt. Entspannung war angesagt, auch wenn’s dem Hund schwerfiel.
Jonas kniete auf einem Bein, ihm gegenüber tat’s ihm Ria nach, zwischen ihnen die Schüssel. Rambo kam dazu und zeigte sich interessiert. Jonas zog prüfend den aufgepumpten Schlauch langsam durchs Wasser.
„Da! Da sind sie!“, sagte Ria und wies mit dem Finger auf aufsteigende Luftblasen. Ihre Blicke fanden sich wieder kurz, es tat so gut, es war so schön. Lächelte er sie an oder amüsierte er sich über sie?
Plötzlich schoss es siedend heiß durch ihren Körper. Sie spürte, wie ihr Gesicht rot anlief. Ria wurde bewusst, dass sie lediglich in engen, alten Jeans, deren Hosenbeine sie sehr hoch abgetrennt hatte, und einem sparsamen Top leicht bekleidet von den Augen des Geliebten gesehen wurde. Hier draußen, wo immer nichts passierte, war die Kleidung gleichgültig, Hauptsache bequem und dem Wetter angepasst, aber was sollte Jonas von ihr denken? Er musste denken, sie sei so eine, so ein leichtes Mädchen. Wie sollte sie es ihm erklären, dass es sich nicht so verhielt? Aber seine Augen, die sie so ansahen, die sagten etwas ganz Anderes als leichtes Mädchen. Und das spürte und beruhigte Ria.
Jonas testete den geflickten Fahrradschlauch. „Der ist dicht“, sagte er, ließ die Luft ab und baute alles wieder zusammen.
Rambo schlabberte zwischendurch Wasser aus der Schüssel. Ria sah Jonas zu und wollte helfen, aber er brauchte ihre Hilfe nicht. Jonas war fertig und Ria sah, dass er sich nicht einmal seine schönen, gepflegten Hände schmutzig gemacht hatte und sie trotzdem in der Schüssel abspülte.
Mit Blick auf das Landgasthaus Schöne Aussicht sagte Jonas: „Seit ein paar Tagen habe ich da oben einen Job. Heute, an meinem freien Tag, wollte ich mal mit dieser Gurke die Gegend erkunden.“
Er schwang sein Bein über den Sattel und sah sie lächelnd an: „Vielen Dank für die Hilfe!“ Ria flehte innerlich: Fahr nicht, bitte fahr nicht so einfach weg!
Ria hätte nicht so besorgt sein müssen, denn so wie er sie die ganze Zeit angesehen hatte, war klar, dass er nicht so einfach wegfahren würde. „Ria“, sagte Jonas, „ich glaube, heute ist doch mein Tag.“
„Ja“, bestätigte sie, „meiner auch.“
Er reichte ihr die Hand. Sie nahm sie und hielt sie fest. „In einer Woche habe ich wieder meinen freien Tag. Wenn du willst, komm ich wieder. So gegen drei?“
„Ja“, strahlte Ria und ergänzte treuherzig, „ich ziehe mir auch was Ordentliches an.“
„Du gefällst mir auch so“, erklärte er, entzog ihr seine Hand, trat in die Pedale und radelte davon.
Ria, ihr Glück kaum fassend, sah ihm gemeinsam mit Rambo nach. Er sah sich nicht mehr um, wurde kleiner und kleiner, bis er nur noch als winziger Punkt zu sehen war.
Als sie sich umwandte, stand Opa mit verschränkten Armen in der Hofeinfahrt und Ria ahnte, was er dachte: Wie alt mag er sein, so neunzehn, zwanzig? Also Bauer ist der jedenfalls nicht.
Auf dem Balkon
Sie standen in Hemd und Hose auf dem Balkon und sahen in den späten Abend hinein. Sie im kurzen Hemd und er in einer kurzen Hose, die man spätestens seit dem verlorenen Krieg auch in der deutschen Heimat vornehmlich Shorts nennt. Sie rauchte und er dachte: Muss sie denn ausgerechnet jetzt rauchen, wo ich ihr doch den Antrag machen will?
Beide blickten in den sich zunehmend verdunkelnden Himmel, der sich über der etwas heller abgesetzten mediterranen Landschaft wölbte. Die ersten Sterne deuteten sich zaghaft an; der Mond war nicht zu sehen, weil er sich ganz, ganz blass ihrem Blickfeld entzog. Ihr fror in ihrem kurzen Hemdchen, das man spätestens seit dem verlorenen Krieg auch in der deutschen Heimat vornehmlich Shirt nennt. Es war nämlich schnell kühler geworden.
Er dachte: Wenn wir ein Zimmer auf der anderen Hotelseite hätten, hätten wir den Sonnenuntergang über dem Meer miterleben können. Sie geht aber nicht im Osten unter und Seeblick ist nun mal teuer. Manchmal spart man am falschen Ende, aber so war es auch schön. Wie so ganz anders es hier roch! Ganz anders als zuhause. Auch die Geräusche jetzt am späten Abend klangen völlig fremd.
Sie fragte: „Weißt du noch? Im Mai in Hamburg auf der Parkbank an der Binnenalster? Erinnerst du dich? Es war so warm. Wir hätten die ganze Nacht dort sitzen können, ohne zu frieren.“
Und ob er sich erinnerte. So lange war das ja nun auch nicht her, die paar Monate seit Mai. Es hatte nach einem Duftmix aus Flieder, Kirsche, Kastanie und Alsterwasser gerochen. Oder etwa so in der Art; jedenfalls so wie es im Mai an der Binnenalster gewöhnlich riecht. Doch irgendetwas fehlte ...
Er fragte zurück: „Kannst du dich an Vogelgesang, Motorenklang oder Menschengemurmel erinnern? Meine Maierinnerung ist ganz ohne Ton. Das ist sinnlich irgendwie inkomplett.“
Sie drückte die Zigarette auf der leeren Zigarettenschachtel aus und balancierte sie auf dem Geländer. „Nein, ich habe nur noch deine Stimme im Ohr. Ich hatte mich ganz auf dich konzentriert und wollte wissen, ob ich dich wirklich haben will“, antwortete sie und blickte wieder in den späten Abend.
Oh, dachte er, sie war anfangs noch unentschieden, ob sie die ganze lange Nacht ohne zu frieren mit mir auf der Parkbank oder im sündhaft teuren Hotelzimmer verbringen wollte.
„Was gab denn den Ausschlag, deine folgenschwere Entscheidung für mich zu fällen?“, wollte er wissen.
Sie drängte dicht an seine Seite und konterte: „Wer sagt dir denn, dass ich mich überhaupt schon für dich entschieden habe?“
Ihre Hand strich über seinen nackten Rücken. Das fühlte sich trotz ihrer kalten Finger angenehm an. Er sagte: „Du hast kalte Hände.“
„Ja“, bestätigte sie, „und die Füße sind noch viel, viel kälter. Ich friere. Und du musst meine Finger wärmen.“
Ihre Hand fuhr vom Rücken unter die kurze Hose. Sie lachte: „Da ist nicht viel dran. Aber schön warm ist es hier.“
Er dachte: Man müsste das jetzt festhalten können, für immer, für ewig, nicht bloß als Erinnerung, mehr so als wieder abrufbares erneutes Erleben. – Sie riecht so gut. Wie würde ich sie und ihre Stimme vermissen, wenn wir mal getrennt sein sollten. – Aber sie friert leicht, besonders an den Füßen. Sie wird sich hier draußen noch erkälten.
Er sagte: „Deine Hand ist wirklich kalt, eiskalt.“
Jemand versuchte sich auf einer Geige. Schräg quietschend lagen die Misstöne in der Luft und wollten nicht so recht zum späten Abend passen. Zwei Kater hatten sich seit geraumer Zeit stumm und bewegungslos drunten auf dem Parkdeck gegenübergesessen. Aus heiterem Himmel schrien und schlugen sie sich plötzlich.
„Einer von den beiden hat ganz offensichtlich die Nerven verloren“, kommentierte er das Geschehen.
Dicht an seinem Ohr hörte er sie deutlich atmen, als sie ihn mit gedämpfter Stimme aufforderte: „Komm, wir spielen Verstecken unter der Bettdecke. Ich erfriere hier ja sonst noch.“
„Nein, erfrieren darfst du mir nicht“, antwortete er.
Und beim Versteckspielen unter der Bettdecke vergaß er ganz und gar, dass er ihr doch an diesem späten Abend einen Antrag machen wollte.
Blues
Wenn einst die Nachwelt Lust verspürt, ihn aufarbeiten zu wollen, beginnen die problematischen Recherchen schon mit seiner Geburt. Man wird sein Geburtshaus nicht mehr ausfindig machen können, denn er kam in einer Nissenhütte zur Welt. Draußen vor der Stadt, wo sich heute das großflächige Gewerbegebiet erstreckt, hatte man diese Wellblechunterkünfte für die ausgebombten Bewohner, deutsche Flüchtlinge und Heimatvertriebene errichtet. Das ist aber schon ein ganzes langes Leben her.
Dass er seine eigene Geburt überhaupt überlebte, verdankte er der Hebamme Leopolda, einer stillen, zierlichen Oberschlesierin, die später den Lottohauptgewinn kassierte und auf Nimmerwiedersehen verschwand. Die Nabelschnur drohte ihn zu erwürgen. Leopolda gelang es, dies ohne ärztliche Hilfe zu verhindern. Und nachdem sie ihn minutenlang bearbeitet hatte, brach aus dem ins Leben Geretteten der Weltschmerz heraus. Er schrie ausdauernd und fiel anschließend erschöpft in einen ersten Schlaf.
„Von Anfang an ging es sofort mit der Scheiße los“, wird er nicht müde, seine eigene Geburtsstunde zu kommentieren.
Tatsächlich tat er sich schwer, fasste nur mühsam Fuß und es ging ihm nichts von der Hand. So steht er bis heute immer im Abseits, am Rand, allein, kontaktlos. Er ist ein verschlossener Eigenbrötler, der in seinem eigenen, für niemanden zugänglichen Universum lebt. Gelingt es eine Bresche in seine abwehrenden Mauern zu schlagen, wird er etwas zugänglicher, aber lässt dennoch niemanden wirklich an sich heran. Dann aber übertreibt er drastisch: „Von der Scheiße, die niemals aufhört, Scheiße zu sein.“
Dörrmeier, sein Flurnachbar, sagt: „Eine Traurigkeit beherrscht ihn; er ist traurig, einfach immer nur traurig.“
Von den wenigen Leuten, denen er nicht gleichgültig zu sein scheint, raten schon mal welche, dass er seine Schwermut behandeln lassen müsse. Doch dann blockt er sofort ab und antwortet darauf nichts. Die meisten Leute nehmen ihn gar nicht wahr. Er weiß, was die Übrigen von ihm halten. Da ist die Rede von:
„Dieser selbstmitleidige Tropf ...“
„Der hat bestimmt was auf dem Kerbholz ...“
„Ein derart ausuferndes Minderwertigkeitsgefühl ...“
„Selbstverachtung äußert sich oft arrogant ...“
„Ein unheimlicher Menschenhasser ...“
„Duckmäuser markieren immer ein Stück Unnahbarkeit ...“
„Ein schweigsamer, beleidigender Ignorant ...“
„Stellt eine schwermütige Zumutung dar ...“
„Ein Schläfer, ein gefährlicher Vulkan ...“
Und so weiter, und so weiter ...
Flurnachbar Dörrmeier sagt: „Er hat den Blues, aber hat dennoch Humor. Er ist eben einfach nur traurig. Warum? Wer weiß?“
Nun ist er in Rente und geht trotzdem morgens wie bisher, die alte Aktentasche unterm Arm, aus dem Haus. Aber jetzt taucht er später als früher im Viertel wieder auf. Er steht in Hansis Zapfhahn an der Theke und trinkt wie immer wortkarg und brummig ein Bier, das er stets sofort bezahlt. Grußlos wie er gekommen ist, geht er nach Hause, wenn er ausgetrunken hat.
Samstags kauft er beim Discounter ein und am Sonntagnachmittag steht er während Heimspielen der 1. Fußballherren der Kreisliga in der Nordkurve als einziger Zuschauer. Bei Auswärtsspielen und spielfreien Tagen läuft er ziellos durch die Stadt.
Dörrmeier sagt: „Er ist ein Clown; ein guter Clown. Denn nur ein trauriger Clown, kann ein guter Clown sein.“
Das will niemand so recht akzeptieren. Doch Dörrmeier bleibt bei seiner Aussage.
Die 1. Fußballherrenmannschaft hat ein Auswärtsspiel und Studentinnen veranstalten in der Fußgängerzone eine Befragung der Passanten. Die Leute müssen drei Bilder, einen Schwarzafrikaner, einen Gorilla und Donald Trump, spontan mit einem Begriff bezeichnen. Die Studentinnen sind mit den Nennungen Gorilla und Donald Trump einverstanden, aber dass er auf einem Bild einen Neger erkannt hat, versetzt sie in unwissenschaftliche Hysterie.
Er setzt sich brüllend zur Wehr: „Rassismus? Ich, ein Rassist? Ich bin selbst mein ganzes weißes Leben lang ein weißer Nigger gewesen!“
Irgendwie passend zur Szenerie spielen Straßenmusiker einen Blues.
Blumenstiel
Niels Blumenstiels Bruder Holger, der mir seit unserer Sitznachbarschaft auf der Gegentribüne in der Volkswagenarena bekannt ist, hat schriftliche Aufzeichnungen über Lebensumstände seines Bruders Niels gemacht und mir diese mit den Worten „mach was draus“ übergeben. Jedoch Wolfsburg dient nicht als Szenerie der brüderlichen Geschichte, die auf Art und Weise eines Polizeiprotokolls mit einer alten, mechanischen Schreibmaschine einschließlich dem hakenden Buchstaben G getippt wurde, sondern sie ereignete sich überwiegend im tiefsten Süden Niedersachsens.
Außer aus der Kellerwohnung konnte man aus den nördlich ausgerichteten Hausfenstern bei guter Sicht den Brocken im Harz klar erkennen. Auch die Sprungschanze auf dem Wurmberg sah man dann deutlich. Das Grundstück, auf dem das Mehrfamilienhaus stand, gehörte dem Witwer Heinz Goldmann, der selbst in der linken Parterrewohnung wohnte und von seiner Altersrente und den Mieteinnahmen ganz komfortabel lebte. Sein glücklich und zufriedenes Idyll wäre perfekt gewesen, wenn da nicht manchmal Ärger durch einen Mieter gestört hätte.
In der anderen Haushälfte, Goldmann gegenüber, wohnte die von ihrem Mann geschiedene Frau Doktor Mona Lisa Pechstein-Schwefel, im Obergeschoss links der Küchenmeister Hubert Nagel und seine Frau Rosa und rechts von ihnen residierte der ledige Polizeihauptkommissar Fred Engel.
Die Dachgeschosswohnung wurde von der Mediengestalterin Stefanie Bogert bewohnt, die bemerkenswerterweise Wert darauf legt, als Fräulein angeredet zu werden, was ihr unter anderem auch schon einen Arbeitsplatz gekostet hatte.
„Das Fräulein assoziiere ich mit der Freiheit, die auch eine emanzipierte Frau nur in den seltensten Fällen für sich in Anspruch nehmen kann. Ich will ganz bewusst ein nicht emanzipiertes Fräulein sein, um jedermann deutlich zu machen, dass ich auch ideologisch frei bin. Ich bin Fräulein und frei!“, argumentierte sie.
Doch ihre eigenwillige Argumentation wurde unter anderem auch behördlicherseits angefochten. Die Systeme der Stadtverwaltung sahen das Fräulein auch im Schriftverkehr nicht mehr vor. Stefanie Bogert monierte dies und machte den Fehler, darauf hinzuweisen, dass es ihr nicht um ihre ohnehin nicht mehr vorhandene Jungfräulichkeit zu tun sei, sondern um ihre Freiheit als Fräulein. Die Verwaltung stellte daraufhin neben Paragrafen zusätzlich klar, dass sie nach den veralteten, unzeitgemäßen Vorstellungen ohne nachweisbare Jungfernschaft eher als gefallenes Mädchen als ein Fräulein gegolten hätte. Auch insofern bliebe es in jedem Fall bei der korrekten Ansprache Frau, hieß es.
Beim Finanzamt hatte Stefanie Bogert mit ihrem Protest mehr Erfolg; der Beamte strich die Anrede Frau im Steuerbescheid und ersetzte sie handschriftlich durch Fräulein. „Hoffentlich kann er dadurch keinen Ärger bekommen“, befürchtete Fräulein Bogert nachträglich.
Kinder wohnten in dem Haus schon lange nicht mehr. Und die Kellerwohnung gegenüber den Versorgungsräumen wurde von Niels Blumenstiel bewohnt. Die Betonung liegt auf wurde, denn Blumenstiel war verschwunden.
Heinz Goldmann hatte als Vermieter schon einiges erlebt. Messie und Mietnomade waren ihm keine Unbekannten. Und bei allem Verständnis für krankhafte Neigungen und Nachsicht gegenüber ausgelebter krimineller Energie, fühlte Goldmann sich doch angesichts des Schadens, den solche Leute ihm zufügten, mitunter ziemlich allein gelassen.
Niels Blumenstiel blieb Goldmann zwar mit seinem Verschwinden vier Monatsmieten schuldig, die aber nach einer verrechneten Mietskaution in Höhe von zwei Mieten einen ertragbaren Verlust darstellten. Hinzu kamen allerdings unter anderem noch Kosten durch die Räumung und Entsorgung des überschaubaren und minderwertigen Mobiliars. Blumenstiel hatte die Wohnung, nachdem er den Personal Computer, die Stereoanlage und den 58 Zoll Flachbildfernseher irgendwie nach irgendwohin sichergestellt hatte, besenrein zurückgelassen.
„Naja, wenn der Blumenstiel auch nicht mehr der Jüngste war, war er doch eigentlich ein dummer Hanswurst“, urteilte Goldmann und ließ damit durchblicken, dass er härteren Tobak, dem ihm Mieter mitunter bereiteten, schon erdulden musste.
Polizeihauptkommissar Fred Engel bewertete Niels Blumenstiel ähnlich: „Schon die Tatsache, dass er sich nicht nur auf seinem Briefkasten als von Blumenstiel tituliert, beweist mir nicht den abgebrühten Hochstapler, der sich gesellschaftliche und finanzielle Vorteile durch seinen Selbstadel verspricht, sondern eher einen alten Mann, der akzeptiert und geachtet sein möchte.“
Eine nicht so wohlwollende Meinung über Niels Blumenstiel vertrat der Küchenmeister Hubert Nagel und begründete dies mit der Unterstellung, dass er, Nagel, sich tagtäglich abarbeiten müsse, während Parasit Blumenstiel nur sporadisch für den eigenen Lebensunterhalt sorge. Ganz von der Hand konnte man das nicht weisen, es war aber doch stark übertrieben.
Laut Bruder Holger hatte Blumenstiel bis zu seinem Abgang sogar ein Girokonto unterhalten, auf dessen vorgefundenen Kontoauszügen das Bemühen abzulesen war, genügend Guthaben vorzuhalten, um die laufenden Kosten bestreiten zu können. Niels Blumenstiel betätigte sich als Gelegenheitsarbeiter mit ständig wechselnden Arbeitsstellen. Beispielsweise konnte man ihn als Mitarbeiter eines Hausmeisterservice einen Rasen mähen, in der Garderobe des Theaters die Mäntel in Empfang nehmen oder auch schon mal im Advent einen Weihnachtsbaum verkaufen sehen.
Ein Auto besaß Niels Blumenstiel, der sich so gerne ganz ernsthaft von Blumenstiel nannte, nicht. Er legte in der Regel auch längere Strecken zu Fuß zurück. Den Stadtbus nutzte er lediglich, wenn er ausnahmsweise eine sperrige oder schwere Last zu transportieren hatte.
Rosa Nagel pflegte zu Blumenstiel ein gutnachbarschaftliches Verhältnis und hatte von ihm eine wesentlich bessere Meinung als ihr Gatte Hubert. „Herr von Blumenstiel hat so etwas Visionäres“, versuchte sie ihre Einschätzung zu erläutern.
Und Stefanie Bogert machte keinen Hehl daraus, dass sie Blumenstiel mochte. „Der alte Knabe wird früher sicher die Mädchen angezogen haben, wie das Gute und Schöne einen Ästheten“, vermutete sie und machte dabei ein Kussmündchen.
Feindselige Missachtung trifft als Beschreibung die gegenseitigen Abneigungen Niels Blumenstiels versus Frau Doktor Mona Lisa Pechstein-Schwefels wohl am besten. Das kam nicht von ungefähr, man kannte sich aus der Jugendzeit.
Als Frau Doktor Mona Lisa Pechstein-Schwefel in Goldmanns Haus eingezogen war, hoffte Niels Blumenstiel, dass sie ihn nicht wiedererkannte. Doch sie sprach ihn direkt auf ihre eher flüchtige Bekanntschaft an und bemerkte abschließend: „Ich bin außerordentlich erleichtert, dass Sie sich nicht auch noch übermütig Doktor von Blumenstiel nennen.“
Blumenstiel hatte geantwortet: „In Ihren Kreisen kennt man sich ja auch diesbezüglich bestens aus; wohl die wenigsten von euch dürften so wirklich lauter sein.“
Frau Doktor Mona Lisa Pechstein-Schwefel war eine renommierte Konfliktforscherin und wusste mit der Situation umzugehen, indem sie süffisant lächelnd Niels Blumenstiel stehen ließ und ihn fortan ignorierte.
Blumenstiels Bruder Holger war Frau Doktor Mona Lisa Pechstein-Schwefel zwar persönlich nicht bekannt, er erinnerte sich aber, dass vor Jahrzehnten sein jugendlicher Bruder Niels berichtete, dass ihm Leonardo da Vincis Mona Lisa Leid täte, weil die Eltern einer Revolutionärin vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund keine größere Geschmacklosigkeit unter Beweis hätten stellen können, als ihre hässliche Tochter auf den Namen Mona Lisa taufen zu lassen.
„Mein Bruder Niels trieb sich damals mit seinen sechzehn, siebzehn Jahren unter den Studenten herum“, berichtete Bruder Holger und fuhr in der maschinenschriftlichen Biographie ausführlich fort:
„Wir, mein Bruder und ich, kamen zwar nicht aus der Gosse, aber nicht weit davon entfernt. Wir hungerten auch nicht, wurden aber lediglich kostengünstig und obendrein falsch ernährt. Naja, wir entstammten unterstem Proletariat. Unser Vater leitete seine schier endlosen politischen Reden stets klassenbewusst mit den Worten ein: ‚Ich als Prolet sage …‘.
Eine Kommilitonin und Genossin der Studentin Mona Lisa Pechstein hieß Lorena und war von der Natur mit ganz besonderer Schönheit bedacht worden. Mit ihren Genossinnen und Genossen hatten sie gemeinsam gegen den Vietnamkrieg demonstriert, Häuser besetzt, die Polizei mit Steinen beworfen, Schaufensterscheiben demoliert, die Meinungen anderer niedergeschrien, gegen das Establishment randaliert und sonstige revolutionäre Gedanken in die Tat umgesetzt.
Lorena und Niels hatten etwas Gemeinsames, nämlich ihren Geburtstag am gleichen Tag, wobei Lorena wohl vier bis fünf Jahre älter gewesen sein dürfte. Mein Bruder Niels sagte damals, dass Lorena in zweierlei Hinsicht Interesse an ihm gehabt habe.
Erstens sei er ihr Studienobjekt aus sozial schwachem Umfeld gewesen, das es galt radikal im sozialistischen Geiste zu revolutionieren. Niels gab zwar zu, dass er von der klugen Lorena viel Brauchbares gelernt hätte, aber er fragte sich auch ungläubig, warum er, wie Che Guevara im afrikanischen und bolivianischen Urwald, eine Arbeiterklasse befreien sollte, die sich weder für den Sozialismus begeistern wollte, noch besonders unfrei wähnte.
Und zweitens gab es in der revolutionären Epoche natürlich auch eine sexuelle Revolution. Niels gestand auch diesbezüglich ein, dass er von der schönen Lorena viel Brauchbares gelernt hätte. Gerne erinnerte er sich später an die gemütliche Matratzenecke in der Wohngemeinschaft. Allerdings hatte er stets das ungute Gefühl, zusammen mit Lorena von mehr oder weniger zugekifften Kommunardinnen und Kommunarden überrascht zu werden. Deren hemmungsloser Begierde nach Gruppensex stand Lorena zum Glück ablehnend gegenüber.
So jung Niels auch war, erkannte er aber doch, dass seine verliebte Beziehung zu Lorena nicht von Dauer sein würde. Spätestens dann, wenn Lorena ihren Langen Marsch durch die Instanzen angetreten hatte, bei dem etappenweise der große Vorsitzende Mao im Geiste mitmarschieren würde, trennten sich ihre Wege in voneinander sehr verschiedene Welten.





























