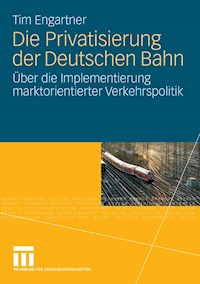Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, warum es einen Staat braucht, der seine Bürger schützen, notleidende Unternehmen stützen und lebensrettende Infrastrukturen – Stichwort: Impfungen – organisieren kann. Dessen ungeachtet hallt das Credo des »schlanken« Staates in weiten Teilen der Gesellschaft nach. Anhand besonders eindrücklicher Beispiele analysiert Tim Engartner in sieben Kapiteln – Bildung, Verkehr, Militär, Post und Telekommunikation, soziale Sicherung, Gesundheit sowie kommunale Versorgung – die Privatisierungen in Deutschland und ordnet sie in internationale Zusammenhänge ein. Sein Weckruf zeigt: Die Politik der Privatisierung öffentlicher Aufgaben, die von allen regierenden Parteien betrieben wird, ist nicht alternativlos. Die historischen Rettungspakete, die der Bund im Zuge der Corona-Krise 2020/21 geschnürt hat, drohen aber den Ruf nach weiteren Ausverkäufen noch lauter werden zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tim Engartner
Staat im Ausverkauf
Privatisierung in Deutschland
2., aktualisierte und erweiterte Auflage
Campus Verlag Frankfurt / New York
Über das Buch
Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, warum es einen Staat braucht, der seine Bürger schützen, notleidende Unternehmen stützen und lebensrettende Infrastrukturen – Stichwort: Impfungen – organisieren kann. Dessen ungeachtet hallt das Credo des »schlanken« Staates in weiten Teilen der Gesellschaft nach. Anhand besonders eindrücklicher Beispiele analysiert Tim Engartner in sieben Kapiteln – Bildung, Verkehr, Militär, Post und Telekommunikation, soziale Sicherung, Gesundheit sowie kommunale Versorgung – die Privatisierungen in Deutschland und ordnet sie in internationale Zusammenhänge ein. Sein Weckruf zeigt: Die Politik der Privatisierung öffentlicher Aufgaben, die von allen regierenden Parteien betrieben wird, ist nicht alternativlos. Die historischen Rettungspakete, die der Bund im Zuge der Corona-Krise 2020/21 geschnürt hat, drohen aber den Ruf nach weiteren Ausverkäufen noch lauter werden zu lassen. »Der Autor … plädiert tapfer für öffentliche Bildung oder einen regulierten Gesundheitsmarkt und gegen die Verbetriebswirtschaftlichung der öffentlichen Daseinsfürsorge.« Süddeutsche Zeitung
Vita
Tim Engartner ist Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Direktor der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung. Er veröffentlicht regelmäßig Artikel in Tages- und Wochenzeitungen (ZEIT, FAZ, FR, taz, Freitag, SZ).
Inhalt
Staat im Ausverkauf – ein Weckruf
Ein lukrativer Markt: das Bildungssystem
Kinder als Kunden: Krippen, Kitas und Kindergärten
Unterricht aus der Marketingabteilung: die Schulen
Die Coronapandemie als Türöffner für die Digitalkonzerne
Apple: iPads, Classroom-Apps und »Education Pricing«
Facebook: Bildungspolitik und personalisierte Lehrpläne
»Googlefizierung« der Klassenzimmer
Microsoft: Programmierkenntnisse zur Codierung des Lebens
Amazon: zwischen Schreibwettbewerben und Lesefreuden
Schleichende Werbung in Zeiten digitaler Euphorie
Der Boom von Unterrichtsmaterialien
Die Ernährungslehre der Lebensmittelindustrie
Die Automobilhersteller erklären den Klimaschutz
Die Finanzwirtschaft lehrt Produktkunde
Profit vor Pädagogik: die Privatschulen
Fragwürdige Schulkonzepte
Distinktion statt Inklusion
Im Notfall zahlt der Staat Lehrgeld: die Hochschulen
Privathochschulen auf dem Prüfstand
Der Privatisierungsdruck an staatlichen Hochschulen
Heimlicher Gewinner: die Bertelsmann Stiftung
Was nur die öffentliche Bildung leisten kann
Die Privatwirtschaft hat Vorfahrt: das Verkehrswesen
Entgleisungen der Privatisierung: die Deutsche Bahn
Verkauf, Verpachtung und Verwahrlosung von Bahnhöfen
Kosten und Nutzen von »Stuttgart 21«
Rückzug aus der Fläche
Das Debakel der Berliner S-Bahn
Die Tarifpolitik der Deutschen Bahn
Der Erfolg der Schweizerischen Bundesbahnen
Der Ausverkauf von British Rail und seine Folgen
Freie Fahrt für Investoren: der Straßenverkehr
Die Nebenbetriebe der Autobahnen
Kostenfaktor Lkw-Maut
Destination Privatisierung: die zivile Luftfahrt
Flughäfen in privater Hand
Deutsche Lufthansa und Deutsche Flugsicherung
Was nur die öffentliche Verkehrsplanung leisten kann
Krieg als Geschäft: die Bundeswehr
Privatisierungen in den USA: Vorbild oder Mahnung?
Die Privatwirtschaft im Einsatz: Service- und Kernaufgaben
Rüstungskonzerne im Auslandseinsatz
New Public Management
Soldatinnen und Soldaten oder Söldnerinnen und Söldner? Kern- oder Serviceaufgaben?
Demokratie in Gefahr: die Folgen der Privatisierung
Privatisierung der Lebensrisiken: Rente und Arbeit
Lobbyistinnen und Lobbyisten profitieren: der Sozialstaat
Auftragsforschung, Honorartätigkeiten und Drehtüreffekte
Rendite statt Rente: die Privatisierung der Altersvorsorge
Altersarmut und Vorsorgelücken
Vergessene Vorzüge des Umlageverfahrens
Privatsache Arbeitslosigkeit: Hartz IV
Ernüchternde Bilanz der Arbeitsmarktreformen
Entsolidarisierung: Wer gewinnt und wer verliert durch die Reformen
Der große Postraub: Post und Telekommunikation
Prekarisierung durch Privatisierung: die Deutsche Post
Die Internationalisierung des Konzerns
Der Ausverkauf von Royal Mail und seine Folgen
Von der Behörde zum Global Player: die Deutsche Telekom
Betriebswirtschaftlich glamourös, volkswirtschaftlich desaströs
Krankheit Ökonomisierung: das Gesundheitswesen
Privatisierung und Entsolidarisierung: die gesetzlichen Krankenversicherungen
Steigende Zuzahlungen, sinkende Leistungen
Der Wirkstoff Betriebswirtschaft: die Krankenhäuser
Die Fälle Offenbach und Gießen/Marburg
Warum der Gesundheitsmarkt kein freier Markt werden kann
Umsteuern als Resultat aus der Coronakrise
Kostentreiber Privatwirtschaft: die kommunale Versorgung
Der Staat als Geisel: die öffentlich-privaten Partnerschaften
Langfristig teurer, nicht preiswerter
Die Macht der Lobby
Vielfältige Geltungsbereiche für ÖPP
Sorgenkinder: Abfallentsorgung und kommunale Gebäudereinigung
Wohnungen als Ware: die Wohnungsbaugesellschaften
Konsumgut statt Lebenselixier: die Wasserversorgung
Was die Kommunalwirtschaft besser kann als die Privatwirtschaft
Wem gehört was warum? Wem soll was gehören?
Aus Fehlern lernen
Gemeinwohlorientierung versus Gewinnorientierung
Die Notwendigkeit staatlicher Wirtschaftstätigkeit
Renaissance des Staates im Schatten der Coronapandemie?
Dank
Literatur
Staat im Ausverkauf – ein Weckruf
Ein lukrativer Markt: das Bildungssystem
Die Privatwirtschaft hat Vorfahrt: das Verkehrswesen
Krieg als Geschäft: die Bundeswehr
Privatisierung der Lebensrisiken: Rente und Arbeit
Der große Postraub: Post und Telekommunikation
Krankheit Ökonomisierung: das Gesundheitswesen
Kostentreiber Privatwirtschaft: die kommunale Versorgung
Wem gehört was warum? Wem soll was gehören?
Staat im Ausverkauf – ein Weckruf
Jeden Abend um 21:00 Uhr spendeten Menschen zu Beginn der Coronapandemie medizinischem Personal und Pflegekräften Applaus für ihren Einsatz. Derartige Anerkennung erfuhren die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bislang selten. Aber in einer Zeit, in der »italienische Zustände« in den bundesdeutschen Krankenhäusern drohten, wurde offenkundig vielen gewahr, dass Covid-19-Infizierte auch um ihr Leben bangen müssen, weil im Gesundheitswesen die Gewinn- an die Stelle der Gemeinwohlorientierung getreten ist. Über Jahrhunderte hinweg hatte die in den Volksmund überführte Maßgabe gelautet: »Gesundheit lässt sich weder in Geld noch in Gold aufwiegen.« Mit dem Aufstieg des Neoliberalismus in den 1980er-Jahren jedoch hielten die Gesetze der Ökonomie auch im Gesundheitssystem Einzug. So hat das Fallpauschalen-System, über das inzwischen mehr als Dreiviertel des Budgets hiesiger Allgemeinkrankenhäuser abgewickelt werden, den Kostendruck erheblich verschärft. Längst ist die an betriebswirtschaftlichen Kriterien ausgerichtete Gesundheitsökonomie an die Stelle einer an den Bedürfnissen des Patienten orientierten Gesundheitsversorgung getreten – zu Lasten der gesetzlich krankenversicherten Patientinnen und Patienten mit teils unverantwortlichen Wartezeiten bei Facharztpraxen und zum Nachteil der Beschäftigten unterhalb der Chefarztebene.
Vom betriebswirtschaftlichen Imperativ und der damit einhergehenden Kapitalmarktorientierung durchdrungen wurde auch der vormals größte Arbeitgeber der Bundesrepublik, die Deutsche Bahn. Fahrpreiserhöhungen, Bahnhofsschließungen, Lok- und Oberleitungsschäden, Weichen- und Signalstörungen, Verzögerungen im Betriebsablauf aufgrund »dichter Zugfolge« – immer wieder gerät die Deutsche Bahn aufs Abstellgleis. Als internationaler Mobilitäts- und Logistikdienstleister konzentriert sich das »Unternehmen Zukunft« (Eigenwerbung) längst auf Frachttransporte zwischen Dallas, Delhi und Den Haag statt auf die Fahrgastbeförderung zwischen Delmenhorst, Dinslaken und Düren. Beinahe zwei Drittel seines Umsatzes erzielt der einst größte Arbeitgeber der Bundesrepublik inzwischen mit bahnfremden Dienstleistungen. Der Global Player vernachlässigt den inländischen Schienenverkehr und setzt stattdessen auf vermeintlich profitable Lkw-Speditionen (Stinnes), Fuhrparks (Bundeswehr) oder den Ausbau des Schienenverkehrs in Indien und Saudi-Arabien. Gleichzeitig fährt die Deutsche Bahn hierzulande bis zu 8.000 Stunden Verspätung am Tag ein.
Auch die Deutsche Post pflegt seit dem Jahr 2000 ihren Börsenkurs statt ihre Kundschaft und Beschäftigten. Um die »Aktie Gelb« attraktiv zu machen, wurden Tausende sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch 450-Euro-Jobs ersetzt, während sich der Vorstandsvorsitzende Frank Appel zuletzt über Bezüge von 5,2 Millionen Euro freuen durfte. Mini-, Midi- und Multi-Jobberinnen und -Jobber sowie Zeit- und Leiharbeiterinnen bzw. -arbeiter stellen Briefe und Pakete im Auftrag oder als »Servicepartner« des Konzerns zu. Wie die Konkurrenten UPS, DPD und Hermes delegiert auch das seit 2002 zur Deutschen Post AG zählende Logistikunternehmen DHL seine unternehmerische Verantwortung an Subunternehmen.
Deutsche Bahn und Deutsche Post führen vor Augen, worüber die Nachrichtensendungen in Deutschland nur selten berichten: Im Glauben daran, dass Privatisierungen Dienstleistungen besser, billiger und bürgernäher machten, schüttelt Vater Staat seit mehr als drei Jahrzehnten seine Aufgaben ab – wie ein Baum seine Blätter im Herbst: Von 1982, dem Beginn der Ära Helmut Kohl (CDU), bis heute trennte sich allein der Bund von rund 90 Prozent seiner unmittelbaren oder mittelbaren staatlichen Beteiligungen.
Unternehmen wie die Deutsche Bundespost, die Deutsche Bundesbahn, die Deutsche Lufthansa, die VEBA-Gruppe (die nun unter E.ON firmiert), die Immobiliengesellschaft IVG, die Bundesanstalt für Flugsicherung, die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahn (nunmehr Tank & Rast) gehörten einst vollständig dem Bund und wurden doch alle privatisiert. Auch auf kommunaler Ebene greift die Entstaatlichung seit vielen Jahren Platz. Allerorten verkaufen Städte und Gemeinden ihre Wohnungen, Stadtwerke und Schulgebäude. Bei zwei von drei Haushalten wird der Müll inzwischen von Privatunternehmen wie den Branchenriesen Alba, Remondis, Sulo oder Veolia entsorgt. Marktmechanismen greifen seit einigen Jahren selbst bei (Hoch-)Schulen, Krankenhäusern und Justizvollzugsanstalten sowie bei Wasser-, Klär- und Elektrizitätswerken. Privatisiert werden neuerdings aber auch militärische Dienste, Gewässer und Sparkassen – stets mit dem Versprechen, alle Mitglieder der Gesellschaft würden dadurch gewinnen und keines etwas verlieren.
Dabei werden die Steuern auf Unternehmensgewinne nicht nur seit Jahren immer weiter abgesenkt. Zugleich treiben die Finanzbehörden die gesetzlich vorgeschriebenen Steuern selbst dann nicht in voller Höhe ein, wenn sie historisch niedrig sind – sei es mangels ausreichenden Personals oder aufgrund politisch organisierter Schlupflöcher. Gerade prototypisch stehen dafür die Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäfte. 31,8 Milliarden Euro sollen dem deutschen Fiskus dadurch entgangen sein, dass Banker, Börsenmaklerinnen und Anwälte über Jahre dafür sorgten, dass Aktionären Steuergeld zurückerstattet wurde, das ihnen nicht zustand. In einigen Fällen erhielten sie sogar eine Steuer, die nur einmal bezahlt wurde, mehrfach zurück (Blickle u. a. 2017).
Von der immer wieder in Aussicht gestellten Entlastung der öffentlichen Haushalte kann aber auch dann keine Rede sein, wenn man auf die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung blickt. So wurden durch die Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur allein in den vergangenen 25 Jahren mehr als 1,2 Millionen Arbeitsverhältnisse vernichtet. Die historische Sondersituation der deutsch-deutschen Vereinigung, die in den 1990er-Jahren massiven ökonomischen Druck erzeugte, begünstigte das Abschmelzen von Bundesbeteiligungen in einzigartiger Weise. Rechnete man den Ausverkauf des DDR-Vermögens durch die Treuhandanstalt hinzu, bei dem viele volkseigene Betriebe weit unter Wert an teils windige Investoren veräußert wurden, fiele die Privatisierungsbilanz noch düsterer aus.
Die kontinuierlich steigenden Kosten, die wir für Wasser, Strom und Gas aufbringen müssen, sind das Ergebnis der in den 1990er-Jahren angestoßenen Privatisierungen im Energiesektor – aber die wenigsten Bürgerinnen und Bürger sehen diesen Zusammenhang. Ferner hat die Debatte um die Ausstattung von Schulen mit digitalen Endgeräten im Zuge der Coronapandemie gezeigt, dass sich Bildung in der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) proklamierten »Bildungsrepublik« schon jetzt nicht mehr jeder leisten kann. Dessen ungeachtet wächst die Zahl der privaten und damit gebührenpflichtigen Kindertagesstätten, (Hoch-)Schulen und Nachhilfeinstitute unaufhörlich. Die mit der Privatisierung der Bundesdruckerei einhergegangene Preisexplosion bei der Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Führerscheinen sorgt zwar regelmäßig für Unmut, aber statt auf die Privatisierungspolitik zu schimpfen, verteufeln wir die träge Verwaltung. Und die Wehklagen über das »Unterschichtenfernsehen« von RTL, RTL II und SAT.1 wären hinfällig, wenn die zu Beginn der 1980er-Jahre vom Bertelsmann-Konzern mit der unionsgeführten Bundesregierung vorangetriebene Privatisierung des Rundfunks unterblieben wäre.
Die Suche nach preiswertem Wohnraum treibt längst nicht mehr nur junge Menschen und finanziell schlechter gestellte Bevölkerungsgruppen um. Waren erschwingliche Wohnungen lange Zeit nur in Hamburg, Köln, München und Stuttgart knapp, mangelt es inzwischen in beinahe allen Ballungszentren an bezahlbarem Wohnraum. Geradezu unter dem Brennglas zu beobachten ist die Dynamik des Wohnungsmarktes in Berlin. Bis zu dem am 30. Januar 2020 eingeführten und nur 16 Monate später vom Bundesverfassungsgericht gekippten »Mietendeckel« schossen die Mieten auch in Vierteln der Bundeshauptstadt in die Höhe, in denen Wohnraum lange preiswert war, sodass die Ärmeren den Wohlhabenderen Platz machen mussten. Gab es 1987 in Westdeutschland noch über vier Millionen Sozialwohnungen, sind es heute bundesweit nur noch rund 1,12 Millionen. Allein von 2007 bis 2019 sank die Zahl der staatlich geförderten Wohnungen in Deutschland um mehr als die Hälfte. Einer der zentralen Gründe: 1989 wurde die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft, d. h. die Förderung von Sozialwohnungen durch Steuererleichterungen. Die Forderung nach einem Recht auf Wohnen verhallt seit Jahren, ohne dass Bundes-, Landes- oder Kommunalregierungen zur Tat schreiten. Obwohl das anhaltend niedrige Zinsniveau prädestiniert wäre, dass die öffentliche Hand eine bundesweite Wohnungsbauoffensive startet, wird Baugrund nach wie vor bevorzugt für private Großinvestoren ausgewiesen. Diese dürfen nicht nur mit einer bevorzugten Behandlung bei der Beantragung von Baugenehmigungen rechnen, sondern auch mit großzügigen Steuerbefreiungen. Für sie beläuft sich die Grunderwerbssteuer ebenso auf 3,5 (Bayern und Sachsen) bis 6,5 Prozent (Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Brandenburg und Thüringen) wie für Familien, die unter schmerzhaftem Verzicht auf Urlaubsreisen Geld für ihr Eigenheim gespart haben.
In all jenen Kommunen, in denen die Abfallentsorgung, die Energie- und Wasserversorgung sowie die Gebäudereinigung privatisiert wurden, klettern die Preise mitunter bis aufs Dreifache. In den vergangenen zehn Jahren wurden weit über 1.100 Schwimmbäder geschlossen. Die teils horrenden Eintrittspreise für privat betriebene »Spaßbäder« können sich finanzschwache und/oder kinderreiche Familien nicht mehr leisten. Der soziale Ausgleich als Prinzip der Sozialen Markwirtschaft bleibt auch im öffentlichen Personennahverkehr auf der Strecke: Bus- und Straßenbahntickets werden regelmäßig teurer, die Taktungen ausgedünnt, Haltestellen aufgegeben.
Obwohl Privatisierungen also offenkundig für die Mehrheit der Bevölkerung beträchtliche und für unzählige Menschen existenzielle Nachteile mit sich bringen, hält sich der öffentliche Unmut in Grenzen. Dabei sorgt sich angesichts des Um- und Abbaus des Sozialstaates nahezu jeder und jede, ob er oder sie den Lebensstandard wird aufrechterhalten können – erst recht im Ruhestand. Wie lässt sich dies erklären? Ein Grund dürfte sein, dass die Bevölkerung die Verschlechterungen gar nicht mit Privatisierungen in Verbindung bringt, weil diese häufig im Verborgenen, ja mitunter sogar »streng geheim«, vor sich gehen. Ein eindringliches Beispiel liefert die Deutsche Bahn, deren damaliger Vorstandsvorsitzender Hartmut Mehdorn 2006 mit der »Verschlossenen Auster« ausgezeichnet wurde – dem von der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche e. V. verliehenen Negativpreis für »Auskunftsverweigerer in Politik und Wirtschaft«. Wesentliche Informationen drangen in der »Mehdorn-Ära« nicht an die Öffentlichkeit; die Bahn zog Werbeanzeigen in Medien, die kritisch berichtet hatten, zurück. Als eine der größten Anzeigenkundinnen im deutschen Verlagswesen und als Abnehmerin großer Zeitungskontingente für Erste-Klasse-Reisende und DB-Lounges kann die Bahn die Berichterstattung beeinflussen. So bleiben viele Folgen ihrer Privatisierung im Dunkeln.
Privatisierungen werden auch deshalb zu selten kritisiert, weil sie im Zeitalter des Neoliberalismus als »alternativlos« wahrgenommen werden. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass mit Privatisierungen lediglich Symptome kurzfristig kuriert, nicht aber die Ursachen für die Missstände langfristig beseitigt werden: Zwar erzielen Kommunen, Länder und der Bund mit Privatisierungen hohe Einmaleinnahmen, für die sich Politikerinnen und Politiker erwärmen können, weil sie ihnen neue finanzielle Handlungsspielräume eröffnen. An der Unterfinanzierung der Gebietskörperschaften ändert dies aber nichts. Es bedarf der Einsicht, dass ein Steuersystem, das Arbeit diskriminiert und Kapital privilegiert, nicht nur die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft, sondern auch den Privatisierungsdruck erhöht.
Hohe Einkommen zeichnen sich durch eine höhere Sparquote aus, d. h. sie werden zu einem geringeren Teil für den Konsum ausgegeben und stattdessen – prozentual steigend – gespart. Die Bezieherinnen und Bezieher hoher Einkünfte suchen also gerade bei niedrigen Kapitalmarktzinsen nach rentablen Anlagemöglichkeiten. Investitionen in die öffentliche Infrastruktur bieten dafür beste Möglichkeiten, da sie ausgesprochen sicher sind: Bahn-, Flug- und Straßenverkehr werden auf absehbare Zeit nicht eingestellt werden, Wasser-, Klär- und Elektrizitätswerke sind unverzichtbar, Selbiges gilt für Justizvollzugsanstalten, Rathäuser und Schulen. Bei investorenfreundlichen Konditionen zulasten der öffentlichen Hand – etwa über öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) – sind diese Investments für Kapitalanleger ausgesprochen lukrativ. Diesen Zusammenhang stellen die meisten Medien jedoch nur selten her, obwohl immer mehr Städte und Gemeinden die Privatisierung von Schulgebäuden mittels ÖPP forcieren. Immer mehr bundesdeutsche Großstädte bevorzugen nicht das im Vergleich zur konventionellen Eigenleistung durch die Stadt oder Gemeinde auf eine Sicht von 30 Jahren regelmäßig teurere Finanzierungsmodell. Die Gutachten des Bundesrechnungshofs und der Landesrechnungshöfe finden nach wie vor zu selten Gehör, so dass ÖPPs unverändert auf allen gebietskörperschaftlichen Ebenen als Lösung für finanzielle und organisatorische Unzulänglichkeiten des öffentlichen Sektors gelten.
Ein weit in die Historie zurückreichendes Beispiel illustriert die guten Gründe, die gegen die Privatisierung hoheitlicher Aufgaben sprechen. Nachdem es im antiken Rom beinahe täglich gebrannt hatte, gründete Marcus Licinius Crassus 70 v. Chr. eine private Feuerwehr. Wenn es brannte, erschien Crassus am Ort des Geschehens und unterbreitete dem Besitzer des brennenden Gebäudes ein Angebot: War er bereit, sein Haus zu einem Bruchteil des angemessenen Preises zu verkaufen, schritten die Löschtruppen zur Tat. Wenn nicht, pfiff Crassus seine Feuerwehrsklaven zurück und ließ dem Feuer seinen Lauf. So stieg er zu einem der reichsten Römer seiner Zeit auf.
Auch zahlreiche Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit lassen erkennen, welche verheerenden Folgen Privatisierungen zeitigen können. Nachdem der britische Premierminister John Major 1994 das Staatsunternehmen British Rail privatisiert hatte, mussten die britischen Bahnreisenden allein im ersten Jahrzehnt mehr als 11.000 Jahre Verspätung in Kauf nehmen. Die Zerschlagung von British Rail in 106 private Einzelgesellschaften ließ nicht nur mehr als 2.000 Subunternehmen entstehen, sondern machte bereits nach kurzer Zeit die damit verbundenen Risiken deutlich: Die Unfälle von Southall (1997), Paddington (1999) und Hatfield (2000), die zusammen 42 Tote und mehr als 500 teils schwer Verletzte forderten, haben sich ins kollektive Gedächtnis der Britinnen und Briten eingebrannt – und die Politik schließlich genötigt, den Infrastrukturbetreiber Railtrack wieder zu verstaatlichen.
Aber während in Großbritannien selbst (bahnpendelnde) Investmentbanker für eine Wiederverstaatlichung (der Eisenbahn) plädierten, versickert nach wie vor jeden Tag von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt ein Drittel des Trinkwassers im Londoner Erdreich. Obwohl die geschätzte Wassermenge ausreichen würde, um mehr als 350 olympische Schwimmbecken zu füllen, und das Trinkwasser aufgrund der eindringenden Luft häufig schal wird, setzt das private Wasserver- und -entsorgungsunternehmen die Rohre nicht in Stand. Thames Water, das seit Oktober 2006 zu einem Konsortium unter Leitung eines australischen Investmentfonds namens Kemble Water Holdings zählt, scheut die Investitionen und wurde auch deshalb häufiger als jedes andere britische Unternehmen wegen Umweltdelikten belangt. Aufgrund überlasteter Kanäle werden beinahe jede Woche ungereinigte Abwässer in die Themse abgeleitet. Nach einer starken Regenflut im Juli 2007 mussten aus dem gesamten Land Tanklaster zusammengezogen werden, um die 150.000 Anwohnerinnen und Anwohner in Cheltenham, Gloucester und Tewkesbury mit Trinkwasser zu versorgen, weil der privatisierte Wassermonopolist Severn Trent die Instandhaltung der Trinkwasseranlagen in den englischen Midlands über Jahre vernachlässigt hatte. Und als der Konzern 2013 eine feindliche Übernahme mit geschätzten 19 Millionen Pfund Sterling abwehren musste, stiegen die Wasserpreise um zwei Prozent.
Man sieht: Auch wenn das vorliegende Buch sich im Wesentlichen den Privatisierungen in der Bundesrepublik Deutschland widmet, rollt die Welle staatlicher Selbstentmachtung doch keinesfalls nur dort. Als sich die »Troika« im Schatten der 2007 über uns hereingebrochenen Wirtschafts- und Finanzkrise auf ein »Sparprogramm« für Griechenland verständigt hatte, schallte der Ruf nach dem Verkauf von Staatsbesitz bis nach Hellas: 50 Milliarden Euro sollte die griechische Regierung durch Privatisierungen bis 2015 erlösen – eine gigantische Summe. Stolz sprach die damalige Regierung vom »weltgrößten Privatisierungsprogramm«, das u. a. die Energiefirmen Depa, DEI und Hellenic Petroleum, das Telekommunikationsunternehmen Hellenic Telecom sowie den Wettanbieter OPAP teilprivatisieren sollte. Tatsächlich flossen bis 2015 nur 3,2 Milliarden Euro in die staatlichen Kassen. Und auch wenn es inzwischen knapp acht Milliarden Euro sind, liegt der milliardenschwere Ausverkauf staatlicher Unternehmen weniger im Interesse der griechischen Bevölkerung als vielmehr in dem der Investoren, das der konservative Premier Kyriakos Mitsotakis als ehemaliger Investmentbanker und Analyst der Unternehmensberatung McKinsey fortlaufend bedient.
Aber auch in Spanien, Portugal und Italien ist die Privatisierungseuphorie der konservativ-liberalen Parteien ungebrochen – und selbst in Lateinamerika und in Südostasien scheuen Regierungen nicht vor Entstaatlichungsprogrammen zurück. Vorreiter sind – wie bei vielen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen – die USA und Großbritannien. So sind die Vereinigten Staaten von Amerika weltweit »Spitzenreiter« beim Einsatz privater Streitkräfte, beim Bau und Betrieb privater Haftanstalten sowie bei der Einrichtung von ÖPPs im Bildungssektor. In Großbritannien ließ Margaret Thatcher kaum ein Staatsunternehmen unangetastet. Während ihrer Amtszeit zwischen 1979 und 1990 privatisierte die »Eiserne Lady« zunächst jene Unternehmen, die besonders hohe Verkaufserlöse versprachen: British Petroleum (1979), British Aerospace (1981), Cable and Wireless (1981), British Telecom (1982), Britoil (1985), British Airways (1987), Rolls-Royce (1987), British Steel (1988) und Thames Water (1989). Allein zwischen 1984 und 1991 wurde ein Drittel der weltweiten Privatisierungserlöse in Großbritannien erzielt. Beinahe eine Million Beschäftigungsverhältnisse wurden während dieses Zeitraums vom öffentlichen in den privaten Sektor überführt (Wright 1994, 10).
Aber der Blick über den Ärmelkanal stimmt auch hoffnungsfroh. Mittlerweile stoßen Privatisierungen bei der überwältigenden Mehrheit der Briten und Britinnen auf Ablehnung. Schon vor zwei Jahrzehnten schilderte der London-Korrespondent der ZEIT, Jürgen Krönig, unter der Überschrift »Insel der Katastrophen – Die Lehren der Eisernen Lady haben ausgedient« das landesweite Unbehagen (2001): »Marktprinzip und Privatisierung, ideologische Markenzeichen der Thatcher-Revolution, von New Labour bejaht und für den Gebrauch einer Mitte-Links-Partei modifiziert, werden auf der Insel nun wieder infrage gestellt. Urplötzlich geistert sogar ein längst tot geglaubter Begriff durch die Lande – Verstaatlichung. Mehr als zwei Drittel der Briten wünschen, die Privatisierung der Eisenbahn möge rückgängig gemacht werden. Über die Schattenseiten der fulminanten Entstaatlichung in den vergangenen zwei Dekaden wird mittlerweile auf Dinnerpartys der konservativen ›middle classes‹ lamentiert. Wir sind zu weit gegangen, lautet der Tenor selbst in Wirtschaftskreisen.«
Die Gründe für den weltweiten Privatisierungswahn – der nur vereinzelt politisch kritisiert wird – sind vielfältig, kulminieren aber letztlich alle im neoliberalen Glauben an den Markt als »Allheilmittel«. Das neoliberale Credo des »schlanken« – mitunter sogar des »magersüchtigen« – Staates geriet und gerät ins Wanken, weil die »Steuerungsdefizite des Staates und im Staate« (Jänicke 1993, 65) immer öffentlichkeitswirksamer herausgestellt wurden. So gelingt es dem Bund der Steuerzahler mit seinem auf die Unzulänglichkeiten staatlicher Wirtschaftstätigkeit zielenden »Schwarzbuch« Jahr für Jahr, ein breites Medienecho auszulösen. Die Unzulänglichkeiten privatwirtschaftlicher Tätigkeit (in Bereichen der öffentlichen Daseinsfürsorge) werden in den überregionalen Tages- und Wochenzeitungen hingegen immer noch viel zu selten behandelt.
Das aber ist gerade jetzt von nicht zu überschätzender Bedeutung, denn mit dem durch die Coronakrise ausgelösten Konjunktureinbruch und den daraus erwachsenden Steuermindereinnahmen wird der Privatisierungsdruck massiv wachsen. Die Frage, ob – und wenn ja, wie – die Finanzpolitik einen Pfad in Richtung regulärer Schuldenbremse gestalten kann, wird schon jetzt in wirtschaftsliberalen Kreisen intensiv diskutiert: »Nach jetzigem Stand sind dabei mittel- bis langfristig Konsolidierungsmaßnehmen [sic!] unvermeidbar. Die jüngsten Prognosen ändern an den Empfehlungen […], ausgabenseitig und bei Subventionen anzusetzen, wenig« (Boysen-Hogrefe 2020, 4). Nach wie vor ist auf der Website des Bundesministeriums der Finanzen zu lesen (2020): »Durch Privatisierung gewinnen Staat und Unternehmen Handlungsfreiheiten: Der Bund setzt Reformpotenziale frei und die Unternehmen steigern ihre Effizienz, um sich im internationalen Wettbewerb zu positionieren. Dies zeigt sich in nahezu allen Bereichen, in denen aus staatlichen monopolisierten Industrien wettbewerbsorientierte Märkte und eine Vielfalt des Angebots entstanden, die den Verbrauchern und Unternehmen zu Gute kommen.« Dass diese Haltung auf der Website des von Olaf Scholz (SPD) geführten Bundesministeriums prominent vertreten wird, lässt erkennen, wie tief der neoliberale Zeitgeist selbst in sozialdemokratische Kreise eingedrungen ist.
Zugleich gilt zu betonen, dass die Politik der staatlichen Selbstentmachtung nicht ohne Lobbyismus in Richtung aller im Deutschen Bundestag vertretenen politischen Parteien denkbar ist, vor allem nicht im Bildungs-, Finanz-, Gesundheits-, Verkehrs- und Sicherheitssektor. Gerade in diesen Politikfeldern stehen Lobbyisten und Lobbyistinnen die Türen zu den politischen Stellwerken teils sperrangelweit offen. Allein die Ministerien für Verteidigung, Inneres und Verkehr verausgabten 2019 knapp 418 Millionen Euro für externe Beraterinnen und Berater. Insgesamt überstiegen die diesbezüglichen Ausgaben (oder derartigen Beraterkosten) der 15 Ressorts auf Bundesebene in Höhe von 548,5 Millionen Euro die auch im internationalen Vergleich kaum vorstellbare Schwelle von einer halben Milliarde Euro (dpa 2020). Bundesfinanzminister Olaf Scholz gab zudem jüngst zu verstehen, dass sein Haus an dieser Praxis festhalten wolle. Dass selbst schmerzliche Erfahrungen wie die mit dem von Andreas Scheuer (CSU) zu verantwortenden »Pkw-Maut-Desaster«, das die deutschen Steuerzahlerinnen und -zahler 760 Millionen Euro kosten dürfte, keine Abkehr von der systematischen und langfristigen Einbindung von aus der Privatwirtschaft entsandten »Leihbeamten und -beamtinnen« auslöst, ist nicht nur ein Armutszeugnis für die öffentliche Verwaltung. Es zeigt außerdem, wie weit die Abhängigkeiten der öffentlichen Hand von privatwirtschaftlichen Interessen gediehen sind.
Überdies erhalten privatwirtschaftliche Interessen durch »janusköpfige« Abgeordnete immer stärker Einzug in die Plenarsäle: Zahlreiche Politikerinnen und Politiker gehen schon als Mandatsträgerinnen und -träger zeitintensiven »Nebentätigkeiten« in der Wirtschaft nach oder werden spätestens nach ihrem Mandat durch die lobbyistische Drehtür auf lukrative Posten in der Privatwirtschaft befördert. Wenn sich ehemalige SPD-Parteivorsitzende wie Sigmar Gabriel in den Dienst der Deutschen Bank stellen, langjährige EU-Kommissare wie Günther Oettinger (CDU) ohne »Abkühlzeit« bei einem Dutzend privater Arbeitgeber wie der Unternehmensberatung Deloitte und der Fondsgesellschaft Amundi anheuern und Neu-Parlamentarier wie Philipp Amthor (CDU) für ihre Lobbyarbeit zugunsten von IT-Unternehmen wie Augustus Intelligence Aktienoptionen erhalten, gefährdet dies nicht nur demokratische Prinzipien. Zugleich bahnt die Methode »Revolving Door« (Drehtür) der Aushöhlung von Vater Staat den Weg, weil die Politiker und Politikerinnen sich nicht mehr (nur) den Interessen ihrer Wählerschaft verpflichtet sehen, sondern auch denen ihrer (potenziellen) privaten Auftraggeber. Diese wurde zuletzt mit der im Frühjahr 2021 vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel aufgedeckten »Maskenaffäre« deutlich, als sich CDU- und CSU-Abgeordnete wie Nikolas Löbel, Georg Nüßlein, Mark Hauptmann, Niels Korte und Alfred Sauter wegen der Einflussnahme auf die Beschaffung und Produktion medizinischer Schutzmasken offenkundig bereicherten. Die eigenen Verdienstmöglichkeiten desavouieren die in Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz festgeschriebene Maßgabe »Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat«.
Wie einflussreich die Akteure hinter den Kulissen sind, zeigte sich unlängst einmal mehr. Die Bürgerbewegung Finanzwende, geführt vom ehemaligen grünen Finanzexperten Gerhard Schick, hat zutage gefördert, dass der Finanzindustrie in Deutschland die Lobbyarbeit über 1.500 Mitarbeiter und mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr wert ist (Bürgerbewegung Finanzwende 2020). Stellt man diesem gewaltigen Engagement die Mitglieder des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag gegenüber, ergibt sich ein Personenverhältnis von 36 zu 1. Welchen Einfluss die führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte, Ernst & Young, KPMG sowie PricewaterhouseCoopers (PWC) insbesondere im Bundeswirtschafts-, Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium geltend machen können, zeigen die von den »Big Four« verwässerten Branchenvorschriften, die zuletzt u. a. im Wirecard-Skandal gipfelten. Unzählige Lobbyorganisationen umgarnen Politikerinnen und Politiker auf pompösen Empfängen, mit detaillierten Stellungnahmen und im direkten Vier-Augen-Gespräch, um ihren Interessen Nachdruck zu verleihen.
Lobbyismus kennt darüber hinaus gerade in »privatisierungsanfälligen« Bereichen verborgene Wege, was in Gestalt des »Deep Lobbying« als besonders subtiler Form der Einflussnahme offenkundig wird: Dazu zählt, dass das Formulieren von Gesetzestexten an Anwaltskanzleien ausgelagert wird. Allen & Overy, Freshfields Bruckhaus Deringer und Gleiss Lutz sind nur drei von vielen. Darunter fällt auch die Platzierung von Leihbeamten und -beamtinnen in Ministerien. Als neue Spielart des informationellen Inputs hat in den vergangenen Jahren die »wissenschaftliche« Politikberatung an Bedeutung gewonnen. Durch Studien aus den Federn von Sachverständigenräten, Beiräten, Expertenkommissionen, Hochschulen, Stiftungen und Think Tanks werden Privatisierungsvorhaben auf ein vermeintlich belastbares Fundament gestellt, obwohl diese »Politikberatung auf Weisung« wissenschaftlichen Gütekriterien häufig nicht genügt.
Während Sie dieses Buch lesen, arbeiten Heerscharen von Industrie- und Finanzunternehmen, von Wirtschaftsprüfern und -anwältinnen, von Stiftungen und Forschungsinstituten, von Konzernbeiräten und Leihbeamten – mal leiser und mal lauter – daran, den Staat weiter zu beschneiden. Tag und Nacht widmen sich Unternehmens- und Steuerberatungen wie McKinsey & Company, Roland Berger Strategy Consultants, Bain & Company, PWC, Ernst & Young, KPMG und Boston Consulting Group der Frage, wie öffentliches Eigentum zugunsten privater Kapitalgeber liquidiert werden kann. Eine halbe Milliarde Euro gab die Bundesregierung allein 2019 für externe Beraterinnen und Berater aus, vor allem für sogenannte Sachverständige im Bereich Verteidigung und Militär. Zum Vergleich: In den sozialen Wohnungsbau wurden 2020 gerade einmal 400 Millionen Euro investiert. Zeitgleich bahnen millionenschwere Lobbygruppen den weiteren Ausverkauf öffentlichen Eigentums an. Dazu zählen die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) mit höchst manipulativen Wort- und Bildkampagnen, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) als eng mit der Politik verflochtenes Netzwerk und die Bertelsmann Stiftung. Solche »Denkfabriken« und Think Tanks üben den wohl am meisten nachhaltigen Einfluss in Richtung »Vermarktlichung« auf die deutsche Politik aus.
Vermutlich wird auch das vorliegende Buch das Pendel der Privatisierungspolitik nicht in die andere Richtung ausschlagen lassen. Dafür wird die Leserschaft dieses Buchs zu klein und die Privatisierungslobby weiterhin zu einflussreich sein. Aber womöglich ändert sich im Nachgang der Coronapandemie als jüngster gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Bewährungsprobe nach der Finanz-, Wirtschafts- und Eurokrise zu Beginn des 21. Jahrhunderts das Bild von staatlichen Gewährleistungsangeboten? Wurde nicht mit den milliardenschweren staatlichen Hilfsprogrammen für Adidas, Lufthansa und TUI erneut das Ende der freien Marktwirtschaft verkündet? Selbst der FDP-Vorsitzende Christian Lindner gab im Frühjahr 2020 im Deutschen Bundestag zu verstehen (zit. nach Heinemann 2020): »Jetzt ist die Stunde des Staates. Wir brauchen ihn bei allem, was über die Fähigkeit, individuell Verantwortung zu übernehmen, hinausgeht.« Und in einer Bundestagsrede am 16. Dezember 2020 betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Blick auf die coronabedingten Kontaktbeschränkungen: »Das Wir ist stärker als das Ich.« Nun, da bekannt ist, dass Spahn inmitten der Coronapandemie gemeinsam mit seinem Ehemann für 4,1 Millionen Euro eine Villa in Berlin-Dahlem erwarb, klingt die Aussage ohnehin schon wenig glaubwürdig. Darf man dennoch an einen belastbaren Wandel des Staatsverständnisses in den Reihen von Union und FDP glauben?
Dem stehen nicht nur die Erfahrungen mit den politischen Realitäten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entgegen, sondern auch der 2015 von dem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Philip Mirowski in seinem Werk »Untote leben länger« formulierte Befund, wonach der Neoliberalismus trotz der mit der Finanzkrise an den Rand des Zusammenbruchs gebrachten Weltwirtschaft stärker sei denn je. Und auch die Feststellung des britischen Politologe Colin Crouch, der nur vier Jahre zuvor in seinem gleichnamigen Werk das »befremdliche Überleben des Neoliberalismus« konstatiert hatte (2011), liest sich überzeugend. Aber unabhängig davon, ob es zu einer dauerhaften Neueinschätzung der Bedeutung staatlicher Wirtschaftstätigkeit kommen wird (oder eben nicht), wird für deren Akzeptanz zentral sein, dass Inkompetenz und Ineffizienz der öffentlichen Verwaltung der Vergangenheit angehören. Inakzeptable Bearbeitungszeiten bei Bauanträgen, mangelhafte Digitalisierungsprozesse in Kommunalverwaltungen, grotesk langwierige Gerichtsverfahren sowie unterfinanzierte und zugleich kostenpflichtige Kita-Plätze schaden der Akzeptanz einer staatlich verantworteten Gemeinwohlorientierung in Gestalt öffentlicher Güter und Dienstleistungen.
Das vorliegende Buch analysiert dieses neu definierte Staatsverständnis zwar, geht aber davon aus, dass es nicht nur eines bloßen Regierungswechsels auf dem Weg zu einer Renaissance des Staates bedarf. Zentrale Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge werden nur dann reaktiviert werden können, wenn es zu einem sicht- und spürbaren Politikwechsel kommt. Das mit dem Ziel der höheren Lesbarkeit auf in wissenschaftlichen Kontexten übliche Quellenangaben stellenweise verzichtende Buch nimmt seinen argumentativen Ausgang daher in einer durchweg privatisierungskritischen Haltung. Privatisierungen betrachte ich als Überführungen staatlichen Eigentums in privates Eigentum im Sinne der »Vermarktlichung« der öffentlichen Daseinsvorsorge, die oft keiner Sachzwanglogik folgen. Meine Ausführungen illustrieren besonders eindrückliche Fallbeispiele und spitzen Thesen zu – unter weitreichender Ausblendung der betriebswirtschaftlich womöglich positiven Dimensionen von Privatisierungen, aber stets getragen von der Überzeugung, dass in den vergangenen Jahren zu viele Gewinne privatisiert und zu viele Verluste sozialisiert worden sind. Denn auch deshalb ist die Vermögensungleichheit inzwischen in keinem EU-Staat größer in Deutschland. Dass das auf dem Leitbild der Leistungsgesellschaft fußende Aufstiegsversprechen der »Alten Bundesrepublik« Tag für Tag unterlaufen wird, ist einer der wesentlichen Gründe für die sich verbreitende und verfestigende Polarisierung unserer Gesellschaft. Die nicht leistungsgerechte Konzentration hoher Vermögen ist jedoch nicht die einzige negative Auswirkung der Privatisierungspolitik. Soll unsere Gesellschaft nicht weiterhin von einer auf Ellenbogenmentalität fußenden Individualisierung geprägt sein, in der jeder und jede allein seines bzw. ihres eigenen Glückes Schmied ist, muss die »Verbetriebswirtschaftlichung« der öffentlichen Daseinsvorsorge dringend ein Ende finden.
Insofern soll dieses Buch einen »Weckruf« darstellen. Es richtet sich nicht nur an all jene, die ohnehin an wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten interessiert sind, sondern auch an diejenigen, die sich zunächst einmal nur sorgen – um ihre Sportstätten und Kultureinrichtungen vor Ort, um das berufliche Schicksal der Paketboten und -botinnen oder Bahnschaffner und -schaffnerinnen, um ihre Gesundheitsversorgung und ihre Rente oder um die Bildung ihrer (Enkel-)Kinder. Längst trifft der Verkauf öffentlichen Eigentums nicht mehr nur Personenkreise ohne politische Lobby, die für eine boomende Wirtschaft nur von geringer Bedeutung sind oder eine heterogene Wählerschaft bilden (zum Beispiel Schülern und Schülerinnen sowie Studierende, Erwerbslose, einkommensschwache Familien oder Menschen mit Behinderungen). Vor diesem Hintergrund sollten wir alle wachsam sein, wenn die Gewinn- an die Stelle der Gemeinwohlorientierung tritt – jedenfalls dann, wenn wir nicht in einer Gesellschaft leben wollen, die von allem den Preis, aber von nichts mehr den Wert kennt.
Frankfurt am Main, im Sommer 2021, Tim Engartner
Ein lukrativer Markt: das Bildungssystem
Die Schulschließungen, die im Zuge der Coronakrise mit dem merkwürdig anmutenden Begriff des »Distanzunterrichts« angeordnet wurden, haben unzählige Routinen und Strukturen auf den Prüfstand gestellt. Auf einen Schlag wurde der schulische Bildungsauftrag in die Zuständigkeit der Familien verlagert. Deren prägende Sozialisationswirkung ist unbestritten, aber was es heißt, wenn die kleinste soziale Keimzelle zur Lehranstalt wird, in der Eltern und Geschwister in die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern schlüpfen, ließ sich bislang allenfalls erahnen. Nun aber wurde im Shutdown nicht nur unter dem Brennglas sicht- und spürbar, wie intakte Familien auf das Phänomen der sozialen Verdichtung reagieren. Zugleich wurde deutlich, welchen zentralen Stellenwert die Schule als Erfahrungs-, Schutz- und Sozialisationsraum für die Gesellschaft hat. Und schließlich haben die Homeschooling-Wochen einige verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse über das hiesige Schulsystem zutage gefördert, die es sich in den Blick zu nehmen lohnt.
So etwa droht »das Land der Dichter und Denker« zum »Staat der Stifter und Schenker« zu werden – und damit Bildung zur Ware: Immer massiver drängen die von dem Digitalpakt Schule beflügelten Digitalkonzerne Apple, Google und Microsoft in die Klassen- und Lehrerzimmer, immer häufiger übernehmen private Nachhilfeanbieter wie Schülerhilfe, Studienkreis, abiturma oder der zur Zeit-Verlagsgruppe zählende Schülercampus die Schulbildung nach Schulschluss. Auch die Anbieter von Sprachreisen und Weiterbildungskursen wachsen rasant, denn längst sind die Bildungsbiografien der Kinder zum Statusmerkmal ihrer Eltern geworden.
Aber in jüngerer Zeit greifen betriebswirtschaftliche Steuerungsmuster auch in einst ausschließlich staatlich verantworteten Bereichen des Bildungssystems Raum. Eine stetig wachsende Zahl an Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen wird nicht mehr ausschließlich aus öffentlichen, sondern auch aus privaten Mitteln finanziert. So öffnete in Deutschland zeitweilig jede zweite Woche eine neue Privatschule ihre Pforten. Und staatliche Hochschulen sind dem Wettbewerb nicht nur ausgesetzt, wenn sie mit der Fernhochschule AKAD, der Hochschule für Oekonomie und Management (FOM), der Hochschule Fresenius oder einer der anderen über 110 Hochschulen in privater Trägerschaft um Studierende buhlen. Längst konkurrieren sie auch untereinander um Hunderte von Millionen Euro an Drittmitteln aus der Privatwirtschaft.
Problematisch ist die Privatisierung von Bildung nicht zuletzt deshalb, weil sie der Fokussierung auf ökonomisch verwertbares Wissen Vorschub leistet. Expertinnen und Experten warnen davor, Bildung im Zeitalter von PISA und Bologna nur an unmittelbar ökonomisch nutzbaren Fachkompetenzen zu messen: Sie sehen in den Bildungsreformen nach PISA-Maßstäben »die Reduktion des Lernens auf Wissen und seine Verwertbarkeit, sie sehen Ökonomisierung von Bildung statt freier Menschenbildung, Selektion als Prinzip statt individueller Förderung« (Tenorth 2013). Ob PISA-Ergebnisse deutscher Schüler und Schülerinnen oder Gewaltexzesse an der Berliner Rütli-Schule – den materiellen und reputativen Schaden, der mit jedem Staatsschulskandal unweigerlich entsteht, deuten Privatisierungsbefürworter und -befürworterinnen nicht als Folge einer verfehlten Sparpolitik, sondern als Beleg für die Unzulänglichkeit staatlicher Bildungseinrichtungen schlechthin. Eltern, die es sich leisten können, reagieren auf Berichte über Mängel an öffentlichen Schulen mit der Bereitschaft zum Zahlen: »Wer alles Mögliche für den Bildungsaufstieg seiner Kinder tun möchte, der wird bei jedem Bericht über katastrophale Zustände an öffentlichen Schulen bereit sein, ein Stück tiefer in die eigene Tasche zu greifen« (Knobloch 2006). Wenn also im Zentrum der Bildungsprozesse nicht die freie Entfaltung der Begabungen und Interessen des oder der Einzelnen steht, sondern die Anwendbarkeit des Gelernten in der Wirtschaft, so dürften die Privatisierungsbefürworterinnen und -befürworter dies durchaus als Erfolg verbuchen.
Wie weit der unternehmerische Einfluss im Bildungssektor gediehen ist, lässt sich u. a. daran ablesen, dass – durch die von den Kultusministerien ausgegebene Losung der »Öffnung von Schule« – privat-öffentliche »Bildungs- und Lernpartnerschaften« historische Ausmaße erreicht haben. So ergab die Befragung der Schulleitungen im Rahmen der PISA-Studie 2006, dass mehr als 87 Prozent der 15-Jährigen hierzulande eine Schule besuchen, an der Wirtschaft und Industrie Einfluss auf die Lehrinhalte nehmen (OECD 2007, 293). Das stellt selbst im OECD-Vergleich einen Rekord dar.
Dabei beschränkt sich der Einfluss von Unternehmen wie BASF und Bayer oder Deutsche Bank und Deutsche Börse im Bildungssektor nicht nur auf Geld- und Sachspenden. Längst produziert und verbreitet die Privatwirtschaft Unterrichtsmaterialien, um sich Zugang zu Schulen zu verschaffen und dort die Vor- und Einstellungen Heranwachsender zu prägen. Weiß man, dass bei Kindern nur ein Viertel des bei Erwachsenen zu veranschlagenden Budgets aufgewandt werden muss, um denselben Werbeeffekt zu erzielen, lässt sich leicht erklären, weshalb 16 der 20 umsatzstärksten deutschen Unternehmen kostenlose Unterrichtsmaterialien mit Firmenlogos anbieten, vom Versicherungskonzern Allianz über die Commerzbank und die Deutsche Telekom bis hin zu den Automobilkonzernen Volkswagen und Daimler.
Sogar Schulgebäude fallen mehr und mehr in die Hände privater Betreiber: Öffentlich-private Partnerschaft lautet auch in diesem einst originär staatlichen Bereich die vermeintliche Zauberformel. Privatunternehmen bauen, renovieren und betreiben Schulen, werden mitunter also sogar mit der Einstellung von Hausmeistern und Reinigungspersonal betraut. So schloss die Stadt Monheim im Januar 2004 einen auf 25 Jahre angelegten ÖPP-Vertrag mit der Hermann Kirchner Projektgesellschaft, der sowohl die Finanzierung als auch die Realisierung aller Sanierungs- und Neubauvorhaben in städtischen Schulgebäuden sowie in sämtlichen Sport- und Turnhallen vorsieht. Anfänglich war in Monheim das private Dienstleistungsunternehmen Serco beteiligt, das über eine Tochtergesellschaft u. a. die Justizvollzugsanstalt Hünfeld betreibt und bis 2008 in der Altmark das modernste Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr betrieb.
In Großbritannien bietet Serco neben Leistungen in der Lehrerausbildung (initial teacher training) bereits ein »Allround-Programm« für Schulen an – neben administrativen Aufgaben und dem Finanzmanagement legt es Bildungsstandards fest und misst die Leistungen von Schülern und Schülerinnen. Die Tatsache, dass der britische Pionier Serco Konkurrenz von der deutschen Bertelsmann-Tochter Arvato bekommt, die in Großbritannien die Verwaltung der Gemeinde Chesterfield im Zuge eines 40 Millionen Pfund schweren Auftrags übernommen hat, sollte uns aufhorchen lassen (Arvato 2011).
Und auch wenn seit dem Wintersemester 2014/15 bundesweit keine Studiengebühren mehr erhoben werden, ist der Trend zur »Vermarktlichung« auch an den Hochschulen zu spüren. Wenn (Hoch-)Schulen im Zeitalter des »akademischen Kapitalismus« (Münch 2011) jedoch zu »Wirtschaftsbetrieben« degenerieren, ändert sich auch ihre Ausrichtung: »Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (werden) nicht mehr um ihrer selbst willen gebildet und erzogen, sondern weil der Wirtschaftsapparat Absolventen mit bestimmten Qualifikationen fordert« (Krautz 2014, 99). Werden Menschen nur noch als ökonomisch interessante Größen wahrgenommen, steht der 2004 zum Unwort des Jahres gekürte Begriff »Humankapital« im Raum. Und erst recht, wenn betriebswirtschaftliche Fachtermini wie Human-Capital- oder Human-Asset-Management in Bildungskontexte Eingang finden, sollte uns die Ökonomisierung von Bildung endgültig Sorgen bereiten.
Kinder als Kunden: Krippen, Kitas und Kindergärten
Die Privatisierungswelle hat längst unsere Kleinsten erfasst: Mit der zum 1. August 2013 in Kraft getretenen familienpolitischen Neuerung, wonach jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz hat, greifen private Akteure nun auch bei diesen Einrichtungen zu. So wurde mit dem an sich begrüßenswerten Rechtsanspruch der Startschuss für eine exzessive Ausweitung des Angebots durch private Träger gegeben: Da das Angebot an öffentlichen Kita-Plätzen der Nachfrage in vielen Kommunen nicht ansatzweise gerecht wird, kompensieren immer mehr private Anbieter den Mangel an öffentlichen Betreuungsplätzen. Angesichts der beträchtlichen Chancen auf dem frühkindlichen »Bildungsmarkt« investieren gewerbliche Anbieter verstärkt in frühkindliche Bildung, wobei die Angebote häufig auf Bilingualität, Exklusivität und Professionalität zielen – und damit dem bei immer mehr Eltern zum Ausdruck kommenden besonderen Förderbedürfnis ihrer Kinder Rechnung tragen. So lernen bereits die Kleinsten in privaten Kindertagesstätten Englisch, Französisch oder Mandarin, erhalten über Experimente einen Zugang zu naturwissenschaftlichen Phänomenen und werden auf diese Weise vermeintlich (!) optimal auf ihre Schullaufbahn und das spätere Berufsleben vorbereitet: »Um die wissenschaftlich erwiesene besondere Aufnahmefähigkeit von Ein- bis Dreijährigen professionell zu nutzen, werden die Kleinen in Lerneinheiten, die an gymnasiale Stundenpläne erinnern, in die Grundlagen etwa der Rhetorik, Ökonomie, Geometrie, Mathematik und Astronomie eingeführt« (Jäckel 2010, 308).
Des Weiteren werden sie umfassend betreut, was vor allem berufstätige Eltern anspricht, die sich die Rundumbetreuung und Bildung ihrer Kinder teilweise bis zu 1.700 Euro pro Monat kosten lassen, wie zum Beispiel in der zur Klett-Gruppe zählenden Kita-Kette Villa Luna (Miklis 2012). Diese an Luxusdomizile erinnernden Kindertagesstätten bieten Kindern im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren in Aachen, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kaarst, Köln und Prag neben einer individuellen und bilingualen Betreuung auch musische und naturwissenschaftliche Förderangebote. Stecken die Eltern in einem Geschäftstermin fest, genügt ein Anruf und der Nachwuchs kann bis 22:00 Uhr in der Edel-Kita bleiben. Abgerundet wird der »Open-End-Service« durch das Angebot, dass die Villa Luna bei Bedarf ihre Pforten auch am Wochenende öffnet. Aber auch in Montessori-Einrichtungen sind Beiträge von 700 Euro durchaus üblich. Zusätzlich werden immer mehr Kurse angeboten, in denen Kleinkinder auch neben der Kita-Betreuung speziell gefördert werden sollen: So bieten etwa die weltweit vertretenen Helen-Doron-Kitas Englischkurse für Babys ab drei Monaten an. In Deutschland waren 2018 gut 73 Prozent der unter Dreijährigen und 65 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen (OECD.Stat 2020).
Unterricht aus der Marketingabteilung: die Schulen
Auch wenn Theorie-Praxis-Kooperationen gerade an Haupt- und Förderschulen durchaus zu begrüßen sind, so nimmt der inhaltliche Einfluss von Privatakteuren auf den Schulunterricht heute ein Ausmaß an, das Sorgen bereiten muss. Längst bedürfte es eines schlagkräftigen staatlichen Regelwerks, das die Trennung von Schule und Privatwirtschaft garantiert. Denn während die Semantik des Begriffs »Bildungspartnerschaft« eine Begegnung auf Augenhöhe suggeriert, ist diese doch keineswegs sichergestellt. Wenn Privatunternehmen ihre Angestellten in den Unterricht entsenden, die dabei Unterrichtsmaterialien einsetzen, die von Marketingabteilungen erarbeitet wurden, so verändert dies auch den Beruf der Lehrkräfte und schmälert sein Ansehen in der öffentlichen Wahrnehmung. Zugleich wird das allgemeinbildende Schulwesen zu einem Handlungsfeld degradiert, in dem Unternehmensrepräsentantinnen und -repräsentanten – anders als staatlich ausgebildete Lehrkräfte – frei von curricularen Vorgaben agieren können. Der Begriff der »Partnerschaft« wird auf diese Weise zum Euphemismus, der die finanziellen und inhaltlichen Abhängigkeiten verschleiert. Diese Schieflage geht auch zulasten solcher Interessengruppen, die nicht über die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen für schulische Lobbyarbeit verfügen – wie zum Beispiel Wohlfahrts- und Umweltverbände, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Gewerkschaften oder klassische Nichtregierungsorganisationen.
Die von privaten Materialanbietern propagierten Partikularinteressen stehen nicht nur im Widerspruch zu einer auf Mündigkeit zielenden Bildung. Sie laufen auch dem 1976 im »Beutelsbacher Konsens« festgeschriebenen »Überwältigungsverbot« zuwider, das bis heute die Grenze zwischen Aufklärung und Indoktrination markiert. Lernprozesse sind nur dann erfolgreich, wenn Überzeugungen generiert, präzisiert und reflektiert werden. Schulen sind der Auf- und nicht der »Verklärung« verpflichtet, haben folglich nicht die Aufgabe, Verhaltensdispositionen und Weltbilder heranzuzüchten. Da Kinder und Jugendliche im Umgang mit Meinungen unerfahren sind, müssen Standpunkte behutsam ausgewählt und – was mindestens ebenso wichtig ist – hinsichtlich ihrer Stoßrichtung austariert werden. Denn weder können sich die Umworbenen den unterrichtlich eingebetteten »Werbeveranstaltungen« entziehen, noch wissen Kinder und Jugendliche den im Unterricht vermittelten Eindruck von Seriosität und Neutralität der interessegeleiteten Expertinnen und Experten zuverlässig zu enttarnen – umso weniger, da ihnen deren Einbeziehung in den Pflichtschulkontext Glaubwürdigkeit zuzuschreiben scheint. Ganz im Gegensatz dazu sollte die Schule ein Schonraum sein, in dem die alltägliche Manipulation durch Werbung auch in ihren subtilen Ausprägungen aufgeklärt wird.
»Die gekaufte Schule« – so titelte das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Oktober 2015 – ist längst keine Hyperbel mehr (Kramer/Schießl). Tatsächlich nutzen immer mehr Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Industrie- und Handelskammern sowie Unternehmensstiftungen die Finanznot der Schulen, um Einfluss auf die Lehrinhalte zu gewinnen. Der Versicherungskonzern Allianz, die Bertelsmann Stiftung, die mit einem Jahresbudget von knapp sieben Millionen Euro ausgestattete Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die LehrCare GmbH, die Fast-Food-Kette McDonald’s – sie alle drängen mit Unterrichtsmaterialien, Lehrerfortbildungen und Schüler-Assessments in den einstigen »Schonraum Schule«, um die Kundschaft von morgen möglichst früh an ihre Marke zu binden, ihr Image aufzubessern, Mitarbeitende zu gewinnen oder aber unternehmenskompatiblen Weltbildern Vorschub zu leisten. Daraus resultiert eine immer weiterreichende Instrumentalisierung des Schulsystems als Werbeplattform und damit die schrittweise Erosion der zu Neutralität verpflichteten Bildungsinstitution Schule.
Dabei hätte man schon im Frühjahr 1996 ahnen können, welchen unternehmerischen Einflüssen Schulen einmal unter- oder besser: erliegen würden. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit der Deutschen Telekom angestoßene Initiative Schulen ans Netz sollte alle Schulen mit kostenlosem Internetzugang ausstatten. Ende 2012 wurde die Initiative unter diesem Namen eingestellt (unter Telekom@School existiert sie weiter), da sie nach eigener Darstellung ihr Gründungsziel erreicht hatte, über 30.000 Schulen ans Netz zu bringen. Daneben hatte die Deutsche Telekom seinerzeit auch ein anderes Ziel erreicht: den werbe- und kundenwirksamen Zugang zu über 30.000 Schulen, den sich der einstige Staatskonzern gemeinsam mit den Partnerunternehmen AVM Computersysteme, Novell und Oracle Deutschland gesichert hatte. Inzwischen mischen an den Schulen auch die Computerkonzerne Apple, Microsoft und Samsung mit, die vielerorts kostenlos Notebooks und Tablets zur Verfügung stellen.
Die Coronapandemie als Türöffner für die Digitalkonzerne
Mit dem im Zuge der Coronapandemie forcierten »Distanzunterricht« hat sich der Trend zum »buchlosen« Lernen nicht nur in »iPad-Klassen« Bahn gebrochen. Da in den Schul-, Bildungs- und Kultusministerien wie auch in den Schulämtern zumeist das Bewusstsein für die Tatsache fehlt, dass der 5,5 Milliarden Euro schwere »DigitalPakt Schule« auch das Ergebnis einer langjährigen Kampagne der führenden Hard- und Softwarehersteller darstellt, könnte der »digital turn«, der in Zeiten der Coronapandemie mit Verve umgesetzt wurde, zum trojanischen Pferd der Unternehmen werden – zulasten der Bildungsrepublik Deutschland (vgl. weiterführend zu den nachfolgenden Aspekten Engartner 2020).
Derzeit bahnen neben dem südkoreanischen Unternehmen Samsung insbesondere Apple, Amazon, Facebook, Google und Microsoft als die US-amerikanischen »Big Five« die Digitalisierung der (schulischen) Bildungswelten an. So wirbt etwa der im kalifornischen Cupertino beheimatete Digitalkonzern Apple für eine intensive Einbindung seiner Produkte in den Unterricht (Apple 2021): »Seit 40 Jahren unterstützt Apple Lehrerinnen und Lehrer dabei, das kreative Potenzial jedes einzelnen Schülers freizusetzen. Heute tun wir das auf mehr Arten als je zuvor. Und das nicht nur mit leistungsstarken Produkten. Sondern auch mit Werkzeugen, Inspirationen und Programmen, die Lehrkräften dabei helfen, geradezu magische Lernerlebnisse zu schaffen.« Auch Google mit Sitz im benachbarten Mountain View (Kalifornien) drängt in die Klassenzimmer (Hulverscheidt 2017): »Der Konzern tut seit Jahren einiges, um gerade Lehrer für sich zu gewinnen. Sie werden gezielt eingeladen, an der Entwicklung lernunterstützender Programme mitzuarbeiten und sich in sogenannten Google-Erziehergruppen untereinander und mit dem Konzern auszutauschen – online und auf Partys. Allein in den USA gibt es mehr als 60 solcher Gruppen.«
Apple: iPads, Classroom-Apps und »Education Pricing«
Vor dem Hintergrund zeitweilig rückläufiger Absätze von Apple-Produkten bietet der von Tim Cook geführte Konzern unter dem Stichwort »Education Pricing« Produkte zum reduzierten Preis an (Apple 2021): »Kauf im Apple Store Bildung ein und spare bis zu 328 Euro bei einem neuen Mac und bis zu 104 Euro bei einem neuen iPad. Bildungspreise sind verfügbar für derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studenten an Hochschulen, Eltern, die für Studenten kaufen, sowie für Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter.« Strategisches Ziel ist es, dass Kinder sich zum Beispiel an iOS-basierte Betriebssysteme gewöhnen, sodass sie ihre Kaufentscheidungen dauerhaft an den aus Schulzeiten vertrauten Produkten ausrichten. Darüber hinaus bietet Apple Apps und Programme an, die auf die eigenen Produkte und deren Nutzung im Schulunterricht zugeschnitten sind. So etwa kooperierte Apple von Mai bis Juli 2017 mit dem Schulbuchverlag Cornelsen im Rahmen des Projekts »Apple Professional Learning«. Ziel des befristeten Pilotprojektes war es, im Rahmen von Workshops Aussagen zu Qualitätskriterien von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte zu gewinnen (Cornelsen Verlag 2017).
Im Unterricht soll nach Vorstellung des Technologieriesen mit der »Classroom App« gearbeitet werden. Sie ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, Lernaufgaben über iPads und iMacs zu bearbeiten, wobei sie gleichzeitig digital von Lehrkräften beobachtet werden können. Selbst digitale Gruppenarbeit ist möglich. Dabei stellt sich nicht nur die Frage nach der Notwendigkeit derartiger Programme, sondern insbesondere auch danach, wie Apple die von den Schülern und Schülerinnen auf den Endgeräten generierten Daten nutzt. Der Umgang des Konzerns mit Kundendaten zeigt sich bei der »Entdeckungsreise mit Apple« für Schüler und Schülerinnen im Apple-Verkaufsladen, bei der sie mit Produkten des Konzerns arbeiten und ihre Ergebnisse als Ergänzung in den Unterricht einbringen können. Der Konzern hatte sich das Recht vorbehalten, Fotos und Videomitschnitte der Teilnehmenden zu verwerten. Erst nach einer Abmahnung durch den Verbraucherzentrale Bundesverband gab Apple eine Unterlassungserklärung ab und veränderte die Teilnahmebedingungen dahingehend, dass die Eltern minderjähriger Schüler und Schülerinnen nun explizit zustimmen müssen, wenn die Aufnahmen für Unternehmenszwecke genutzt werden sollen (Schmerr 2019, 59).
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die für iPads nutzbare App »Schoolwork«: »Mit ihr ist es ganz leicht, Aufgaben zu verteilen und einzusammeln, die Fortschritte von Schülern in Lernapps im Auge zu behalten und mit einzelnen Schülern von überall aus in Echtzeit zusammenzuarbeiten« (Apple 2018, 2). Für Lehrkräfte dürfte die App insofern eine wegweisende Entlastung darstellen, als sie mit ihr Unterrichtsinhalte von externen Anbietern einbinden können: Ein zentrales Wesensmerkmal des Programms besteht nämlich darin, dass sich weitere Apps wie zum Beispiel »GeoGebra AR«, »Kahoot!« oder »Duolingo« in die digitale Lernumgebung einfügen lassen (ebd., 2): »Mit Schoolwork können Sie Schüler ganz einfach zur richtigen Aktivität in der richtigen App führen. Sie können unterstützte Apps nach für Ihren Lehrplan geeigneten Inhalten durchsuchen. Anschließend können Sie ausgewählte App-Aktivitäten mit Ihren Schülern teilen. Mit einem einzigen Fingertipp gelangen sie so direkt zur richtigen Aktivität.« Die Nutzung der App bedeutet folglich, dass Kinder und Jugendliche nicht nur den Werbeeinflüssen von Apple-Produkten ausgesetzt sind, sondern auch den Unterrichtsinhalten von privaten Lernmaterialanbietern. Weiterhin muss davon ausgegangen werden, dass Apps von Drittanbietern ihre Positionierung im »Schoolwork«-Gefüge gegen Bezahlung entsprechend beeinflussen können. Apple profitiert mithin gleich zweifach von seinen Schulmarketingaktivitäten – zum einen als Plattformanbieter, zum anderen als Dienstleister.
Facebook: Bildungspolitik und personalisierte Lehrpläne
Geprägt von seiner Studentenzeit an der Harvard University, begann sich Mark Zuckerberg, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Facebook, zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt in seiner Karriere für Bildungsfragen zu engagieren. So spendete er noch vor dem im Mai 2012 lancierten Börsengang des Technologieriesens, zu dem neben dem sozialen Netzwerk Facebook, die Video- und Foto-Sharing-AppInstagram und der MessengerWhatsApp gehören, 100 Millionen US-Dollar für die Schulen der Stadt Newark (New Jersey) (Pérez-Peña 2010). Gemäß der im Silicon Valley regelmäßig ausgegebenen Losung »Think Big« setzte er auf die Revolution der Schulbildung (Russakoff 2014): Sein Engagement zielte zunächst vor allem auf Summit Public Schools, d. h. auf öffentliche Schulen in den USA, die keine Unterrichtsgebühren erheben. Das strategische Interesse des Konzerns an Summit Public Schools liegt unter anderem darin begründet, dass sie in landesweiten Vergleichsstudien stets hervorragende Ergebnisse erzielen: 99 Prozent der Absolventen und Absolventinnen immatrikulieren sich anschließend an Universitäten oder für vierjährige Collegeprogramme; mehr als die Hälfte davon schließt das Studium erfolgreich ab (fast doppelt so viele wie im nationalen Durchschnitt). Somit erreicht Facebook besonders begehrte potenzielle Kunden und Kundinnen, nämlich Kinder und Jugendliche, die beste akademische Ausbildungen erhalten und entsprechend hohe Einkommen und Erbschaften erwarten dürfen.
Mit dem für die Summit Public Schools entwickelten Programm »Personalized Learning Plan« (PLP) werden Lernziele und -fortschritte personalisiert, was die Motivation der Lernenden erhöhen soll, weil sie selbst entscheiden könnten, auf welche Ziele sie hinarbeiteten, wie viel Zeit sie dafür veranschlagen und wie weitreichend sie vom Lehrpersonal unterstützt werden (möchten). Von Seiten des Konzerns steckt dahinter der Wunsch, dass Kinder und Jugendliche frei zugängliche Materialien aus dem Internet nutzen, die sie auf »Chromebooks« abrufen. Unstrittig verfolgt Facebook mit seinem sich auf mehrere hundert Millionen US-Dollar belaufenden Engagement im Bildungssektor das Ziel, mittels Lernplattformen Zugriff auf personenbezogene Daten der Lernenden zu gewinnen. Allen philanthropischen Verlautbarungen ihres Gründers Mark Zuckerberg zum Trotz zielt das in Palo Alto ansässige Unternehmen letztlich darauf ab, Daten in Geld zu verwandeln.
»Googlefizierung« der Klassenzimmer
Mit Diensten wie »Google Maps«, »Google Chrome«, »Google Docs«, »Google Calendar« oder auch der Videoplattform »YouTube« ist das Unternehmen Google, das inzwischen weltweit mehr als 500 Millionen aktive Nutzer und Nutzerinnen zählt, in nahezu sämtlichen Bereichen des modernen Lebens präsent – so auch in den Klassenzimmern (Frühbrodt/Floren 2019). Beinahe die Hälfte der deutschen Schüler und Schülerinnen greift auf YouTube als digitales Leitmedium zu, verbunden mit einer Nutzungsquote von 86 Prozent für schulisches Lernen (Rat für kulturelle Bildung 2019).
Doch die Videoplattform schaltet vor nahezu alle Clips einen Werbespot, sodass die Schule als werbefreier Erfahrungs-, Schutz- und Sozialisationsraum zunehmend gefährdet wird. Der Rat für kulturelle Bildung konstatiert in seiner im Juni 2019 veröffentlichten Studie mit dem Titel »Jugend/YouTube/Kulturelle Bildung« (2019, 6): »Die Video-Plattform [YouTube] ist mittlerweile Teil des Geschäftsmodells von Google; die Zahl der Klicks, die Dauer des Aufenthalts und die durch Algorithmen gesteuerte gezielte Werbung sind die zentralen Erfolgskriterien. Mit Blick auf die Nutzung für Information, Unterhaltung, Übung, Bildung etc. ist YouTube offen. In diesem Kontext gewinnt YouTube eine unerwartet hohe Bedeutung für den Bildungsbereich und nimmt einen Stellenwert ein, der sich stark auf das Lehren und Lernen auswirkt. Sehr viele Jugendliche nutzen YouTube-Videos ganz selbstverständlich als Hilfsmittel für ihre Lern- und Bildungsprozesse.«
In der »Google Zukunftswerkstatt« wiederum werden neben Schulungen für Lehrkräfte auch Unterrichtsmaterialien angeboten. Letztere können unter anderem in Verbindung mit virtuellen Klassenreisen, sogenannten »Google Expeditions«, in den unteren Jahrgangsstufen genutzt werden. Die Plattform »Google for Education« wurde sogar explizit eingerichtet, damit begeisterte Lehrende und Lernende ihre Bildungseinrichtung von einer Kooperation mit dem Konzern überzeugen. Unter dem Stichwort »Google Classroom« trägt das Unternehmen mit Broschüren und Fortbildungen zur Gestaltung virtueller Lernumgebungen im Klassenzimmer bei. Auffällig ist die Tatsache, dass Google die Onlinekurse, die Trainings vor Ort, die virtuellen Klassenreisen und die Workshops für Lehrkräfte inklusive Materialien unentgeltlich anbietet. Die Kostenfreiheit der Angebote ist bemerkenswert, weil zur Erstellung dieser Ressourcen Zeit und Geld aufgewendet werden müssen. Auch deshalb geriet die Einführung des Einplatinencomputers »Calliope mini«, mit dem bereits Grundschulkinder Programmiersprachen erlernen sollen, in die Kritik. Während die sächsische Landesregierung in erster Linie wettbewerbsrechtliche Bedenken gegen die Verwendung des Minicomputers formulierte, kritisierten andere den »ungefilterter« Zugang des Digitalkonzerns zu den Schulen (Ehrenhauser 2017).
Für »Calliope« macht sich auch die Berliner Professorin Gesche Joost stark, die zwischen 2014 und 2018 als »Internetbotschafterin der Bundesregierung« fungierte. Sie erhielt nach Recherchen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und des ARD-Magazins »Report Mainz« vom Bundeswirtschaftsministerium jährlich 50.000 Euro für ihre Dienste. Obwohl sie laut Vertrag keine Aufgaben übernehmen durfte, die ihre Unabhängigkeit gefährden, zog sie 2015 in den Aufsichtsrat von SAP ein, das mit dem Schulprojekt »Calliope« betraut ist– gegen eine Vergütung von »zuletzt fast 200.000 Euro im Jahr« (Becker/Ehrenhauser 2018). Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum mehr, wenn sich Joost auf der Calliope-Website dafür ausspricht, »dass digitale Bildung ab der Grundschule als fester Baustein im Curriculum verankert und von den Ländern angemessen budgetiert« werden soll (zit. nach Stadler 2019).
Das Beispiel illustriert, wie stark die unternehmerischen Initiativen von der Politik unterstützt werden. In Zeitungs- und Radiointerviews oder Grußworten von Imagebroschüren finden auch Bildungsminister und -ministerinnen anerkennende Worte für das schulische Engagement von Unternehmen. So lässt sich die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mit Blick auf die Aktivitäten der von 141 Unternehmen, Stiftungen und Hochschuleinrichtungen getragenen Initiative »Wissensfabrik. Unternehmen für Deutschland« in deren jüngstem Jahresbericht wie folgt zitieren (Wissensfabrik 2019, 5): »Bildung in der digitalen Welt ist für uns ein zentrales Handlungsfeld. Wir bilden und erziehen zur digitalen Mündigkeit – und das setzt ein Verständnis der technologischen Hintergründe voraus. Das Wissensfabrik-Projekt ›IT2School‹ ergänzt unsere vielfältigen Maßnahmen an den Schulen dabei hervorragend.«
Microsoft: Programmierkenntnisse zur Codierung des Lebens
Microsoft vermarktet seine Lobbyarbeit insbesondere unter dem Bildungsauftrag der Chancengleichheit: »Grenzenlose Lernchancen eröffnen« und »Engagement für Barrierefreiheit und Inklusion« lauten die Slogans. Mithilfe der von Microsoft angebotenen Soft- und Hardware sollen Schüler und Schülerinnen individuell gefördert werden, wodurch »personalisierte Lernerfahrungen« und die »Chance für jeden Schüler, in der Schule und im Leben Erfolg zu haben, in Aussicht gestellt werden« (Microsoft 2021). In einem der Werbevideos wird dezidiert auf die Möglichkeiten eingegangen, die ein digitales Lernumfeld für Menschen mit Behinderung bietet. Nur wenige Zeilen später wirbt Microsoft dann für die eigenen Produkte: Es wird erläutert, inwiefern das Programm »Microsoft Office 365« und das Betriebssystem »Windows 10« für auf Inklusion zielende Unterrichtsvorhaben notwendig sind. Dazu werden verschiedene Workshops und Materialien teils kostenfrei zur Verfügung gestellt. Lehrkräften werden Tools zur Unterrichtsvorbereitung, -gestaltung und -analyse angeboten. So stellt Microsoft die Behauptung in den Raum, dass Schulen, die »Microsoft 365« mit Programmen wie Word, Excel oder Outlook einführen, eine deutlich höhere Unterrichtseffizienz erfahren würden, wobei rund 200 Stunden pro Jahr »eingespart« werden könnten (ebd.). Auch dieses Verständnis von Effizienz stellt eine Geringschätzung staatlich verantworteter Bildungsangebote dar.
Amazon: zwischen Schreibwettbewerben und Lesefreuden
Während Apple, Google und Microsoft mit der Verbreitung von Hard- und Software an Schulen vergleichsweise leichtes Spiel hatten und haben, traf Amazon frühzeitig auf Widerstände. Der Schreibwettbewerb »Kindle-Storyteller-Kids«, der die Lese- und Schreibfähigkeit von Grundschulkindern fördern sollte, wurde 2016 in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterbunden (Küfner 2017). Die zuständigen Ministerien wiesen auf das Werbeverbot an Schulen hin, welches sie durch den Wettbewerb als gefährdet ansahen. So etwa meinte das Hessische Kultusministerium (HKM), der Zweck der Leseförderung träte hinter den eigentlichen vom Unternehmen intendierten Zweck – nämlich den der unternehmerischen Selbstdarstellung – zurück: »Nach unserer Ansicht ist dieser Wettbewerb mit den schulrechtlichen Vorschriften zum Werbeverbot in Schulen nicht vereinbar« (zit. nach Hanack 2016). Es sei »offensichtlich, dass es dem Unternehmen ausschließlich um das eigene Image in der Öffentlichkeit geht« (ebd.). Als problematisch sei außerdem zu werten, »dass der Wettbewerb nur im direkten Umfeld der Amazon-Standorte ausgetragen werde« und ausschließlich Amazon-Produkte, nämlich »30 Kindle eBook-Reader, digitale Bücher im Wert von mehr als 1.700 Euro und Amazon-Gutscheine im Wert von 50 Euro«, zu den Preisen gehörten (ebd.).
Während die oben genannten Bundesländer den Wettbewerb verboten, konnte ihn Amazon in anderen Bundesländern wie zum Beispiel in Sachsen erfolgreich einführen. Die Nichtregierungsorganisation LobbyControl verweist auf unkritische Berichte, die nach erfolgten Amazon-Wettbewerben in Lokalzeitungen veröffentlicht wurden, und auch die teilnehmenden Schulen loben den Wettbewerb vielfach. Es wird von Eltern berichtet, die der Siegesfeier beiwohnten und »vor allem begeistert davon [waren], dass sie einen Rundgang durch das Logistikzentrum machen durften, weil man ja sonst in dieses Logistikzentrum nicht kommt« (zit. nach Kamella 2015).
Felix Kamella, langjähriger Campaigner bei LobbyControl, verweist indes darauf, dass durch solche Wettbewerbe »auch langfristige Kontakte zu den im Bildungssektor Verantwortlichen aufgebaut werden« sollen (zit. nach ebd.). So etwa hatten für den Wettbewerb [i]n den allermeisten Fällen […] vor Ort die Bürgermeister eine Schirmherrschaft […] übernommen» und »sich […] positiv zu Amazon geäußert« (ebd.). Somit hat der Konzern dort bereits einen Fuß in der Tür, was insofern von strategischer Weitsicht des Unternehmens zeugt, als sich eine, wie oben bereits erwähnt, eindeutige geografische Ballung der Wettbewerbe im Umfeld von Grundschulen beobachten lässt, die in der Nähe von Amazon-Logistikzentren liegen. Verfolgt wird diese Strategie der regionalen Integration auch von Microsoft und dem Branchenverband Bitkom (Töpper 2017): »Für die ›Code your Life‹-Initiative von Microsoft haben 14 Bundestagsabgeordnete eine Schulpatenschaft übernommen, für ›Erlebe IT‹ des Branchenverbands Bitkom sogar 140 Abgeordnete.«
Schleichende Werbung in Zeiten digitaler Euphorie
Die skizzierten Aktivitäten der Unternehmen lassen erkennen, wie einflussreich sie insbesondere unter den Vorzeichen der auch hierzulande für die Schulen proklamierten digitalen Wende sind. Vielfach fungieren scheinbar harmlose Schülerwettbewerbe als »Türöffner«. Der von Amazon 2016 ausgerichtete und wenig später in drei Bundesländern untersagte »Kindle-Storyteller-Kids«-Schreibwettbewerb steht geradezu emblematisch dafür, wie Unternehmen ihre Werbung schleichend in die Schulen einspeisen. Auch die von Google 2013 gemeinsam mit den Gruppen »Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen« und »Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter« angebotene »Reihe von offenen Unterrichtsmaterialien (OER) zu aktuellen medialen Erscheinungen«, die den Wettbewerb »Digitales Lernen in der Praxis – Ideen für den Unterricht« in Umlauf brachte (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter o. J.), ist sinnbildlich für die Wirkmächtigkeit des schulischen Engagements von Unternehmen. Denn derartige – meist kostenfreie – Lehr- und Lernmaterialien werden häufig überaus positiv von Lehrkräften aufgenommen, eröffnen sie doch in vermeintlich einzigartiger Weise (fach-)didaktische Zugänge zu den digitalisierten Lebenswelten der Schüler und Schülerinnen (Töpper 2017). In erster Linie jedoch wäre der Unabhängigkeit von Schulen gedient, »wenn die öffentlichen Etats für Medienfortbildungen, für die IT-Ausstattung an Schulen und für Lehr- und Lernmittel aufgestockt würden« (Schmerr 2019, 61).
Ergänzt werden müssten diese Bemühungen um eine kritische Medienpädagogik, die sich der inhaltlichen Einflussnahme, der zielgerichteten Werbung und der grassierenden Datenunsicherheit widmet. Denn die Digitalkonzerne nehmen mittels Unterrichtsmaterialien (direkten) und über die zur Verfügung gestellten Medien (indirekten) Einfluss auf die (Art und Weise der) im Klassenzimmer vermittelten Inhalte. Zugleich lässt sich an einer rasant wachsenden Zahl US-amerikanischer Schulen beobachten, dass die »Big Five« ihre Produkte und Dienstleistungen durch die mitunter gar nicht so unauffällige »Schleichwerbung« an Lehrende und Lernende herantragen, um zugleich ihre digitalen Medien zu festen Säulen oder gar dominanten Treibern von Lehr- und Lernprozessen werden zu lassen. Nicht nur mit dem Prinzip des »Bring your own device«, sondern auch durch die von Apple, Google, Microsoft und Samsung angebahnte Digitalisierung der Schulwelt wird das digitalen Medien (noch) innewohnende Innovationspotenzial für die Gestaltung des Unterrichts zum Anlass genommen, »klassische« Medien (zum Beispiel das Schulbuch), zentrale fachdidaktische Zugänge (zum Beispiel die Problemorientierung) oder etablierte methodische Arrangements (zum Beispiel die Pro-Contra-Debatte) an den Rand zu drängen oder gar ganz auszuschalten.
Die Unternehmen senden mit ihrem Bildungsengagement eine Botschaft aus, die sie als allgemeinwohlorientiert oder gar altruistisch erscheinen lassen soll. Dass dies gerade bei den US-amerikanischen »Big Five« als fragwürdig wahrgenommen werden muss, lässt sich daran ablesen, dass sie trotz ihrer schieren Omnipräsenz in den EU-Staaten weitaus weniger Steuern entrichten als beispielsweise die DAX-Konzerne, deren Steuerquote in der Regel zwischen 15 und 25 Prozent liegt (Brinkmann/Obermaier 2018). Apple dagegen soll nach Schätzungen der EU-Kommission bis zum Jahr 2014 auf eine Million Euro Gewinn durchschnittlich gerade einmal 50 Euro Steuern entrichtet haben – das wäre also eine Steuerquote von 0,005 Prozent. Aber auch danach – in den Jahren 2015 bis 2017 – sollen den EU-Staaten durch Apples