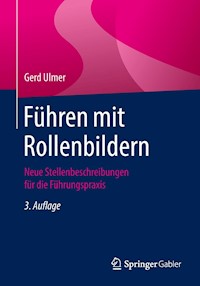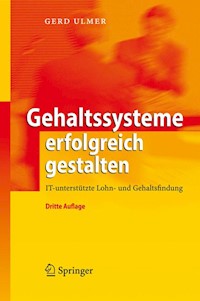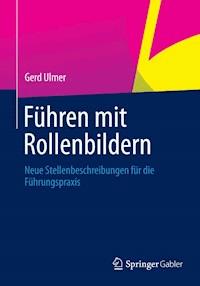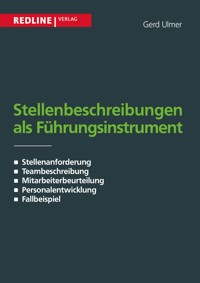
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Stellenbeschreibungen haben Potenzial und Sinn: Sie können sowohl als Leitinstrumente in Führungs- und Organisationsprozessen eingesetzt werden, als auch Weichensteller für Organisations- und Personalentwicklung sein. Herkömmliche Stellenbeschreibungen mit lustlosen Aufzählungen aller möglichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten leisten das allerdings kaum. Fokussiert man die Stellenbeschreibung dagegen auf die wichtigsten Aufgaben, ergänzt mit Hinweisen zum Anforderungsniveau und welchen Prozessen sie dienen, dann liegen wertvolle Informationen zur weiteren sinnvollen Verwendung vor. Wenn zudem die Stellenbeschreibung als Grundlage zur Beurteilung von Mitarbeitern dient, dann wird sie zum aktiven Führungsinstrument und eröffnet Einblick in Stärken und Schwächen bei Mitarbeitern und Organisation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
GERD ULMER
Stellenbeschreibungen als Führungsinstrument
• STELLENANFORDERUNG
• TEAMBESCHREIBUNG
• MITARBEITERBEURTEILUNG
• PERSONALENTWICKLUNG
• FALLBEISPIELE
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Nachdruck 2013
© 2012 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© 2001 by Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter, Wien/Frankfurt
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Münchner Verlagsgruppe GmbH
Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN Print 978-3-86881-451-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-415-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-826-2
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter
www.muenchner-verlagsgruppe.de
eBook by ePubMATIC.com
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung – Die Stellenbeschreibung zwischen Euphorie und Frustration
Teil 1
Warum Stellenbeschreibungen/Rollenbilder?
Überlegungen zu Sinn, Zweck und Nutzen
Der Begriff »Rollenbild«
Die Stelle im Blickfeld des Rollenbildes
Die Stelle – Element der Organisationsstruktur
Die Stelle – im richtigen Stellenverständnis
Stellendynamik – Stellensystemik
Rollenbild versus Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibung
Einbindung der Rollenbilder in das Organisationsmanagement
Stellenbeschreibung gestern – Rollenbild heute
Rollenbilder in funktionsorientierter und prozessorientierter Organisation
Einfluss der Rollenbilder auf Unternehmensprozesse
Teil 2
Rollenbilder im Arsenal der Organisations & Führungsinstrumente
Übersicht und Wirkungszusammenhang
Vernetzung der Rollenbilder mit anderen Organisations- und Führungsinstrumenten
Organigramm
Funktionendiagramm
Stellenplan, Stellenbesetzungsplan
Stellenprofil
Stellenbewertung – Basis für Lohn-/Gehaltssysteme
Vereinfachter Katalog von typischen Stellenanforderungen
Management by Objectives (MbO)
Mitarbeiterbeurteilung und Mitarbeitergespräch
Rollenbilder – Zusammenspiel der Organisations- und Personalführungsinstrumente
Darstellung und Beschreibung der Zusammenhänge im Einzelnen
Beispielhafte Erkenntnisse aus der Abfrage der Rollenbilder
Teil 3
Die Ausarbeitung
Ein Führungsprozess, der nicht an Stäbe delegiert werden darf
Die Ausarbeitung von Rollenbildern
Struktur der Rollenbilder und Hinweise zur inhaltlichen und formalen Gestaltung – die Informationsfelder im Detail
Vorgehen bei der Einführung von Rollenbildern
Vorarbeiten zum Projekt
Das Realisierungsprojekt
Die definitive Einführung der Rollenbilder
Beispiel für den Projektablauf zur Einführung von Rollenbildern in einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern
Erfolgskriterien bei der Erarbeitung und Nutzung der Rollenbilder
Die Ausarbeitung von Teambeschreibungen
Struktur der Teambeschreibung und Hinweise zur inhaltlichen und formalen Gestaltung
Vorgehen bei der Einführung von Teambeschreibungen
Vorarbeiten zum Projekt
Das Realisierungsprojekt
Die definitive Einführung der Teambeschreibungen
Erfolgskriterien bei der Erarbeitung und Nutzung der Teambeschreibungen
Die Ausarbeitung von Stellenprofilen, Stellenwert
Struktur der Stellenprofile und Hinweise zur inhaltlichen und formalen Gestaltung
Vorgehen bei der Einführung von Stellenprofilen.
Vorarbeiten zum Projekt
Das Realisierungsprojekt
Die definitive Einführung der Stellenprofile
Erfolgskriterien bei der Erarbeitung und Nutzung der Stellenprofile und Stellenwerte
Die Ausarbeitung von Stellenausschreibungen/Stellenanzeigen
Struktur der Stellenausschreibung/Stellenanzeige und Hinweise zur inhaltlichen und formalen Gestaltung – die Informationsfelder im Detail
Erfolgskriterien bei der Erarbeitung und Nutzung der Stellenanzeigen
Teil 4
Der Folgenutzen von Rollenbildern und Stellenprofilen
Der Folgenutzen am Beispiel der Lohn-/Gehaltsfestlegung
Der Folgenutzen am Beispiel der Organisationsanalyse
Der Folgenutzen am Beispiel der Positionsanalyse
Der Folgenutzen am Beispiel des Personal- und Organisationsaudits
Schlussbemerkung
Anhang: Fallbeispiele
Vorbemerkungen zu den Fallbeispielen über Rollenbilder
Fall 1: Produktionsassistent/in, Sachbearbeiter/in
Fall 2: Sekretärin, Sachbearbeiter/in
Fall 3: Sachbearbeiter/in Kommerz
Fall 4: Systeme- und PC-Support/Informatik
Fall 5: Fachbearbeiter/in Materialprüfung – Mikroskopie
Fall 6: Technischer Kundendienst PPP
Fall 7: Segmentleiter/in Kostenrechnung/Planning
Fall 8: Schichtleiter/in
Fall 9: Leitung Anlageninstandhaltung
Fall 10: Leitung Chemie
Fall 11: Leitung Produkte- und Verfahrensentwicklung
Fall 12: Bereichsleitung Kommerz X-Produkte
Vorwort
Haben Stellenbeschreibungen ausgedient – oder sind sie besser als ihr Ruf? Egal wo das Thema Stellenbeschreibungen angesprochen wird, die Diskussionen dazu lassen Skepsis zur Sinnhaftigkeit und zum Nutzen dieses Organisations- und Führungsinstruments erkennen.
Eine Umfrage bei namhaften Persönlichkeiten der Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung bestätigt diese Skepsis. Die Mehrheit der Befragten meint, dass der Aufwand zur Ausarbeitung und Pflege von Stellenbeschreibungen in keinem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen steht.
Mehrfach stellte auch ich selbst dieses Instrument in Frage, wenn ich im Zuge von Organisationsanalysen versuchte, neben anderen Abklärungen auch aus den vorhandenen Stellenbeschreibungen ein Bild über den Organisationszustand eines Unternehmens abzuleiten. Die wenig aussagefähigen Exemplare gaben kaum Aufschluss über Strukturen und Abläufe rund um den Stellenbereich und ließen in dieser Form überhaupt keine systematischen Schlussfolgerungen über die Effizienz und Effektivität der Organisation zu. Man mag dazu einwenden, dass Stellenbeschreibungen für solche Auswertungen gar nicht vorgesehen sind, dass sie nur für Führungszwecke gemacht sind. Auch da kommen Zweifel auf. Die Nachlässigkeit der Führungskräfte bei der gebotenen Aktualisierung der Stellenbeschreibungen lässt kaum auf regen Gebrauch in der Führungsarbeit schließen. Der Staub auf den Exemplaren bestärkt diesen Verdacht. Aber für die Personalbeschaffung, das Recruiting, sind sie nützlich, wenden Personalchefs ein. Dann werden also Stellenbeschreibungen für den »Einmal- und Einzweckgebrauch« angefertigt und wandern dann ins Archiv. Diese Einschätzung widerstrebt mir, sie widerspricht meinen Vorstellungen von Verhältnismäßigkeit der Handlungen und von Nutzenerwartung.
Bei zahlreichen Stellenbeschreibungen, in die ich Einblick nahm, hatte ich den Eindruck, dass sich die Verfasser bei der Ausarbeitung der Stellenbeschreibungen erheblich gequält hatten, so als ob es eher aus Pflichterfüllung denn aus Einsicht in die Notwendigkeit geschähe.
Es ist bedauerlich, dass Stellenbeschreibungen so in Misskredit gekommen sind. Zu Unrecht, wie ich mittlerweile überzeugt bin. Den Grund für den schlechten Ruf sehe ich in der bis anhin isolierten Ausrichtung der Stellenbeschreibung. Jede Stelle wird für sich betrachtet – in stellenzentrierter Optik. Die Wechselbeziehungen der Stellen zueinander werden zu wenig beachtet, mit Ausnahme der hierarchischen Beziehung und der Regelung von Stellvertretungen. Stellenbeschreibungen werden nicht nach Informationen zur Stellenvernetzung ausgewertet – weil solche gar nicht erfasst sind.
Diese Erkenntnis war für mich Anstoß über das Thema Stellenbeschreibungen neu nachzudenken, wie denn solche Vernetzungen sichtbar gemacht und definiert werden können, wie die Stellenbeschreibungen mit den heutigen IT-Mitteln ausgewertet werden können und wie sie im Rahmen der Führungsarbeit effektvoller zum Einsatz kommen sollen.
Im Rahmen meiner Recherchen zu diesem Buch äußerte Professor Dr. Martin Hilb, Direktor des Instituts für Führung und Personalmanagement an der Universität St. Gallen, folgende Auffassung: »In der heutigen Zeit der raschen Veränderungen können Stellenbeschreibungen kaum aktuell gehalten werden. Sie versuchen ein Situationsbild der Stelle wiederzugeben, so wie es im Augenblick ist – eine Momentaufnahme, die beim nächsten Einblick bereits Geschichte ist. Sie hinken der Realität nach und sind deshalb unbefriedigend. Außerdem kommt es gar nicht so sehr darauf an, die Details der Stelle anzuführen – je mehr Details, umso kurzlebiger die skizzierte Situation. Konzentration auf das Wesentliche ist erforderlich: Was soll die Stelle bewirken, welche Rolle ist ihr zugedacht?«
Was ist die logische Konsequenz? Worin liegen also die Aufgaben? Wirtschaft und Wissenschaft greifen zu einem neuen Begriff: Rollenbild. Es soll die etwas verstaubte und lahme Stellenbeschreibung als Führungs- und Organisationsinstrument ablösen. Das Rollenbild soll auch assoziieren, dass es auf der Unternehmensplattform heute mehr denn je Rollenträger braucht, die nicht einstudiert, sondern spontan agieren und optimal aufeinander eingehen, um Erfolg zu erzielen und die Zukunft gemeinsam zu meistern. In diesem Sinn bringt es die Aussage von Professor Hilb auf den Punkt.
Ich danke all jenen, die in zahlreichen Diskussionen zum Thema Stellenbeschreibung diesen Wandel in meiner Einstellung mit bewirkt haben, von der Problemerkennung bis zur Problemlösung. Jetzt liegen Grundlagen vor, die sich jeder, der Interesse hat, nutzbringend aneignen kann.
Karl Reinmann, Leiter Personal und Kommunikation der Rhodia Industrial Yarns in Emmenbrücke, Schweiz, hat einen maßgeblichen Beitrag zu diesem Buch geleistet, indem er zahlreiche Stellenbeschreibungen seines Unternehmens für Fallbeispiele zur Verfügung stellte und damit den Praxisbezug dieses Buches sicherte. Mein besonderer Dank an ihn wie auch an jene Exponenten der Wirtschaft und Wissenschaft, die mit ihrer Stellungnahme zum Instrument Stellenbeschreibung wertvolle Anregungen für dieses Buch geliefert haben.
Einleitung
Die Stellenbeschreibung zwischen Euphorie und Frustration
Ein großes Unternehmen der Elektroapparate-Metallbranche entschloss sich zu einer Organisationsstudie im indirekt produktiven Bereich. Nicht die fundamentale Struktur sollte unter die Lupe genommen werden (das war schon geschehen), sondern die Mikroaspekte, der Feinraster sollte analysiert und auf Effizienz und Effektivität überprüft werden. Maßnahmen waren vorzuschlagen und der Effekt abzuschätzen, den sie bringen sollten. Das Projekt sah vor, von den im Untersuchungsbereich nahezu flächendeckend verfügbaren Stellenbeschreibungen auszugehen, die dort aufgelisteten Aufgaben mit Angaben zum Bedarf an Personalkapazität zu ergänzen und sie zuvor definierten Geschäftsprozessen zuzuordnen. Die Auswertung würde dann ergeben, wie viel Aufwand für welche Prozesse erforderlich ist, wie viele Beteiligte es dabei gibt, welcher Schnittstellenverkehr stattfindet, bis der jeweilige Prozess abgeschlossen ist. Daraus sollte sich beurteilen lassen, ob es übermäßig Doppelspurigkeiten, Friktionen und Leerläufe gibt – Anhaltspunkte für Verbesserungen.
Schön, wie das ausgedacht war, nur … die Stellenbeschreibungen spielten nicht mit. Sie waren wohl verfügbar, wie zugesagt, aber allzu vage verfasst, ohne griffige Aussage, für den erwähnten Zweck wertlos. Um das Projekt realisieren zu können, musste in einer Blitzaktion eine Umfrage via Fragebogen und ergänzenden Interviews vorgeschaltet werden, um zu den benötigten Informationen zu gelangen. Ergänzend sei erwähnt: Solche Blitzaktionen führen bekanntlich zu erheblichem Unmut bei den Betroffenen, die zurecht darauf hinweisen, dass sie solche Übungen schon mehrfach absolviert hätten – zum Beispiel bei der letzten Generalaktualisierung der Stellenbeschreibungen!
Das war eines von zahlreichen Erlebnissen, bei denen ich erkennen musste, dass Stellenbeschreibungen, sofern überhaupt vorhanden, nur selten in der Form vorliegen, dass sie für Organisationsüberlegungen nützlich sind. Für Organisationsanalysen, Business-Reengineering, aber auch für Stellenbewertungen und Entgeltsysteme und Qualifikationsanalysen der Stelleninhaber boten sie kaum brauchbare Informationen. Für solche Zwecke war es fast immer notwendig, einen Kraftakt für spezielle Erhebungen voran zu setzen, bevor mit der eigentlichen Aufgabe begonnen werden konnte. Kein Wunder, dass solche Aktionen als kulturfeindlich angesehen werden.
Auch den Stellenbeschreibungen will es nicht recht gelingen, zum Kulturbestandteil des Unternehmens zu werden, eingebunden in das Ritual des Geschäftsjahres. Ihr Effekt in der Personalführung, ihr Beitrag für Personalentwicklung mit Potentialanalysen usw. ist eher bescheiden.
Und dennoch will keiner recht auf dieses Instrument verzichten.
Sollten Stellenbeschreibungen etwa nur ein Pseudoinstrument sein für »Wichtigmacher« im Human-Resources-Bereich oder eine Schikane von Geschäftsleitern?
Auch wenn solch ein Verdacht manchmal aufkeimen möchte, wäre es falsch, der Stellenbeschreibung ihren Wert als Organisations- und Führungsinstrument abzuerkennen.
Der Misskredit ist dort entstanden, wo Stellenbeschreibungen verordnet wurden, ohne sie in einen Organisations- und Führungszusammenhang zu stellen. Wenn im Führungsalltag nicht fortlaufend auf die Stellenbeschreibung zurückgegriffen wird, sei es im Zuge von Neueinstellungen, Versetzungen, Mitarbeiterbeurteilung, Personal- und Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement, Prozessgestaltung usw., dann kann dieses Instrument keinen richtigen Nutzen bringen und folglich wird es auch nicht akzeptiert.
Nicht anders ergeht es Lohn- und Gehaltssystemen, die sinnleer und effektlos bürokratisiert werden, oder Qualitätssystemen, die nur deshalb inszeniert werden, um zum Kreis der Auditierten zu gehören. Nach ISO 9000 ff verlangt das Qualitätsmanagement eines Unternehmens, dass Geschäftsprozesse nachvollziehbar definiert sein müssen und die zuständigen Stellen in Aufgaben und Verantwortlichkeit zu definieren sind.
Eine Chance für die Stellenbeschreibung. Sie wird dadurch aufgewertet. Denn ohne bzw. mit nur unzureichenden Stellenbeschreibungen erhält das Unternehmen kein Qualitätszertifikat!
Wunschtraum eines Idealisten:
»Wie schön, wenn jedem Stelleninhaber klar wäre, was man zu tun hat und was von anderen erwartet werden darf, wer genau wofür verantwortlich ist, welche Kompetenzen zugestanden werden und welche nicht.«
Die Stellenbeschreibung sollte das klären. Aber warum gibt es dennoch reichlich Unklarheiten und Verwirrungen im Aktionsbereich der Stellen, auch wenn Stellenbeschreibungen vorhanden sind? Versagt die Stellenbeschreibung oder was wird falsch gemacht?
In zahlreichen Diskussionen bestätigten sich anhin bekannte Auffassungen:
Führungskräfte befürchten, sich allzu konkret festlegen zu müssen, wenn es um die Beschreibung von Zielsetzungen, Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortung geht. Sie empfinden die Stellenbeschreibung als Korsett und Blockade, als Einengung von Spielräumen.
Stelleninhaber befürchten, in ihrem Einsatzverhalten konkret und exakt nach dem Inhalt der Stellenbeschreibung qualifiziert zu werden und konzentrieren daher ihre Arbeit auf die vermeintlich so wichtigen Präzisierungen. Sie klammern sich an Worte.
Außerdem: Stellenbeschreibungen gelten als Instrument der Bürokratie. Sie manifestieren den »exzessiven Formalismus« im Unternehmen.
Solche Einschätzungen erinnern an sich selbst erfüllende Prophezeiungen: Vorgesetzte und Mitarbeiter verhalten sich vielfach ihren Befürchtungen entsprechend. Demnach wird die Stellenbeschreibung für einen Kodex gehalten, der für den Fall von Verirrungen zur Aufdeckung von Fehltritten herangezogen wird. Ein Rechtfertigungsinstrument.
Es leuchtet ein, dass mit so einem Instrument nicht geführt werden kann! Jedenfalls nicht im Sinne der heute angestrebten Führungskultur, die auf Motivation setzt, Flexibilität und Eigeninitiative erwartet und Mitarbeiter als Mitunternehmer betrachtet.
Stellenbeschreibungen: Wer braucht sie? Wem nützen sie? Wann schaden sie?
Aus dieser Optik ist klar, dass Vorgesetzte und Mitarbeiter vielfach lieber auf Stellenbeschreibungen verzichten, als sich ihrem Joch zu unterwerfen. Für jene Abläufe und Geschäftsfälle, die besonders wichtig und delikat sind oder bei denen es wiederholt zu Pannen und Unzulänglichkeiten kommt, bevorzugen sie eine Ausführungsfestlegung oder eine verbindliche Handlungsanleitung. Diese regelt den Fall, nicht jedoch den Job.
Die Stellenbeschreibung hat nicht den einzelnen Fall zu regeln. Sie soll beim Vorgesetzten und beim Stelleninhaber zu einem übereinstimmenden Stellenverständnis führen – und weiter noch zum Organisationsverständnis: zum Wirkungszusammenhang mit anderen, vernetzten Stellen. Nicht mehr!
Die Wirkung der Stellenbeschreibung ergibt sich aus dem Sinnverständnis. Ob bei Führungskraft oder Mitarbeiter: Die lediglich taxative Aufzählung der Aufgaben in der Stellenbeschreibung führt zu Blockade und Frust. Denn offenbar – so wird angenommen – gehört alles, was nicht aufgeführt ist, auch nicht zum Stelleninhalt. Demgegenüber vermittelt die exemplarische, kurze Stellenbeschreibung das Stellenverständnis wesentlich besser als seitenlange, auf Vollständigkeit bedachte Aufzählungen.
Sind Stellenbeschreibungen bevorzugt ein Instrument für große Unternehmungen, denen unterstellt wird, dass die linke Hand nicht mitbekommt, was die rechte tut? Oder geht es um mehr als nur die Inventarisierung und Zuordnung von Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen? Fraglos erfordert die Führung von großen Unternehmungen mehr Systematisierung in Organisation und Führung, mehr Grundlagen und Instrumente, um die Dinge im Griff zu halten.
Stellenbeschreibungen gehören zu den elementaren Grundlagen und Instrumenten, die jedes Unternehmen benötigt, um den Personaleinsatz, die Personalführung und Gehaltsbestimmung effektvoller zu gestalten, was sich – wenn richtig gemacht – in jedem Fall in betriebswirtschaftlichem Nutzen niederschlägt.
Freilich ist auch einzuräumen, dass bei kleinen Unternehmen der Spielraum für intuitives, pragmatisches Handeln breiter gesteckt werden kann als in Großunternehmen: Eine Organisation mit wenigen Mitarbeitern kann von einzelnen Gesamtverantwortlichen einigermaßen überblickt werden. Jeder im Unternehmen weiß in etwa, was der andere tut, worauf es ankommt und was der Chef will. Dennoch, um Irrtümern und Missverständnissen vorzubeugen, sollten auch hier (einfache) Regelungen getroffen werden.
Stellenbeschreibungen nützen sowohl den Führungskräften wie auch den Stelleninhabern, wenn sie das Stellenverständnis samt organisatorischer Wirkung klären und vermitteln. Das richtige Stellenverständnis wird nicht allein durch die Aufzählung von Aufgaben erzielt. So wie aus einer Stückliste kaum auf die Konstruktion und Funktion eines Produkts geschlossen werden kann, lässt sich aus der Auflistung der Aufgaben nur unzureichend auf die Stelle schließen. Zahlreiche Stellenbeschreibungen sind jedoch so verfasst, als ob ihre Autoren dieser Illusion aufgesessen wären.
Viele frustrierende Erfahrungen mit Stellenbeschreibungen erklären sich aus solchen Irrtümern. Die Stellenbeschreibungen deswegen aufzugeben oder auf eine Einführung von vorn herein zu verzichten, wäre falsch.
Schließlich erfolgt eine Neu- oder Nachbesetzung wichtiger Stellen auch nicht mittels einer Stellenausschreibung oder Stellenanzeige, die sich allein mit der Stellenbezeichnung und der Angabe von drei bis fünf Aufgaben begnügt. Darüber hinaus bedarf es auch Hinweise zur Einordnung in die Organisation (wo eingesetzt?, wem unterstellt?, Zusammenarbeit mit wem? …) und zur gewünschten Qualifikation, zum Anforderungsprofil. Die guten Stellenanzeigen in den Zeitungen zeigen, was alles ausgesagt werden soll. Der Stelleninteressent möchte in wenigen plakativen Informationen das Wesentliche zur Stelle erfahren. Sobald er oder sie zum Inhaber der Stelle geworden ist, gilt es, das Stellenverständnis zu vertiefen.
Nutznießer zweckmäßiger Stellenbeschreibungen sind somit auch die Personalmanager und Organisationsarchitekten. Die einen hinsichtlich der Stelleninhaber, die für die Stelle zu rekrutieren sind und auch in Richtung anderer, breiter gesteckter, anspruchsvollerer Stellen weiter entwickelt werden sollen, wie es ihr Potential erlaubt. Die anderen aus der Sicht der Stelle an sich, die dazu da ist, um Funktionen für das Unternehmen zu erfüllen und jene Wirkungen zu erzeugen, die dem Unternehmen mit möglichst wenig Friktion, Doppelspurigkeit und Leerlauf zum angestrebten Erfolg verhelfen.
Stellenbeschreibungen schaden nur mehr, wenn sie alibimäßig, ohne Einbindung in den Führungsalltag ihr Dasein fristen – nur für den Fall bereitliegend, dass irgendjemand mal nachfragen könnte, was der Stelleninhaber eigentlich macht.
Die Stellenbeschreibung im erweiterten Sinn, das Rollenbild, ist die Mutter der Stellenausschreibung/Stellenanzeige, des Stellenprofils und des Stellenwerts. All das leitet sich aus dem Rollenbild ab, wie die nachstehende Übersicht darlegen soll.
Der Titel dieses Buches verweist auch auf die wesentlichen Nutzanwendungen der Stellenbeschreibung. Aus ihr leiten sich die Stellenanforderungen ab, Input für die Stellenbewertung/ -anzeige und auch Stellenausschreibung. Sie liefert die Grundlagen für die stellenbezogene Mitarbeiterbeurteilung und für eine Standortbestimmung zur Personalentwicklung. Team und Stelle im gegenseitigen Spannungsverhältnis: Die Stellenbeschreibung bezieht sich nun mal auf die Stelle und den Stelleninhaber – mit dem Effekt, dass sich die stellenzentrierte Sicht zum Hindernis in der Teamentwicklung entpuppt. Die Teambeschreibung soll in jenen Fällen, da die teamorientierte Sicht Vorrang hat, die Stellenbeschreibung ersetzen.
Im Teil 1 des Buches gehen wir der Frage nach: »Warum Stellenbeschreibungen/Rollenbilder?« Vor allem jene Leser, die am Sinn, Zweck und Nutzen der Stellenbeschreibungen Zweifel hegen, sollen sich mit grundsätzlichen Überlegungen zur Funktion von Stellenbeschreibung/Rollenbild auseinander setzen.
Teil 2 des Buches stellt die Rollenbilder in Bezug zu den anderen üblichen Organisations- und Führungsinstrumenten und zeigt die komplementären Zusammenhänge.
Teil 3 des Buches widmet sich der Gestaltung und Ausarbeitung der Rollenbilder und ihren ergänzenden Komponenten wie Stellenprofil, Stellenwert und Stellenanzeigen.
Teil 4 des Buches zeigt die vielseitige Nutzanwendung der Rollenbilder, jene Anwendungsbereiche, die über die ursprünglich zugedachte Unterstützung in der Führung des Stelleninhabers hinaus reichen in gesamtorganisatorische und führungstechnische Zusammenhänge.
Der Anhang des Buches enthält eine beispielhafte Sammlung von typischen Rollenbildern. De facto wurden die bestehenden Stellenbeschreibungen eines Unternehmens nach den Empfehlungen dieses Buches zu Rollenbildern überarbeitet.
Dieses Buch beginnt also mit der Frage nach dem Sinn von Stellenbeschreibung/Rollenbild und endet mit der Ausarbeitung von konkreten Beispielen, die als direkte Vorlage zum Entwurf von Rollenbildern im Unternehmen des Lesers dienen können.
Teil 1
Warum Stellenbeschreibungen/ Rollenbilder?
Überlegungen zu Sinn, Zweck und Nutzen
Eine Meinungsumfrage zum Einsatz und Nutzen von Stellenbeschreibungen bei Personalmanagern großer Unternehmungen, durchgeführt im Jahr 2000, hat folgendes Bild ergeben:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!