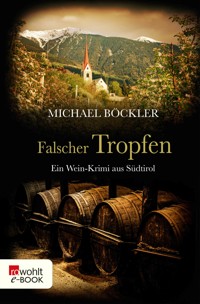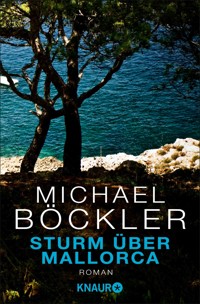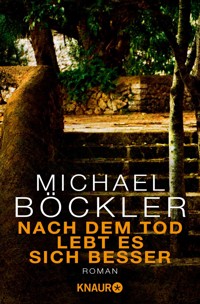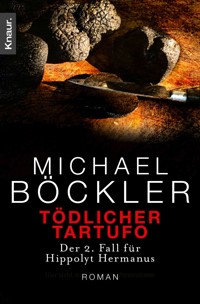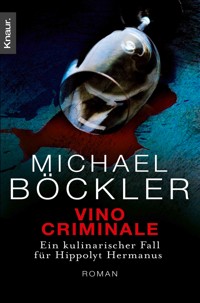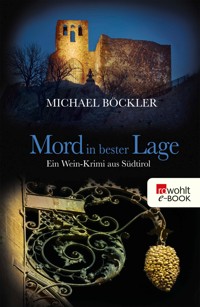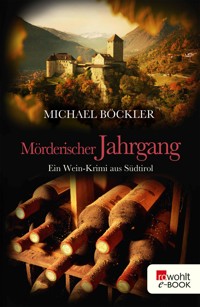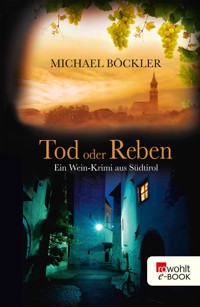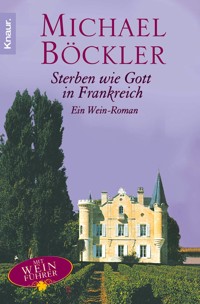
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Hippolyt Hermanus
- Sprache: Deutsch
In der Provence wird ein Weinhändler mit einer Flasche Lafite-Rothschild erschlagen, und das Mitglied einer exklusiven Weinbruderschaft ertrinkt in einem Teich. Als sich die mysteriösen Vorfälle häufen, ist es aus mit dem faulen Leben, das Hippolyt Hermanus doch so liebt. Denn der Weinkenner und Psychologe hat früher in einer Sonderkommission der Polizei gearbeitet. Begleitet von Valérie, die sich Hals über Kopf in ihn verliebt hat, macht er sich auf die Jagd nach den Schuldigen - quer durch Frankreich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Michael Böckler
Sterben wie Gott in Frankreich
Ein Wein-Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In Saint-Rémy-de-Provence wird ein Weinhändler mit einer Flasche Château Lafite-Rothschild erschlagen. Wie sich später herausstellt, handelt es sich dabei um gefälschten Wein. Aus einem Grab in Burgund werden fünf Flaschen Château d’Yquem des legendären Jahrgangs 1784 gestohlen. Im Bordelais werden Weinfässer angebohrt. Ein Mitglied der Chevaliers des Grands Crus ertrinkt in einem Teich auf einem Golfplatz. Was steckt hinter dieser unglückseligen Serie? Hippolyt Hermanus, genannt Hipp, ist von Anfang an in die Geschehnisse verstrickt. Er hat als Psychologe früher in einer Sonderkommission der Polizei gearbeitet und ist ein ausgewiesener Weinkenner. Eigentlich ist er auf gut Deutsch gesagt stinkfaul, doch da ist auch noch Valerie, die Tochter des Ober-Chevaliers der Weinbrüderschaft, bei deren Onkel es sich just um jenen erschlagenen Weinhändler handelt. Und wo die Liebe hinfällt, kann sich auch Hipp nicht mehr entziehen …
Inhaltsübersicht
Landkarte
Préface
Prologue
Première Partie
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Deuxième Partie
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
La Grande Conférence annuelle des Chevaliers des Grands Crus
52. Kapitel
Épilogue
Supplément
Introduction des Vins
Bordeaux
Burgund
Champagne
Elsass
Jura und Savoyen
Korsika
Languedoc-Roussillon
Loire
Provence
Rhône-Tal
Südwestfrankreich
Dank
Alphabetisches Wein-Register
Préface
Von Napoléon Bonaparte ist überliefert, dass er dem Wein eine außerordentliche Wertschätzung entgegenbrachte. Vor allem der Chambertin hatte es ihm angetan, ein vorzüglicher Pinot Noir aus Burgund. Allerdings soll Napoléon eine schreckliche Angewohnheit gehabt haben. Er ließ sich nämlich nicht davon abbringen, auch exquisite Rotweine zu spritzen. Den Protagonisten im vorliegenden Roman würde ein solcher Frevel selbst im Traum nicht einfallen, schließlich handelt es sich durchweg um ausgewiesene Wein-Connaisseure. Aber ein gespritzter Château Latour, ein mit Wasser verdünnter Pétrus oder Romanée-Conti wären – obgleich es einem schon bei der bloßen Vorstellung kalt den Rücken hinunterläuft – noch harmlos gemessen an dem, was einigen von ihnen widerfährt: Sie fürchten in einem Gärbottich um ihr Leben, werden mit einer Flasche Wein erschlagen (immerhin mit einem Lafite-Rothschild), erwerben Weinraritäten, die sich als Fälschung erweisen, werden ihrer kostbarsten Jahrgänge des edelsüßen Château d’Yquem beraubt – und kommen selbst im Grab nicht zur Ruhe.
Mehr soll in diesem Vorwort nicht verraten werden. Nur so viel: Der Roman spielt in den wichtigen Weinbauregionen Frankreichs. Was kein Zufall ist, sondern erklärte Absicht. Denn das Buch will nicht nur eine spannende Geschichte erzählen, sondern gleichzeitig eine systematische Einführung in die französischen Weine geben. Die turbulente Handlung führt von Burgund über die Loire und Bordeaux bis hinunter in die sonnenverwöhnte Provence. Die Weine aus dem Elsass finden ebenso ihre Erwähnung wie die Champagne oder das Rhône-Tal. Es werden die Anbaugebiete genannt, die Rebsorten beschrieben, berühmte Weingüter und ihre Spitzenweine vorgestellt.
Damit die Orientierung etwas leichter fällt und um die Lücken im Roman zu schließen, gibt es einen Anhang, der als kompakter französischer Weinführer fungiert. Das Supplément ist nach den Weinbauregionen gegliedert. Wer nicht sicher ist, wo er zum Beispiel bei dem Stichwort Margaux nachsehen soll – zugegeben ein eher hypothetischer Fall –, der findet am Ende in einem alphabetischen Sammelregister das betreffende Weingebiet genannt (Bordeaux).
Bevor der Roman beginnt und Sie bei mondheller Nacht auf einen Friedhof im Mâconnais entführt, noch drei Hinweise.
Erstens: Um sich die Welt der französischen Weine näher zu erschließen, gibt es nichts Besseres und Schöneres, als in die Anbauregionen zu reisen, die berühmten Weinberge zu besichtigen, Weingüter zu besuchen und vor Ort ihre Erzeugnisse zu probieren. Auch dazu soll dieses Buch einen bescheidenen Beitrag leisten und einige Anregungen geben. Vielleicht macht es Spaß, auf den Spuren der Handlung (und des Autors) zu wandeln? Mit dem Roman in der Hand wäre das leicht möglich. Außerdem sind im Anhang bei allen Weinbauregionen einige Restaurants und Hotels als erste Anlaufadressen genannt. Und für Golfer gibt’s Tipps zum Aufteen! Bon voyage!
Zweitens: Zum genussvollen Savoir-vivre gehören in Frankreich natürlich auch die Kreationen der Küche. Im Idealfall gehen sie eine wunderbare Symbiose mit den ausgewählten Weinen ein. Weil dies auch die Akteure im Roman wissen, wird auf den folgenden Seiten nicht nur gerne getrunken, sondern zudem mit Genuss gespeist. Einige kulinarische Hinweise zu den Weinbauregionen und typische Rezepte finden sich im Anhang. Bon appétit!
Drittens: Natürlich ranken sich die Verbrechen in diesem Roman um weltberühmte Spitzenweine und sündteure Raritäten. Was kaum überraschen dürfte, denn sonst fehlte ja der Anreiz für die Täter. Leider wird der größte Teil der Leser mit dem Autor das Schicksal teilen, sich solche Weine nur gelegentlich – wenn überhaupt – leisten zu können. Das ist zwar höchst bedauerlich, aber kein Anlass für quälende Frustrationen. Wenn man sich nämlich einmal im Mikrokosmos der französischen Weine zurechtgefunden hat, und dazu können auch die teuren Weine ihren theoretischen Beitrag leisten, dann wird man sehr schnell feststellen, dass es auch in verträglichen Preiskategorien ausgezeichnete Tropfen gibt, die es nur zu entdecken gilt. À votre santé!
Genug der Vorrede, der Friedhof wartet schon!
Prologue
Château d’Yquem1784
Er war hierher gekommen, um eine Todsünde zu begehen. Er freute sich nicht darauf, aber es musste sein. Der Vollmond und die sternenklare Nacht waren für sein Vorhaben geradezu ideal. Nur kurz hatte er die Inschrift auf dem großen Granitstein angeleuchtet, um sicherzustellen, dass er am richtigen Grab stand.
Sollte er wirklich? Nervös sah er sich um. Die Situation war gespenstisch und nichts für seine schwachen Nerven.
Der Friedhof lag im Mâconnais, vielleicht eine Autostunde südlich von Beaune. Kurz nach Mitternacht war er über die Mauer gestiegen. Er warf einen entschuldigenden Blick hinüber zur romanischen Basilika, in der er heute Nachmittag eine Kerze gestiftet und schon vorab um Absolution gebeten hatte. Von Cluny war die Kirche im 12. Jahrhundert erbaut worden, von jenem einst so mächtigen Kloster, das sogar dem Vatikan in Rom die Stirn geboten hatte, mit einer der größten Kathedralen der Christenheit, von der – nicht weit von hier – nur noch Ruinen übrig geblieben waren. Was währte schon ewiglich? Für einen kurzen Augenblick war ihm, als würde er aus der Basilika cluniazensische Chorgesänge hören. Aber die Mönche von Cluny, denen Burgund unter anderem auch den Aufschwung des Weinbaus verdankte, sie lagen längst unter der Erde. Genauso wie jener bemitleidenswerte Mann, der hier, direkt vor ihm, seine letzte Ruhestätte gefunden hatte. Erst vor wenigen Tagen war der Commandant beigesetzt worden. Commandant, unter diesem Namen war der schwerreiche Großindustrielle über Frankreichs Grenzen hinaus bekannt gewesen. Sein ganzes Geld hatte ihm nichts geholfen, die dritte Herzoperation hatte den Commandant unwiederbringlich ins Jenseits abberufen.
Während er die Handschuhe anzog, dachte er zum tausendsten Mal darüber nach, ob das wirklich stimmen konnte, was ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt worden war. Aber er kannte den ehemaligen Privatsekretär des Commandant schon lange. Sie waren gute Freunde, warum also sollte er sich so eine absurde Geschichte ausdenken? Zuzutrauen jedenfalls war es dem alten Herrn. Er war ein Weinsammler von großer Leidenschaft gewesen. Und seine Verkostungen, zu denen nur die wichtigsten Leute aus Wirtschaft und Finanzen geladen wurden, sie waren legendär. Die unglaublichsten Weinraritäten hatte er in seinem Château geöffnet, unbezahlbare Schätze aus vergangenen Jahrhunderten. Dazu ließ er regelmäßig ein komplettes Symphonieorchester aufspielen. Ein Leben wie Gott in Frankreich!
Es war bekannt, dass sich der Commandant vor allem bei einem ganz bestimmten Wein wie im siebten Himmel gewähnt hatte. Natürlich bei einem Château d’Yquem. Bei welchem Wein denn sonst? Bei jenem edelsüßen Mythos aus Sauternes, der Jahrhunderte überdauern und dabei eine unvergleichliche Aromenfülle entwickeln konnte. Ihm stieg der Duft von Pfirsich und Aprikose in die Nase, von Karamell, Honig und exotischen Gewürzen. Und dazu diese unvergleichliche tiefgründige Farbe, goldgelb, an Bernstein erinnernd.
Ja, diese Passion des verstorbenen Commandant konnte er bis in die letzten Nuancen nachvollziehen. Aber war es wirklich möglich, dass dieser verrückte alte Mann …? Warum nicht? Er hatte von einem japanischen Multimillionär und Kunstsammler gelesen, der auf seine letzte Reise ein berühmtes Gemälde von Vincent van Gogh mitgenommen hatte. Jedenfalls war es seit seinem Tod verschwunden, und es hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass die Leinwand im Sarg über seinem Leichnam vermodern würde.
Vielleicht hatte sich der Commandant von dieser Geschichte inspirieren lassen? Jedenfalls wusste er von seinem Freund, dem ehemaligen Privatsekretär und Vertrauten, dass seit dem Tod des Commandant aus dem Weinkeller sechs Flaschen Château d’Yquem fehlten. Sie hatten einen Ehrenplatz in einer kleinen Apsis gehabt und waren von ihm wie ein Heiligenbild verehrt worden. Aus dem Jahre 1784 stammten die Flaschen. Und sie trugen einen Schriftzug, eingraviert im Glas, der unter Weinkennern legendär ist: »Th. J.«.
Das Kürzel steht für Thomas Jefferson, den dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und Verfasser der Unabhängigkeitserklärung. 1784 war Thomas Jefferson noch der amerikanische Abgesandte in Frankreich gewesen. Und weil er den Sauternes so liebte, hatte Château d’Yquem für ihn eine Sonderabfüllung gemacht und mit seinen Insignien gekennzeichnet.
Unbezahlbar waren heute die noch wenigen Flaschen, die die Zeiten überdauert hatten. Falls es überhaupt noch welche gab. Was war seitdem alles passiert? Der Sturm auf die Bastille, die Französische Revolution, Robespierre, Napoléon, die Belle Époque, Flaubert, Zola, der Bau des Eiffelturms, Marcel Proust und die Suche nach der verlorenen Zeit …
Er gab sich einen Ruck, um seine Gedanken aufs Wesentliche zu konzentrieren. Er war nicht hier, um zu philosophieren. Jedenfalls war der Château d’Yquem auch nach dieser großen Zeitreise immer noch zu trinken. Wahrscheinlich jedenfalls. Und es war ein unverzeihlicher Frevel, ihn ins Jenseits mitnehmen zu wollen. Wenn es stimmte, ja, wenn es zutraf, was ihm sein alter Freund angedeutet hatte, dann befanden sich diese Schätze direkt vor ihm, etwa zwei Meter tief unter der Erde, in den über der Brust verschränkten Armen des Commandant. Ob er dabei einen seligen Gesichtsausdruck machte? Der Gedanke war makaber, und es graute ihm schon jetzt bei der Vorstellung, dem Leichnam die Flaschen wegzunehmen. Aber konnte er diesen Irrsinn zulassen? Als ob der Commandant auf den Jüngsten Tag mit einem Gläschen Château d’Yquem anstoßen wollte. Vielleicht hatte er zu diesem Zweck auch Glas und Korkenzieher im Sarg? Dieser Gedanke immerhin belustigte ihn. Aber er glaubte nun mal nicht an ein Leben nach dem Tod. Und der Wein von Thomas Jefferson wäre bei ihm definitiv besser aufgehoben als auf diesem Friedhof.
Er hätte mit dieser Aktion allzu gerne noch einige Wochen gewartet und sich mental besser vorbereitet, aber er hatte Sorge, dass der Wein Schaden nehmen könnte. Im Prinzip war die Lagerung ja nicht schlecht. Geschützt vor hellem Licht, keine Erschütterungen, eine gleichmäßige Temperatur, und auch die Luftfeuchtigkeit sollte in Ordnung gehen. Wäre da nur nicht dieser Leichnam. Er hatte keine Ahnung, wann die Verwesung einsetzte, aber er fürchtete, dass das relativ schnell passierte. Und wie sich das auf einen noch originalverkorkten Yquem auswirkte, daran wollte er besser nicht denken. Nein, es gab keine Alternative. Wenn es wirklich stimmte, dann musste er schnell handeln. Sehr schnell, noch heute Nacht, jetzt. Ein letztes Mal sah er sich um. Dann packte er den Spaten und machte sich an die Arbeit.
Première Partie
Millésimes morbidesTödliche Jahrgänge
1
Der Blick auf den brodelnden roten See erregte ihn. Jedes Jahr fieberte Jean-Yves diesen Tagen entgegen. Gab es etwas Schöneres, als diesem magischen Schöpfungsakt beizuwohnen? Er beobachtete das furiose Aufsteigen der Blasen, den wilden Tanz des weißen Schaumes, die kleinen stillen Oasen, die sich für Sekunden im Inferno bildeten, um dann vom Sturm hinweggefegt zu werden. So ähnlich stellte er sich die Entstehung der Erde vor und den Beginn allen Lebens. Jean-Yves schloss die Augen. Und dazu dieser überwältigende Geruch, diese ungehemmten, wilden Düfte. Kaum vorstellbar, dass sie sich zähmen ließen und zu unendlicher Verfeinerung fähig waren. Irgendwo waren sie verborgen in dieser olfaktorischen Wucht, die bittersüßen Aromen von Waldbeeren, von schwarzer Kirsche, der Hauch von Nelken und Wacholder.
Jean-Yves lag bäuchlings auf dem großen Holzbottich. Er hatte eine Lampe in den Foudre gehängt und starrte fasziniert auf die gärende Maische. Gut vierzehn Tage würde er den Syrah auf ihr belassen, diese Zeit brauchte der Rebensaft, um die Farbstoffe und Tannine aus der Traubenschale zu extrahieren. Erst wenn er die ganze Kraft aufgenommen hatte, die er für ein vielversprechendes Leben brauchte, würde er den Wein von der Maische abziehen. Er freute sich schon auf die spätere Vermählung mit dem Mourvèdre, der im kleineren Nachbarfass vor sich hin gärte. Die Assemblage der beiden Rebsorten würde seinem Wein schließlich die Seele einhauchen. Und dann begann die Phase der Ruhe, der Reife. Ein bis zwei Jahre würde er dem Wein in Barriquefässern aus französischer Eiche gönnen. Ganz langsam würde er die feinen Aromen von Vanille einatmen, in seinen Lungen speichern – um sie irgendwann einmal, bei hoffentlich passender Gelegenheit, im Glas wieder freizusetzen.
Mit einer Hand langte Jean-Yves hinter sich und tastete nach der Stange, die er an die Leiter gelehnt hatte. Er war nicht nur zur Ergötzung auf den hölzernen Gärbottich geklettert. Die alkoholische Gärung riss die Traubenschalen an die Oberfläche, wo sie sich zum Tresterhut verfestigten. Um ein Austrocknen zu verhindern, mussten die Schalen regelmäßig in den gärenden Most zurückgedrückt werden.
Jean-Yves führte die Holzstange, die an der Spitze drei Zacken hatte, durch die Öffnung und begann mit ihr in die Maische zu stoßen. Der Foudre war nur zur Hälfte gefüllt, und so musste er sich mit dem Kopf voran bis zur Hüfte in den Gärbottich beugen, um mit der Stange den Trester zu erreichen. Für den nötigen Halt sorgten seine Füße, die er in der Leiter verkeilt hatte. Er wusste, dass er vorsichtig sein musste. Immer wieder gab es tödliche Unfälle, die auf das Kohlendioxid zurückzuführen waren, das bei der alkoholischen Gärung in großer Menge freigesetzt wurde. Das giftige Gas hatte die unangenehme Eigenschaft, schwerer als Luft zu sein. Darüber hinaus war das CO2 gemeinerweise völlig geruchlos. Man erstickte sozusagen, ohne es zu merken. Erst im letzten Jahr war ein guter Freund von ihm in der Nähe von Les Baux-de-Provence, also nur wenige Dörfer von hier entfernt, auf dem Boden seines Weinkellers tot aufgefunden worden. Jean-Yves hatte deshalb die Türen und Fenster zu diesem Raum weit geöffnet und vorher mit einer Kerze die Konzentration des Kohlendioxids im Gärbottich geprüft. Im oberen Bereich, also dort, wo er sich jetzt mit seinem Kopf befand, war die Luft noch rein, die Kerze hatte munter weitergebrannt.
Er war mit seiner Arbeit fast fertig und mit den Gedanken schon bei einem Pastis in seiner Lieblingsbar von Saint-Rémy, als er plötzlich merkte, wie er an den Füßen gepackt wurde.
»Ce n’est pas drôle«, rief er erschrocken, »das ist überhaupt nicht witzig!«
Jean-Yves versuchte sich aus dem Holzbottich zu winden. Der Schrecken steigerte sich zur Panik. Die Stange war ihm bereits entglitten und im brodelnden Sud versunken. Jetzt wurden seine Beine nach oben gerissen. Kopfüber und völlig hilflos hing er im Gärbottich, mit den Händen nur noch wenige Zentimeter von der Maische entfernt. Er spürte, wie ihm die Gärwärme ins Gesicht stieg. Es war ihm klar, dass er jetzt fast reines Kohlendioxid einatmete. Wie lange würde es dauern, bis er ohnmächtig wurde? Zwanzig Sekunden, eine Minute? Und wer verdammt noch mal hatte ihn an den Füßen gepackt?
»Arrête, maintenant, Schluss jetzt, zieh mich raus!«, schrie Jean-Yves. Er sah sich schon leblos in der Maische treiben. Neben seinem toten Kopf stiegen weiße Blasen auf, um ihn herum bildete sich ein immer festerer Tresterhut. Kurioserweise dachte er dabei weniger an sich als an den wunderbaren Syrah. Noch nie hatte er einen so vielversprechenden Jahrgang eingebracht. Der Sommer war sonnig und trocken gewesen, aber ohne diese Gluthitze, die selbst dem Syrah zu viel werden konnte. Ende August hatte er die Reben zurückgeschnitten. Nach dieser Vendange verte, der grünen Lese, hatte sich die ganze Kraft in den verbliebenen Trauben konzentriert. Und jetzt, wo sich gerade die wunderbare Verwandlung des Mosts in einen köstlichen Wein vollzog, da wurde alles in Frage gestellt. Wer sollte die Vinifizierung zu Ende bringen, wenn er hier in diesem Foudre zu Tode kam? Obwohl, mit einer Leiche in der Maische war der Wein vielleicht nicht mehr ganz so vielversprechend, streng genommen wohl kaum mehr …
Was sind das für abwegige Gedanken?, schoss es ihm durch den Kopf. Hatte ihm das Kohlendioxid bereits so zugesetzt? Immerhin ging es hier um sein Leben. Und den Wein, den machte er sowieso nur zu seinem privaten Vergnügen, für sich und für seine besten Freunde.
»Sors moi d’ici!«, schrie er.
Wie durch Watte hörte er von oben eine dumpfe Stimme. »Das hättest du dir vorher überlegen müssen!«
»Pourquoi, was heißt vorher überlegen? Was habe ich gemacht?«, fragte er kurzatmig.
»Mein Chef war mit deiner letzten Weinlieferung nicht einverstanden, überhaupt nicht einverstanden!«
Fast hätte Jean-Yves gelacht. Irgendwie fühlte er sich plötzlich euphorisch. Ob das am Kohlendioxid lag oder an diesem lächerlichen Vorwurf? Was sollte das eigentlich heißen? Mit der letzten Weinlieferung nicht einverstanden? Weine zu liefern war nun mal seine Profession. Er hatte sich auf die wirklich großen Franzosen spezialisiert und auf sündteure Raritäten, bei denen Weinkenner einen erhöhten Puls bekamen. Was war schon sein Syrah dagegen? Eine önologische Bagatelle, die ihm allerdings die Freude vermittelte, einen eigenen Wein zu verkorken. Mit der letzten Weinlieferung nicht einverstanden? Jean-Yves kicherte. Hatte der 1991er Romanée-Conti vielleicht Kork? Oder hatte der 1959er Château d’Yquem den hoch gesteckten Erwartungen nicht ganz entsprochen?
»Je ne te comprends pas, zieh mich raus, ich ersticke!« Jean-Yves merkte, dass er nur noch ein Flüstern zustande brachte. Im Kopf pochte es, gleichzeitig würgte es ihm in der Kehle.
Er hörte, wie eine 1947er Magnumflasche Pétrus erwähnt wurde. Aber so ganz sicher war er sich nicht, vielleicht war auch der großartige 45er gemeint.
Während ihm die Sinne schwanden, spürte er, wie er losgelassen wurde. Mit dem Kopf voran stürzte Jean-Yves in die brodelnde Maische.
Adieu, war sein letzter Gedanke. Adieu, mein schönes Leben, adieu, mes amis, adieu, Provence, und adieu, Syrah!
2
Der Gastgeber hatte eine CD mit klassischer Musik aufgelegt, auf dem langen Holztisch brannten einige Kerzen, es standen Schalen mit frisch aufgeschnittener Baguette und mit etwas Käse bereit. Am Kopfende war ein Dutzend Weinflaschen streng in Reihe aufgestellt, wobei die letzte von einer großen Stoffserviette verhüllt wurde. Dahinter wartete eine ansehnliche Batterie von blank polierten Rotweingläsern auf ihren Einsatz. Zufrieden rieb sich Dr. Praunsberg die Hände. Seine kleine Einladung zur Degustation würde ein voller Erfolg werden, davon war er überzeugt. Die ausgewählten Tropfen versprachen jedenfalls ein besonderes Erlebnis. Als Chevalier einer elitären Weinbruderschaft war er seinen Gästen ja auch einiges schuldig. Es war üblich, dass sich die Chevaliers des Grands Crus gegenseitig zu Verkostungen im privaten Rahmen einluden. Ganz unprätentiös und entspannt, ohne den Aufwand, den sie bei ihren offiziellen Veranstaltungen trieben. Heute war wieder mal er an der Reihe. Wobei sich das Datum eher zufällig ergeben hatte. Einige der Chevaliers hatten an diesem Tag geschäftlich in Frankfurt zu tun gehabt, da konnten sie leicht einen Abend anhängen und nach Bad Homburg kommen, wo Praunsberg oberhalb des Spielkasinos und der Thermen eine noble Villa bewohnte. Das war das Besondere bei ihrer Weinbruderschaft, nämlich dass die Chevaliers aus den verschiedensten Städten, ja sogar aus dem Ausland kamen. Aber da alle beruflich sehr erfolgreich und ohnedies viel unterwegs waren, stellte das kein Problem dar.
Praunsberg schätzte die Zusammenkünfte der miteinander gut befreundeten Chevaliers nicht zuletzt deshalb, weil sie sozusagen als willkommene Begleiterscheinung zum Weingenuss auch der Pflege ihrer geschäftlichen Kontakte dienten. Zwar hatten sie ganz unterschiedliche Professionen, Dr. Ferdinand Praunsberg war in einer leitenden Position bei einem bedeutenden pharmazeutischen Unternehmen tätig, aber es gab immer wieder Berührungspunkte, die zu höchst aufschlussreichen Gesprächen führten, man wurde unter dem Siegel der Verschwiegenheit mit Insider-Wissen versorgt und bekam den einen oder anderen wichtigen Kontakt oder sogar Auftrag vermittelt. Doch das Entscheidende war natürlich ihre gemeinsame Leidenschaft, ihre Liebe zu den großen Weinen Frankreichs, zu den Spitzengewächsen, den Grands Crus.
Praunsberg bereitete es ein großes Vergnügen, bei diesen Degustationen nicht nur mit seinem eindrucksvollen Weinkeller zu renommieren, es war ihm auch wichtig, seinen Ruf als Connaisseur zu pflegen und mit seinen Weinkenntnissen zu brillieren. Wären nur Chevaliers anwesend, hätte diese Selbstdarstellung wenig Sinn gemacht oder hätte subtiler ausfallen müssen, aber vielleicht gerade deshalb gehörte es zum Ritual, immer einige Gäste einzuladen. Und bei jenen hatte man ja sozusagen eine moralische Verpflichtung, etwas Nachhilfe in Weinkultur zu geben. Schließlich war es immer wieder erstaunlich, wie wenig selbst kultivierte Menschen letztlich über Wein wussten.
Bereits eingetroffen waren in der Villa in Bad Homburg Prof. Dr. med. Peter Losotzky, Dr. jur. Heribert Quester und Joseph Niebauer. Alle drei erfreuten sich beträchtlichen Wohlstands und gehörten seit Jahren den Chevaliers an.
Prof. Losotzky war Schönheitschirurg, er hatte eine Privatklinik am Zürichsee und viele zahlungskräftige Patienten aus Prominentenkreisen, vornehmlich weiblichen Geschlechts. Ein internationaler Ärztekongress hatte ihn für zwei Tage nach Bad Soden geführt.
Dr. Quester war ein Notar aus München, ein Beruf, der in Bayern einer Lizenz zum Gelddrucken gleichkam. Dr. Quester hatte morgen einen Termin bei einer Großbank in der Frankfurter City und war schon am Abend vorher angereist.
Joseph Niebauer hatte seinen Hauptwohnsitz in Köln. Er war als Bauträger zu einem großen Vermögen gekommen. Vor einiger Zeit hatte er sich ein kleines Château in Bordeaux gekauft und setzte große Hoffnung auf seinen eigenen Médoc. Niebauer war einfach so gekommen. Vor dem Haus wartete sein Chauffeur, der ihn später zurück nach Köln bringen würde.
»Halt, meine Herren, bitte nicht anlangen!«, protestierte Dr. Praunsberg, als er sah, wie der Schönheitschirurg und der Notar das Geheimnis der letzten Flasche lüften wollten. »Ihr bringt euch ja sonst um das besondere Vergnügen der finalen Blindverkostung. Wäre doch schade.«
Die beiden zuckten zurück und grinsten verlegen wie Schulbuben, die beim Spicken ertappt worden sind. Sehr zu ihrer Freude ging in diesem Moment die Tür auf, und Valerie kam herein, die überaus ansehenswerte Tochter von Praunsberg. Valerie stellte zwei leere Karaffen auf den Tisch und begrüßte die Gäste. Prof. Losotzky gab der schwarzhaarigen Webdesignerin einen Handkuss und äußerte gut gelaunt, dass sich bei ihr leider immer noch jegliche Schönheitsoperation verbiete, was nicht nur auf ihr jugendliches Alter zurückzuführen sei. Gott sei Dank, stellte er fest, gebe es auch weniger perfekte Geschöpfe auf dieser Welt.
»Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen«, sagte Praunsberg lachend, »meine Tochter wird uns gleich wieder verlassen, schließlich habe ich Ihnen eine Herrenrunde versprochen. Meine Frau Béatrice hat deshalb schon die Flucht ergriffen und ist zu einer Freundin gefahren.«
Während sich Valerie noch mit dem Schönheitschirurgen unterhielt, traf Pierre Allouard ein, ein Franzose, der gerade den Karrieresprung in den Vorstand eines Pariser Elektrokonzerns geschafft hatte. Das Unternehmen hatte seine Deutschlandniederlassung in Frankfurt, und da war es Allouard nach der Einladung von Praunsberg leicht gefallen, hier schnell einen Termin anzuberaumen. Auch Allouard gehörte den Chevaliers an. Er hatte ein Ferienhaus an der Loire und stellte regelmäßig die Kontakte zu Weinbruderschaften in Frankreich her. Er sprach nicht nur ausgezeichnet Deutsch, er war auch mit einer Deutschen verheiratet.
Als Nächstes begrüßte Praunsberg Thilo Thoelgen, der gerade zufällig in Deutschland war. Eigentlich wohnte er bei Ramatuelle an der Côte d’Azur, wo er sich vor einigen Jahren eine Villa gekauft hatte. Thilo Thoelgen war einer jener Dotcom-Gründer, die in Zeiten der Internet-Bonanza fast über Nacht zu Millionären geworden waren. Als die Seifenblase dann platzte, da hatte es auch ihn erwischt, sein Unternehmen musste die Insolvenz beantragen. Irgendwie war es ihm aber gelungen, noch rechtzeitig Geld rauszuziehen, sodass er sich heute sehr komfortabel dem süßen Nichtstun widmen konnte. Auch Thilo Thoelgen war seit Jahren ein engagiertes Mitglied der Chevaliers – und zudem ein heimlicher Verehrer von Valerie. Entsprechend herzlich fiel seine Umarmung aus.
Kurz nach Thoelgen traf Dieter Schmid ein, einer der beiden geladenen Gäste. Schmid war Inhaber einer Werbeagentur in Düsseldorf und hatte seine Liebe zum Wein erst vor kurzem entdeckt. Praunsberg sah es als seine ehrenvolle Pflicht an, ihm die nötigen Grundkenntnisse zu vermitteln. Schmid hatte eine Präsentation nach Frankfurt geführt, und weil er sie für seine Agentur gewonnen hatte, machte ihm die Einladung besonderen Spaß.
Der Gastgeber sah auf die Uhr. »Fehlt nur noch Karl Talhammer, dann wären wir komplett. Ach ja, Karl bringt noch einen Freund mit, den Namen habe ich vergessen.«
Karl Talhammer war in der Geschäftsleitung einer großen Frankfurter Versicherung. Er gehörte erst seit kurzem den Chevaliers des Grands Crus an. Praunsberg hielt es sich zugute, seinen alten Kumpel dazu gebracht zu haben, den italienischen Weinen zugunsten der Franzosen abzuschwören.
Praunsberg ging zu den Flaschen, die er bereits vor einiger Zeit entkorkt hatte, nahm eine und begann sie vorsichtig über einer Kerze in eine Dekantierkaraffe umzufüllen.
»Ich mache das weniger wegen des Depots«, erläuterte Praunsberg an die Adresse des Novizen Schmid, »wir haben hier einen relativ jungen Pauillac, der wohl noch keine Sedimente am Flaschenboden gebildet hat.«
»Macht nichts«, kommentierte Schmid, »mir gefällt dieses Zeremoniell, es steigert die Vorfreude.«
»Das ist keine Show. Der Cabernet Sauvignon ist sehr tanninbetont«, fuhr Praunsberg belehrend fort, »er braucht etwas Sauerstoff, damit er geschmeidiger wird und sich die unterdrückten Aromen gegen die Gerbsäure durchsetzen und entfalten können.« Praunsberg stellte die leere Flasche ab. »In einer halben bis einer Stunde ist er so weit. Bei einem alten Wein dürften wir übrigens nicht so lange warten. Der muss unmittelbar nach dem Dekantieren getrunken werden, weil er beim plötzlichen Luftkontakt schnell in sich zusammenbrechen kann. Ist mir erst vor kurzem bei einem fünfzig Jahre alten Château Margaux passiert.« Praunsberg machte eine kurze Pause. »Man stelle sich vor, der Wein hat ein halbes Jahrhundert in der Flasche seiner Vollendung entgegengedämmert, und dann, nach wenigen Minuten, die allerdings einen großartigen Genuss vermittelten, hat er sein Leben ausgehaucht und ist oxidiert.«
»Wie die älteren Damen, die sich bei dir unters Messer legen«, unkte der Notar an die Adresse des Schönheitschirurgen, »sie sind auch ziemlich oxidiert und verwittert.«
»Deshalb sollte man sie nach Möglichkeit in jüngeren Jahren verkosten«, griff Prof. Losotzky die Bemerkung auf.
»Jedenfalls gelangen die meisten Frauen früher zur Reife als ein Spitzengewächs aus dem Médoc«, bestätigte Praunsberg. Und mit einem Blick zu seiner Tochter: »Entschuldige, meine Liebe, du siehst, wir kommen bereits auf das schlüpfrige Niveau einer Herrenrunde. Ich möchte dich nicht wegschicken, aber …«
Es klopfte, und die beiden letzten Gäste trafen ein. Valerie, die der Aufforderung ihres Vaters gerade folgen und gehen wollte, zögerte – und beschloss zu bleiben. Was nicht an Karl Talhammer lag, den alten Freund ihres Vaters kannte sie schon ewig. Nein, der Mann in seiner Begleitung fand ihr Interesse. Er war deutlich jünger als die anderen, vielleicht Ende dreißig, groß gewachsen, mit langen Haaren, die er im Nacken zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Er hatte eine runde Nickelbrille auf, trug im Unterschied zu den anderen Gästen weder Anzug noch Krawatte, sondern Jeans und Lederjacke.
»Hallo, mein Lieber!«, rief Talhammer zur Begrüßung und umarmte Valeries Vater. »Wie versprochen, habe ich dir einen weiteren Gast mitgebracht.« Talhammer deutete auf den Mann hinter ihm. »Ich darf vorstellen: Hippolyt Hermanus. Wir haben heute ein geschäftliches Projekt zum Abschluss gebracht, und da dachte ich, es ist eine gute Idee, dies bei einigen Flaschen Wein zu feiern …« Talhammer lachte und schlug Praunsberg auf die Schulter. »Speziell wenn diese nicht von mir bezahlt werden müssen.«
»Sehr geschickt, jetzt weiß ich, wie deine Versicherung die Kosten senkt. Jedenfalls sind Sie bei mir herzlich willkommen, Herr Hermanus. Karl sagte soeben, dass Sie ein geschäftliches Projekt zum Abschluss gebracht haben, darf ich fragen, was Sie machen?«
»Eigentlich ist Hippolyt Diplompsychologe«, übernahm Talhammer die Antwort. »Er war viele Jahre bei der Polizei.«
Ein Psychologe und Expolizist?, dachte Valerie. Dieser Hippolyt fiel wirklich aus dem Rahmen der üblichen Gäste ihres Vaters.
»Bei der Polizei? Wie ungewöhnlich. Was haben Sie dort gemacht?«, wollte Niebauer wissen.
»Ich war Polizeipsychologe, habe Täterprofile erstellt …«, antwortete Hippolyt Hermanus zurückhaltend.
»Und auch verdeckt ermittelt, und zwar außergewöhnlich erfolgreich«, fiel ihm Talhammer ins Wort. »Ich weiß, das erzählst du nicht gern. Jedenfalls arbeitet Hipp jetzt freischaffend unter anderem für große Versicherungen, wie wir eine sind. Dank Hipp haben wir heute einen raffinierten Versicherungsbetrug aufgedeckt und den Täter überführt. Hipp hat nämlich ein Spezialgebiet …«
»Ihr Spezialgebiet ist bestimmt sehr interessant«, unterbrach Praunsberg den Redefluss seines Freundes, »aber die Flaschen sind bereits entkorkt, und deshalb schlage ich vor, dass wir uns dem eigentlichen Thema des Abends zuwenden. Herr Hermanus, verstehen Sie etwas von Wein?«
»Also, das Spezialgebiet von Herrn Hermanus ist …«, versuchte Talhammer seinen Satz noch zu Ende zu bringen, verstummte dann aber, weil es Ferdinand Praunsberg wirklich nicht zu interessieren schien.
»Ob ich was von Wein verstehe? Nun, es geht so«, antwortete Hippolyt Hermanus auf Praunsbergs Frage. Dieser hatte sich seine Meinung über den Gast längst gebildet. So ganz behagte es ihm nicht, dass Karl Talhammer jemanden mitbrachte, der zwar sympathisch wirkte, aber so überhaupt nicht in diesen Kreis passen wollte. Ein verkrachter, schlecht angezogener Psychologe, der bei der Polizei rausgeflogen ist und sich jetzt mit kleinen Jobs für Versicherungen durchschlägt. Warum war eigentlich Valerie noch hier? Die wollte doch schon längst gehen.
»Valerie, meine Liebe, ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber die Herrenrunde ist komplett und Damengesellschaft nicht vorgesehen. Außerdem beeinträchtigt dein Parfüm unser hoch entwickeltes Geschmacks- und Geruchsempfinden.«
»Erstens, mein Sugar-Daddy, bin ich überhaupt nicht parfümiert, was deinem Geruchssensorium wohl entgangen ist.« Valerie sah kurz hinüber zu Hipp, zog einen Stuhl heran und setzte sich. »Und zweitens gedenke ich zu bleiben. Ich hoffe, du hast nicht ernsthaft was dagegen, wenn sich deine Tochter fortbilden will. Ich bin auch ganz brav und halte mich zurück.«
»Also, du willst uns wirklich Gesellschaft leisten?« Praunsberg schaute zweifelnd. »Ich glaube nicht, dass …«
»Warum denn nicht, alter Freund«, mischte sich der Schönheitschirurg ein. »Wir haben doch nichts zu verbergen. Heribert muss sich halt seine schmutzigen Witze verkneifen. Und wann leistet uns alten Knackern schon mal eine so schöne junge Frau wie Valerie freiwillig Gesellschaft?«
Wieder warf Valerie einen verstohlenen Blick zu Hipp. Täuschte sie sich oder entdeckte sie da ein amüsiertes Lächeln in seinem Gesicht?
Praunsberg klatschte in die Hände. »Nun gut, überredet. Wir müssen auch endlich anfangen. Meine Herren, meine Dame, bitte nehmen Sie Platz, zieht die Jacken aus, lockert die Krawatten, macht es euch bequem.« Er sah verzückt auf seine Flaschen. »Ich schlage vor, wir beginnen mit einem Burgunder, ein klassischer Pinot Noir aus der Appellation Gevrey-Chambertin, genauer gesagt ein Grand Cru aus der Lage Clos de Bèze. Er hat zwölf Jahre Reifezeit hinter sich und sollte uns vortrefflich auf den Abend einstimmen. Wobei ich unseren beiden Gästen sagen muss, dass wir damit schon zum Auftakt die Messlatte ziemlich hoch legen. Nicht von ungefähr war der Chambertin der Lieblingswein von Napoléon Bonaparte …«
Valerie hörte ihrem Vater nur mit halbem Ohr zu. Sie sah, wie er etwas Wein erst in ein Glas goss, dieses schwenkte, dann den Wein nacheinander in die weiteren Gläser der Runde füllte. Er nannte diese Prozedur »Vinieren« und sprach davon, dass die Gläser auf den Wein eingestimmt werden mussten. Erst nach diesem andächtigen Vorspiel kam er zum eigentlichen Eingießen des Chambertin, was er mit großer Konzentration tat. Dann neigte er sein Glas leicht nach vorne, sodass er über der weißen Tischdecke die Farbe beurteilen konnte. Alle in der Runde folgten seinem Beispiel, auch Valerie. Alle? Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Hipp leise lächelnd die Rituale der Verkoster beobachtete, selbst aber das Glas noch gar nicht in die Hand genommen hatte.
»Und jetzt die Geruchswahrnehmung. Zunächst sollten wir die Duftstoffe aus dem ungeschwenkten Glas …«
Ferdinand Praunsberg lief bereits beim ersten Wein der Degustation zur Höchstform auf. Er merkte, dass ihm Schmid fasziniert folgte, nur dieser Hipp Hermanus war etwas zögerlich, aber das war bei blutigen Anfängern oft zu beobachten. Praunsberg fragte in die Runde, vor allem an die Adresse seiner routinierten Chevaliers, welche Duftnoten wahrgenommen wurden. Sofort entspann sich eine heftige Diskussion um Kirscharomen und Pflaumen. Dann wurden die Gläser heftig geschwenkt und die Nasen tief hineingesteckt. Valerie konnte sich dem Schnuppertest nicht entziehen und identifizierte sehr zum Wohlgefallen ihres Vaters zarte Himbeernoten. Schließlich wurde der Wein probiert. Valerie fiel erneut auf, dass Hipp nur sehr zurückhaltend und wohl eher aus Höflichkeit mitmachte. Kein Zweifel, der Typ gefiel ihr, aber zum Weinkenner schien er nicht geboren. Vielleicht hätte er lieber ein frisch gezapftes Pils getrunken. Allerdings kam auch ihr das ganze Brimborium etwas übertrieben vor. Wobei sie zugeben musste, dass auf diese Weise der Wein sehr viel intensiver wahrgenommen wurde. Ihr Vater philosophierte noch über die Bedeutung eines langen Abgangs, als er bereits die nächste Flasche und frische Gläser für die Verkostung vorbereitete.
Während Thilo Thoelgen aufstand und sich für einen kurzen Augenblick entschuldigte, erklärte Praunsberg, dass der neue Wein von seinem Schwager Jean-Yves Peyraque sei. Nach dem Gevrey-Chambertin würde er es natürlich schwer haben, fairerweise hätte er ihn zum Auftakt kredenzen sollen, gab er zu. Aber der Bruder seiner französischen Frau Béatrice, übrigens auch ein Mitglied ihrer Weinbruderschaft, erklärte er den beiden Gästen, sei nicht nur ein exzellenter Weinhändler, sondern produziere zudem auf seinem kleinen Landgut in der Provence einen vorzüglichen Syrah. Nur wenige Flaschen und exklusiv für seine Familie und die engsten Freunde. Eigentlich ein einfacher Wein, aber mit all den Charakteristika eines Syrah …
Valerie fiel auf, dass Hipp diesem Wein etwas mehr Aufmerksamkeit schenkte. Nach kurzem Schnuppern sparte er sich das kollektive Rumgeschwenke und Fachsimpeln, lehnte sich stattdessen zurück und trank den Wein entspannt aus. Also doch kein Pilstrinker? Oder ein Ignorant, der den vergleichsweise einfachen Wein ihres Onkels den großen Gewächsen vorzog.
Nach der Provence machte ihr Vater einen Ausflug ins Rhône-Tal, genauer gesagt zu einem Châteauneuf-du-Pape. Mit dem nächsten Wein ging es endlich ins Bordelais, der bevorzugten Weinregion von Ferdinand Praunsberg. Zuerst nach Saint-Émilion, dann würde Pomerol an die Reihe kommen und schließlich das Haut-Médoc mit dem bereits dekantierten Pauillac.
Valerie sah, wie Thilo Thoelgen zurückkam, sie überlegte noch kurz, wo er wohl so lange gewesen war, dann blickte sie wieder hinüber zu Hipp. Valerie bedauerte, dass sie so weit von ihm entfernt saß, so hatte sie keine Chance, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Überhaupt schien dieser Mann nicht besonders redselig zu sein – ganz im Unterschied zu allen anderen, die mit jeder weiteren Flasche immer ausgelassener wurden, mit großer Begeisterung die Weine diskutierten und wortreich die Vorträge ihres Gastgebers kommentierten.
Gegen elf Uhr meldete sich Hipp zu Wort, um sich bei Praunsberg zu entschuldigen, er habe leider noch eine Verabredung und müsse bald aufbrechen. Aber der Blindverkostung würde er doch noch beiwohnen wollen, erwiderte Praunsberg. Diesen krönenden Abschluss dürfe er sich keinesfalls entgehen lassen. Nach kurzem Zögern nickte Hipp zustimmend.
Feierlich stellte Praunsberg die Gläser bereit und vollzog mit besonderer Inbrunst das bekannte Zeremoniell. Dabei achtete er sorgfältig darauf, dass die Flasche immer verhüllt blieb. Schließlich kam der ersehnte Augenblick. Die granatrote Farbe des Weines wurde begutachtet, die Aromen identifiziert, schließlich probiert. Praunsberg genoss es sichtlich, die Spekulationen der Chevaliers zu hören. Dass es sich auch um einen ausgereiften Wein aus dem Bordelais handeln müsse, da waren sich die Experten sofort einig. Wegen des charakteristischen Aromas von schwarzen Johannisbeeren wohl um einen Cabernet Sauvignon. Auffällig auch die Tabaknoten, die Anklänge von Zedernholz und das seidige Gefühl auf der Zunge. Viel weiter kamen sie allerdings nicht. Prof. Losotzky, Dr. Quester und Allouard warfen die Namen einiger berühmter Châteaux in den Raum, lagen aber zur Freude von Praunsberg daneben. Einzig Hipp beteiligte sich nicht an der Diskussion. Valerie sah, wie er aufstand. Er sagte, dass ihm dieser Wein sehr gut schmecke, ein großes Kompliment an den Gastgeber und herzlichen Dank für diesen gelungenen und überaus generösen Abend. Aber er müsse jetzt wirklich gehen, es tue ihm ausgesprochen Leid …
»Noch eine Minute!«, hielt Praunsberg ihn auf. »Wollen Sie denn gar nicht wissen, was Sie eben probiert haben? Und überhaupt, Sie haben sich zu den Weinen den ganzen Abend kaum geäußert. Ich bin Ihnen da nicht böse, wirklich nicht. Aber jetzt sagen Sie mir doch wenigstens, welche Weine Ihnen am besten geschmeckt haben und warum. Dann verrate ich Ihnen, was sich hinter der Blindverkostung verbirgt, und Sie dürfen gehen. Einverstanden?«
»Nein, herzlichen Dank, bringen Sie mich nicht in Verlegenheit«, wehrte Hipp ab. »Noch einmal tausend Dank, auch für Ihre ebenso unterhaltsamen wie informativen Erläuterungen, die Ihrem Rang als Chevalier alle Ehre machen, aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte.«
»Kommt nicht in Frage, ich bestehe darauf«, insistierte Praunsberg, was Valerie nicht weiter wunderte. So kannte sie ihren Vater. Hipp würde nicht ungeschoren davonkommen. Sie war neugierig, wie er sich aus der Affäre ziehen würde.
Hipp schüttelte den Kopf, sah dann fragend zu Talhammer, der ihn schließlich mitgebracht hatte. Aus unerfindlichen Gründen grinste dieser.
»Also, wenn Sie so nachdrücklich darauf bestehen, kann ich wohl nicht anders«, sagte Hipp, während er bereits die Jacke anzog. »Am besten geschmeckt hat mir der Wein Ihres Schwagers aus der Provence, ein zugegeben einfacher, aber sehr ausgewogener Tropfen. Meiner bescheidenen Meinung nach übrigens kein sortenreiner Syrah, sondern eine überaus gelungene Assemblage mit Mourvèdre, erkenntlich am dezenten Brombeeraroma, und etwa zwölf Monate in Barrique ausgebaut, deshalb diese schönen Vanilletöne. Den Gevrey-Chambertin …« Hipp machte ein kurze Pause. Valerie hatte ihren Vater noch nie so verdutzt dreinblicken sehen. »… habe ich auch als sehr angenehm empfunden, ein wunderbarer Grand Cru. Sie verzeihen mir, wenn ich sage, dass ich ihm noch ein oder zwei Jahre Pause zugebilligt hätte, vielleicht hätten sich die leichten Gewürznoten noch feiner entwickelt, aber das kann man ja vorher nie so genau wissen.«
Valerie hing fasziniert an Hipps Lippen. Sie hatte es geahnt. Schon beim Eintreten war ihr aufgefallen, dass dies ein ungewöhnlicher Mann war, voller Geheimnisse und besonderer Fähigkeiten. Dass sich diese Einschätzung so schnell bestätigen würde, hatte sie freilich nicht erwartet.
Hipp deutete auf den Tisch: »Der Châteauneuf-du-Pape, wirklich ausgezeichnet, mit Château Rayas haben Sie eine glänzende Wahl getroffen, meiner Meinung nach wirklich eines der besten Güter der Appellation und vorbildlich in der verpflichtenden Leidenschaft für die Rebsorte Grenache. Die nächsten Weine darf ich überspringen, ich muss gehen. Nochmals herzlichen Dank. Ach so, ja, die Blindverkostung. Ich muss wirklich sagen, Sie haben sich hier von Ihrer großzügigsten Seite gezeigt. Ich denke, es handelt sich um einen Cabernet Sauvignon, mit Anteilen von Merlot und Cabernet Franc. Vermutlich ein Premier Cru Classé de Graves, ein Haut-Brion. Ich könnte mir vorstellen, dass er aus dem herausragenden Jahrgang 1961 stammt. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich darf Ihnen in den nächsten Tagen eine Bouteille als Zeichen meiner Dankbarkeit zukommen lassen. Meine Herren, Fräulein Praunsberg, ich habe die Ehre, auf Wiedersehen.«
Rückwärts gehend hatte Hipp die Tür erreicht, er winkte noch kurz und verschwand. Valerie, die im Hinausgehen einen Blick von ihm aufgeschnappt hatte, sprang auf und eilte Hipp nach. Irgendjemand musste ihn doch aus dem Haus begleiten. Und außerdem wollte sie sich persönlich von ihm verabschieden.
Nachdem hinter ihr die Tür zugefallen war, herrschte im Raum zunächst große Stille. Langsam nahm Praunsberg die Flasche von der Blindverkostung, zog bedächtig die Stoffserviette ab und hob sie so in die Höhe, dass sie jeder sehen konnte.
»Es stimmt, ein Haut-Brion, auch der Jahrgang 1961, einfach unglaublich.«
Praunsberg stellte die Flasche wieder ab und wendete sich an seinen Freund Karl, der Hipp mitgebracht hatte. »Ich denke, du bist uns eine Erklärung schuldig!«
Karl Talhammer hob grinsend und in gespielter Verzweiflung die Hände in die Höhe. »Weil du mich nie ausreden lässt. Du bist selbst schuld. Ich wollte dir doch zu Beginn unbedingt erzählen, dass Hipp Hermanus ein Spezialgebiet hat. Aber du wolltest nichts davon wissen …«
»Du hast gesagt, er ist Psychologe, war bei der Polizei und arbeitet jetzt als privater Ermittler.«
»Siehst du, du unterbrichst mich schon wieder«, entgegnete Talhammer. »Er arbeitet als privater Ermittler, das ist richtig, aber fast ausschließlich auf seinem Spezialgebiet, und das sind nun mal die Weine.«
»Was gibt es da zu ermitteln? Etwa die Rebsorte und den Jahrgang?«, fragte Schmid.
»Nein, rund um den Wein, vor allem bei den teuren Flaschen und den so genannten Raritäten gibt es viel Betrügereien«, erklärte Karl Talhammer. »Erst heute haben wir mit Hilfe von Hipp Hermanus einen geschickt angelegten Versicherungsbetrug eines Privatsammlers aufgedeckt, der uns über eine Million Euro gekostet hätte. Vorige Woche sind bei einer Auktion in London einige Flaschen Château d’Yquem aus dem 19. Jahrhundert unter den Hammer gekommen. Hipp ist sich sicher, dass sie aus einem schon länger zurückliegenden Einbruch in England stammen und dass die Dokumente über ihre Herkunft manipuliert sind. Und dann gibt es noch all diese Fälschungen, sündteure Flaschen, in denen alles Mögliche ist, aber nur nicht der Wein, der auf den Etiketten steht.«
»So etwas gibt es?« Schmid schaute entsetzt.
»Ja, leider«, erklärte Praunsberg, »diese Raritäten werden gehandelt, versteigert, unter der Hand verkauft …«
»… und versichert«, fuhr Talhammer fort. »Wenn da jemand ermitteln soll, dann muss er sich bei Weinen extrem gut auskennen. Hipp ist aus sehr privaten Gründen aus dem Polizeidienst ausgeschieden, hat sich schon immer intensiv mit Wein beschäftigt und besitzt sogar einen Abschluss an der berühmtesten Sommelier-Schule in Bordeaux. Mit dieser Kombination, erstens Psychologe, zweitens ehemaliger Sonderermittler bei der Polizei und drittens Weinexperte, ist er für uns unersetzbar. Auch wenn er als Mensch nicht immer ganz einfach ist und so seine Eigenarten hat …« Karl Talhammer zuckte mit den Schultern. »Doch das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls dachte ich, es ist eine gute Idee, ihn mitzubringen. Aber da es mir nicht vergönnt war, ihn vorzustellen, ist das etwas anders gelaufen als geplant. Und hättest du ihn vor wenigen Minuten nicht so impertinent bedrängt, wäre er ebenso sang- und klanglos gegangen, wie er gekommen ist. Er ist der Allerletzte, der sich produziert, er spielt normalerweise immer den Unwissenden.«
»Sozusagen eine verdeckte Ermittlung«, warf der Schönheitschirurg grinsend ein.
»Und die Blindverkostung hat er auch identifiziert. Ist mir immer noch ein Rätsel, wie das geht. Sogar den Jahrgang, einfach unglaublich«, räsonierte Schmid.
»Da staune ich auch«, gab Praunsberg zu. »Das haben heute selbst unsere Chevaliers nicht zustande gebracht.«
Prof. Losotzky sah verlegen zu Dr. Quester. Pierre Allouard schüttelte den Kopf.
»Wo bleiben die obligatorischen Zigarren?«, versuchte er vom Thema abzulenken.
»Die Cohibas warten im Humidor auf ihren Einsatz«, antwortete Praunsberg und deutete auf das Kästchen aus poliertem Walnussholz. »Bedient euch!«
»Cohiba!«, freute sich Dieter Schmid aus Düsseldorf »Das ist mal ein wirklich kultivierter Herrenabend.«
»Apropos …« Praunsberg blickte zur Tür. »Wo bleibt eigentlich mein Töchterchen?«
»Du warst so mit deiner Weinpräsentation beschäftigt, dass dir wohl entgangen ist, warum Valerie bei uns geblieben ist und wie oft sie deinem Überraschungsgast verstohlene Blicke zugeworfen hat«, half ihm Pierre Allouard auf die Sprünge.
»Du meinst, Valerie hat sich in diesen Typen verguckt?« Praunsberg schüttelte irritiert den Kopf. »Das fehlte noch. Jedenfalls bitte ich Karl nie mehr, jemanden mitzubringen. Sag mal, ist dieser Hipp vielleicht zu allem Überfluss ein Single.«
»Ja, ist er, soviel ich weiß«, bestätigte Karl Talhammer.
»Mach dir keine Sorgen«, versuchte der Schönheitschirurg Praunsberg zu beruhigen. »Um im Bild zu bleiben: Ich würde sagen, dieser Hipp hat für Valerie den falschen Jahrgang und zu viel Tannine.«
Praunsberg warf erneut einen Blick zur Tür. »Aber ich finde, meine Tochter hat einen gefährlich langen Abgang!«
»Fast so wie dieser Haut-Brion, Jahrgang 1961!«, sagte Pierre Allouard kichernd.
3
Mit dem Rücken gegen die Hauswand gelehnt, saß er schwer atmend auf dem Terrassenboden. Jean-Yves wischte sich mit einem Handtuch übers Gesicht. Er warf einen dankbaren Blick hinauf zum azurblauen Himmel. Mit den Augen folgte er den kleinen weißen Wolken, die von Avignon und aus dem Rhône-Tal kommend über die schroffen Alpilles hinwegsegelten gen Süden, über die Plaine de la Crau hinaus aufs Mittelmeer. Vor ihm seine liebevoll gepflegten Rebstöcke und die alten knorrigen Olivenbäume, die schon sein Großvater beschnitten hatte. Links die ockerfarbene Mauer mit dem Lavendel davor. Mon Dieu, war das schön. Wie ein Aquarell von Paul Cézanne. Dass er das noch einmal sehen durfte! Seine geliebte Provence. Das Glücksgefühl wurde von einem heftigen Hustenanfall unterbrochen. Erneut fuhr er sich mit dem Handtuch über das Gesicht. Immer wieder lief ihm aus den Haaren roter, süßlich riechender Most in die Augen. Jean-Yves versuchte tief einzuatmen. Was ihm gar nicht so leicht fiel, seine Lungen mussten sich offenbar erst wieder an den Sauerstoff gewöhnen.
»Geht es jetzt besser?«
Jean-Yves zuckte bei dieser Frage zusammen und sah nach rechts hinüber, wo Sergej im Korbstuhl saß, in einem blütenweißen Anzug, mit gefalteten Händen. Hinter ihm stand Boris, sein breitschultriger Leibwächter, der Sergej selten von der Seite wich. Dieser Boris war es wohl, der ihn an den Beinen gepackt, hochgehoben und hilflos im Gärbottich hatte baumeln lassen. Stark genug war er. Gott sei Dank auch kräftig genug, ihn aus dem gärenden Most wieder herauszuziehen und an die frische Luft zu bringen. Denn dass sich Sergej nicht die Finger schmutzig gemacht hatte, sah man an seinem unbefleckten Anzug.
»Nun sag schon, bist du wieder bei Sinnen?« Sergej sprach sehr langsam, mit einem schweren russischen Akzent. Vor einigen Jahren war er in Frankreich aufgetaucht. Er besaß ein luxuriöses Anwesen an der Côte d’Azur, oberhalb von Cannes. Außerdem hatte er eine Wohnung in Paris am Jardin du Luxembourg. Womit Sergej in Russland reich geworden war, wusste kein Mensch. Jedenfalls warf er mit dem Geld nur so um sich, und er war vernarrt in die Statussymbole der kapitalistischen Gesellschaft. Sergej, mit dem Nachnamen hieß er Protomkin, liebte nicht nur schwarze Mercedes-Limousinen mit getönten Scheiben, rote Ferraris, goldene Rolex-Uhren und schnelle Motoryachten, er war auch seit kurzem ganz scharf auf französische Weine der Spitzenklasse. Eine Leidenschaft, gegen die Jean-Yves nichts einzuwenden hatte, war er doch auf diese Weise zu einem neuen, sehr zahlungskräftigen Kunden gekommen. Dass Sergej vom Wein nicht sehr viel verstand, machte nichts. Sergej hatte ein einfaches Prinzip: je teurer, desto besser. Auch die Weine waren für ihn in erster Linie eine Prestigeangelegenheit. Deshalb konnte man ihn nur mit den großen Châteaux glücklich machen, mit einem Château Latour, Margaux, Pétrus oder d’Yquem. Einen Château Lafite und Château Mouton schätzte er schon deshalb ganz besonders, weil sie im Namen den Zusatz Rothschild trugen.
Außerhalb des Bordeaux ließ Sergej nicht mehr viel gelten. Aus Burgund mochte er eigentlich nur Weine der Domaine de la Romanée-Conti. »Jean-Yves«, pflegte er zu sagen, »ein Romanée-Conti ist schon deshalb köstlich, weil für Normalsterbliche so unerreichbar wie ein Diadem aus der Eremitage in St. Petersburg!«
»Nun, Jean-Yves, hat es dir die Rede verschlagen? Du musst mir dankbar sein, Boris hat dir das Leben gerettet!«
Sauvé la vie? Jean-Yves spürte, wie seine Beine noch immer zitterten. Au contraire, fast hätte ihm Boris das Leben gekostet!
»Mir das Leben gerettet? Sergej, mon ami, c’est une mauvaise plaisanterie, das ist ein schlechter Scherz, ich kann darüber nicht lachen!«, erwiderte Jean-Yves.
»Ein schlechter Scherz?«, griff Sergej die Formulierung auf. »Das habe ich auch gedacht!«
Jean-Yves verstand nicht, was Sergej damit andeuten wollte. Obwohl? Jetzt kam ihm ein Gedanke, sein Kopf war noch etwas benebelt und funktionierte, wie es schien, mit einer gewissen Verzögerung. Hatte Boris, bevor er ihn in die Maische hatte fallen lassen, nicht einen Pétrus erwähnt? Eine Magnum-Flasche? Nun erinnerte er sich wieder an alles. Ja, er ahnte, warum ihm Sergej einen Besuch abstattete. Sollte er diesen neureichen Russen und seine Freunde unterschätzt haben?
»Was hast du gedacht?«, fragte Jean-Yves vorsichtig.
Sergej zündete sich bedächtig ein Zigarillo an. »Dass du dir mit dem Château Pétrus in der Magnum-Flasche aus dem Jahrgang 1947 einen Scherz gemacht hast, das habe ich gedacht. Einen schlechten Scherz, mein lieber Jean-Yves, einen tödlich schlechten Scherz!«
»Warum? Was war mit dem Wein? Ich war glücklich, dass ich ihn dir liefern konnte. Das war nicht leicht, der 47er Pétrus ist eine echte Rarität, une véritable rareté, vor allem in der Magnum-Flasche. Aber du wolltest ja genau diesen Wein.«
»Natürlich wollte ich ihn«, sagte Sergej und blies auf die Glut seines Zigarillos. »Ich glaube, ich muss dir erklären, wie internationale Geschäfte ablaufen. Ich habe wichtige Partner in Japan, genauer gesagt in Osaka. Sehr wohlhabende und sehr verwöhnte Menschen. Du verstehst?«
Jean-Yves nickte, obwohl er nicht so recht verstand, was Sergej eigentlich sagen wollte.
»Nun«, fuhr Sergej fort, »diese Geschäftspartner aus Osaka wollten mit mir einen Abschluss machen. Sie sind extra deshalb von Japan zu mir nach Frankreich gekommen. Weißt du, wo Japan ist, Jean-Yves? Japan ist weit weg, sehr weit weg, auf der anderen Seite der Weltkugel. Meine Partner haben die lange Reise gemacht, um einen Vertrag zu unterschreiben. Und ich habe ihnen versprochen, dass wir diesen Vertrag mit einem Château Pétrus 1947 Magnum besiegeln werden. Denn diesen Wein und Jahrgang wollte mein Freund Asahira Tomamotu schon immer trinken. Asahira hat wie viele Japaner ein Faible für französische Spitzenweine …«
Und genauso wenig Ahnung davon wie ihr neureichen Russen, fügte Jean-Yves in Gedanken dazu.
»Ich habe dich gefragt, ob du mir diesen Wein besorgen kannst, erinnerst du dich?«, sagte Sergej.
»Bien sûr«, bestätigte Jean-Yves. »Du hast mich nicht nur gefragt, sondern bedrängt, angefleht, mindestens zweimal hast du jeden Tag angerufen. Und weil du ein guter Freund bist, un vrai ami, habe ich alles versucht und schließlich den Wein in Amsterdam auf einer Auktion ersteigert. Die Flasche hat mich achtzehntausend Euro gekostet, ich habe nur zehn Prozent Provision verlangt und gerade noch rechtzeitig geliefert.«
»Besser, du hättest ihn nicht geliefert«, erwiderte Sergej.
»Warum? Was war mit ihm nicht in Ordnung? Hatte er einen Korkfehler? War er oxidiert? So etwas kann passieren, gerade bei so alten Tropfen, das weißt du doch.«
Sergej schüttelte den Kopf. »Mein japanischer Geschäftspartner hatte zur Weinprobe einen Freund dabei, einen Amerikaner, der zufällig gerade für einige Tage in Frankreich war.«
»Un Américain? Was hat er mit unserem Wein zu tun?« Jean-Yves guckte verständnislos, in Wahrheit aber schwante ihm Schlimmes.
»Nicht irgendeinen Amerikaner hatte er dabei, sondern …«
Sergej machte eine kurze, dramatische Pause. Jean-Yves gelang es offenbar nicht ganz, sein Erschrecken zu verbergen.
»Nein, Robert Parker persönlich war es nicht«, beruhigte ihn Sergej grinsend, »aber ein jüngerer Kollege des berühmten Weingurus, mit einer fast genauso guten Nase.«
»Un connaisseur de vin, c’etait parfait, n’est-ce pas«, sagte Jean-Yves scheinheilig, doch er merkte, dass seine Stimme sehr dünn klang.
»Von wegen ›parfait‹, mein Lieber. Wir haben die Flasche feierlich entkorkt, wir waren alle sehr aufgeregt. Dieser George aus Boston natürlich weniger, für den war das nicht so besonders, aber auch er war sehr auf den 47er Pétrus gespannt.«
»Und?«
»Nun, mir hat der Wein ehrlich gesagt nicht schlecht geschmeckt, auch Asahira und seine Freunde waren ganz entzückt.«
Jean-Yves ahnte, dass die Geschichte noch nicht zu Ende war.
»Auch dieser George hat den Wein gelobt. Er habe viel Frucht und erstaunlich intensive Aromen – für einen eher minderwertigen Pomerol, der allenfalls zwanzig Jahre alt und nie und nimmer ein Grand Vin von Pétrus sei. Geschweige denn ein 47er, der sich aufgrund des heißen Sommers durch geradezu überwältigende Aromen auszeichnen würde.«
Jean-Yves schluckte. Wie konnte er wissen, dass diese Banausen, Sergej und seine japanischen Freunde, die sich vielleicht bei Sake auskannten, einen veritablen Weinkritiker hinzuziehen würden? Dem war der Unterschied natürlich aufgefallen. Obwohl diese Bemerkung mit dem minderwertigen Pomerol eine Frechheit war, er hatte einen auch nicht gerade billigen Wein aus einer unmittelbaren Nachbarlage von Pétrus genommen. Mit den zwanzig Jahren lag der Amerikaner dagegen ziemlich richtig.
Jean-Yves faltete die Hände und sah Sergej unschuldig an. »Ist das wahr? Mon ami, das tut mir Leid, c’est incroyable! Ein falscher Wein in der Flasche? Incroyable! Quelle horreur! Und das zu diesem Preis. Diese Weinauktionen sind ein Skandal. Dabei hat die Flasche unversehrt ausgesehen, das Etikett, die Kapsel, auch die Farbe des Weines, der Füllstand, alles exzellent. Und dann diese Enttäuschung, incroyable.«
Sergej sah Jean-Yves intensiv an. »Du willst mir doch nicht allen Ernstes weismachen, dass du den Wein in Amsterdam gekauft hast und nichts von dem Schwindel wusstest. Zeig mir die Rechnung!«
»La facture, nun, die Rechnung, also …«
»Du musst dir keine Mühe geben, lieber Jean-Yves. Wir haben uns in deinem Weinlager umgesehen. Du sammelst leere Flaschen von Raritäten, wo auch immer du die herhast. Du bewahrst alte Originalkorken auf und hast ein Gerät zum Verkapseln von Weinflaschen. Boris und ich sind uns sicher, der Château Pétrus Jahrgang 47 stammt nicht von einer Auktion, sondern ist eine Schöpfung von dir. Gib’s zu!«
Jean-Yves bekam einen weiteren Hustenanfall. Erneut wischte er sich mit dem Handtuch das Gesicht ab, diesmal aber wegen der Schweißperlen, die sich auf seiner Stirn gebildet hatten. Was sollte er antworten? Sergej hatte ja Recht. Wenn er das aber zugab, was würde dann mit ihm passieren? Er dachte an das unfreiwillige Bad im Gärbottich. So schnell jedenfalls konnte sein Leben ein Ende nehmen.
»Ich werte dein Schweigen als Eingeständnis«, sagte Sergej und zog an seinem Zigarillo.
Jean-Yves sah ihn ratlos an. Das zustimmende Nicken konnte er sich sparen.
»Ich gebe dir das Geld zurück«, sagte er. »Ich wollte dich nicht betrügen, wirklich nicht. Eigentlich wollte ich dir einen Gefallen tun, damit du bei deinen japanischen Geschäftspartnern einen guten Eindruck machen kannst. Der abgefüllte Wein war ganz hervorragend und alles andere als billig. Ich konnte ja nicht ahnen, dass deine Freunde einen Weinexperten mitbringen.«
»Nein, das konntest du nicht ahnen«, bestätigte Sergej. »Machst du das eigentlich oft?«, wollte er wissen.
»Was mache ich oft?«
»Wein fälschen, meine ich.«
»Nur ganz selten«, gab Jean-Yves wahrheitsgemäß zu. »Ich bin eigentlich ein durch und durch seriöser Weinhändler. Da kannst du jeden fragen. Ich habe eine ausgezeichnete Reputation. Nur ganz selten manipuliere ich Weinraritäten. Mehr zum Spaß, es ist ja so einfach. Ich will mich damit nicht bereichern, ich meine nicht wirklich, das heißt irgendwie …«
»Schade«, sagte Sergej.
»Was heißt schade?«, fragte Jean-Yves irritiert.
Sergej beugte sich nach vorne. »Ich meine, es ist schade, dass du das nur ganz selten machst. Es ist nämlich eine sehr gute Geschäftsidee.« Sergej schlug sich auf die Schenkel und lachte. »Aber es macht natürlich keinen Sinn, nur ab und zu eine Flasche zu fälschen. Da stehen Aufwand und Risiko in keinem Verhältnis zum Ertrag. Deshalb werden wir mit tausend Flaschen Lafite-Rothschild anfangen!«
Jean-Yves langte sich an den Kopf. »Pardon, qu’est-ce que tu veux dire? Ich verstehe dich nicht, was willst du damit sagen?«
Sergej stand auf, ging langsam auf Jean-Yves zu, der immer noch auf dem Boden saß, beugte sich über ihn und bohrte seinen Zeigefinger mitten auf die Stirn des Franzosen. »Ist doch ganz einfach. Ich verzeihe dir deinen Fehler. Ab jetzt sind wir Partner. Und das sieht so aus: Du tust, was ich sage. Ab heute fälschen wir Wein. Du bist sozusagen der Künstler, der das macht. Du hast ja bewiesen, dass du das kannst. Und ich übernehme die Organisation. Geht das in deinen Kopf hinein?«
»Oui, ja, ich habe das verstanden«, bestätigte Jean-Yves. »Aber ich mache so etwas nicht, je regrette. Ich bin kein professioneller Weinfälscher, je suis un homme honnête.«
»Du bist kein ehrlicher Mann, du hast es schon einmal getan, schon einige Male. Wo ist da der Unterschied? Du hast den ersten Schritt längst gemacht. Jetzt ist es zu spät, mon ami. Die tausend Flaschen Lafite-Rothschild sind nur der Anfang, sozusagen zum Warmlaufen. Dann steigen wir groß in das Geschäft ein, wir werden die ganze Welt beliefern. Reiche Amerikaner, Russen, Chinesen, Japaner. Ich bin bereit zu investieren. Du musst nur sagen, was du brauchst. Einen teuren Farbkopierer, Scanner, Originalflaschen, Korken? Kein Problem, wir werden es für dich beschaffen.«
»Non, absolument pas, ich mache das nicht!« Jean-Yves hob protestierend die Arme.
Sergej packte ihn mit einer Hand am Hals und drückte zu. »Du hast keine Wahl, Jean-Yves. Entweder du machst mit, oder du bist ein toter Mann. So einfach ist das. Einen Sergej betrügt man nicht. Du hast Glück, dass mir deine Idee gefallen hat, sonst wärst du schon längst eine Leiche. Und du weißt ja, wo man dich irgendwann gefunden hätte. Du machst, was ich sage, haben wir uns verstanden? Sonst wird dich Boris umbringen. Du wärst nicht der Erste, glaube mir.«