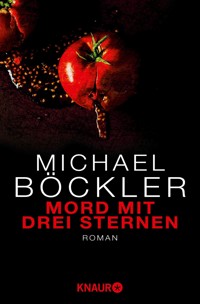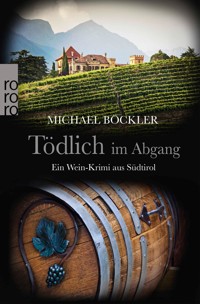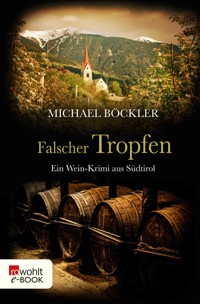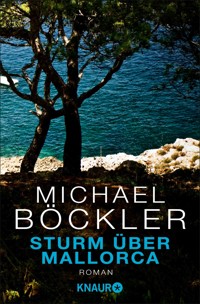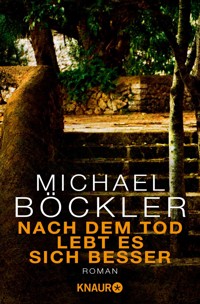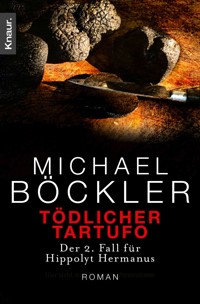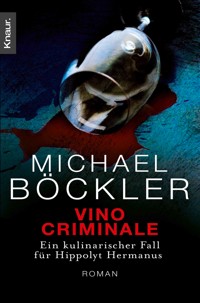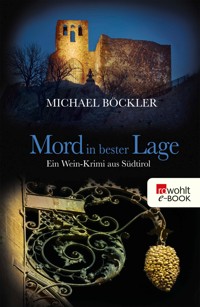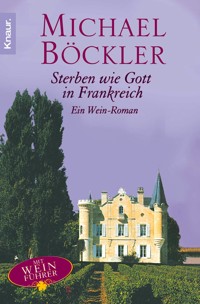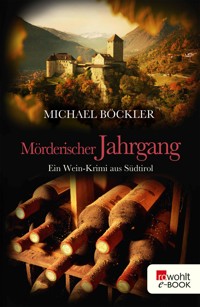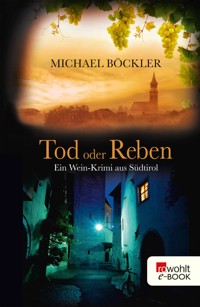6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein erfolgreicher Münchner Herzchirurg hat den beruflichen Stress satt: Er steigt aus und sucht Entspannung in der Toskana. Mit der schönen Witwe Carlotta kommt unerwartet die Liebe ins Spiel. Doch bald fallen erste Schatten auf sein Paradies, und der Glückliche muss um sein Leben fürchten. "Ein Thriller mit Pasta- und Pizza-Ideen und vielen Insider-Tipps für Hotels und Restaurants." Maxi
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Michael Böckler
Wer stirbt schon gerne in Italien?
Ein Toskana-Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der erfolgreiche Herzchirurg Maximilian Mauritz hat den beruflichen Stress satt: Er steigt aus und sucht Entspannung in der Toskana. Mit der schönen Carlotta kommt sogar ganz unerwartet die Liebe ins Spiel. Doch bald fallen erste Schatten auf sein Paradies, und schließlich muss Maximilian um sein Lebenfürchten.
Inhaltsübersicht
Motto
Landkarte
Prefazione
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Registro Turistico
Anmerkung
Or tutto si coprì
di lugubre mister
ed io non ho nel cor
che tristezza e terror.
Nun bedeckt sich alles
mit einem trauervollen Geheimnis
und ich fühle nichts im Herzen
als Traurigkeit und Schrecken.
Arie aus Giacomo Puccinis Oper Le Villi
Prefazione
Das hatte sich der Münchner Herzchirurg Prof. Dr. med. Maximilian Mauritz so schön ausgemalt: Dem beruflichen Druck nicht mehr gewachsen, erhoffte er sich von einem Ausstieg auf Zeit Erholung und Entspannung. Und welche Region wäre dafür besser geeignet als die Toskana? Das Land der Zypressen und Pinien, der Hügel, die sich im Dunst verlieren, der alten Weingüter und Olivenhaine. Städte wie Florenz, Pisa, Siena und Lucca mit ihrer Stein gewordenen Geschichte. Die Wiege der Renaissance im Herzen Italiens. Die Verlockungen der toskanischen Küche. Die Sehnsucht nach Schönheit und Frieden. Kurzum, die ganze Palette der kulinarischen und kulturellen Genüsse von Bruschetta und Brunello bis Brunelleschi und Boccaccio. Dazu ein eigenes Häuschen mit Blick aufs ferne Meer. Herz, was willst du mehr? Die Seele baumeln lassen. Das innere Gleichgewicht wiederherstellen.
All diese Träume, sie schienen für Max in Erfüllung zu gehen. Die Toskana zeigte sich von ihrer schönsten Seite. Und gänzlich unerwartet kam sogar die Liebe ins Spiel. Doch dann fielen erste Schatten auf sein Paradies. Die Schatten, sie wurden immer länger, dunkler, bedrohlicher. Und schließlich mußte Max um sein Leben fürchten …
Mehr soll in diesem Vorwort nicht verraten werden. Warum hat dieser Roman überhaupt ein Vorwort? Weil dem Buch ein besonderes Konzept zugrunde liegt, das zur Einstimmung kurz erläutert werden soll. Die Abenteuer des Maximilian Mauritz verfolgen nämlich neben der hoffentlich spannenden Unterhaltung noch ein zweites Ziel. Das Buch will gleichzeitig eine Art touristischer Begleiter sein, denn in den Roman ist systematisch eine Fülle von Informationen über die Toskana eingearbeitet. Die Erzählung führt durch die Geschichte der Toskana (von den Etruskern bis zu den Medici). Sie stellt die großen Genies vor, die in der Toskana gelebt und gewirkt haben (von Botticelli bis Michelangelo). Städte wie Florenz, Pisa, Siena und Lucca bilden den Rahmen für die oft turbulenten Ereignisse. Die großen Weine der Toskana werden kredenzt (vom Chianti bis zum Sassicaia). Und wenn gegessen oder genächtigt wird, dann in konkreten Restaurants und Hotels – zur Nachahmung empfohlen.
In Ergänzung der Informationen, die in den Roman integriert sind, gibt es mit dem Registro turistico einen umfangreichen Anhang.
Natürlich hat das Buch hinsichtlich der touristischen Informationen keinen Ehrgeiz, in irgendeiner Weise komplett zu sein. Diesem hehren Anspruch können im Falle der Toskana selbst traditionelle Reise- oder Restaurantführer nicht gerecht werden. Aber vielleicht erleichtern die Erlebnisse mit und um Maximilian Mauritz ein klein wenig die Orientierung zwischen Apennin und dem Tyrrhenischen Meer, von Carrara im Norden bis Pitigliano im Süden. Darüber hinaus appelliert der Autor an den Entdeckungsdrang jedes einzelnen. In diesem Sinne:
Buon viaggio e buon divertimento!
1
Der Oberkörper war weit aufgerissen und der Brustkorb aufgesägt. Wie mittelalterliche Folterwerkzeuge preßten vier große Klammern das Gewebe zur Seite. Vor ihm war das freigelegte Herz. Ohne zu schlagen und blutleer. Die Herz-Lungen-Maschine hatte die lebenswichtigen Funktionen übernommen. Die Pumpen, die im Hintergrund zu hören waren, hielten den Kreislauf aufrecht und sorgten für einen gleichmäßigen Transport des heparinisierten Blutes. Ein Oxygenator reicherte das Blut mit Sauerstoff an und entzog ihm das Kohlendioxid.
Durch seine Latex-Handschuhe massierte sich Prof. Dr. med. Maximilian Mauritz die Finger. Gleich würde er das Skalpell zum ersten Schnitt ansetzen. Für den erfahrenen Herzchirurgen eigentlich nichts Besonderes. Tägliche Routine. Und doch war Prof. Mauritz beunruhigt. Sogar etwas nervös. Früher hatte es das bei ihm nicht gegeben. »Dr. Eiskalt« wurde er von seinen Kollegen nicht ohne Respekt genannt. Aber in den letzten Wochen und Monaten hatte er immer häufiger diese innere Unruhe verspürt. Er war jetzt Ende Vierzig. Wirklich kein Alter. Doch die ungezählten Herzoperationen hatten ihre Spuren hinterlassen. Und wie so oft in den letzten Tagen ging ihm wieder einmal durch den Kopf, daß er eigentlich auch aufhören könnte. Der ewige Kreislauf aus Herzklappen, Schrittmacher, Bypass und Transplantationen. Dieser Kreislauf würde auch ohne ihn weitergehen. Seinen Beitrag hatte er längst geleistet. Jeder war ersetzbar.
Prof. Mauritz betrachtete den Herzmuskel. Von außen war ihm nicht anzusehen, daß er einen tödlichen Defekt hatte. Vor einigen Wochen hatten sie der Patientin einen Herzkatheter eingeführt. Etwas über dreißig Jahre war sie alt. Eine hübsche Frau, die als Dolmetscherin arbeitete. Von früher Kindheit an hatte sie unter heftigen Herzrhythmusstörungen gelitten. Immer wieder und ohne Vorwarnung war das Herz losgaloppiert. Von sechzig auf zweihundert Schläge in wenigen Sekunden. Supraventrikuläre Tachyarrhythmie heißt dieses Phänomen. Die Herzkatheteruntersuchung offenbarte einen angeborenen Herzfehler. »Vorhofseptumdefekt«, murmelte Prof. Mauritz in seinen Mundschutz. Ein kleines häßliches Loch zwischen den beiden Vorhöfen des Herzens. Durch dieses Loch gelangte bei jedem Herzschlag Blut vom linken in den rechten Vorhof. Der Vorhofseptumdefekt war überraschend groß. Ohne Operation würde die Patientin nicht mehr lange leben. Die Lücke in der Wand mußte geschlossen werden.
Prof. Mauritz atmete noch einmal tief durch. Um ihn herum stand das Operationsteam und wartete auf sein Signal.
»Fangen wir an«, sagte Prof. Mauritz und beugte sich nach vorne.
Zwanzig Minuten später war die Hauptarbeit getan und das Herz wieder geschlossen. Jetzt mußte die Patientin nur noch von der Herz-Lungen-Maschine getrennt, das Herz reanimiert und der aufgesägte Brustkorb mit Draht verklammert und der Schnitt vernäht werden.
Eine großflächige Spezialelektrode wurde angesetzt und ein erster kurzer Gleichstromstoß auf das Herz abgegeben. Ohne Ergebnis. Prof. Mauritz spürte wieder dieses nervöse Kribbeln im Magen, an das er sich nicht gewöhnen konnte. Ein zweiter Stromstoß. Die ersten Schweißperlen traten auf seine Stirn.
Nach vierzig Minuten waren sämtliche Bemühungen der Reanimation gescheitert. Sie hatten alles, aber auch wirklich alles versucht. Prof. Mauritz zog seine Handschuhe aus. Vor ihm lag der tote Körper der jungen Patientin. Barbara war ihr Name gewesen, schoß dem Chirurgen durch den Kopf. Barbara Hombach. Gestorben bei einer Operation mit keiner allzu großen Sterbewahrscheinlichkeit. Die Statistik half hier nicht weiter. In Gedanken ging er die Operation noch einmal durch. Alles war nach Plan gelaufen. Keine Probleme oder zusätzlichen Risikofaktoren. Auch kein operativer Fehler, da war er sich absolut sicher. Die junge Frau hatte Pech gehabt. So einfach war das. Es gab eben eine höhere Instanz, die über Leben und Tod entschied. Früher hätte er sich damit relativ rasch abfinden können. Ein Herzchirurg, der mit dem Tod nicht klarkommt, hat seinen Beruf verfehlt. Prof. Mauritz hatte den Mundschutz abgenommen und wischte sich mit dem zusammengeknüllten Stoff den Schweiß von der Stirn. Dr. Eiskalt? Das war einmal! Barbara Hombach – er sah sie noch vor sich. Wenige Stunden war das erst her. Gelächelt hatte sie. Etwas verängstigt zwar und verkrampft, aber gelächelt. Das frische Lächeln einer Frau, die das Leben noch vor sich haben sollte.
Erst vor drei Tagen war auf der Intensivstation ein Bypass-Patient gestorben, ein Vater von zwei kleinen Kindern. Und vor wenigen Wochen war eine Transplantation schiefgegangen.
Prof. Mauritz richtete den Blick nach oben in das helle Licht der großen Operationslampe. Sein Entschluß stand fest. Er würde aufhören. So schnell wie möglich.
2
Mit geschlossenen Augen saß Max im Sessel, bequem zurückgelehnt und die Hände im Schoß gefaltet. Max, so wurde Maximilian Mauritz von seinen Freunden genannt. Wieder war er mit seinen Gedanken bei dieser Operation, die nunmehr bereits ein gutes halbes Jahr zurücklag. Er hatte ernst gemacht. Der Vertrag mit seiner Klinik war bereits gekündigt. Natürlich konnte er nicht von heute auf morgen aufhören. Einige Monate würde er noch seiner Arbeit nachgehen müssen. Die Aufregung war ohnehin groß genug und ein Nachfolger nicht so schnell gefunden. Seine ordentliche Professur an der medizinischen Fakultät der Uni München würde er im nächsten Semester ruhen lassen. Wie nicht anders zu erwarten, war seine Entscheidung auf großes Unverständnis gestoßen. Seine Kollegen hielten ihn offenbar für verrückt. Wie konnte ein glänzender Herzchirurg auf dem Höhepunkt seiner Karriere und Leistungsfähigkeit einfach aussteigen? Das wollte niemand verstehen.
Auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit? Max schüttelte langsam den Kopf. Von wegen, das war ja gerade das Problem. Burnout-Syndrom wurde dieses Phänomen genannt. Max hatte schon früher darüber gelesen. Das Gefühl des Ausgebranntseins, der völligen Leere, das komme zwar in vielen Berufen vor, sei aber gerade bei Ärzten stark verbreitet. Die permanente Anspannung fordert plötzlich ihren Tribut. Er hatte sich nie vorgestellt, daß er selbst einmal Opfer dieses Burnout sein könnte. So konnte man sich täuschen. Schon seit langem plagten ihn Schlafstörungen. Die Operationen machten ihn physisch und psychisch fertig. Vor einigen Tagen erst hatte er sich nach einem Bypass auf der Toilette übergeben müssen. Die Schicksale der Patienten gingen ihm an die Nieren. Und jedesmal hatte er Angst, daß seine Hände zittern. Soweit durfte er es nicht kommen lassen. Die verbleibende Zeit würde er noch durchhalten. Und dann wollte er erst mal ausspannen, sich mit anderen Dingen beschäftigen und wieder zu sich selbst finden. Er würde schon sehen, wieviel Zeit das in Anspruch nimmt. Egal, er war unabhängig. Finanziell sowieso. Daran hatte auch seine kostspielige Scheidung vor drei Jahren nichts geändert. Und privat? Privat war er frei wie ein Vogel. Seine Tochter studierte in Amerika, und seine Exfrau verbrachte die meiste Zeit auf dem Golfplatz und hatte sicherlich genug Verehrer.
Eine Lautsprecherstimme riß Max aus seinen Gedanken. »Noch fünfzehn Minuten bis zur Landung. Sie können sich freuen, das Wetter in Pisa ist schön. Ein wolkenloser Himmel bei einer Temperatur von einundzwanzig Grad Celsius. Wir hoffen, der kurze Flug hat Ihnen gefallen. Signore e signori, mancano quindici minuti all’atterraggio …«
Max machte die Augen auf und schaute aus dem Fenster. Wie weggewischt waren die Alpträume. Unter ihm glitt der Schatten des Flugzeugs über grüne Hügel. Die Berge da vorne rechts, das mußten bereits die Apuanischen Alpen sein. Max erinnerte sich an eine alte Legende. Danach gehen diese Berge auf den Liebeskummer einer schönen Hirtentochter zurück. In der Nacht weinten mit ihr die Sterne Tränen, die schließlich zu Stein erstarrten. Zu einem Stein der ganz besonderen Art, aus dem später ein Genie wie Michelangelo seinen David meißeln sollte. Was im Dunst weiß schimmerte, das war kein Schnee, sondern der Marmor von Massa und Carrara.
Die Maschine setzte zu einer leichten Kurve an. Im Gang blieb die Stewardeß stehen, beugte sich über die alte Dame, die neben ihm saß, und lächelte ihn auffordernd an. Max nahm irritiert zur Kenntnis, daß sie ausgesprochen hübsch aussah. Ach so, sie wollte nur sein leeres Cognacglas einsammeln. Was hatte er vermutet? Das kommt davon, wenn man mit seinen Gedanken ganz woanders ist.
Max klappte das Tischchen hoch und stellte die Lehne seines Sitzes senkrecht. Sein Blick fiel wie von selbst erneut auf die Stewardeß, die nun auf der anderen Seite des Gangs einen männlichen Fluggast mit ihrem Anblick erfreute. Keine Frage, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Und erst recht ein wohlproportionierter Hintern. Unwillkürlich beugte sich Max leicht nach vorn, um mit schräg gestelltem Kopf auch die Beine in Augenschein zu nehmen. In der Tat, sehr ansprechend. Jedenfalls konnte er einem befreundeten Kollegen nicht zustimmen, der jüngst resignierend festgestellt hatte, daß nicht nur die Krankenschwestern, sondern auch die Flugbegleiterinnen immer häßlicher würden.
Die alte Dame auf dem Nebensitz schaute ihn vorwurfsvoll von der Seite an. Was dachte die jetzt wohl von ihm? Bestimmt nichts Gutes. Max räusperte sich und wandte sich wieder dem Fenster zu. Er hatte es den ganzen Flug über beharrlich vermieden, sich auf ein Gespräch einzulassen. Diesen Erfolg wollte er in den letzten Minuten nicht aufs Spiel setzen. Bei ihrem mißlaunigen Gesichtsausdruck konnte sie gewiß wenig zu seiner Erheiterung beitragen. Und er hatte in seiner momentanen Gemütsverfassung nun mal keine Lust, sich auch noch die Probleme anderer Menschen anzuhören.
Die hochstehende Sonne spiegelte sich in einem See. Das könnte der Lago di Massaciuccoli sein, überlegte Max. Ihm fiel der große Opernkomponist Giacomo Puccini ein, der lange an diesem See südlich von Viareggio gelebt hatte. Allzugern würde er einmal zum Puccini-Festival nach Torre del Lage fahren. La Bohème auf der großen Freilichtbühne am Seeufer, das wäre was.
Schon tauchten die Häuser von Pisa auf. Kaum vorstellbar, daß die Stadt im Altertum noch direkt am Meer gelegen war. Durch die Ablagerungen des Arno ist die Flußmündung heute Kilometer entfernt. Wie ein kleines Kind preßte Max seine Stirn gegen die Scheibe. Irgendwo mußte er doch sein, der berühmte Platz der Wunder, die Piazza dei Miracoli. Max kniff die Augen zusammen. Wer sagt’s denn, da war er auch schon. Deutlich sah er den Dom, das Baptisterium und vor allem den Turm, den schiefen Campanile. Recht putzig wirkte der Torre Pendente von hier oben, ganz ähnlich wie die kleinen Modelle, die in den Souvenirläden verkauft werden.
Das Betonband der Autostrada, ein Pinienwald; das Ufer huschte vorbei, jetzt waren sie über dem Meer. Max spürte, wie er an die Schulter gestupst wurde. »Entschuldigen Sie, könnten Sie mal etwas zur Seite rücken, damit auch ich rausgucken kann.« Die alte Dame drängte ihren Kopf in Richtung Fenster. Max lehnte sich zurück und hob in sanfter Verzweiflung die Augenbrauen. Er fing den Blick der Stewardeß auf, die ihm mitfühlend zulächelte, dann aber bedauerlicherweise hinter den Lehnen verschwand, wahrscheinlich, weil sie sich zur Landung setzen und festschnallen mußte. Warum war der Platz neben ihm nicht frei?
Das Flugzeug machte eine scharfe Linkskurve und verlor rasch an Höhe. Der graue Kopf vor seiner Nase wollte den Platz am Fenster nicht mehr preisgeben. Dabei gab es doch außer Wasser ohnehin nichts zu sehen. Max kämpfte mit einem immer stärker werdenden Niesreiz. Ein bemerkenswertes Haarspray hatte die alte Dame! Zuerst war es ihm vorgekommen, als ob sie ihn damit narkotisieren wollte. Und jetzt dieser überaus belebende Nasenreflex!
»Mir scheint, wir landen jeden Augenblick«, sagte Max mit zugehaltener Nase in die dauergewellten Haare. »Jedenfalls wäre mir wohler, wenn Sie sich wieder gerade hinsetzen könnten.«
Leise protestierend folgte die Dame seiner Aufforderung. Gerade noch rechtzeitig. Nach einem eruptiven Niesanfall atmete Max befreit durch. Schon war die Küste wieder zu sehen. Wenig später setzten sie auf, und die Maschine rollte zu ihrem Standplatz. Max schaute auf die Uhr. Fast pünktlich. Sehr schön, schließlich wurde er abgeholt. Dieser Kurzurlaub in der Toskana war schon so etwas wie eine erste kleine Flucht. Immer wieder hatte er die Einladung von Fausto abgelehnt. Fünf Jahre war es her, da hatte er Fausto eine künstliche Herzklappe eingesetzt. Fausto hieß mit Nachnamen Brunetta und war Rechtsanwalt. Offenbar war er recht vermögend, denn der Avvocato war extra nach München gekommen, um sich von ihm operieren zu lassen. »Cerco sempre i migliori«, hatte Fausto gesagt, »deshalb lasse ich mich nur vom Besten operieren!«
Die Operation war tatsächlich nicht so einfach gewesen. Jedenfalls glaubte Fausto seitdem, daß er Max sein Leben verdankte. Und immer, wenn Fausto in München zu tun hatte, wurde Max von ihm zum Abendessen, in die Oper oder ins Konzert eingeladen. Normalerweise hielt er bei Patienten auf Distanz, aber Fausto hatte ein ausgesprochen einnehmendes Wesen, war sehr gebildet, sprach hervorragend Deutsch – und er war ein Genießer von hohen Graden. Jedenfalls konnte sich Max Faustos Charme nicht entziehen. Oft waren sie in München zusammengewesen, und im Laufe der Zeit hatte sich so etwas wie eine Freundschaft entwickelt.
Jetzt, da Max mit der Abnabelung von seinem Job Ernst machen wollte, war ihm wieder Faustos Einladung eingefallen. Ein kurzer Anruf, Fausto hatte sich fast überschlagen vor Freude, und nun war er da. Mal sehen, welche Überraschungen sein caro amico für ihn bereithielt.
»Junger Mann, könnten Sie mir bitte meine Tasche herunterheben?«
Max mußte lächeln, als ihm klar wurde, daß er mit dem »jungen Mann« gemeint war. Die alte Dame war ja eigentlich doch recht nett.
3
Das Fenster war einen Spalt geöffnet, ein leichter Windzug bewegte den weißen Vorhang. Im Hof gurrten Tauben. Im etwas antiquiert, aber durchaus freundlich eingerichteten Zimmer saß eine junge Frau im Lehnstuhl und las, neben ihr ein kleiner Tisch mit Spitzendecke und einer Karaffe Wasser und einem Glas. Die blonde Frau hatte einen schwarzen Kimono an. Das Haar war hochgesteckt und wurde von einem Kamm zusammengehalten. Ihr ungeschminktes Gesicht hatte klassische Züge und war von fast makelloser Schönheit. Nur zwei steile Falten auf der Stirn störten die Harmonie und zeugten von einer inneren Anspannung. Die Frau legte ihr Buch zur Seite und begann sich mit den Zeigefingern die Schläfen zu massieren, ganz langsam und immer im Kreis. Abgesehen von diesen leichten Kopfschmerzen ging es ihr gut. Der Aufenthalt in der psychosomatischen Privatklinik hatte ihr geholfen. Sie fühlte sich entspannt. Und sie hatte sich völlig unter Kontrolle.
Es klopfte an der Tür, eine Ärztin kam herein und setzte sich zu der Patientin.
»Na, Eva, wie geht es Ihnen heute? Haben Sie immer noch diese Kopfschmerzen?« In der Klinik wurden aus Gründen der Diskretion alle Patienten mit dem Vornamen angeredet.
Eva lächelte: »Nur ganz leicht, kein Problem. Aber sonst geht es mir gut, wirklich gut. Ich komme mir vor, als ob ich zur Kur gewesen wäre.«
»Das waren Sie doch auch. Ihr Aufenthalt bei uns war so etwas wie eine Kur. Eine Kur für Ihre Seele.« Die Ärztin schwieg und musterte Eva. Nach einer längeren Pause fragte sie: »Fühlen Sie sich befreit?«
»Befreit?«
»Ja, befreit. Befreit von dieser Stimme, von der Sie uns erzählt haben.«
»So sehr befreit, daß ich schon fast nicht mehr weiß, wovon Sie sprechen.«
»Das freut mich, Eva. Ich will auch gar nicht länger darüber reden. Die Stimme wird nicht mehr zurückkehren. Nie mehr! Haben Sie mich verstanden!«
»Klar habe ich das.« Eva schaute zum Fenster. »Ich hoffe bloß, Sie haben recht.«
»Sie müssen nur genauso fest davon überzeugt sein wie ich. Dann habe ich recht. Sie geben einfach der Stimme keine Chance mehr. Unter keinen Umständen. Jeden Versuch dieser Stimme, von Ihnen Besitz zu ergreifen, ersticken Sie im Keim. Eva, Sie haben eine starke Persönlichkeit, Sie schlagen einfach die Tür zu.«
»Am besten, ich mach die Tür gar nicht erst auf.«
»Gut, Eva, so gefallen Sie mir.«
»Und was ist mit den Tabletten? Muß ich die weiternehmen?«
»Das sollten Sie, ja, unbedingt, wenigstens vorläufig. Sie wissen ja, diese Pillen wirken beruhigend und dämpfen die Entstehung bestimmter Nervenimpulse, die für Ihre Halluzinationen mitverantwortlich sind. Nehmen Sie die Tabletten weiter. Ich schlage vor, daß Sie ungefähr in einem halben Jahr wiederkommen. Nur für einige Tage. Wir werden uns ein bißchen unterhalten. Und vielleicht können wir die Tabletten dann absetzen. Einverstanden?«
»Ja, einverstanden. Ich bin wirklich froh, daß ich den Weg in Ihre Klinik gefunden habe. Sie und Professor Runleger haben mir sehr geholfen.«
»Das ist doch schön, auf diese Weise haben wir beide Grund zur Freude.« Die Ärztin war aufgestanden und gab Eva kurz die Hand. »Wir sehen uns dann noch morgen vormittag. Bis dann, tschüs.«
Als die Tür ins Schloß fiel und die Schritte der Ärztin im Flur immer leiser wurden, machte Eva die Augen zu. Im Hof gurrten wieder die Tauben. Keine Stimme, nur die Tauben. Keine Stimme. Evas Gesicht wirkte entspannt. Auch die beiden Falten auf der Stirn schienen weniger tief.
Um achtzehn Uhr kam der Pfleger Karl vorbei.
»Hallo, Eva, ich hab gehört, Sie gehen morgen nach Hause. Haben Sie denn überhaupt kein Herz? Sie können doch nicht Ihren größten Verehrer einsam in der Wüste zurücklassen.«
Eva lachte. »Man will mich hier nicht mehr haben. Ich werde einfach weggeschickt. Da kann ich leider nichts machen. Aber ich denke, Sie werden es überleben.«
»Im schlimmsten Fall werde ich wahnsinnig«, erwiderte Karl mit einem freundlichen Grinsen, »doch das merkt hier sowieso keiner.«
»Sie haben einen seltsamen Humor.«
Karl stellte ein bauchiges Gefäß ins angrenzende Badezimmer. »Verehren Sie uns zum Abschied noch eine Urinprobe?«
»Mit dem größten Vergnügen. Ich werde diese netten Abwechslungen vermissen.«
»Das glaube ich Ihnen aufs Wort.« Karl schaute auf die Uhr. »Gleich gibt’s Essen.«
Die Stunden vergingen. Es war abends um zehn Uhr. Eva lag im Kimono auf dem Bett. Sie hatte kein Licht eingeschaltet. Nur der laufende Fernseher sorgte für eine flackernde Beleuchtung. Der Kopfhörer lag neben dem Bett auf dem Fußboden. Eva starrte an die Decke. Ihre Hände hatte sie zu Fäusten geballt. Die Knöchel traten weiß hervor. Auf ihrer schweißnassen Stirn waren die Falten tief eingegraben.
Ihre Lippen bewegten sich. »Nein, bitte nicht, nein!«
Eva nahm die Hände hoch und hielt sich die Ohren zu.
»Nein, ich will dich nicht hören. Laß mich in Ruhe!«
»Eva!«
»Nein, ich bin nicht da«, flüsterte Eva.
»Eeeeva!«
Eva trampelte mit den Füßen auf den Bettbezug.
»Laß mich in Ruhe! Bitte, bitte, laß mich in Ruhe!«
»Du weißt doch, das geht nicht.«
»Nein, nein.« Über Evas Gesicht lief eine Träne. »Nein.«
Ihre Bewegungen wurden langsamer. Die Verkrampfung schien sich zu lösen. Evas angespannte Gesichtszüge glätteten sich. Nur ihre Augen wirkten seltsam starr. Sie faltete die Hände über der Brust. So blieb sie einige Minuten liegen.
»Braves Mädchen. Jetzt bist du wieder meine kleine Marionette. Richtig?«
Ganz langsam nickte Eva mit dem Kopf. Die Stimme hatte erneut von ihr Besitz genommen. Sie fühlte sich willenlos. Vergessen waren alle Vorsätze. Der Widerstand gebrochen. Fast war sie erleichtert. Es bedurfte keiner großen Anstrengung mehr. Sie würde auf die Stimme hören, jene Stimme, die ihr so vertraut war.
»Eva, warum hast du versucht, mich loszuwerden? Diese Behandlung in der Klinik. Das war nicht lieb. Du brauchst mich doch.«
»Ich weiß, ich brauch dich. Ich hab dich immer gebraucht«, murmelte sie.
»Ich vergebe dir. Aber mach so etwas nie wieder. Und die Tabletten, du weißt, das ist Teufelszeug. Du wirst abhängig werden und bist nicht mehr du selbst. Keine Tabletten. Du schmeißt sie jetzt sofort in die Toilette! Steh auf!«
Eva erhob sich vom Bett, ging wie in Trance zu dem kleinen Tisch, nahm die Plastikdose, lief ins Bad und schüttete die Tabletten ins Klo. Schon nach dem ersten Ziehen der Spülung waren sie alle verschwunden. Die leere Dose steckte sie in ihre Handtasche.
»Gut gemacht, Eva. Eva? Hörst du mich? Ja, du hörst mich. Eva, ich brauch noch einen richtigen Beweis, daß du wieder mein braves Mädchen bist. Du mußt etwas tun. Bist du bereit?«
Wieder nickte Eva mit dem Kopf. »Ja, ich bin bereit.«
»Dein Pfleger Karl ist ein Schwein!«
»Nein, er ist nett«, flüsterte Eva, die mitten im Raum stand und auf die leere Wand neben der Tür starrte.
»Kein Widerspruch, Eva. Er ist ein Schwein. Hast du das nicht gemerkt. Die Tabletten haben dich blind gemacht. Dieser lüsterne Blick, wie ihm das Wasser im Mund zusammenläuft. Die geile Sau zieht dich mit den Augen aus. Nackt stehst du vor ihm, völlig nackt. Und er stiert dir ständig auf die Titten. Ein perverser Spanner ist dein Pfleger. Am liebsten würde er dich flachlegen, im Bad, auf dem Kachelboden neben der Wanne. Die Kleider möchte er dir vom Leib reißen und es dir besorgen. Er ist ein perverses, feiges Schwein.«
»Das glaube ich nicht«, erwiderte Eva, den Blick weiter auf die weiße Wand gerichtet.
»Doch, du glaubst es. Weil ich es dir sage. Und weil du mein braves Mädchen bist. Ich habe dir wieder einmal die Augen geöffnet. In dieser Welt gibt es soviel Niedertracht, soviel Abschaum. Ach, was bist du naiv und schutzlos. Aber ich passe auf dich auf. Hab keine Angst. Du weißt, was du jetzt tun mußt? Du verpaßt diesem geilen Bock einen Denkzettel. Das verlange ich von dir. Das mußt du tun, nicht für mich, sondern für dich.«
Eva atmete tief durch. Sie würde der Stimme gehorchen. Sie wußte es. Der Stimme gehorchen, wie sie es immer getan hatte. Eva machte einige Schritte zur Tür hin, drückte leise die Klinke hinunter und sah durch den schmalen Spalt. Sie hatte das Zimmer am Kopfende. Vor ihr lag der lange, verlassene Flur, rechts und links die Türen zu den Zimmern der Patienten. Ganz vorne am anderen Ende des erleuchteten Gangs war das Zimmer für das Pflegepersonal. Und gleich dahinter ging es an der Treppe vorbei zum Lift.
Ohne den Flur aus den Augen zu lassen, zog Eva den seidenen Gürtel ihres Kimonos stramm. Dann schlich sie sich barfuß aus dem Zimmer. Auf den Zehenspitzen eilte sie über den alten Parkettfußboden, vorbei an den vielen Türen, vor zum Zimmer des Pflegers. Dort angekommen, spähte sie um die Ecke.
Karl stand vor einem weißen Tisch und ordnete auf einem großen Tablett eine Vielzahl kleiner Flaschen, die er vorher alle akkurat beschriftet hatte. Es handelte sich um die Urinproben der gesamten Etage. Hinzu kamen einige Blutentnahmen. Karl warf einen kurzen Blick auf die Leiste mit den Lämpchen. Alle waren ausgeschaltet, die meisten Patientinnen und Patienten schliefen wahrscheinlich schon. Keiner brauchte Hilfe. Später würde er einen Kontrollgang durch die einzelnen Zimmer machen, die Fenster kippen, Fernseher ausschalten und Bettdecken hochziehen. Aber vorher wollte er noch die Proben runter ins Labor bringen. Er nahm das Tablett an den beiden Griffen und hob es hoch. Mit all den Gläsern darauf eine etwas kipplige Angelegenheit, aber er hatte ruhige Hände. Er hielt es nicht für nötig, den Rollwagen zu holen, den er im Erdgeschoß vergessen hatte.
Seit zwanzig Jahren schon arbeitete er in dieser Klinik. Er verdiente nicht viel, doch er lebte bescheiden, da machte das nichts. Und er fühlte sich wohl bei seiner Arbeit. Karl liebte den Kontakt zu den Menschen, die für einige Tage, Wochen oder gar Monate blieben. Er hatte ein gutes Gespür für die meisten. Fast immer gelang es ihm, einen Zugang zu finden. Er hatte das Gefühl zu helfen, auf seine ganz persönliche Art und Weise. So, wie es die Doktoren niemals konnten. Karl drehte sich mit dem Tablett in den Händen um. Er verließ das Zimmer und ging zum Lift. Eva hatte sich hinter einem Mauervorsprung versteckt. Als Karl an der steilen Treppe vorbeikam, die hinunter ins Erdgeschoß führte, hörte er hinter sich ein Geräusch. Langsam drehte er sich um, vorsichtig das Tablett mit den Gläsern balancierend. Nur zwei Meter vor ihm stand Eva.
»Eva, was machen Sie denn hier so spät abends auf dem Gang?« fragte Karl mit besorgter Stimme. »Haben Sie ein Problem? Sie hätten doch auf den Knopf am Bett drücken können, ich wäre sofort gekommen.«
Eva sah Karl in die Augen. Dann löste sie den Gürtel und öffnete ihren Kimono. Sie hatte nichts darunter an. Eva atmete schwer, und ihre Brüste hoben und senkten sich.
»Ist es das, was du sehen willst?« Ihre Stimme klang unnatürlich heiser.
Karl schaute völlig irritiert auf Evas Körper, dann wieder in ihr Gesicht. Seine Hände zitterten, die Gläser mit den Urin- und Blutproben begannen zu klirren.
»Wie kommen Sie denn darauf? Bitte bedecken Sie sich wieder und gehen schnell in Ihr Zimmer zurück.« So etwas war ihm in seiner ganzen Zeit als Pfleger noch nicht passiert.
»Schau mich nur an. Macht dich das heiß? Gib’s zu, das macht dich heiß. Du bist geil auf mich.«
»Ich, ich …«, stotterte Karl.
»Wie fühlt man sich als perverses Schwein? Du solltest dich schämen!« Eva ließ den Kimono zu Boden gleiten, stützte die Hände herausfordernd in die Hüften und schob sich näher. Karl machte einen Schritt rückwärts zur Treppe. Die Glasgefäße auf dem Tablett tanzten immer stärker.
Um Gottes willen, dachte Karl, was will dieses Weib? Die ist ja völlig irre geworden. Eva war nur noch wenige Zentimeter vom Tablett entfernt. Da hatte er sich zu allem Überfluß noch in eine ungünstige Lage manövriert. Hinter ihm die steile Treppe, in den Händen diese blöden Gläser und vor ihm diese Wahnsinnige.
»Jetzt hast du Schiß, stimmt’s?« hörte Karl Evas heisere Stimme. Was ist denn mit ihren Pupillen los? Die sind so groß und starr.
»Willst du abhauen, du Schlappschwanz? Dann hau ab, hinter dir ist die Treppe.«
Natürlich will ich abhauen, dachte sich Karl. Nur schnell weg von hier. Und dann sofort den diensthabenden Arzt alarmieren. Karl drehte sich um. Hoffentlich fallen mir auf dieser steilen Treppe nicht die Gläser vom Tablett. Er machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne. In diesem Moment bekam er einen mächtigen Schlag in den Rücken. Eva war ihm mit beiden Füßen ins Kreuz gesprungen. Während sie schon wieder wie eine Katze auf die Beine geschnellt war, stürzte Karl die Treppe hinunter. Am Ende der Stufen krachte er kopfüber in die Mauer des Treppenhauses. Um ihn herum splitterten die Gläser. Urin und Blut spritzte gegen die Wände.
Eva warf von oben einen verächtlichen Blick auf die regungslose Gestalt. Der Kopf des Pflegers war unnatürlich zur Seite gedreht.
»Gute Nacht«, krächzte Eva. Dann machte sie kehrt und spurtete los. Im Vorbeirennen bückte sie sich nach dem Kimono. Nackt und mit fliegenden Haaren eilte sie den Gang hinunter. Trotz der Hast glitten ihre bloßen Füße fast lautlos über den Boden. Nur noch wenige Meter, jetzt hatte sie ihr Zimmer erreicht. Leise zog sie die Tür hinter sich ins Schloß.
4
Mit ausgebreiteten Armen kam Fausto auf Max zugeschritten. »Benvenuto in Italia«, schallte es durch die Ankunftshalle des Flughafens Galileo Galilei in Pisa. »Amico mio, come sono contento di rivederti, ich freue mich so sehr.« Und ehe es sich Max versah, drückte ihn Fausto an seine mächtige Brust. »Wie war der Flug? Tutto bene?«
»Ja, tutto bene«, antwortete Max lachend und befreite sich aus der Umarmung. »Der Flug war herrlich, die Sonne scheint, der Himmel ist blau.«
»Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me«, fing Fausto unversehens das Singen an, um sich dann selbst mit einem Räuspern zu unterbrechen. »Habe ich es dir doch gesagt, die Toskana ist herrlich. Und der blaue Himmel ist erst der Anfang.«
Mit einer ausholenden Handbewegung stellte Fausto seinen Begleiter vor. »Das ist Enzio, er kümmert sich um dein Gepäck. Ich sehe, du hast dein Golfbag mitgebracht. Buona idea, da können wir einige Runden zusammen spielen. Es gibt viele schöne Golfplätze in dieser Gegend, du wirst sehen.«
Fausto hatte Max untergehakt und schlenderte mit ihm zum Ausgang. »Wie lange bleibst du? Hoffentlich hast du etwas Zeit.«
»Eine gute Woche. So viel Urlaub habe ich schon lange nicht mehr am Stück genommen.«
»Da machst du aber irgend etwas entschieden falsch«, kommentierte Fausto. »Der Mensch braucht Urlaub und Abwechslung. Il riposo è importante. Verstehst du? Immer nur lavoro, das ist nicht gesund. Paß nur auf, am Ende bekommst du noch einen Herzfehler.« Fausto boxte Max feixend in die Rippen. »Und du kannst dich doch nicht selbst operieren.«
Vor der Ankunftshalle stand ein alter schwarzer Lancia, ein rechtsgesteuertes Modell aus den frühen fünfziger Jahren.
»Scusa, kein BMW oder Mercedes. Ich liebe alte italienische Autos. Ah, i vecchi tempi, als ein Enzo Ferrari noch selbst Rennen gefahren ist. Ein Ettore Bugatti oder Vincenzo Lancia. Das waren Zeiten. Der große Tazio Nuvolari hat als Privatwagen einen Lancia Augusta chauffiert. Felice Bonetto ist 1953 mit einem ganz ähnlichen Lancia Dritter bei der Mille Miglia geworden. Damals haben wir noch Autos mit großem Charakter gebaut, capisci?« Mit einer theatralischen Geste öffnete Fausto den linken Wagenschlag. »Prego.« Und als er den kurzen Blick von Max zu Enzio und seinem Gepäck bemerkte, meinte er: »Non preoccuparti, Enzio kommt mit dem Gepäck nach.«
Fausto startete den Motor, und als der alte Sechszylinder zuverlässig zu röhren begann, lehnte er sich mit einem zufriedenen Lächeln zurück und ließ die Kupplung kommen.
Max verlor schnell die Orientierung. Gerade war da noch ein Schild Pisa zu sehen, dann Viareggio und jetzt Lucca. Er hatte keine Ahnung, wo Fausto genau wohnte. In einer Stadtwohnung oder auf dem Land? Er wollte sich überraschen lassen. Jedenfalls hatte Fausto am Telefon gesagt, daß Max bei ihm wohnen könne. Er habe noch eine Ecke frei. Fausto steuerte den Lancia zügig über die Landstraßen. Die linke Hand ständig am Schaltknüppel, fuhr er nach Möglichkeit Ideallinie und unbekümmert über alle durchgehenden Mittelstreifen. »Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro …«, sang er fröhlich vor sich hin. Max spürte, wie das positive Lebensgefühl langsam auf ihn überging. Der alte Lancia roch nach Benzin und Leder. Der Motor ließ ein kräftiges Gurgeln hören. Faustos rauhe Stimme schwankte zwischen Paolo Conte und Adriano Celentano. Am Straßenrand zogen Platanen vorbei. Als er bei einem kleinen Obststand kurz hupte, winkte ihnen eine alte Frau zu. Max kurbelte das Fenster herunter und ließ sich den Fahrtwind ins Gesicht wehen. Jetzt roch es nach Oleander. Oder war das der Geruch von Flieder? Warum war er nicht schon viel früher Faustos Einladung gefolgt?
Nach einer knappen halben Stunde Fahrt schaltete Fausto herunter, der Lancia antwortete mit einer Fehlzündung, und mit quietschenden Reifen bog er rechts ab in eine kleine Straße.
»Es ist nicht mehr weit, wir sind gleich da.«
Sie fuhren durch ein offenstehendes schmiedeeisernes Tor. Weiter ging es durch eine Zypressenallee, die leicht bergan führte. Sieht nicht gerade bescheiden aus, dachte Max.
»Du lebst auf dem Land?«
»Sì, sì, in campagna«, antwortete Fausto lachend. »Aber ich bin kein contadino, kein Bauer, leider, ich bin nur ein avvocato.«
Die Zypressenallee hörte auf. Vor ihnen lag eine große Wiese. Und dahinter …
»Da wohnst du?« staunte Max.
»So ist es, Max. Ich hoffe, es gefällt dir.«
»Ob es mir gefällt? Ich bin sprachlos.«
Max blickte auf einen kleinen Barockpalast, davor antike Statuen und eine große Freitreppe. Der Kies knirschte unter den Rädern, als Fausto den alten Lancia vor einem Portal mit zwei großen steinernen Löwen ausrollen ließ.
»Allora, das ist meine – wie sagt man bei euch in Deutschland? – meine bescheidene Hütte.«
»Du bist vielleicht ein Spaßvogel. Du lebst ja hier wie ein Renaissancefürst.«
»Il Rinascimento, ja, das wäre schön«, erwiderte Fausto und schnalzte mit der Zunge. »Dann hätte ich eine Kutsche mit prächtigen Pferden, eine Schar von Dienern, ja, und vor allem Kurtisanen, wunderschöne, blonde Frauen, die sich mir in Liebe hingeben.« Fausto stöhnte. »Aber wir leben im 20. Jahrhundert. Das Leben ist hart und ungerecht.«
»Entsetzlich, mir kommen die Tränen.«
5
Es war im vorigen Jahr, als am 14. August, kurz nach Sonnenuntergang, auf der Fähre von Livorno nach Cagliari auf dem Parkdeck Feuer ausbrach. In einem Wohnmobil hatten Urlauber versehentlich einen Campingkocher angelassen. Zunächst brannte das Feuer im Kücheneck des verlassenen Wohnmobils harmlos vor sich hin. Mit etwas Glück wäre irgendwann das Propangas ausgegangen. Aber die Passagiere der Fähre, sie hatten kein Glück an diesem Vorabend des Mariä-Himmelfahrts-Festes. Die meisten Fahrgäste hielten sich im Hauptrestaurant auf und freuten sich auf die bevorstehenden Urlaubstage auf Sardinien. Es waren an diesem Abend sehr viele Italiener an Bord, denn zu Ferragosto macht fast ganz Italien Urlaub. Im Wohnmobil auf dem verlassenen Parkdeck, wo ein Auto dicht neben dem anderen stand, brannte das Propangasfeuer munter vor sich hin. Das kleine Schiebefenster über dem Kocher stand offen. Die Fähre war bereits an Elba vorbei, rechts lag die Insel Korsika. Der Wind über dem Mare Tirreno frischte auf, zerstob den Schaum auf den brechenden Wellen. Er fuhr in die Haare von Carlotta Manzini, die an der Reling auf dem Vordeck stand und zu den Lichtern von Porto Vecchio hinübersah. Ihr Mann Paolo würde gleich wiederkommen, er war ins Parkdeck hinuntergelaufen, um für Carlotta aus dem Alfa Romeo einen Pulli zu holen. Carlotta legte den Kopf in den Nacken und schloß die Augen. Sie genoß den frischen Wind, der ihre Wangen kühlte. Carlotta lebte in einem kleinen Dorf in der Nähe von Cecina. Ihr Mann Paolo war Arzt am Hospital von Cecina, sie Lehrerin für Sport. Nicht nur Paolo fand, daß Carlotta eine bemerkenswert schöne Frau war. Carlotta stammte aus Rom. Ihre Augen waren fast so schwarz wie ihr Haar. Ihre Haut hatte auch im Winter einen angenehmen braunen Teint. Durch den Sportunterricht war Carlotta trotz ihrer Eßleidenschaft schlank und geschmeidig. Die vierzig Jahre sah man ihr nie und nimmer an.
Carlottas Gedanken eilten dem Schiff voraus. Paolo hatte ihr zum Geburtstag eine Woche im Süden Sardiniens geschenkt, in jenem kleinen Hotel am Strand von Santa Margarita, versteckt in den Pinienwäldern, das türkisfarbene Meer direkt vor der Terrasse – ganz so wie vor Jahren auf ihrer Hochzeitsreise. Sie würde die Tage mit ihm alleine verbringen. Die siebenjährige Tochter Gianna hatten sie bei der nonna, der Mutter von Paolo, in Livorno gelassen, nicht ganz ohne Trennungsschmerz. Und doch freute sie sich darauf, wieder einmal mit Paolo ganz intensiv zusammensein zu können, ohne die quirlige Gianna, die sonst immer im Mittelpunkt ihrer kleinen Familie stand.
Der auffrischende Wind, er wirbelte nicht nur Carlottas Haare durcheinander, er blies auch immer heftiger über das mächtige Heckluk der Fähre. Und er pfiff durch das kleine Schiebefenster über dem einsamen Propanfeuer. Der geblümte Vorhang blähte sich auf, rutschte immer mehr in die Mitte, vollführte einen wilden Tanz über dem kleinen, aber kräftigen Feuer. Erst verkokelten die Fransen der Borte, dann fing der Vorhang Feuer. Dieses griff rasch auf das Inventar über. Kissen und Sitzbezüge gingen in Flammen auf. Das Bettzeug fing zu lodern an. Schließlich explodierte die Propangasflasche. Das weggesprengte Dach des Wohnmobils rotierte durch das Parkdeck. Unglückseligerweise stand direkt daneben ein Lkw mit leichtentzündlicher Ladung. Später sollte in der Öffentlichkeit, in den Medien und vor den Gerichten heftig über die Sicherheitsbestimmungen an Bord der Fähre diskutiert werden. Jedenfalls fand das Feuer rasend schnell neue Nahrung. Die ersten Fahrzeugtanks explodierten. Als die Rauchmelder reagierten, auf der Kommandobrücke Warnlampen aufblinkten und die automatische Sprenkleranlage auf dem Parkdeck in Aktion trat, da war es schon zu spät. Das Feuer wurde von der frischen Brise des Meeres nach vorne gepeitscht. Paolo hatte keine Chance. Carlottas Mann, der mit dem Pulli über dem Arm gerade seinen Alfa absperren wollte, sah die Feuerwalze auf sich zukommen. Er ließ den Pulli fallen und rannte zwischen den Autos davon. Aber das Feuer war schneller.
Paolo war das erste Todesopfer. In den nächsten Minuten sollten weitere folgen. Der Kampf gegen das Feuer hatte noch gar nicht begonnen und war doch schon entschieden. Eine große Rettungsaktion lief an. Schwimmwesten wurden ausgegeben, Passagiere drängten sich in die Rettungsboote, andere sprangen über Bord. Aus den Häfen von Bastia, Olbia und Civitavecchia liefen Seenot- und Löschschiffe aus. Helikopter starteten. Ein Kreuzfahrtschiff änderte den Kurs und hielt auf die Fähre zu.
»Paolo, Paolo!« schrie Carlotta immer wieder. Auf der Suche nach ihrem Mann stemmte sie sich gegen die auf sie zuströmenden Menschen und den beißenden Rauch, ein ebenso unvernünftiges wie aussichtsloses Unterfangen. Ein Mitglied der Schiffsbesatzung zwang Carlotta zur Umkehr. Ihr Mann sei bestimmt schon längst in Sicherheit, schrie er ihr ins Ohr. Jetzt müsse sie sich verdammt noch mal selbst retten. Er schob Carlotta in ein Rettungsboot, das Sekunden später zu Wasser gelassen wurde.
Vierundfünfzig Tote gab es in jener Nacht vor Mariä Himmelfahrt. Sechshundertvierundzwanzig Passagiere konnten gerettet werden. Unter ihnen Carlotta. Die ausgebrannte Fähre sank in Sichtweite von Korsika und Sardinien auf der Höhe von Bonifacio.
Es sollte Monate dauern, bis Carlotta wirklich begriff, daß sie jetzt Witwe war. Daß Paolo nicht mehr lebte. Daß Gianna keinen Vater mehr hatte. Daß sie mit ihrem gemeinsamen Leben fortan alleine fertig werden mußte. Gott sei Dank hatte sie ihre Arbeit als Lehrerin. Oft war sie mit ihrer Schwiegermutter in Livorno zusammen. Ihre eigenen Eltern sah sie seltener, denn sie lebten in Rom. Den vielen Freunden, die ihr helfen wollten, über Paolos Tod hinwegzukommen, gab sie häufig einen Korb, nicht, weil sie deren Bemühungen nicht zu schätzen wußte, aber Carlotta war lieber alleine. Alleine mit Gianna, die zwar auch unter dem Tod ihres Vaters litt, aber mit ihrem kindlichen Gemüt und fröhlichen Temperament für täglichen Sonnenschein sorgte. Alleine mit der Schwiegermutter, in deren Gesicht sie Züge von Paolo wiederzufinden glaubte. Und alleine mit ihrer geliebten Tante Isabella. Eigentlich war die Contessa keine richtige zia von ihr, aber sie war die beste Freundin ihrer Mutter, und seit sich Carlotta erinnern konnte, war Isabella ein festes Mitglied ihrer Familie gewesen. Die Contessa Isabella di Balduccio gehörte einem uralten toskanischen Adelsgeschlecht an, hatte aus unerfindlichen Gründen nie geheiratet und lebte die meiste Zeit des Jahres auf ihrem Landsitz in den Colline hinter Bolgheri. Hier war Carlotta am liebsten. Bis tief in die Nacht unterhielt sie sich mit ihrer Tante. Dabei konnte die Contessa bemerkenswerte Mengen von Rotwein konsumieren, der von ihrem eigenen Gut stammte. Und wenn sie dann endlich schlafen gingen, schauten sie bei Gianna vorbei, die friedlich in ihrem Bettchen lag. Da war die Welt dann fast, aber eben leider nur fast in Ordnung.
Auch ihre Tante Isabella meinte, daß sie wieder etwas unter Leute kommen sollte – mal eine Einladung zu einem Essen annehmen, das Konzert in der Kirche Santa Maria Assunta. Warum sie nicht gekommen sei? Die Vernissage am letzten Mittwoch in Montescudaio. Da hatte sie doch schon zugesagt. Carlotta versprach, sich zu bessern. Und wußte doch, daß sie noch nicht soweit war.
6
Als Max am Abend die Treppe in der großen Halle hinunterging, blieb er auf halber Höhe stehen, um die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Die Stimme von Enrico Caruso hallte durch den Raum. Offenbar hatte Fausto eine Schallplatte mit einer alten Aufnahme von Puccinis Oper La Bohème aufgelegt. Im offenen Kamin knisterte das Feuer. Zwei riesige Kandelaber sorgten für üppigen Kerzenschein.
»Ma quando vien lo sgelo il primo sole è mio«, hörte Max einen Sopran. »Doch fängt es an zu tauen, ist die erste Sonne mein.«
Max zündete sich versonnen ein Zigarillo an. Er dachte an Giacomo Puccini, der nicht weit von hier in Lucca das Licht der Welt erblickt hatte. Sein Vater war Domkapellmeister gewesen, wie bereits sein Großvater und Urgroßvater. Schon in jungen Jahren hatte sich Giacomo als Organist betätigt. Noch viel lieber spielte er aber in Tavernen und bei Volksfesten auf dem Klavier. Später schaffte er dann die Aufnahmeprüfung am berühmten Mailänder Konservatorium, eine gefürchtete Klippe, an der einst sogar der junge Verdi gescheitert war. Nach seinem Studienabschluß beteiligte sich Puccini an einem Preisausschreiben einer Theaterzeitschrift. Unter Zeitnot komponierte er eine kurze Oper. Die Enttäuschung war groß, als er keinen Preis gewann. Angeblich war seine Notenschrift zu unleserlich, ein Makel, der ihm sein ganzes Leben lang anhaften sollte. Um so größer der Triumph, als Le Willis kurz darauf zur Aufführung kam und ein riesiger Erfolg wurde. Eilig schrieb Puccini eine Neufassung. Die Oper Le Villi hatte 1884 im Turiner Teatro Regio Premiere. Es folgten Aufführungen an der Mailänder Scala, in Buenos Aires und Hamburg. Aus jener Zeit stammen die ersten Fotos, auf denen Puccini mit frechem Grinsen, die obligatorische Zigarette im Mundwinkel und den Hut keck auf dem Kopf, die Opernwelt herauszufordern schien. Und rasch lagen ihm nicht nur die Opernfreunde, sondern auch die Frauen zu Füßen. In Mailand gab er einer gewissen Elvira Gemignani Gesangsunterricht. Bald hatten sie eine stürmische Liebesbeziehung. Das wäre weiter nicht schlimm gewesen, aber Elvira war verheiratet und hatte zwei Kinder. Als sie ihren Mann verließ und zu Giacomo Puccini zog, war der Skandal perfekt. Zu allem Überfluß war der betrogene Ehemann ein alter Schulfreund Puccinis aus Lucca. Die Wogen schlugen so hoch, daß Puccini allen Ernstes erwog, nach Südamerika auszuwandern. Auch war seine nächste Oper, Edgar, ein ziemlicher Mißerfolg. Aber Puccini gab nicht auf. Er ließ sich von der schmachtenden Leidenschaft in einem französischen Roman fesseln und komponierte allen Widrigkeiten zum Trotz Manon Lescaut. Die letzten Takte entstanden in Torre del Lago, dort, wo Puccini fortan hauptsächlich leben sollte. Manon Lescaut wurde 1893 in Mailand uraufgeführt. Der Erfolg war überwältigend und der endgültige Durchbruch geschafft. 1896 folgte La Bohème, im Jahre 1900 Tosca. Puccini konnte weite Reisen unternehmen. Er ging auf die Jagd – auf Wasservögel, aber auch auf Frauen. Und mit großer Leidenschaft fuhr er Motorboot, auf ebenjenem Lago di Massaciuccoli, den Max aus dem Flugzeug beim Landeanflug auf Pisa gesehen hatte. Puccini schrieb Madame Butterfly. Nach dem Premierenfiasko eroberte schließlich auch diese Oper die Bühnen der Welt. Mit zunehmendem Alter entwickelte Puccini einen depressiven Wesenszug. Was in seinen jungen Jahren Melancholie war, mündete in eine ausgesprochene Schwermut. Obwohl er immer noch mit Elvira zusammenlebte, begann er ein Verhältnis mit einer verheirateten Engländerin, Sybil Seligman. Das dürfte für Elvira nicht überraschend gewesen sein, denn Puccini hatte immer seine Amouren. Aber unglückseligerweise war Elvira in hohem Maße eifersüchtig. Einmal trieb sie eine Hausangestellte in den Selbstmord, nur weil sie glaubte, daß diese ein Liebesverhältnis mit Giacomo Puccini hatte. Elvira wurde dafür zu einer Zuchthausstrafe verurteilt, die sie allerdings nicht antreten mußte, da Puccini den Verwandten der Hausangestellten eine Entschädigung zahlte. Jedenfalls blieb Puccini der Engländerin Sybil bis zu seinem Tod verbunden. Noch während seiner Arbeit an Turandot erkrankte Puccini an Kehlkopfkrebs. Er starb 1924. Bei der Trauerfeier im Mailänder Dom dirigierte Toscanini das Requim aus Edgar.
Max hatte sich bei einem Treppenabsatz an das Geländer gelehnt und lauschte der Musik von Puccini. Erst als Fausto in die Halle gestürmt kam, fand Max in die Gegenwart zurück.
»Vieni, vieni«, rief Fausto, »auf der Terrasse wartet ein Aperitivo auf dich.«
»Ich komm ja schon«, erwiderte Max. »Du mußt entschuldigen, aber ich war mit meinen Gedanken gerade bei Puccini.«
»Puccini, ja, ich liebe seine Musik. Puccini, das war ein wirklich großer Maestro. Aber ein lausiger Autofahrer.«
»Was bringt dich denn da drauf?«
»Weil er bei einem schweren Autounfall fast ums Leben gekommen wäre. Das war 1903 mitten in seiner Arbeit an Madame Butterfly, da hatte er einen üblen Crash. Damals ist ja noch kaum jemand Auto gefahren. Aber Puccini zählte zu den begeisterten Pionieren. Schon dafür könnte ich ihn lieben. Doch am Steuer war er immer zu veloce, verstehst du? Etwas mehr adagio wäre besser gewesen. Na ja, jedenfalls war er hinterher für einige Zeit an den Rollstuhl gefesselt. Und weißt du, in welchem Auto ihm das passiert ist? In einem Lancia, stell dir vor.«
Mittlerweile war Max die Treppen hinuntergegangen und stand nun neben Fausto, den die Tatsache, daß Puccini in einem Lancia fast gestorben wäre, in eine tiefe Verzweiflung zu stürzen schien. Von einem Augenblick auf den anderen fing er wieder zu lachen an und schlug Max auf die Schulter. »Andiamo, jetzt komm endlich auf die Terrasse, es ist noch wunderbar warm draußen, und Enzio macht gerade eine Flasche Prosecco auf. Ich habe gedacht, wir bleiben heute abend zu Hause. Alleine, ohne Gäste, einfach zwei gute Freunde, die was Feines essen werden und dazu einige Flaschen Wein aufmachen. Einverstanden?«
»Klingt gut, sehr gut sogar, ich bin mehr als einverstanden.«
»Wir sind beide geschieden. Das haben wir uns so nicht ausgesucht. Aber das hat auch Vorteile. Wir können einen entspannten Abend ohne diese schnatternden Wesen verbringen. Das ist wahre Lebensart.«
»Ich dachte, du liebst die Frauen?«
»Natürlich liebe ich die Frauen, ich verehre sie geradezu, ich begehre sie, sie sind ein Geschenk des Himmels.« Fausto rollte theatralisch mit den Augen. Dann senkte er verschwörerisch die Stimme: »Aber wenn sie einen mal für einen Abend in Frieden lassen, dann ist das auch kein Fehler.«
Max und Fausto gingen auf die Terrasse und machten es sich in Korbsesseln bequem. Enzio reichte ihnen die Gläser mit dem Prosecco.
»Alla salute, amico, noch einmal herzlich willkommen.«
»Cin cin«, prostete Max zurück, »und herzlichen Dank für deine Einladung.«
»Bah«, winkte Fausto ab und klopfte sich auf die Brust. »Hättest du mir nicht mein Herz geflickt, dann könnte ich mir die Zypressen von unten anschauen.«
»Erlaubst du mir eine indiskrete Frage?« sagte Max nach einer Pause und schaute Fausto grübelnd an.
»Aber natürlich. Unter Freunden gibt es keine Indiskretionen.«
»Ich weiß von dir nur, daß du Rechtsanwalt bist. Nun, auch bei uns verdienen manche Rechtsanwälte nicht schlecht, aber einen solchen Palast können sich wohl nur die wenigsten leisten. Hast du den von deinen Vorfahren ererbt, oder verdienst du soviel?«
Fausto lachte. »Von meinen Vorfahren? Nein, das waren relativ arme Leute. Meine Familie kommt aus Sizilien, mußt du wissen. Auch ich bin dort geboren.«
»Bist du aus Palermo? Da war ich einmal vor einigen Jahren.«
Fausto zögerte kaum merklich. »Nein, aber nicht sehr weit von da, ein kleiner Ort im Herzen Siziliens, er heißt Corleone.«
»Kenne ich nicht, obwohl, der Name klingt irgendwie vertraut.«
»Das kommt vor«, sagte Fausto. »Doch um deine eigentliche Frage zu beantworten, ich habe mir alles selbst verdient.«
»Und wie hast du das geschafft? Bist du Scheidungsanwalt?«
»Per amor di Dio, nein. Ich bin auf Wirtschaftsrecht spezialisiert, und auch etwas auf Strafrecht.« Fausto musterte kurz seinen Freund. »Ich habe nur einen sehr kleinen Klientenkreis, aber das sind alles Leute mit Geld und Einfluß. Ich helfe ihnen etwas bei ihren Geschäften und wenn sie mal in Schwierigkeiten stecken sollten. Im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten. Dafür werde ich angemessen bezahlt.«
7
Eva saß in einem Café. Obwohl der Himmel wolkenverhangen war, hatte sie eine Sonnenbrille auf. Vor ihr lag neben der Cappuccino-Tasse eine aufgeschlagene Tageszeitung. »Pfleger in Irrenanstalt zu Tode gestürzt« stand in großen Lettern auf der Titelseite.
»Irrenanstalt?« flüsterte Eva. »Eine Anstalt für Irre? Die sind wohl wahnsinnig, haben keine Ahnung.«
Eva dachte an die psychosomatische Privatklinik im Taunus bei Frankfurt. Erst gestern vormittag hatte sie die Klinik wie geplant verlassen. Nach einer gut zweimonatigen Kur für Leib und Seele. Eine Irrenanstalt war das nun wirklich nicht gewesen. So ein Quatsch. Nur um eine reißerische Überschrift zu formulieren. Manchmal verstand Eva ihre Kollegen nicht. Sie war ja selbst Journalistin, doch so einen Blödsinn würde sie nie verfassen. Ein kleines, aber feines Sanatorium war das. Und wer dort hinging, der tat das nicht nur freiwillig, er oder sie mußte es sich auch leisten können. Eva dachte an ihren Aufenthalt zurück. Die Betreuung hatte ihr gutgetan. Sie fühlte sich entschieden besser. Sie machte ihre Handtasche auf und suchte die Dose mit den Tabletten. Eva hatte der Ärztin versprochen, daß sie jeden Tag ihre Tabletten nehmen würde. Da war die Dose. Aber sie war leer. Keine Tabletten. Was hatte sie nur mit den Tabletten gemacht? Gestern war die Dose doch noch voll gewesen. Eva steckte sie in die Handtasche zurück. Sie würde nachher die Ärztin anrufen und sich ein Rezept schicken lassen. So was Dummes. Was war nur mit den Tabletten passiert? Warum konnte sie sich nicht daran erinnern? Sie stöhnte leise, machte ein Hohlkreuz und drückte mit der rechten Hand gegen ihren Rücken. Und außerdem hatte sie seit gestern Rückenschmerzen. Ganz so, als ob sie unglücklich gestürzt wäre. Aber auch daran konnte sie sich nicht erinnern. Na egal, das würde wieder vergehen. Hauptsache, die Halluzinationen kommen nicht wieder. Welche Halluzinationen? Eva verbot sich, überhaupt daran zu denken. Der Verschluß ihrer Handtasche schnappte zu.
Sie nahm einen Schluck vom Cappuccino und freute sich, daß er richtig zubereitet war, mit aufgeschäumter Milch, so wie es sich gehört, und etwas Kakao darüber. Keine Schlagsahne aus der Sprühdose. Igitt.
Eva nahm die Zeitung. Sie hatte den Artikel bereits gelesen. Nicht nur einmal. Sie las ihn erneut.
Pfleger in Irrenanstalt zu Tode gestürzt
In der Privaten Nervenheilanstalt Prof. Runleger wurde gestern morgen um vier Uhr der Pfleger Karl Senner tot aufgefunden. Er lag mit Genickbruch auf einem Treppenabsatz inmitten von zerbrochenen Laborflaschen. Karl Senner, 51, arbeitete bereits seit 22 Jahren in der Klinik und war bei Ärzten und Patienten sehr beliebt. Noch ungeklärt ist, wie es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte. Die Klinikleitung spricht von einem tragischen Unglück. Trotzdem ermittelt die Kriminalpolizei. Zweifelsfrei hat der Treppensturz zum Tode geführt. Dennoch müssen die möglichen Auslöser für den Sturz untersucht werden. Theoretisch könnte es sich ebenso um einen Unfall wie um eine fahrlässige oder vorsätzliche Tötung handeln, verlautbart die Pressestelle der Kriminalpolizei. Allerdings sei es eine rein routinemäßige Untersuchung, die aufgrund des besonderen Umfeldes einer Nervenheilanstalt angezeigt sei. Es lägen keine konkreten Verdachtsmomente für ein Tötungsdelikt vor. Auch hätten Zeugenbefragungen und die gerichtsmedizinische Untersuchung keine Anhaltspunkte gegeben.
Eva zog die Stirn in Falten. Karl Senner! Sie hatte überhaupt nicht gewußt, daß Karl einen Nachnamen hatte. Unsinn, natürlich war das klar. Aber in der Klinik war Karl einfach der Karl, genauso wie die Patienten keine Nachnamen hatten. Eva konnte sich noch gut an die Aufregung gestern am frühen Morgen erinnern. Der Lärm auf dem Flur hatte sie aus einem schweren, bleiernen Schlaf aufgeschreckt. Zunächst wußte sie überhaupt nicht, wo sie war. Nackt hatte sie auf dem Bett gelegen, auf dem Bauch und mit dem Gesicht tief im Kopfkissen vergraben. Kaum hatte sie ihren Kimono, der sich neben dem Bett befand, angezogen, klopfte es schon an der Tür. Zusammen mit einem diensthabenden Arzt machte ein Kommissar von der Polizei die Runde durch alle Krankenzimmer. Kirred hieß der Kommissar, Klaus Kirred. Ob sie etwas gehört habe? Und wann sie den Pfleger Karl das letztemal gesehen habe? Erst später erfuhr sie, was passiert war. Tragisch, wirklich tragisch. Karl war zweifellos der netteste Pfleger in der Klinik gewesen, immer höflich und gut gelaunt. Wie konnte er nur die Treppe hinunterstürzen? Warum war er eigentlich nicht mit dem Lift gefahren? Mit all den Laborflaschen? Ob ihn doch jemand gestoßen hatte?
Wie in einer kurzen Filmsequenz sah sie Karl die Stufen hinunterstürzen und kopfüber in die Mauer des Treppenhauses krachen. Um ihn herum splitterten Gläser. Ihre Phantasie spielte ihr wieder einmal einen Streich. Sie hatte ab und zu solche Filmeinblendungen. »Mein ganz persönliches Bordkino«, hatte sie das Phänomen einmal scherzenderweise einem Arzt beschrieben. »Absolut realistisch. Ganz so, als ob ich es persönlich erlebt hätte. Beängstigend realistisch. Und doch nur das Produkt meiner Phantasie.«
Karl, der arme Karl. Schade um ihn.
Ihre Entlassung aus der Klinik hatte sich aufgrund des Unglücks etwas verzögert. Kommissar Kirred hatte sich noch einmal mit ihr unterhalten. Und dann mußte sie noch irgend so ein Protokoll unterschreiben.
Eva massierte sich mit den Zeigefingern die Schläfen. Jetzt tat ihr nicht nur der Rücken weh, auch die nervigen Kopfschmerzen setzten wieder langsam ein. Wo hatte sie nur die Tabletten gelassen? Was sollte die leere Dose in ihrer Handtasche? Verdammt noch mal, warum konnte sie sich einfach nicht daran erinnern?
8
Fausto stellte das ausgetrunkene Prosecco-Glas auf das Tischchen und stand auf.
»So, Max, jetzt kommt der schwierigste Teil des Abends. Wir müssen den Wein auswählen. Glücklicherweise verfüge ich über einen bescheidenen Weinkeller. Würdest du mich begleiten?«
»Einen bescheidenen Weinkeller? Mittlerweile glaube ich dir gar nichts mehr.«
In Faustos Gesicht machte sich ein spitzbübisches Grinsen breit.
»Ich merke schon, du lernst mich langsam kennen. Hai ragione, ganz so bescheiden ist er vielleicht doch nicht.«
Während die beiden über die Terrasse und die davorliegende Wiese zum Weinkeller schlenderten, der in einem benachbarten Hügel untergebracht war, fing Fausto zu erzählen an.
»Weißt du eigentlich, daß der Chianti aus Eifersucht entstanden ist?«
»Ich dachte, der Name ist uralt und geht auf die Etrusker zurück«, antwortete Max. »Und die Lega del Chianti stammt aus dem 13. Jahrhundert. Von Eifersucht ist mir nichts bekannt.«
»Fast hätte ich vergessen, daß du ein Kenner des italienischen Weins bist«, sagte Fausto lachend. »Aber du liest die falschen Bücher. Da ist alles so ernst. Das wahre Leben ist viel spannender, voller Anekdoten. Vor gut hundert Jahren, da gab es den Conte Bettino Ricasoli. Der lebte in Florenz und hatte eine wunderschöne junge Frau. Una bella donna, verstehst du? Dieser schönen Frau lagen natürlich die Männer zu Füßen. Der Conte hatte allen Grund zur Eifersucht. Ihm fiel nichts Besseres ein, als seine umschwärmte Gattin aus dem Verkehr zu ziehen.«
»Eine sehr treffende Formulierung«, kommentierte Max trocken. »Dein Deutsch wird immer besser.«