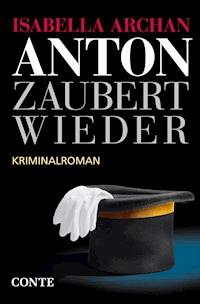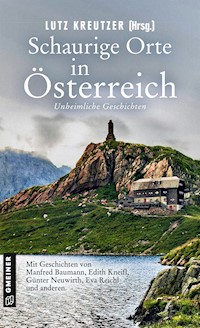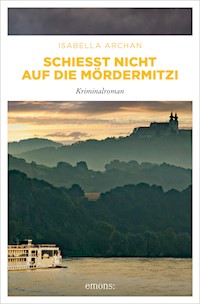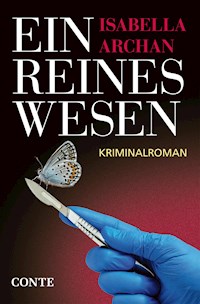12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Servus
- Serie: Servus Krimi
- Sprache: Deutsch
Abgründig und äußerst unterhaltsam: Krimi-Spannung in der Steiermark Nach Jahren bei Europol in Deutschland kehrt Ferdinand Sterz in die Steiermark zurück. Aber das Wiedersehen mit seiner alten Heimat ist alles andere als einfach: Sein bester Freund aus Jugendtagen wurde brutal mit einer Mistgabel erstochen. Inspektor Sterz will den Fall unbedingt lösen. Doch die Grazer Polizei-Kollegen sind ihm gegenüber skeptisch. Zusammen mit seiner neuen Kollegin Gitte Busch ermittelt er auf Hochtouren, doch keine der Spuren scheint mit der Tat zusammenzupassen. Unerwartet geschieht ein zweiter Mord, nicht weniger grausam. Kann er dieses Rätsel lösen? - Inspektor Ferdinand Sterz ermittelt: Band 1 der Steiermark-Krimireihe - Heimatkrimi mit Humor und Regio-Charme - Tatort Steiermark: Österreich-Krimi mit viel Lokalkolorit - Unterhaltsamer Regionalkrimi als perfekte Urlaubslektüre Verbrecherjagd statt Heimat-Idylle: Wer steckt hinter den grausamen Morden? Die Ermittlungen in den beiden Mordfällen gestalten sich schwierig. Hinzu kommen private Probleme, die Sterz aus dem Konzept bringen. Das Verhältnis zu seinem Vater ist angespannt. Zusätzlich flammt seine Liebe zur Schwester des Opfers neu auf, die ihn damals verlassen hat. Sterz kämpft mit Enthüllungen über seine eigene Vergangenheit. Welche dunklen Geheimnisse kommen jetzt ans Licht? Die Autorin Isabella Archan wurde in Graz geboren und kennt die Schauplätze ihrer Krimis genau. Dadurch ist »Sterz und der Mistgabelmord« besonders anschaulich und authentisch – ein Lesevergnügen für alle Krimi-Fans! »Isabella Archan schreibt leichtfüßig, pointiert und mit viel schwarzem Humor.« ORF Radio Steiermark
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Isabella Archan
STERZ UND DER MISTGABELMORD
Ein Steiermark-Krimi
Diese Geschichte ist frei erfunden. Tatsächlich existierende Personen und Firmen wurden verändert und/oder von der Autorin ausgedacht, Geschehnisse anderen und/oder fiktiven Personen zugeordnet. Verbleibende Übereinstimmungen mit etwaigen realen Personen wären somit rein zufällig und sind nicht gewollt.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlags ist ausgeschlossen.
1. Auflage 2022
Copyright © 2021 by Isabella Archan
Copyright © Deutsche Erstausgabe 2022 Servus Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Dieses Werk wurde vermittelt durch die literarische Agentur Peter Molden, Köln.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Courier, Bauer Bodoni
Umschlaggestaltung: b3K design, Andrea Schneider, diceindustries
Umschlagmotive: Hintergrund Hütte: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com; Mistgabel: Gustafsson / Westend61 / picturedesk.com; Himmel: MOHAMMED ABED / AFP / picturedesk.com
Autorenillustration: Claudia Meitert
ISBN 978-3-7104-0308-8
eISBN 978-3-7104-5062-4
Inhalt
I AUFPUDLN (SICH AUFSPIELEN)
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
II KRAWUTISCH (WÜTEND)
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
III HUDRIWUDRI (DURCHEINANDER)
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
IV SPOMPANADLN (DUMMHEITEN)
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
V BUSCHGAWEDL (BLUMENSTRAUSS)
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
DANK
REZEPT: STEIRISCHER HEIDENSTERZ ODER HOADNSTERZ
GLOSSAR
Gute Nacht, ihr Freunde,
ach, wie lebt ich gern!
Daß die Welt so schön ist,
dank ich Gott dem Herrn.
Daß die Welt so schön ist,
tut mir bitter weh,
wenn ich schlafen geh.
PETER ROSEGGER
I
AUFPUDLN
(SICH AUFSPIELEN)
1
Der Geruch ist bitter, vergleichbar mit alten Socken oder saurer Milch.
»Warum denn im alten Saustall?«, hat der Stichl sein Gegenüber vorhin beim Hineingehen gefragt und überlegt, wie lang hier drinnen schon keiner mehr war. Auch dass es höchste Zeit wird, den ehemaligen Schweinestall abzureißen. Der Holzbau ist für den Bauernhof ohne Nutzen, Schweine werden seit Ewigkeiten nicht mehr gehalten. Überhaupt sind Haus und Felder inzwischen so gut wie verjubelt, zerstückelt ist das Erbe der Eltern wie ein Häferl, das zu Boden fällt und in Scherben zerbricht.
Wer trägt daran die Schuld? Keiner und alle. Das ist eine schlechte Antwort, aber eine bessere fällt ihm nicht ein.
Durch die Ritzen der Wände fällt Licht und zeichnet Striche auf den erdigen Boden.
Er stutzt. Sein Blick richtet sich auf die Zinken der verrosteten Mistgabel, die sein Gegenüber unvermutet in die Hände genommen hat. Schwarz schauen die Spitzen aus, wie verbrannt.
»Was willst denn damit?«, will der Stichl jetzt wissen.
Nach all der Rederei und den Vorwürfen nun noch diese Drohgebärde.
Sein Gegenüber verweigert eine Antwort, hebt das Werkzeug höher.
Langsam wird’s lächerlich, denkt er, doch nach Lachen ist ihm nicht mehr zumute.
Warm ist es hier drinnen. Bacherlworm, wie es auf Steirisch heißt. Die ganze Angelegenheit kann einen wirklich ins Schwitzen bringen. Man kann nix gutreden, und drumherumreden hilft nicht. Der Stichl kann verstehen, warum sein Gegenüber ihn in der Rage sogar aufspießen möchte.
Er hat Mist gebaut, ohne Gabel. Er, der Ludwig Manfred Stichlhofer, wie sein vollständiger Name lautet. Aber ewig ist er schon der Stichl.
Ludwig rufen ihn nur wenige. »Wiggerl« hat ihn erst kürzlich sein Herzensmensch genannt, sonst in letzter Zeit niemand. An den will er in diesem verranzten Saustall jedoch nicht denken. Herr Stichlhofer ist er für die Behörden. Aber Stichl passt in Wahrheit am besten.
Stichl, was machst? Stichl, was red’st? Stichl, was hast denn da wieder für einen Scheiß gebaut?
In seinem Kopf türmen sich diese Fragenzeichen, doch er findet nicht einmal für sich selbst Antworten. Weghören war und ist seine gewählte Strategie, wegsehen auch. Das Hoffen auf ein anderes Leben hat ihn blind gemacht für seinen Abstieg. Mehr geträumt hat er als gehandelt. Und wenn, dann Fehler gemacht. Zu viele Fehler – ja, das stimmt.
Er macht die Augen zu und den Mund wieder auf.
»Geh, komm, lass uns weiterreden. Wir finden eine Lösung.« Seine Stimme klingt gedämpft, als würde der Raum sie schlucken. Er will schnell wieder hinaus ins Helle. »Alles wird gut.«
So ein dummer Spruch, aber irgendetwas muss er ja sagen.
Der Stichl breitet die Arme aus. Lauscht. Wartet auf das Geräusch, das eine Mistgabel macht, wenn man sie auf die Erde fallen lässt. Er wartet auf einen Seufzer, vielleicht sogar ein Aufatmen. Eine Umarmung mit Schulterklopfen wäre das Größte.
Sein Magen knurrt. Er hat Hunger. Lust auf ein Stück Brot hätte er, dunkles Brot, in Kernöl getunkt, wäre genau das Richtige. Erst gestern hat er das schwarze oder grüne Gold, wie das Öl oft betitelt wird, von einem Bekannten geholt. Der Luis, drei Höfe weiter, gehört der Gemeinschaft für steirisches Kürbiskernöl in Leibnitz an, und seines ist eines der besten, wie der Stichl findet. Die abgefüllten Glasflaschen stehen noch ungeöffnet in der Speisekammer. Vielleicht, wenn sein Gegenüber und er endlich den Streit beiseitegelegt haben, wird er sich einen Kaffee kochen. Dann das dunkle, sämige Öl aufs Brot träufeln, daran riechen, es langsam kauen. Die Aussicht auf Speis und Trank treibt ihm ein Lächeln auf die Lippen.
Was sich nun allerdings abspielt, lässt ihn die Augen aufreißen und in der Position der geöffneten Arme erstarren. Zugleich beginnt sein Herz zu rasen. Es pumpert wie wild.
Sein Gegenüber stößt einen Schrei aus. Sehr laut und kräftig. Nicht aus Gram oder Kummer oder Verzweiflung. Nein, es ist ein Wutschrei. Ganz klar hört der Stichl den Zorn heraus, kein Irrtum möglich.
Vor Ewigkeiten haben seine verstorbenen Eltern auf dem Bauernhof einmal einen Hahn gehabt, der nicht ganz richtig im Kopf gewesen ist und jeden angegriffen hat, der sich ihm genähert hat. Mit einem schrillen und schrägen Kikeriki ist der Vogel in die Höhe gesprungen und hat sich auf den vermeintlichen Feind gestürzt. »Höllenhendl« haben sie das aggressive Vieh getauft und sich lustig darüber gemacht, bis es schließlich im Suppentopf gelandet ist.
Suppentopf, denkt der Stichl. Doch im Moment wird es wohl mit einer Jause nichts werden. Gut, das Essen kann warten. Aber wo bitte kommt denn diese gesammelte Aggression hinter dem Schrei her? Doch nicht von heute, von eben, von vorhin. Die Verbitterung muss lange schon da gewesen sein, und er hat sie nicht bemerkt. Oder ignoriert. Ein unrealistischer Träumer ist und war er, wieder ein verschämtes Ja dazu.
»Nein!«, argumentiert er aber gegen den Schrei und hebt den Arm. »Alles lässt sich regeln. Schluss damit.«
Die erhobene Mistgabel zittert, die Zinken bewegen sich vom Stichl weg. Nicht um sich zurückzuziehen, sondern um Anlauf zu nehmen.
Der Stichl macht zwei Schritte nach hinten, bis er die Holzwand in seinem Rücken spürt. Weiter geht es nicht. Endstation.
»Hör auf! Sofort! Bist deppert?!« Jetzt schreit auch er.
Das nachfolgende Geschehen spielt sich ohne weitere Brüllerei ab und wie in Zeitlupe. Die vier Zinken kommen auf ihn zu, werden nach vorne geführt, zielen auf dem Stichl seine Brust. Dorthin oder ein Stück darunter.
Er will ausweichen, leider erreicht der Befehl aus seinem Hirn zu spät seine Füße. Nur den Bauch zieht er automatisch ein, als ob diese Bewegung etwas verhindern könnte.
Sakra, will er rufen, und Hilfe, doch nur ein »Uff« rollt über seine Lippen. Mehr nicht.
Der Stichl legt den Kopf in den Nacken. Es knackt.
Die Mistgabel trifft auf ihr Ziel.
Sie stößt mit voller Wucht gegen ihn, gegen seinen Leib, dort, wo sein Herz inzwischen hämmert wie verrückt, seine Lungen den Atem keuchend ausstoßen, seine Bauchmuskeln sich verkrampfen. Es folgt ein Gefühl des Eindringens, unheimlich und unwirklich. Etwas bahnt sich einen Weg durch sein T-Shirt und seine Hautschichten, durchdringt die Masse der Muskeln, wird durch die Knochen abgelenkt, trifft schließlich auf die inneren Organe.
Ein unfassbarer Wahnsinn läuft hier ab. Aber es tut nicht weh. Keinen Funken Schmerz spürt der Stichl. Seltsam.
Ein schmatzender Laut ist zu hören.
Dem Stichl kommt in den Sinn, wie er einmal mit seinem besten Freund durch den Wald getobt ist. Sie waren zwölf und haben Schwerter aus Baumästen in den Händen gehalten und sich gegenseitig gejagt, einen Film über Ritter nachgespielt. Bis der Stichl gestolpert ist. Am Ende des Sturzes ist er mit seiner Hand in einem weichen Haufen versunken. Beim Herausziehen haben die Finger eklig gestunken, geschmatzt hat es dabei. Der Kadaver eines Fuchses hat dort gelegen, halb verwest.
»Wiggerl, nimm mein Hemd und wisch dich sauber«, hat sein bester Freund gesagt und es über den Kopf gestreift. Tatsächlich auch einer, der ihn zumindest früher manchmal mit diesem zärtlichen Kosenamen gerufen hat.
Wo der grad ist, was der wohl grad macht, der Freund, der Kumpel, der Vertraute aus Kinder -und Teenagertagen?
Der Stichl rutscht an der Wand nach unten. Er zieht sich am Hintern drei Späne ein, was er allerdings nicht bemerkt und was keine Rolle mehr spielt.
Immer noch streckt er das Kinn nach oben, er will nicht wissen, wie tief und wie schwer ihn die Spitzen der Mistgabelzinken getroffen haben. Über ihm bricht Tageslicht durch einen Spalt an der Decke, er meint, Mücken im Hellen tanzen zu sehen.
Das Atmen fällt ihm mit einem Mal viel schwerer.
Dass er verletzt worden ist, ist ihm klar, aber er hofft noch auf Rettung. Und auf Vergebung. Er wird seinem Gegenüber keinen Vorwurf machen, es muss sich ja um eine Tat im Affekt gehandelt haben. Muss. Sofort Hilfe holen und dann wird alles wieder gut.
Schluss mit der Wut, dem Groll. Keine Vorwürfe, bittschön. Keinen solchen Pallawatsch mehr.
Ein Rauschen setzt in seinen Ohren ein. Eine Welle baut sich auf. Ein Berg an Schmerzen, die er bis eben nicht gespürt hat. Der Schmerztsunami wird ihn gleich treffen, mit voller Wucht. Plötzlich kriegt der Stichl Angst. Die ganze Zeit über war dieses Gefühl nicht vorhanden. Nicht während des Streites, nicht, während die Mistgabel auf ihn gerichtet war, nicht einmal, während sein Gegenüber Anlauf zum Aufspießen genommen hat.
Jetzt erst zeigt sie sich, die Angst, nimmt Anlauf. Panik rollt über die Ränder der Furcht. Er will und kann diese Schmerzen nicht aushalten. Ihm wäre es lieber, wenn er fortgehen könnte. Nicht aus dem ehemaligen Schweinestall hinaus, dafür ist es zu spät, aber wenigstens in das Licht mit den tanzenden Mücken hinein.
Toter Fuchs, denkt er. Wiggerl, das war’s mit dem verträumten Leben, denkt er weiter. Als letztes Bild aber sieht er den verrückten Hahn vor sich. Kikeriki.
Sein Herz tut ihm den Gefallen und steht still, bevor ihn die Welle trifft.
2
Wann hatte sich die Gefühlslage so verändert?
Wann waren die Gedanken feindselig geworden, die Unzufriedenheit toxisch?
Es gab kein genaues Datum dafür, wobei das Vergehen der Zeit schon länger keine Rolle mehr spielte. An einem bestimmten Punkt hatte sich der Frust zu einem Knäuel aus bösen Wünschen und wachsendem Groll verdichtet. Daraus tropfte die Wut. Mehr und mehr. Ein Rinnsal, ein Bach, ein Strom, der sich zu stauen begann, bevor er überlief. Am Ende war es wie ein Ertrinken unter einer Sturzflut aus blankem Hass.
Durfte man sich noch als Mensch bezeichnen, wenn man von morgens bis abends abscheuliche Gedanken wälzte?
Nein war die Antwort. Man wurde zu einem Etwas, einem Ding, das Gift und Galle spuckte, sich an nichts mehr erfreuen konnte, in andauernder innerer Dunkelheit existierte. Die äußere Hülle war eine Maske für die Welt draußen. Nur nicht auffallen, nicht anecken, funktionieren und immer weiter hassen und verachten.
Bis zu dem Punkt, wo das Etwas wieder Form bekam in einer neuen Gestalt. Dann war man final zu einem Monster geworden, das kein Mitleid, kein Verständnis und keine Gnade kannte. Ein Es, das zu einer Tat fähig geworden war, die eine Todsünde darstellte.
Tod und Sünde.
Keine Reue zu finden, nirgendwo.
Bedauern schon. Bedauern darüber, dass kein Weg daran vorbeigeführt, es keine andere Lösung gegeben hatte. Die Tat war unausweichlich gewesen. Dass es heute geschehen war, eine Verkettung der Umstände. Wäre es nicht zu dieser spontanen ungeplanten Aktion gekommen, hätte das Monster den Stichl anders beseitigen müssen.
Aktion und Beseitigung.
Das Monster starrte auf den leblosen Körper am Boden. Fast friedlich sah der Stichl aus, wäre da nicht sein blutbeflecktes T-Shirt gewesen. Dazu die Mistgabel, die nach dem Zustechen nicht einfach in der Brust des Opfers stecken geblieben war, sondern ein gespenstisches Eigenleben entwickelt hatte. Der Stichl war an der Wand neben der Stalltür zu Boden gesackt. Stiel und Griff hatten sich, von der Schwerkraft angezogen, nach unten zu neigen begonnen, bis sie parallel zum Stallboden stoppten. Danach erst war das Blut aus der Wunde geflossen.
Fluss und Blut.
Noch einen vorsichtigen Schritt kam das Monster näher, ging in die Hocke. Durch einen Riss in der Decke des renovierungsbedürftigen Schweinestalls fiel ein Lichtstrahl über die Stirn und eines der offenen starren Augen des eben Verstorbenen.
»Nun heißt’s aufräumen. Nur keinen Fehler machen. Gell! Hilf mir beim Denken, ja?!«
Es redete zum Stichl, als ob der noch leben würde.
Mit Schwung schnellte das Monster wieder in die Höhe und sah sich um.
Der Stiel der Mistgabel musste abgewischt werden. In der rechten Ecke lehnte ein Rechen an der Wand. Damit ließ sich gut die feuchte Erde lockern, um die Fußabtritte unkenntlich zu machen. Am besten, wenn man im Rückwärtsgang den Stall verließ. Am Ende auch den Rechen säubern und beim Wohnhaus abstellen. Als ob dort normalerweise sein Platz wäre, neben der Schaufel und dem Besen.
Worauf war noch zu achten?
Haare oder Hautschuppen am Körper des Opfers würden kein Problem darstellen. Vorhin hatte keine direkte Berührung stattgefunden. Außerdem hatte der Stichl dem Geruch nach sein Hemd nicht gewaschen, und es mochten sich einige andere Kontakte darauf verewigt haben. Wer auch immer, Arschlöcher allesamt. Verlogene Deppen, die genauso den Tod verdient hätten. Das Monster hätte sie zusammentreiben sollen, genau hier einsperren und den Stall anzünden. Es hätte sich an ihren Schreien ergötzt. War man auf den Geschmack gekommen, könnte das Morden weitergehen. Der liebe Gott konnte ein Monster bloß einmal in die Hölle schicken.
Hölle und Hass.
Da war er wieder. Dieser Hass. Er überzog das Denken, das Fühlen und war körperlich spürbar in einer Art Juckreiz, der niemals aufhörte, egal wie lange und wie intensiv man sich kratzte.
»Keiner is schuld und ich schon gar nicht.« Erneut sprach das Monster den toten Stichl an. »Denk daran, ich muss mit deinem Abgang leben. Du hast es hinter dir. Was meinst, is leichter?«
Einem Toten Fragen zu stellen, machte das Monster doch nervös. Höchste Zeit, sich wieder die Maske des Menschlichen überzustülpen.
3
»Ich brauch dich, Ferdinand.«
Ihre Stimme hörte sich nah an, so nah, als würde sie wirklich neben ihm liegen.
Inspektor Ferdinand Sterz war aus dem Schlaf gerissen worden und nach dem vierten Klingeln an sein Handy gegangen, das er stets auf dem Nachttisch deponierte. Kein Bereitschaftsdienst übers Wochenende plus den Feiertag. Es war auch kein Kollegenname auf dem Display erschienen, sondern eine ihm unbekannte Nummer. Mit Vorwahl aus Österreich.
Die Anruferin allerdings war ihm mehr als vertraut.
»Hallo, bist du es, Lena?« Natürlich war sie in der Leitung. Niemals hätte er den Klang dieser Stimme vergessen können.
»Lena?«
Ein leises Schluchzen.
»Lena!«
Ihren Namen dreimal nach der langen Zeit auszusprechen, erschien ihm unwirklich wie ein Traum, und er kniff sich in den Oberarm. Es tat weh. Er war wach. Ferdinand nahm das Smartphone kurz vom Ohr und checkte die Zeit. Weit nach Mitternacht.
»Ferdinand.«
Sie hauchte in den Hörer hinein.
Die vergangenen Jahre verwandelten sich zu Staub und fielen in sich zusammen. Ferdinand war wieder jung und verliebt. So irrsinnig verliebt. In Lena.
»Was ist passiert?«
Er begann nachzurechnen. Lena hatte er das letzte Mal vor elf Jahren gesprochen. Kurz und rasch hatten sie sich unterhalten, beide wollten nichts mehr voneinander wissen, hatten nur ein paar Informationen ausgetauscht.
Nein, zwölf. Ein Dutzend Jahre war es her. Die Zeit war schneller als sein noch nicht ganz waches Denken. Das letzte persönliche Zusammensein in der Zeit davor war kein gutes gewesen. Vorwürfe, Tränen, Herzschmerz, Kummer. Ihr Entschluss war felsenfest geblieben, und seine Koffer hatten darauf gewartet, gepackt zu werden. Irrsinnig verliebt und doch getrennt. Es passte bis heute nicht zusammen. Lena hätte mitkommen sollen. Stattdessen war Ferdinand verlassen worden.
»Lena, bist du noch dran?«
»Ach, Ferdi, lieber Ferdi. Er is tot.«
Sein Vater. Ferdinand war sich sicher, dass den Gemeinderat August Sterz der Schlag getroffen hatte. Oder etwas in der Art. Erstaunlich, dass keiner seinen Sohn bisher informiert hatte. Vielleicht, weil der Papa es so gewollt hatte. Das lange Schweigen zwischen Lena und Ferdinand hatte auch vor Vater und Sohn nicht haltgemacht. Obwohl Ferdinand mit Papa letzte Weihnachten und die Weihnachten davor geskypt hatte. Zehn Minuten Floskeln ausgetauscht. Nicht zu vergessen, dass sie sich über die Jahre Postkarten geschrieben hatten. Eine old fashioned Vater-Sohn-Beziehung.
Nun war August tot, höchstwahrscheinlich aber noch nicht begraben. Die Trauer kam und setzte sich an den Bettrand, doch sie erreichte nicht Ferdinands Herz.
»Komisch, dass du mich anrufst, Lena, und es mir erzählst.«
»Du musst kommen.«
»Klar komm ich. Ich muss ja alles organisieren.«
»Was denn organisieren?« Plötzlich klang sie unwirsch.»Den Tod aufklären musst du. Den Mörder finden. Du – du kannst das.«
Ferdinand war irritiert. »Der Papa ist ermordet worden?«
»Aber nein. Deinem Vater geht es gut.« Lena wechselte zurück zum Schluchzen.
Eine winzige Enttäuschung darüber blieb neben der Erleichterung in Ferdinand zurück.
»Wovon redest du dann, Lena?«
»Hast du es nicht schon im Internet gelesen, Ferdinand?
Hat dich noch niemand informiert?«
Gegenfragen, die ihn verunsicherten. Er kam sich in seiner Unwissenheit hilflos vor.
»Du weißt, Lena, dass ich immer noch in Köln lebe. Ich guck die Online-Portale von hier. Über die Steiermark stand nichts in den News.«
»Wie du redest, Ferdi.« Sie schluckte. »Gucken und News.«
»Na ja, so redet man eben.« Er hatte das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. »Jetzt sag halt, was los ist.«
»Der Wiggerl.«
Der Name seines früheren besten Freundes und Bruder seiner Jugendliebe Lena kam wie ein Schwall Eiswasser über Ferdinand.
»Was meinst du mit ›der Wiggerl‹? Ist ihm etwas passiert?«
»Er is tot, Ferdinand. Tot is er, unser Ludwig.«
»Oh mein Gott.«
Sie schnappte hörbar nach Luft. »Umgebracht is er worden, Ferdinand. Erstochen. Aufgespießt wie ein Hendl am Grill. Deshalb musst du kommen. Verstehst mich?«
Er verstand nicht. Noch nicht.
4
Kurz bevor der Zug hielt, schreckte Ferdinand Sterz erneut aus einem tiefen Schlaf hoch. Während der langen Stunden über Nacht hatte er Sorge gehabt, einen der drei Umstiege zu verpassen, und sich mit Essen, Trinken und Lesen wachgehalten. Er hätte fliegen sollen, doch die Idee war ihm als passioniertem Bahnfahrer zu spät gekommen. Erst gegen Ende der Reise war er überhaupt eingenickt. Sogar geträumt hatte er: vom Stichl, vom Ludwig, von ihm auch Wiggerl gerufen. Sein bester Freund. In seiner Jugend zumindest.
In seinem kurzen Traum waren sie gelaufen, immer weiter, ohne anzuhalten. Ohne auch nur Luft zu holen. Nebeneinanderher, auf gleicher Höhe, eine staubige Landstraße entlang. Auf der einen Seite ein sich in die Unendlichkeit erstreckendes Maisfeld. Der Kukuruz war noch nicht reif für die Ernte, doch kurz davor. Zwischen den braun-grünen Blättern blitzten die gelben Maiskolben auf. Linker Hand eine Wiese, die ebenfalls grenzenlos erschien unter einem Himmel, in dem Flugzeuge ihre weißen Spuren hinterlassen hatten. Ein Muster, das wie ein Netz aussah.
Der Stichl und der Sterz. So rief man die beiden. Meist in einem Atemzug. Ludwig Stichlhofer und Ferdinand Sterz. Eine Freundschaft, die ernster und reifer war, als die Erwachsenen um sie herum es je bemerkt hatten.
In der traumlosen Realität erreichte der Sterz am Montag, den 3. Oktober die Hauptstadt der Steiermark: Graz. Der Stichl war am Samstag, den 1. Oktober gewaltsam mitten aus dem Leben gerissen worden, wie es so schön hieß.
Ferdinand schüttelte sich. Ihm war kalt, und er musste die Traumbilder loswerden. Er war nicht zurückgekommen, um nostalgische Erinnerungen wachzurufen, sondern um einen Mordfall aufzuklären. Das Verbrechen an Ludwig Stichlhofer. Aufgespießt mit einer Mistgabel, gefunden im ehemaligen Schweinestall des Bauernhofs der Familie in Leibnitz, gestorben an der schweren Verletzung. Innerlich verblutet.
Nach Lenas nächtlichem Anruf hatte Ferdinand sofort die aktuellen Beiträge aus Österreich im Internet durchgesehen. Das Verbrechen mit der Mistgabel war tatsächlich in allen Medien. Selbst den deutschen Online-Nachrichtenplattformen war es eine Meldung wert gewesen. Ferdinand erinnerte sich, sogar schon davon gelesen zu haben. Doch dass hinter dem Opfer Ludwig S. (36) aus der Südsteiermark sein Freund stand, war ihm nicht eine Sekunde lang in den Sinn gekommen. Bis Lena anrief und ihn bat zurückzukehren, in seiner Funktion als Ermittler.
Inspektor Sterz arbeitete allerdings schon lange nicht mehr für den Bereich Gewaltdelikte im Landeskriminalamt Steiermark, dem LKA.
In seinem ersten Dienstjahr, als blutjunger Anfänger, war ihm dort ein Ermittlungscoup in einem spektakulären Fall gelungen. Ein Serienmörder, der seit Monaten die Polizei und die Presse auf Trab gehalten hatte, war durch Ferdinand überführt worden.
Der »Eisenbahntunnel-Killer«, wie die Journalisten ihn getauft hatten, weil er die bereits Toten stets am Ende eines Tunnels deponiert hatte, sodass sie auch noch einmal von einem Zug überfahren wurden.
Die Auswahl der Opfer schien zuerst willkürlich. Von einer älteren Dame über zwei Männer in ihren mittleren Jahren bis zu einem Teenagermädchen. Vier Ermordete, alle schnell durch einen Schuss ins Herz getötet und als Leichen auf die Gleise gebettet. Die erfahrenen Kollegen von der Kripo standen vor einem Rätsel. Als der junge Sterz die Idee hatte, zusätzlich die Krankenakten der Verstorbenen zu durchforsten, war ihm keiner gefolgt. Dort jedoch hatte die Lösung gelegen. Alle vier waren in jungen Jahren an Leukämie erkrankt gewesen und wieder genesen. Die Schwester des Täters allerdings war daran tragischerweise verstorben.
Das Trauma des überlebenden Bruders hatte sich erst Jahrzehnte später in der Mordserie offenbart. Keines der Opfer hatte leiden sollen, aber sie hatten seiner Meinung nach auch kein Recht darauf gehabt, am Leben zu sein. Er selbst hatte bis zu seiner Verhaftung als Lokführer gearbeitet. Manchmal lagen Antworten so nahe, dass man sie kaum glauben mochte.
Inspektor Sterz war danach in aller Munde gewesen. Lob und Neid waren gefolgt. Eine Beförderung hatte gewinkt. Hämische Kommentare waren ebenso nicht ausgeblieben. Dazu eine Anfrage von Europol, nach Deutschland zu kommen, erst nach Frankfurt, im Anschluss daran nach Köln.
Wäre Ferdinand in der Steiermark geblieben, wenn es den Unfalltod seiner Mutter und das Zerwürfnis mit seinem Vater in seiner eigenen Kindheit nicht gegeben hätte? Höchstwahrscheinlich.
Neben seinem Freund Ludwig gab es dort seine Jugendliebe Lena, Stichls Schwester. Wie wunderschön und zerbrechlich sie gewesen war, wie innig ihre Zärtlichkeit, wie intensiv die Beziehung überhaupt. Heirat, Kinder, Häuschen im Grünen standen auf dem Plan. Zumindest auf Lenas Zukunftsentwurf. Denn Ferdinand hatte nicht einmal eine Stunde gebraucht, das Europolangebot anzunehmen.
»Komm mit, Lena«, hatte er gefleht. »Was wir hier haben, gibt es anderswo genauso. Sogar besser. Ich möchte weg – mit dir, verstehst du?«
Sie hatte seinen Entschluss mit verständnisloser Miene kommentiert, hatte überlegt und sich dagegen entschieden. Gegen einen Umzug und damit auch gegen Ferdinand. Das Erste verletzte ihn, das Zweite versetzte ihn in eine Art Schockstarre der Gefühle. Nach einer letzten Aussprache war es vorbei mit der großen Liebe. Er war gegangen, Lena geblieben. Der Kontakt war dürftig gewesen und schließlich abgebrochen.
Mit der Freundschaft zum Stichl hatte es anfangs besser funktioniert. Ludwig hatte sich als Einziger begeistert gezeigt, Ferdinand sogar mehrfach besucht in den ersten zwei Jahren. Aber ihr Alltag war zu unterschiedlich, ihre Sorgen, ihre Freuden, ihre Ziele hatten sie auf getrennten Pfaden weiterwandern lassen. Irgendwann, nach Lenas Hochzeit mit einem anderen, waren aus den Besuchen Telefonate geworden. Die Abstände verlängerten sich, bis ein stummes Aneinanderdenken blieb. Lena und Ludwig waren aus Ferdinands Leben entschwunden.
Blieben ihm noch sein Vater und die Postkartenbeziehung mit ihm. Der Bruch zwischen ihnen beiden hatte mit Alma Sterz’ Tod begonnen. Bei einem Autounfall war sie ums Leben gekommen. Ein Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer, der Vater und Sohn traumatisiert hatte. Ferdinand elf, August vierunddreißig. Fast auf den Tag genau trennten die beiden dreiundzwanzig Jahre. Nach dem Unglück war jeder von ihnen allein mit seinem Schmerz geblieben. Eine Sprachlosigkeit war entstanden, die der erwachsene Mann nicht verhindern und der Junge nicht hatte auffangen können.
Hätte es damals nicht die Patentante seiner Mutter gegeben, wäre der Bub daran zerbrochen. Hannerl Hawlik, zu der Zeit Ende vierzig und an der Oper als Souffleuse tätig, hatte versucht, ihm ein wenig die Mama zu ersetzen. Inzwischen war sie vierundsiebzig und immer noch teilweise aktiv.
Die große Leere aber hatte der beste aller Schulfreunde ausgefüllt. Unfassbar, dass der Wiggerl jetzt tot sein sollte.
»Graz Hauptbahnhof. Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.« Eine kratzige Lautsprecherstimme holte Ferdinand aus seinen Rückblenden und verabschiedete die Reisenden.
Er verließ den Zug mit Erinnerungen im Gepäck, die schwerer wogen als sein Rollkoffer. Beim Durchqueren der Eingangshalle und draußen am Vorplatz wurde ihm bewusst, dass sich einiges verändert hatte in den Jahren seiner Abwesenheit. Ferdinand schwante, dass er sich erst neu würde zurechtfinden müssen. Er machte kehrt, wandte sich nach rechts und ging in die Bahnhofsbuchhandlung.
»Brauchen S’ Hilfe?«
Die blonde Buchhändlerin in einer sonnengelben Bluse strahlte Ferdinand an.
»Eine Karte mit den Straßenbahnen und Bussen für Graz und die Steiermark hätte ich gerne.«
»Wie schön.« Ihr Lächeln wurde breiter. »Endlich wieder ein junger Mann, der sich nicht nur im Internet nach dem Weg umschaut.«
Damit brachte sie auch Ferdinand zum Schmunzeln. Seine nachdenkliche Stimmung löste sich. Jung war relativ. »Ich mag es, Bücher in der Hand zu halten. Bin ein haptischer Mensch.«
»Folgen Sie mir.« Sie huschte an ihm vorbei. Vor einem Regal, das überquoll von Bildbänden und Reiseführern, blieb sie stehen und zog blitzschnell ein Magazin heraus.
»Da sind alle Strecken drin plus die schönsten Ecken. Unsere Öffis bringen Sie sicher an alle Ziele, die Sie besuchen wollen.«
»Danke. Ich nehme es.«
»Kommen S’ aus Berlin?«
»Nein. Köln.«
»Ah, geh. Bleiben S’ lang? Machen S’ Urlaub? Wollen S’ einen Kaffee?« Drei Fragen, ohne eine Antwort abzuwarten.»Unser Automat macht eine köstliche Melange. Ich bin übrigens die Romana.«
»Dreimal nein, aber einmal danke für das Angebot, liebe Romana.«
»Das erste Mal in Graz?«
Ferdinand schmunzelte. Hier sah ihn keiner mehr als Einheimischen an. Schon als Kind hatte er gerne hochdeutsch geredet wie seine Mutter. Beim Gedanken an Alma stahl sich die Betrübnis zurück. Er stellte den Kragen seines Mantels auf, als würde ein kalter Wind durch den Laden wehen. Auf einmal kam er sich tatsächlich wie ein Durchreisender vor, smart und geschäftig unterwegs in Sneakers, Rollkragenpullover, grauer Stoffhose und eben dem Herbstmantel.
»Sie haben es erraten«, flunkerte er, nahm der Buchhändlerin in der sonnengelben Bluse das Magazin aus der Hand und ging zur Kasse.
»Schönen Aufenthalt, der Herr«, rief sie ihm hinterher.
Das Wechselbad der Gefühle, das Ferdinand eben erfasst hatte, intensivierte sich bei der Straßenbahnfahrt durch die Annenstraße Richtung Innenstadt. Zwischen freudigem Wiedererkennen, Verwunderung über Neues bis zu Trauer und unverarbeitetem Groll, den er mit seiner Jugend hier verband, reichte die Palette.
Am Südtiroler Platz stieg er aus, um zu Fuß weiterzugehen. Der Koffer, den er hinter sich herzog, machte auf seinen Rollen ein ächzendes Geräusch, als wäre ihm der Marsch zu anstrengend.
Ferdinand bewegte sich am Kunsthaus vorbei. Mit seiner ungewöhnlichen Dachform erinnerte es ihn an einen schwarzen Wal und beeindruckte ihn wie einst, als es noch ganz neu war. Der weitere Weg führte über die Mur, in der Mitte der Brücke hielt er kurz inne. Vor ihm ragte der Schloßberg mit dem Uhrturm auf, das Wahrzeichen von Graz. Dort oben war er früher oft gewesen, hatte im Winter als kleiner Bub Vögel gefüttert, im Sommer eine Aufführung des Räuber Hotzenplotz auf der Freiluftbühne in den Kasematten gesehen. Begleitet von Mama, die damals noch gesund und schön war und für den kleinen Ferdinand ewig leben würde.
Als er schließlich am Hauptplatz ankam, meldete sich sein Magen mit einem Knurren. Vor dem Rathaus waren die Marktstände aufgebaut, umrahmten den Erzherzog-Johann-Brunnen.
Ferdinand wurde von einem der Würstelstände magisch angezogen.
»Bittschön, der Herr.« Ein korpulenter Mann beugte sich über den Standl-Tresen.
»Einmal Frankfurter mit Senf und Kren, bitte.«
»Auch was trinken?«
Ferdinand schüttelte den Kopf. »Nur ein Semmerl dazu.«
»Is eh dabei.«
Er zahlte und setzte sich, den Pappteller balancierend, auf die Stufen des Brunnens. Kaum hatte er zwischen anderen Leuten – Einheimische und Touristen bunt gemischt – Platz genommen, näherten sich ihm Spatzen und eine Taube, die auf Reste hofften.
Ferdinand tunkte die Spitze der ersten Frankfurter in den Senf, dann in den Kren und biss ab. Die Schärfe ließ seine Augen tränen, aber der Geschmack war besser als jede Currywurst, die er sich in den letzten Jahren gegönnt hatte.Er riss ein Stück von der Semmel ab und begann zu kauen. Die Sonne zeigte sich hinter den Wolken, einer der Spatzen setzte sich neben Ferdinands Schuh und pickte enthusiastisch die Brösel auf, die zu Boden rieselten.
Alles wie gehabt, dachte Ferdinand. Ich bin daheim.
In der nächsten Sekunde tauchte in seinem Kopf das bis jetzt einzige Foto auf, das er vom toten Ludwig und dem Tatort gesehen hatte.
Wie eine Stoffpuppe hatte der Körper seines Freundes an einer Bretterwand gelehnt, die Augen offen, das Shirt blutgetränkt. Allerdings ohne Mistgabel in der Brust, die musste die Spurensicherung bei der Aufnahme bereits entfernt haben.
Es war keine nostalgische Reise in die Vergangenheit. Inspektor Ferdinand Sterz hatte in wenigen Stunden ein Gespräch im Landeskriminalamt Steiermark in der Straßganger Straße mit einem der Leiter der Landespolizeidirektion, Chefinspektor Gerald Wiedenhüpfer. Ihn kannte Ferdinand noch aus Anfängerzeiten und hatte ihn als gesprächigen Beamten in Erinnerung, der zu Übergewicht und Haarausfall neigte. Dass er auch der langjährige Golfpartner von Ferdinands Vater war, konnte ein Vorteil sein.
Wie schwer es sein würde, sich in die Ermittlungen einzuklinken, würde sich noch zeigen. Ein kurzes Telefonat gestern mit Wiedenhüpfer privat war nicht ergiebig gewesen. Außer einer ersten E-Mail, die als wichtigste Information den Namen des Leiters der rasch ins Leben gerufenen SOKO enthielt – Chefinspektor Max Drombovic –, und eben dem einen Foto als Anhang hatte Ferdinand nichts weiter in der Hand. Das musste sich schnellstmöglich ändern.
Es gab jedoch noch eine Neuigkeit, die Ferdinand vor seiner Abfahrt im Intranet der Polizei entdeckt hatte. Eine erste Verhaftung hatte stattgefunden: ein Verdächtiger, der zwar in der Steiermark gemeldet, aber deutscher Staatsbürger war. In einem solchen Fall könnte sich Ferdinand als Ermittler von Europol für eine Beratertätigkeit ins Spiel bringen, da er bereits in beiden Ländern gearbeitet hatte.
Der Stichl war tot. Der Sterz war hier, um den Mord aufzuklären. Zeit, sich an die Arbeit zu machen.
Trotzdem genoss Ferdinand die Frankfurter Würstel bis zum letzten Biss.
5
Die Passanten, Standlbetreiber und Würstelesser bei einer kurzen Verschnaufpause zu beobachten, war im Prinzip nichts Ungewöhnliches. Von der Ecke an der schmalen Franziskanergasse hatte man einen guten Blick über den gesamten Hauptplatz.
Doch augenblicklich stellte sich der Wunsch nach einer vollkommen irrationalen Aktion beim Beobachtenden ein: sich auf jemanden in der Menge zu stürzen mit einem Schrei. Ihn zu töten am helllichten Tag, vor aller Augen.
Was für ein ungeheuerlicher Gedankengang.
Vielleicht, weil das Töten erst vor Kurzem Einzug in das Leben des Beobachtenden gehalten hatte und noch frisch im Blut zirkulierte?
Der Drang nahm zu, wurde fast übermächtig. Die Herzschläge beschleunigten sich, ein Pfeifen in den Ohren.
Der Beobachtende rang nach Luft, lehnte sich an eine Hausmauer und schloss die Augen. Begann von sechzig herunterzuzählen. Was bei null passieren würde, war nicht vorauszusehen.
Die Minute verstrich, und nichts geschah.
Mit stetig klopfendem Herzen ging der Beobachtende seiner Wege, verschwand im Häuserschatten der Gasse, wurde selbst Teil des Menschenstroms.
Der auf den Stufen des Brunnens sitzende und Würstel essende Inspektor wischte sich indessen die Krentränen aus den Augen. Er verspürte kein Kribbeln im Rücken, kein sechster Sinn schlug bei ihm an.
Ferdinand sah weiter nach oben, über die Fassade der Altbauten und Läden, zum Uhrturm hinauf. Im Sonnenlicht wirkte die dunkle Spitze wie ein Pfeil, der in den blauen Himmel zeigte. Wolkenlose Leichtigkeit, die er sich nicht nur für den Moment wünschte.
Goldener Oktoberbeginn in der Hauptstadt des Schilcherlandes Steiermark.
6
Ferdinand warf den leeren Pappteller und die zerknüllte Serviette in den Mülleimer und sah nach oben zur großen Uhr am Rathaus. Keine vier Stunden mehr bis zum wichtigen Zusammentreffen am Landeskriminalamt. Dort würde sich entscheiden, ob er es schaffte, sich tatsächlich dem Team um die Mordaufklärung anzuschließen. So motiviert und getrieben Ferdinand war, so genau wusste er auch, wie schwierig sich seine Position darstellte.
Ihm musste es gelingen, offiziell eingebunden zu werden. Mit seiner Fachkompetenz konnte er vielleicht punkten, doch die hatte jeder der Ermittler. Dass es eine Verbindung zu Deutschland gab, schien immer noch das beste Argument auf Ferdinands Seite zu sein.
Dringend war zusätzlich, dass die hiesige Polizei um eine sofortige Freistellung bei seinem jetzigen Arbeitgeber ansuchen musste. Sonst müsste er seinen Dienst in Köln bereits am nächsten Tag wieder aufnehmen. In Gedanken begann er, eine Mail an seinen Vorgesetzten zu entwerfen, um sein Verhalten und seine überstürzte Abreise zu rechtfertigen.
Die schwierigste Hürde allerdings stellte seine Befangenheit dar. Er müsste die enge Verbindung zwischen Ludwig und ihm angeben und wäre damit aus dem Rennen, bevor er es überhaupt an die Startlinie geschafft hätte.
»Eins nach dem anderen, Ferdi«, murmelte er leise und marschierte vom Hauptplatz weiter in die Herrengasse. Einige alteingesessene Geschäfte gab es immer noch, doch viele neue Läden säumten die Fußgängerzone.
An der Ecke zur Jungferngasse stoppte er. Hier hatten Ludwigs und Lenas Großeltern mütterlicherseits und auch die Kinder unter der Woche gewohnt. Auf Wunsch vom Großvater hatten beide nach der Volksschule auf ein Gymnasium in Graz gewechselt.
Die fleißig backende Oma Erna und der überstrenge Opa Ludwig, von dem der Stichl seinen ersten Vornamen erhalten hatte. Laut ihm waren Opas Ohrfeigen heftig und Omas Kuchen saftig gewesen, nach dem Tod der Großmutter blieben die Schläge ohne Zuckerguss. Darunter hatte der Wiggerl stetig gelitten, es aber nie seiner Mutter erzählt. Ferdinand fand diesen Umstand in der Rückschau nicht nachvollziehbar. Er erinnerte sich hingegen nicht mehr, wie es Lena ergangen war, was ihn für wenige Sekunden aus der Fassung brachte.
Er atmete tief durch und rief seine Gedanken zur Ordnung.
Bevor er sich erneut in Reminiszenzen verlor, zückte er sein Handy. Die gesuchte Nummer anzutippen, war vielleicht noch schwieriger als der bevorstehende Termin.
»Gemeindebezirk Raaba-Grambach, Büro vom Gemeinderat August Sterz, Grüß Gott. Was kann ich für Sie tun?«
Die Ansage war lang, und die Stimme klang derart süßlich, dass Ferdinand an einen Biss in einen Krapfen denken musste, aus dem Marillenmarmelade quoll.
»Inspektor Sterz am Apparat. Ich hätte gern meinen Vater gesprochen.«
Pause am anderen Ende der Leitung. Ferdinand fragte sich, ob die Person hinter der süßlichen Stimme überhaupt wusste, dass August Sterz einen Sohn hatte.
»Hallo, sind Sie noch dran?« Ferdinand versuchte, der Süße Schärfe entgegenzusetzen. »Stellen Sie mich doch einfach durch. Bitte. Oder ist er in einer Sitzung?«
»Ah, ja … ich meine, nein.« Die Verunsicherung war greifbar. Dann: »Ich verbind Sie sofort, Herr Sterz, ich meine, Herr Inspektor.«
Ein Klavierstück setzte ein, aus dem Sofort wurde eine längere Wartezeit mit klassischer Musik.
Ferdinand konnte sich gut vorstellen, dass die Stimme erst Rücksprache mit dem Gemeinderat hielt. Auf ein oder zwei Minuten kam es ihm allerdings nicht an.
»Ferdinand? Bist du es?« Der neue Gesprächspartner hörte sich vollkommen anders an als die süße Begrüßung. Kräftig und extrem überrascht. »Is was passiert?«
Nun musste Ferdinand erst mal schlucken. Er sah seinen Vater vor sich, den großen Mann mit den breiten Schultern, dessen Haare in den Jahren weiß geworden waren und der einen Bart trug, ebenfalls weiß. August Sterz hätte an Weihnachten ohne Perücke den Nikolaus spielen können.
»Alles in Ordnung, Papa.« Der nächste Satz fiel ihm schwer.»Du, ich bin in Graz und muss dich dringend um einen Gefallen bitten.«
»Wo bist du?«
»Vorhin angekommen.«
»Aber geh«, ein Verlegenheitsräuspern. »Warum hast dich nicht angekündigt? Ich hätt dich abgeholt vom Flughafen.«
»Ich bin mit der Bahn gefahren, Papa.« Auch Ferdinand hüstelte. »Es musste rasend schnell gehen.«
»Du kommst wegen dem Ludwig, gell?«
Und du hast mir nicht einmal Bescheid gegeben, Vater. Wenn schon kein Anruf, dann wenigstens eine Postkarte.
Ferdinand schluckte den Vorwurf hinunter. »Genau.«
»Wegen der Beerdigung weiß keiner etwas, Ferdinand. Sein Körper is noch nicht freigegeben worden, hat die Lena mir erzählt. Is noch in der Gerichtsmedizin in Graz.«
Aha, mit Lena hast du über Ludwig geredet, aber mit mir nicht.
Auch die nächste Vorhaltung musste auf einen passenderen Zeitpunkt warten.
»Papa, ich muss mich kurzfassen. Pass auf: Ich hab gleich einen Termin im Landeskriminalamt. Ich will …« Er stockte. »Nein, ich muss mit ermitteln. Verstehst du das?«
»Na ja, schon. Sehen wir uns danach?«
»Papa, hör zu. Der Gerald Wiedenhüpfer ist doch dein Golfpartner. Dein Freund, dein Spezi.«
»Du meinst den Chefinspektor.« August Sterz mochte Titel.
»Genau, Papa. Er sitzt in der Polizeidirektion und hat das Sagen bei Mordermittlungen. Er kann mir mit einer Autorisierung behilflich sein, dass ich ins Team einbezogen werde. Verstehst du?«
»Du überrollst mich damit, Ferdinand.« Sein Vater schnaubte. »Ich kann mich Ende der Woche mit ihm zum Golfen verabreden und das Thema anschneiden.«
»Papa. Jetzt.«
»Wie jetzt?«
»Ich leg auf, und du tätigst einen Anruf. Ein Leichtes, finde ich.«
»Leicht wohl nicht, Ferdi. Bist du nicht eh befangen, weil ja der Stichl und du so gut befreundet wart?«
Der Einwand traf voll ins Schwarze. »Ewig her und keiner Rede wert, Papa. Was ich brauche, ist einfach ein wenig Unterstützung.«
»Vitamin B.«
»Nein, es geht nicht um meine Karriere, sondern nur um eine Art Eintrittskarte.«
»Was is mit Köln?«
»Bei Europol regelt sich alles, wenn es hier anläuft.«
»Wirst du bei mir wohnen, Ferdinand?«
Der Themenwechsel überrumpelte nun Ferdinand. Doch in der nächsten Sekunde wurde ihm der angebotene Deal seines Vaters klar. Vater und Sohn, nach Jahren wieder unter einem Dach, kein Postkartenaustauch, kein Skype, sondern ein persönliches Miteinander. Als Gegenleistung winkte der Anruf.
»Hab ich vor, Papa.«
»Wann wirst denn heute zu Hause bei mir sein? Ich werd früher Schluss machen und alles vorbereiten. Bett überziehen und so.« Er ließ einen leichten Schmunzler anklingen. »Wir könnten uns auch zuerst im Gasthaus Zur Schmied’n treffen. Zur Wiederkehr eine Einladung meinerseits.«
»Ich kann es nicht sagen. Wenn alles gut läuft, stecke ich rasch mitten in den Ermittlungen.«
»Ich würd mich freuen, wenn es mit einem ersten gemeinsamen Abendessen losgeht, Ferdinand.«
Zweite Bedingung. Wobei der Vorschlag mit dem Gasthaus nicht schlecht war. Das Wiedersehen auf neutralem Boden.»Ich mach es möglich, Papa, und gebe dir noch eine Zeit durch. Stimmt deine Handynummer noch?«
»Tut sie. Ruf aber bei meiner Sekretärin an. Ich geb dir die Durchwahl. Sie regelt auch meine privaten Termine.« Von Nähe auf Distanz in atemberaubendem Wechsel.
»Verstanden, Papa. Zuerst jedoch bitte Wiedenhüpfer.«
»Ich versuch mein Mögliches, kann dir aber nichts versprechen.«
»Weiß ich.«
»Bis später, Ferdi, baba.«
Kaum war das Telefonat beendet, spürte Ferdinand ein Brennen im Magen. Der ungewohnt scharfe Kren oder das bevorstehende Gespräch am LKA. Am wahrscheinlichsten aber der Austausch mit seinem Vater.
Wie aus dem Nichts war sie ebenfalls wieder da. Die Trauer um den Tod seiner Mutter. Ferdinand krümmte sich nach unten und hielt sich mit einer Hand am Mauerwerk des Eckhauses zur Jungferngasse fest.
Mama, Mama – ein Ruf nach seiner Mutter geisterte durch seinen Kopf. Er war wieder elf und seine geliebte Mama von einer Stunde auf die andere nicht mehr in seiner Welt. So oft hatte er wach gelegen und sich vorgestellt, wie es für Alma in den letzten Sekunden gewesen sein musste. Die Scheinwerfer, die ihr entgegenkamen, der Zusammenstoß, der Aufprall. Hatte seine Mutter gelitten? Hatte sie gewusst, dass ihr Leben gleich vorbei sein würde? Hatte einer ihrer letzten Gedanken Ferdinand gegolten?
»Hey, du! Alles in Ordnung?«
»Danke, mir geht es blendend«, antwortete er und sah hoch.
Ein junger Mann in einer grasgrünen Outdoorweste und einem rötlichen Spitzbart am Kinn berührte ihn leicht an der Schulter. »Du schaust nicht so aus. Echt alles im grünen Bereich?«
»Im grasgrünen.« Ferdinand versuchte einen Scherz. »Wie dein frisch gemähtes Oberteil.«
Der andere lachte schallend. »Oida, du bist aber a Lustiger!«
Obwohl der Schmerz immer noch andauerte, stimmte Ferdinand in das Lachen mit ein.
7
Am Empfang zeigte Ferdinand seinen Dienstausweis von Europol und hoffte das Beste.
Er hatte sich entschlossen, die Zeit, die ihm bis zu seinem Zusammentreffen mit Chefinspektor Wiedenhüpfer blieb, zu nutzen. Vom Jakominiplatz weg hatte er Straßenbahn und Bus genommen und war zur Medizinischen Universität gefahren, um sein Glück beim Diagnostik- und Forschungsinstitut für Gerichtliche Medizin zu versuchen.
Wobei Glück ein völlig falsches Wort war. Ferdinands Vater hatte ihn mit seiner Bemerkung, dass die Leiche von Ludwig noch nicht freigegeben war, darauf gebracht.
Aus seinem ersten Jahr als junger Ermittler hatte er das Gelände kleiner in Erinnerung. Ein Zeitungsartikel über eine groß angelegte Erweiterung fiel ihm ein, den ihm Hannerl Hawlik vor zwei oder drei Jahren geschickt hatte. Er hatte nie auf ihre Post geantwortet, für dieses Versäumnis war dringend eine große Entschuldigung fällig.
»Was kann ich für Sie tun?«
Der Pförtner saß hinter einer Plexiglasscheibe, trug eine elegante dunkelrote Fliege am Hemdkragen und hatte einen Dreitagebart, was nicht recht zusammenpassen wollte.
»Inspektor Sterz, Kriminalpolizei. Ich will zur Gerichtsmedizin. Es geht um einen aktuellen Mordfall.« Ferdinand hielt sich knapp, je mehr er erklärte, desto unwahrscheinlicher war es, sein Vorhaben durchzuziehen.
Der Mann am Empfang runzelte die Stirn. »Zu wem denn? Haben Sie einen Termin?«
»Ich werde dringend erwartet.«
»Soll ich Sie im Sekretariat ankündigen oder direkt in Dr. Casellas Büro melden?«
»Bei Dr. Casella natürlich.« Auch wenn Ferdinand keine Ahnung hatte, wer hinter dem Namen stand.
Ohne ein weiteres Wort wandte sich der Pförtner einer Schaltfläche zu und nahm einen Telefonhörer in die Hand. Nach einer kurzen Pause hörte Ferdinand ihn leise reden, konnte aber wegen der Plexiglasscheibe keinen zusammenhängenden Satz verstehen. Er wappnete sich, bei einer Abfuhr zu insistieren.
Der Mann am Empfang legte auf und beugte sich vor.»Es holt Sie gleich einer ab. Gehen S’ durch und bleiben S’ am Lift stehen, ja?!«
»Danke.«
Das Innere des weitläufigen Gebäudekomplexes sah elegant und futuristisch aus.
»Kann ich meinen Koffer bei Ihnen lassen?« Ferdinand wandte sich noch einmal an den Pförtner.
Der kratzte sich am Kinn, zupfte im Anschluss an der Fliege. »Ungern.«
»Ja oder nein?«
»Hallo? Inspektor Sterz?«
Eine Frauenstimme unterbrach. Ferdinand drehte sich um. Eine Assistentin oder auch Studentin stand in einer langen beigen Strickjacke hinter ihm. Die Frau sah derart jung aus, dass sie durchaus als Gymnasialschülerin hätte durchgehen können. Ihr Körperbau war zierlich, sie reichte ihm gerade einmal bis an die Schulter. Das lange dunkelblonde Haar hatte sie zu einem dicken Zopf gebunden, der seitlich über den breiten Kragen fiel. Ihre Augen strahlten in einem Grün, das Ferdinand an die Weste des Mannes erinnerte, der ihn vorhin am Brunnen nach seinem Befinden gefragt hatte.
»Genau der bin ich.«
Er streckte ihr die Hand entgegen, die sie nicht annahm. Stattdessen neigte sie nur ihren Kopf. »Kann ich Ihren Ausweis sehen?«
»Bitte.«
Ihr Blick war länger und prüfender als der des Mannes am Empfang. »Europol?«
»So ist es. Ich bin heute Morgen aus Köln angereist und werde zum Fall Ludwig Stichlhofer hinzugezogen.« Eine nächste Schwindelei, die allerdings hoffentlich bald wahr werden würde. »Ich wollte mir einen eigenen ersten Eindruck verschaffen. Wenn Sie also so freundlich wären, mich zu Dr. Casella zu bringen.«
»Ich bin Casella«, sie zeigte ein kurzes Lächeln.»Dr. Katarina Casella. Folgen Sie mir, aber lassen Sie den Koffer hier. Das geht doch, Herr Kastner.«
Der Pförtner erhob sich. »Selbstverständlich, Frau Doktor.« Dann, an Ferdinand gewandt: »Na, stellen S’ Ihr Gepäck dort in die Eck’n. Damit keiner drüberstolpert.«
Ferdinand tat, wie ihm geheißen, und musste sich im Anschluss beeilen, um mit der Gerichtsmedizinerin Schritt halten zu können.
Katarina Casella hatte den Zeigefinger ausgestreckt und bewegte ihn wie über eine Landkarte am Körper der Leiche entlang.
»Hier. Das Durchtrennen der Bauchaorta war kausal für den Tod. Die anderen Zinken der Mistgabel haben nur Fleisch durchbohrt. Wenn der Treffer ein paar Millimeter weiter links oder rechts erfolgt wäre, hätte das Opfer überleben können. Der kleine Unterschied mit der einen finalen Wirkung.«
Ferdinand war damit beschäftigt, sich seinen Schock nicht anmerken zu lassen.
Sie standen nebeneinander an einem der Sektionstische. Beide trugen sie jetzt einen grünen Schutzkittel, Handschuhe, Häubchen und einen Mundschutz. Grün schien die dominante Farbe zu sein, auf die Ferdinand hier traf, vielleicht, weil die Steiermark als das grüne Herz Österreichs betitelt wurde. Dieser winzige, vom Geschehen ablenkende Gedanke in seinem Kopf half ihm, sich ein wenig aus der Starre zu lösen.
Ferdinand hatte in seinen Dienstjahren viele Tote gesehen und zusammen mit den Rechtsmedizinern vor Ort oder in den Räumen der Rechtsmedizin begutachtet, aber keines der Opfer hatte er gekannt oder war mit ihm sogar eng befreundet gewesen.
Ludwigs Körper zu betrachten, war traumatisch. Das Foto, das Ferdinand von der Leiche gesehen hatte, hatte ihn nicht auf den direkten Anblick vorbereitet. Ihm wurde bewusst, dass er erst in diesem Moment realisierte, dass es sich bei dem Mann vor ihm wahrhaftig um den Stichl handelte.
Bloß und nackt, durch die Einstiche entstellt, war der tote Freund aufgebahrt. Die schwarzen Löcher, hervorgerufen durch die Gabelzinken, wiesen Umrandungen von dunklen Blutergüssen auf. Dazu die Nähte an Brust und Bauch, die von der Sektion stammten. Alles in allem atemberaubend schrecklich. Ein Wiedersehen des Grauens, würde Ferdinand es benennen, wenn es dafür überhaupt Worte gab.
Ludwigs Wangen waren eingefallen, das Gesicht von Falten durchzogen, die schon zu Lebzeiten da gewesen sein mussten. Ferdinand fragte sich, ob der Jugendfreund schneller gealtert war als er selbst oder ob auch er älter aussah, als er es sich beim Blick in den Spiegel eingestand.
Ein süßlicher Geruch schwebte in der Luft, der Ferdinand körperlich schmerzte.
»Er ist also innerlich verblutet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Dr. Casella. Hat es lange gedauert?«
»Bei einer solchen Verletzung verstirbt man binnen kürzester Zeit. Jede Hilfe wäre zu spät gekommen.»
»Hat er gelitten?«
Katarina Casella hob die Augenbrauen. »Normalerweise fragen das nur die Angehörigen.«
»Bei meinen Ermittlungen will ich mir ein abgerundetes Gesamtbild verschaffen. Ich erkundige mich bei jedem Mordopfer nach diesen Details.« Wieder das Flunkern. Ferdinand war nicht der Typ, dem erfundene Geschichten leicht über die Lippen kamen. Er hoffte, dass er bald keine Ausreden mehr benötigte.
»Okay.« Sie hob erneut ihren Zeigefinger. »Ich gehe davon aus, dass der Schockzustand lange genug angehalten hat, um Schmerzen gar nicht erst aufkommen zu lassen.«
Ferdinand schickte ein Stoßgebet gen Himmel, dass die Gerichtsmedizinerin recht hatte.
»Was haben Sie bisher noch herausgefunden, Dr. Casella?«
»Ich dachte, Sie sind bei den Ermittlungen mit dabei, Inspektor Sterz.«
»Da ich eben erst angekommen bin, fehlen mir die aktuellsten Daten.«
»Wollen wir in meinem Büro weiterreden, bei einem Kaffee? Sie sehen blass aus.«
Ferdinand schüttelte den Kopf. Die Zeit lief, und das Landeskriminalamt lag nicht ums Eck. Er musste die Fahrtzeit mit den Öffis einplanen. Noch dazu hatte er einen zweiten Zwischenstopp privater Natur vor. Als Erstes aber musste er dringend zurück an die frische Luft. Er hatte plötzlich das Gefühl, dass dieser spontane Besuch in der Gerichtsmedizin keine gute Idee gewesen war. Ferdinands Auftauchen dort, noch bevor er offiziell eingebunden war, konnte auf ihn zurückfallen.
»Wir werden uns sicher zu einem anderen Zeitpunkt wiedersehen, Dr. Casella. Jetzt bräuchte ich eine Kurzversion.«
»Nun, dann würde ich sagen, Sie studieren meinen Bericht.« Auch mit Mundschutz war ihr die Skepsis anzusehen.»Melden Sie sich, wenn Sie tatsächlich mit dem Team um Chefinspektor Dromeritsch agieren.«
Sie betonte den Namen des Ermittlungsleiters. Die kleine Finte durchschaute Ferdinand sofort. Darüber musste er lächeln, was seine Fassungslosigkeit endlich schrumpfen ließ.
»Mit Chefinspektor Max Drombovic, wie er richtigerweise heißt, will ich heute noch zusammentreffen. Deshalb muss ich jetzt weiter, Dr. Casella.«
»Ich halte Sie nicht auf. Möchte Sie aber trotzdem bitten, erst meinen Bericht zu lesen. Danach wird ein Austausch leichter sein. Folgen Sie mir, ich bringe Sie zum Empfang zurück, damit Sie sich nicht verlaufen.«
Die Gerichtsmedizinerin gab einem Assistenten, der im Hintergrund gewartet hatte, einen Wink und ging Richtung Ausgang.
Ferdinand verharrte noch wenige Sekunden. »Mach’s gut, Wiggerl«, flüsterte er. »Ich find den, der dir das angetan hat. Ich schwör’s dir.«
»Wie bitte?« Katarina Casella drehte sich um.
»Ich sagte, dass ich Ihr Angebot gerne in den nächsten Tagen nachholen möchte. Ein Gespräch, einen Austausch. Dazu mit Ihnen einen starken österreichischen Kaffee zu trinken, wird mir ein Vergnügen sein.«
Erst draußen, als sie beide Schutzkleidung, Mundschutz und das Häubchen abgenommen hatten, gab sie ihm eine Antwort. »Inspektor Sterz, bei mir gibt es einen Cappuccino oder einen Espresso. Ich hoffe, Sie mögen die italienische Variante genauso gern.«
»Das klingt wunderbar, Dr. Casella.«
»Das ist mein Caffè auch.« Sie nickte ihm augenzwinkernd und diesmal ohne Misstrauen zu.
Ferdinand dachte über die Unmöglichkeit nach, dass Katarina Casella jünger wirkte, als er bei seinem Weggang aus Graz gewesen war.