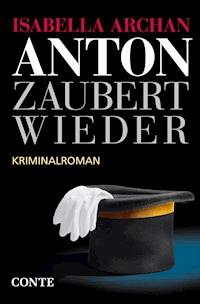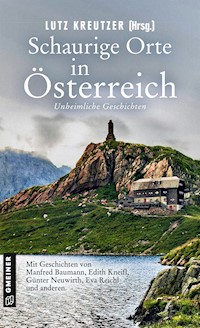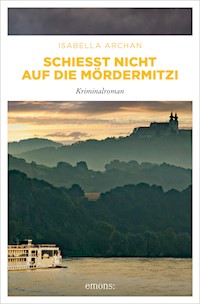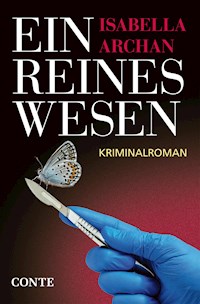Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: MörderMitzi und Agnes
- Sprache: Deutsch
Schräg, schwarzhumorig, ungewöhnlich. Alpenblick? Idyllische Ruhe? Nix da! Mitzi kann's mal wieder nicht lassen. Als eine alte Dame, die Mitzi an ihre Oma erinnert, bei einem Brand ums Leben kommt, schrillen bei ihr alle Alarmglocken. Sie bittet Inspektorin Agnes Kirschnagel um Hilfe, die tatsächlich auf ein Verbrechen stößt – der einzige Erbe wird verhaftet. Der Fall scheint gelöst. Doch Mitzi findet heraus, dass sich das Opfer von einer geheimnisvollen Weißen Frau verfolgt fühlte. Als ihr nicht einmal Agnes Glauben schenkt und es eine weitere Tote gibt, wagt sie einen gefährlichen Alleingang ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Isabella Archan wurde 1965 in Graz geboren. Nach Abitur und Schauspieldiplom folgten Theaterengagements in Österreich, der Schweiz und in Deutschland. Seit 2002 lebt sie in Köln, wo sie eine zweite Karriere als Autorin begann. Neben dem Schreiben ist Isabella Archan immer wieder in Rollen in TV und Film zu sehen, unter anderem im Kölner »Tatort«, in der »Lindenstraße« und in »Die Füchsin«. Ihre MordsTheaterLesungen zu ihren Krimis erfreuen sich großer Beliebtheit.
www.isabella-archan.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang findet sich ein Glossar.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Katya Evdokimova/Arcangel Images
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-637-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
Ich will dir sagen, woran ich glaube. Ich glaube an das unterschwellig Wahrnehmbare.
Stephen King
Ohne Glaube Liebe Hoffnung gibt es logischerweise kein Leben. Das resultiert alles voneinander.
I.
MarillenknödelFeuer
– Um auf Ihre Eltern zurückzukommen, Frau Schlager.
Dr. Rannacher ist Psychotherapeut in Wien und hat mit seinem weißen Bart und seiner Nickelbrille Ähnlichkeit mit Sigmund Freud. Das hat er nie beabsichtigt, aber er kokettiert schon mal damit. Seine heutige Patientin ist Maria Konstanze Schlager, die extra aus Salzburg zu ihm angereist ist.
– Meine Eltern sind und bleiben tot. Auch mein kleiner Bruder, der Benni. Durch meine Schuld. Es war an einem Sonntag. Mama, Papa, mein kleiner Bruder und ich, wir waren auf unserem Grundstück in Kalsdorf, in der Steiermark. Mit Blockhütte. Eigentlich war es dort immer toll, viel Wiese und dahinter der Wald. Ich wollt Spaghetti am Campinggasherd kochen und hab das Gas aufgedreht. Plötzlich krabbelt eine Spinne über den Boden, eine riesige Spinne, und ich bin davongelaufen. Als die Mama und der Papa mit dem Benni auf dem Arm in die Blockhütte sind, is alles explodiert. Nur ich war nicht drinnen. Ich war bei den Obstbäumen.
– Den Ablauf haben Sie mir bereits öfter geschildert. Ich verstehe, dass Sie sich schuldig fühlen, versuche aber, Ihnen diese Schuld zu nehmen. Es war ein Unfall. Ein schrecklicher, dummer, unfassbarer Unfall. Nicht mehr, leider auch nicht weniger, Frau Schlager.
– Sie können gern Mitzi zu mir sagen. Frau Schlager, das klingt so förmlich. Und alt.
– Wie alt fühlen Sie sich denn, wenn ich Sie mit Frau Schlager anspreche?
– Wie neunundzwanzig. Oder fast dreißig eben.
– Und wenn ich Sie nun Mitzi nenne?
–
1
Es beginnt mit einem Druck auf der Blase.
Die alte Frau ist tief in ihren Träumen versunken, und nur ein kleiner Teil ihres Bewusstseins registriert das körperliche Bedürfnis.
Nein, nicht jetzt grad Pipi, denkt sie, irgendwo gefangen zwischen Traum und Wirklichkeit.
Sie stellt sich vor, dass sie in ihrem Lieblingscafé auf die Damentoilette geht. Dort im Café ist die Dekoration so hübsch, dass sie meistens stundenlang sitzen bleibt und sich abwechselnd die anderen Gäste und die kleinen gerahmten Bilder an der Wand anschaut. Sie zeigen die Wachaulandschaft und die Donau im Wechsel der Jahreszeiten. Einfach schön.
Ach, jetzt ein Kaffeetscherl, denkt sie weiter oder träumt sie vor sich hin. Dazu ein Marillenknödel. Mit der Gabel in den hellgelben gezuckerten Teil stechen und die Marille freischaufeln. Saftig und süß, gefolgt von dem leicht sauren Obstgeschmack.
Plötzlich kippt der Geruchstraum. Statt voller Blase ist es ein voller Magen. Zu voll. Als würde der Marillenknödel im Inneren wachsen und sich ausdehnen. Er macht nicht halt an den Magenwänden, sondern versucht sie zu sprengen.
Die alte Frau wimmert im Schlaf, ist aber noch nicht fähig, zu erwachen.
Ihr Magen, ihr Bauch, ihr gesamter Leib dehnt sich aus, spannt sich an. Es beginnt richtig wehzutun. Herrgott noch einmal, will sie rufen, laut, damit sie jemand hören kann.
Hilfe muss her. Im Traum platzt sie gleich. Ihre Vorderseite hebt sich, ein Berg wächst unter ihrem Nachthemd. Und es wird heiß. Die Temperatur steigt um sie und in ihr an, erreicht den Grad eines brütenden Sommertages.
Aber es is doch Winter. Kalter, grausamer Jänner mit mehr Schnee als die Jahre zuvor.
Die Jahreszeit interessiert den sich auftürmenden Vulkan, zu dem ihr Leib geworden ist, nicht. Er brodelt, er kocht, gleich wird er Lava spucken. Die Übelkeit wird unerträglich, der Schmerz breitet sich im gesamten Körper aus. Erfasst ihre Arme und Beine. Sie muss sich bewegen.
Die Explosion steht unmittelbar bevor. Mit einem irren Krachen reißt ihr Körper auf, zerreißt der Stoff des Nachthemds, das gute Teil, das jahrelang eines ihrer Lieblingsstücke gewesen ist.
Jesus, Maria und Josef, was is das?
Aus dem neuen Krater ihres Körpers steigt eine Gestalt empor. In Rot und Grellorange und Gelb und Weiß. Ein Ungetüm, das aus Flammen besteht. Feuerteufel, denkt sie wieder. Endlich auch: Aufwachen. Du musst wach werden. Das is zwar ein Traum, aber etwas stimmt nicht. Absolut nicht.
Sie sammelt Kraft, atmet ein und wieder aus. Heißen Atem, der einen säuerlichen Geruch hat.
Endlich schafft sie es, sich aus der Schlafstarre zu befreien. Sie setzt sich ruckartig auf. Ihr Oberkörper schnellt nach oben. In ihrem Rücken knackt es gewaltig. Ihr alter Körper ist ein derartiges Hochfahren nicht mehr gewohnt. Aber darum kann sie sich später kümmern.
Den Tobi wird sie anrufen, dass der für sie einen Termin beim Chiropraktiker ausmacht.
Dieser erste vernünftige und klare Gedanke macht sie ruhiger. Sie öffnet die Augen.
Aufrecht im Bett sitzend sieht sie sich um. Sie meint immer noch zu träumen.
Im Zimmer ist es nicht richtig dunkel. Die Weihnachtsdekoration von den Nachbarn gegenüber wirft ihr Licht durch die Vorhänge. Vor über zwei Wochen haben ihr die Hartlingers versprochen, alles endlich wieder einzumotten bis zum nächsten Lichterfest. Doch immer noch stehen dort drüben der Elch und die Kutsche mit bunten Packerln drauf, die der Weihnachtsmann verteilen soll.
Herrgott noch einmal. Es is eine totale Stromverschwendung. Diese Deppen. Sie wird ihnen morgen noch einmal ordentlich die Leviten lesen, den Hartlingers.
Zuerst muss sie sich um ihr eigenes Malheur, oder was auch immer heut Nacht in ihren vier Wänden geschieht, kümmern.
Das Schlafzimmer hat sich nämlich in eine Nebelwelt verwandelt. Feine Fäden kräuseln sich an der Decke, Wölkchen hängen an den Wänden, und über den Boden zieht sich eine dickere Schicht grauer Masse. Der Nebel strömt unter dem Spalt der Zimmertür durch, am seitlichen Rahmen kommt er ebenso herein.
Ihre Sicht ist eingeschränkt, sie kann den Spiegeltisch an der gegenüberliegenden Seite des Bettes nur durch eine graue Schleierwand erkennen.
Doch richtiger Nebel ist es nicht. Es herrscht keine Feuchtigkeit im Raum. Es ist nicht kühl, sondern warm. Viel zu warm. Der Alptraum mit dem Feuerwesen, wie es sich aus ihrem Inneren herausgesprengt hat, huscht durch ihre Erinnerung.
Der Nebel ist in Wahrheit Rauch.
Das wird der alten Frau in dem Moment klar, als der Husten einsetzt. Er ist mächtig und lang andauernd, es gelingt ihr kaum, zwischen den bellenden Tönen Atem zu holen. Der Husten verdrängt eine Weile alles andere. Tränen rinnen aus ihren Augen, ihre Lunge beginnt zu brennen, Punkte tanzen vor ihren Augen. Ihr Rücken knackt und knirscht bei jedem einzelnen Laut.
Nach einer gefühlten Ewigkeit lässt der Husten nach. Sie wischt sich mit dem Ärmel des Nachthemds die Augen trocken und braucht eine weitere Minute, um zu sich zu finden.
Was zum Teufel is hier los?
Apropos Teufel: Es stinkt. Als ob der Beelzebub mit seinem Huf gescharrt hätte. Nein, im Ernst. Es riecht wie letzten November, als sie die Pizza im Ofen vergessen und der Tobi ihr zu Feuermeldern geraten hat. Wollte sie im Frühling installieren lassen. Definitiv zu spät.
Feuer! Es brennt.
Ihr Haus, ihr Heim, ihr Dach überm Kopf fackelt gerade ab.
Nein. Sie schüttelt den Kopf. Das kann nicht sein. Jeden Abend dreht sie eine letzte Runde durch ihr kleines Häuschen, das noch mehr Jahrzehnte als sie selbst auf dem Buckel hat. Im Vorzimmer fängt sie an, begibt sich dann in das Wohnzimmer, von dort in die Nähstube und am Ende in die Küche. Besonders in der Küche schaut sie jeden Abend dreimal beim Herd nach, ob sie alle Schalter abgedreht hat. Jedes Mal. Jeden gottverdammten Abend das gleiche Ritual. Seit Jahren.
Ein Kurzschluss wäre eine Erklärung. Im Keller, bei den Sicherungen.
Die alte Frau schwingt die Beine aus dem Bett. Noch immer blitzen ein paar Sterne vor ihren Augen auf. Noch immer ist ihre Kehle gereizt. Der Husten kann jeden Augenblick wiederkommen. Sie knipst die Nachttischlampe an. Der Rauch lässt das sonst so helle Licht trüb erscheinen.
Sie muss handeln, schnell. Die Feuerwehr, die Polizei und den Tobi anrufen. Am Bettpfosten zieht sie sich hoch und kommt zum Stehen. Und stutzt. Die Haut auf ihren Händen sieht so rosig aus. Wie die Haut eines kleinen Schweins, eines Ferkels.
Schweinchenrosa.
Sie dreht sich um. Der Rauch unter der Tür strömt nicht mehr nur, er quillt herein. Ihr Herz beginnt zu rasen. Wahnsinniges Klopfen, das sie noch mehr erschreckt.
Sie macht ein paar Schritte Richtung Tür. Der Boden knarrt. Sie schaut nach unten, ihre Füße sind im Rauch verschwunden. Die Hitze im Zimmer steigt höher. Der Husten setzt wieder ein.
Die alte Frau muss sich krümmen und hustet sich im wahrsten Sinn der Worte die Seele aus dem Leib. Trotzdem gelingt es ihr nach einer Zeit, das Bellen anzuhalten. Sie zwingt sich, still zu sein. Da ist ein Geräusch, ein Lärm, der langsam lauter wird. Er kommt von hinter der Tür. Ein Knistern. Etwas frisst sich draußen durch ihr Haus, stopft sich den Bauch an ihrem Heim voll. Es hört sich an, als würden Zähne mahlen.
Feuer! Es brennt. Eindeutig.
Kein Zögern, sondern Handeln.
Ihr wird klar, dass es nicht klug ist, jetzt die Tür zu öffnen. Also fällt das Telefon im Wohnzimmer weg. Das Handy, das ihr der Tobi geschenkt hat, wäre jetzt ein Sechser im Lotto. Wo hat sie es nur hingetan?
Heureka, sie weiß es wieder. Sie hat gestern vor dem Schlafengehen noch eine Nachricht geschrieben. Mühsam eingetippt mit ihren arthritischen Fingern, mit einem Foto vom Schnee draußen. An den Tobi. All das hat sie geschafft, so wie es der Tobi ihr erklärt hat. Schon hundertmal. Danach hat sie das Ding auf der Fensterbank abgelegt.
Überhaupt ist das Fenster die beste Idee. Nix wie raus. Das Schlafzimmer liegt zwar im ersten Stock, aber besser ein paar gebrochene Knochen, als zu ersticken oder gar zu verbrennen. Warum hat sie nicht gleich daran gedacht?
Dummes Weiberl, du!
Fenster auf und um Hilfe rufen. Frische Luft hereinlassen. Warten auf die Feuerwehr. Die Hartlingers werden wohl hoffentlich wach werden und Alarm schlagen. Oder jemand anders am Mitterweg hier in Krems. Wenn nicht, kann sie immer noch springen, als letzte Option.
Die alte Frau dreht sich. Atmet tief ein. Holt Luft für die nächsten Schritte Richtung Fenster.
Ein Fehler.
Ihre Knie geben nach. Es ist wie ein Zusammenklappen, ein Darniedersinken. Das Denken fällt ihr schwerer. Es fühlt sich an, als würde sie zurück in die Traumwelt gezogen.
Bitt schön nicht. Dort lauert das Feuermonster, das vorhin aus ihrem Bauch gesprungen ist.
Ihre Augenlider schließen sich, sie kann nichts dagegen tun. Es wird dunkel um sie. Die alte Frau stößt einen letzten tiefen Seufzer aus.
Doch statt eines Feuerteufels taucht ein Marillenknödel vor ihr auf. Schwebt in der rauchigen Luft des Zimmers. Ein Marillenknödel, mit Puderzucker umhüllt. Flaumig und weich ist der Teig. Die Marille innen drin wird saftig und ein wenig sauer schmecken. Das weiß sie. Sie öffnet den Mund. Der Marillenknödel schwebt hinein. Sie beißt zu.
So schmeckt also der Tod.
Das ist das Letzte, was die alte Frau denkt.
2
Toni Krooß musste eine Pause machen.
Eigentlich war es den Feuerwehrleuten nicht erlaubt, sich vom Brandherd zu entfernen, aber Toni hatte das Gefühl umzukippen, wenn er sich nicht eine minimale Auszeit gönnte.
Er war hinter der Reihe von drei Feuerwehrwägen, mehreren Polizeieinsatzfahrzeugen und dem Krankenwagen vorbeigeschlichen. Wie ein Dieb, oder schlimmer, wie einer, der den Brand gelegt haben könnte. Denn dieses Feuer sah nach Brandstiftung aus.
Nicht spekulieren. Toni holte tief Luft. Noch stand nichts fest.
Außer dass es einen Toten gegeben hatte. Oder eine Tote. An der verkohlten Leiche in einem der ausgebrannten Räume in dem alten Haus am Mitterweg war unmöglich direkt zu erkennen, ob die Leiche männlich oder weiblich war. Zumindest für ihn.
Inzwischen waren auch zwei dunkelblaue Kombis mit jeweils drei Spurenermittlern an Bord eingetroffen. Sie würden den Fall untersuchen. Er, Toni Krooß, freiwilliger Feuerwehrmann in seinem zweiten Jahr, würde es wohl erst über die Kameraden erfahren, wer dort drinnen ums Leben gekommen war. Oder aus der Zeitung.
Noch nicht einmal zwei Wochen war der Januar alt und schon so ein Unglück. Schlechtes Omen für das neue Jahr.
Es begann leicht zu schneien. Toni nahm seinen Helm und die Sauerstoffmaske ab und streckte die Zunge heraus. Schneeflockenfangen, das war es, was er brauchte. Ein paar Minuten Auszeit, dann würde er kehrtmachen und an seinen ehrenamtlichen Arbeitsplatz zurückkehren, ohne dass die Kameraden etwas bemerkt hätten.
Ehrenamt, das Wort klang falsch in Tonis Ohren. Weil er damit Begeisterung und Freude verband. Doch bereits seit seinem ersten Einsatz wollte er wieder aufhören. Gemeinwohl hin oder her, er hatte sich die Hitze, den beißenden Geruch, die körperliche Anstrengung nie derart intensiv vorgestellt. Als ihn seine Oma zu dieser Tätigkeit gedrängt hatte, war er davon ausgegangen, dass er hauptsächlich Katzen von Bäumen und Lebensmüde von Dächern zu retten hatte. Hin und wieder ein Feuer, leicht in den Griff zu bekommen. Dazu Lob und Anerkennung von den Kremsern, den Kollegen und der Familie.
Er war eines Besseren belehrt worden. Allein in diesem Winter war es bereits der vierte Großbrand. Was zum Teufel trieben die Leute? Hatten alle in der Stadt und im Umland marode Leitungen und alte Öfen? Oder fanden es viele spaßig, ein Lagerfeuer in den eigenen vier Wänden zu machen?
Apropos Feuer: Die Leiche fiel ihm wieder ein. Der Moment, in dem er und die Kameraden die Feuerwand bezwungen hatten und ins Innere vorgedrungen waren. Unten im Parterre war so gut wie alles ausgebrannt. Verkohlte Möbel, geschmolzener Nippes, die Wände voller Ruß. Hier würde in absehbarer Zeit niemand mehr wohnen, das Haus war zu einer Ruine geworden.
Nach der Absicherung waren er und Johannes, der gutmütige und stets gut gelaunte Kumpel, immer noch vorsichtig die Treppe hoch. Die Stufen waren aus Stein, und das Feuer hatte sie mit schwarzen Flecken übersät, sodass sie aussahen wie verfaulte Zähne. Aber sie waren stabil. Johannes und Toni waren in den ersten Stock vorgedrungen.
Oben gab es ein Bad und ein einziges weiteres Zimmer. Johannes hatte die Reste der Tür mit seinem Feuerwehrbeil weggeschlagen und war als Erster hinein. Toni, dicht hinter ihm, hatte eine Sekunde lang gedacht, dass der Klumpen am Boden wie ein großes verbranntes Hähnchen aussah, das jemand am Grill vergessen hatte. Im nächsten Augenblick war ihm klar geworden, dass zwischen Bett und Tür eine stark verkohlte Leiche lag.
Der Körper war in einer eigenartigen Haltung. Der Kopf zur Seite gedreht. Ein Arm nach vorne gestreckt, der andere nach hinten gebeugt. Wie ein Kleinkind, das in einer schrägen Haltung eingeschlafen war. Hier wäre es allerdings ein Kind, das in der Hölle geschmort hatte. Schaurig.
Tonis Kamerad Johannes hatte die Leiche umrundet und sich im Zimmer nach weiteren Brandherden umgesehen. Doch die Truppe hatte bereits von außen ganze Arbeit geleistet. Auf einen Wink von Johannes hin waren sie beide wieder nach unten und vor den Eingang gegangen. Sobald die Hitze nachließ, würde dieser Tatort, denn das war das abgebrannte Haus nach ihrer Entdeckung geworden, von den Brandermittlern in Augenschein genommen werden. Johannes und Tonis Arbeit war fürs Erste erledigt.
Toni hatte während des Berichts von Johannes beim Hauptmann hauptsächlich genickt. Johannes war im Anschluss zu den Kameraden zurück, und Toni hatte sich schnell und leise hinter die Wagenreihe geschlichen, um sich die kurze Auszeit zu gönnen.
Die frische Januarluft tat ihm gut. Das Tanzen der Schneeflocken ebenso. Der Lärm von der Unglücksstelle klang gedämpft zu ihm herüber, und er schloss die Augen.
»Die alte Dame, die dort lebt. Hat sie es überstanden?«
Die Stimme riss Toni aus seiner Verschnaufpause. Sein Herz machte einen Stolperer, schlug etwas schneller.
»Gott, haben Sie mich erschreckt. Was schleichen S’ sich denn so an!« Tonis Ton war harsch. Journalisten waren eine Pestplage.
»Ich bin nicht von der Presse.«
Der Mann schien seine Gedanken erraten zu haben. »Das soll ich dir glauben?« Toni war direkt zum Du übergegangen. Schaulustige waren noch schlimmer. Pest und Cholera.
»Ich bin auch kein Gaffer, wenn Sie das denken.«
Wenn Toni ehrlich war, wirkte der Fremde tatsächlich weder wie das eine noch wie das andere. Auf seinem Kopf saß eine Strickmütze, und sein dunkler Bart war mit Schneeflocken übersät. Er trug einen Parka und hatte beide Hände in den Taschen vergraben. Keine Anzeichen, dass er ein Handy zücken wollte, eine Kamera oder auch nur einen Notizblock.
Dennoch blieb Toni misstrauisch. »Hier haben Privatpersonen nichts zu suchen. Eigentlich sollte der Bereich längst abgesperrt sein. Also, der Herr, gemma weiter.«
»Hat die alte Dame überlebt?«
Erneut stellte der Mann diese Frage. Toni dachte an die gekrümmte Leiche. Alte Dame. Eine Gänsehaut lief über seinen Rücken. Seine Oma tauchte in seinem Kopf auf. Auch sie eine alte Dame, entsetzlich der Gedanke, dass sie so enden könnte.
Wie bei einem Kartentrick hatte der Mann plötzlich seine Hand aus der Jacke geholt und hielt Toni eine Karte vor die Augen. Es war viel zu dunkel, um sie lesen zu können.
»Sind Sie von der Polizei?« Toni war zur Sicherheit wieder zum Sie gewechselt.
»Kann man nicht sagen. Obwohl ich ermittle.«
»Versteh ich nicht.«
Mit einem Mal fiel Toni die Sprache des Fremden auf. Hochdeutsch. Kein Einheimischer. Seine Skepsis stieg wieder höher. »Ich darf mit niemandem über das Geschehen reden. Noch is nix geklärt.«
»Hören Sie, Herr …?«
»Krooß. Toni Krooß.« Er hatte sich automatisch vorgestellt, und in der nächsten Sekunde ärgerte sich Toni über seine schnelle Reaktion. Sollte der Mann doch von der Presse sein, konnte die Erwähnung seines Namens ihm Unannehmlichkeiten einbringen.
»Sie heißen wie der Fußballer?«
»Welcher Fußballer?«
»Toni Kroos. Bayern München, Real Madrid. Hat auch für die Nationalelf gespielt. Also, für Deutschland. Ein Fußballstar.«
»Ich kenn den, klar. Aber ich schreib mich mit einem scharfen ß. Und ich mag Fußball nicht so. Sie sind Deutscher?« Ein Tourist, also. Pest und Cholera mit Ebola obendrauf.
»Genau. Ich komme aus Deutschland. Aus Köln. Der Dom, der Rhein, der Karneval.«
»Sie machen hier also Urlaub! Jetzt aber dalli, dalli, gehen S’ in Ihr Hotel und schauen S’ Nachrichten. Es gibt nix zu sehen oder zu fotografieren. Holen Sie sich Ihre Katastrophenbilder woanders. Aber nicht bei meinem Feuer.« Toni stoppte kurz. Sein Feuer? Das klang merkwürdig.
»Ihr Feuer?« Der Fremde griff Tonis Ansage auf. »Keine Sorge, Toni Krooß mit scharfem ß. Ich bin auch kein Tourist. Auf meiner Karte steht es.«
»Es is arschfinster. Die kann ich nicht lesen.«
»Höchste Zeit, dass ich mich vorstelle: Axel Brecht. ›Brecht – Investigative Nachforschungen‹.«
»Bitte was?«
»Ich bin Privatdetektiv.«
»Na gehen S’. Das is ja interessant.« Tonis Misstrauen wurde von seiner Neugier eingeholt. »Ein Privatdetektiv? Wie der Marlowe? Also, der Philip Marlowe aus den Filmen, falls Ihnen die noch was sagen.«
Mit seiner Oma hatte er im Laufe der Jahre Dutzende alte Hollywoodklassiker geschaut. Darunter einige mit Philip Marlowe, Darsteller Humphrey Bogart war einer von Omas Lieblingen. »Tote schlafen fest« hatten sie sich sogar dreimal im Laufe der Jahre angesehen. Was würde sie dazu sagen, wenn ihr Enkel Toni ihr von dem Zusammentreffen mit einem waschechten Detektiv erzählte? Allerdings war an dem Äußeren von Axel Brecht nichts, was Ähnlichkeit mit Bogart hatte.
»Ach, die alten Schinken. Das war noch großes Kino.« Der Mann kam einen Schritt näher. »Am Ende bin ich sogar deshalb Privatschnüffler geworden, wer weiß. Aber im Ernst. Ich frage noch mal: Hat die alte Dame, die in dem Haus wohnt, überlebt?«
Toni zögerte, überlegte, wie viel Schaden er anrichten konnte. Nicht viel, denn schon jetzt würde die Meldung über das Feuer durch den Nachrichtenticker laufen. Die Zusatzinformation von der Leiche würde nicht lange auf sich warten lassen.
»Es gibt ein Opfer.«
»Wen?«
»Damit bin ich überfragt. Jemanden, der den Brand eben nicht überstanden hat.«
»Liegt ein Verbrechen vor?«
»Das werden unsere Brandermittler feststellen. Ich bin nur Feuerwehrmann.«
»Wo ist das Feuer ausgebrochen?«
»Wenn ich nach meinen ersten Eindrücken geh, würd ich sagen, im Vorzimmer, beim Eingang. Von dort aus hat es sich durch- und hochgefressen. Komisch is nur –« Toni stockte. Erst hatte er überhaupt nichts preisgeben wollen, und nun sprudelte es aus ihm heraus.
»Was ist komisch?«
»Sie müssen es aber für sich behalten.«
Was für ein dummer Spruch. Die beste Art, etwas in die Welt zu posaunen, war dieser Satz.
»Mein Ehrenwort.«
Jetzt musste Toni schmunzeln. »Sagt man das so unter Schnüfflern bei Ihnen in Köln?«
»Ich sage es. Und ich halte mich auch daran. Berufsethos. Wir sind nicht so schlecht wie vielleicht unser Ruf.«
»Schon gut.«
»Was ist Ihnen also merkwürdig vorgekommen?«
»Eigentlich hätten das Haus und die Zimmer gar nicht derart stark ausbrennen dürfen.«
»Weiter?«
»Ich würd auf einen Brandbeschleuniger tippen.«
»Dann wäre es Mord.«
Toni zuckte zusammen. »Geh, was red ich denn da? Sie und Ihre Detektivgeschichten haben mich ganz wirr gemacht. Ich hab keine Ahnung. Ich bin bei der freiwilligen Feuerwehr Krems, und ich mache meine Arbeit, so gut ich eben kann. Aber mit Verbrechen kenn ich mich nicht aus. Außerdem muss ich zurück. Die Kameraden warten.«
Toni Krooß fühlte sich unrund. Er hatte sich von der Truppe entfernt, er hatte einem Fremden mehr erzählt, als er durfte. Am Ende mochte er der Dumme sein.
»Schon klar. Danke trotzdem, dass Sie mir Auskunft gegeben haben.« Der Privatdetektiv tippte sich mit dem Zeige- und Mittelfinger an die Stirn. »Hut ab vor Ihnen und Ihrer Arbeit.«
Er drehte sich um und ging in die entgegengesetzte Richtung. Nach wenigen Metern hatte ihn die Dunkelheit verschluckt.
Toni Krooß blieb noch unschlüssig stehen. Der Schneefall war dichter geworden. Er setzte seinen Helm wieder auf. Höchste Zeit, zurück zum Schauplatz des Feuers zu gehen. Oder zum Tatort.
Der verbrannte Körper war möglicherweise eine alte Dame gewesen. Gruselig. Ein Fall für Philip Marlowe könnte wohl so beginnen.
3
Die Hex stand mitten in der Menge.
Der Geruch ließ ihren Magen knurren. Das Feuer war gelöscht, aber die Luft roch nach Grillparty mit Rippchen und Würstchen. Knusprig. Kross.
Eine Assoziation zum Sommer kam hoch. Fast konnte man sich vorstellen, an der Donau zu sitzen und ein Picknick zu veranstalten. Oder jetzt zu dieser Jahreszeit zumindest in einem begrünten Wintergarten zu frühstücken, mit Blick nach draußen in die verschneite Landschaft. Ein petit-déjeuner mit Eiern und gebratenem Speck.
Automatisch leckte sie sich die Lippen. Bis zum Morgen würden noch ein paar Stunden vergehen. Sie würde auf das Frühstücksbuffet warten.
Eine Tafel Schokolade hatte sie im Zimmer. Eigentlich war sie ohnehin eine Süße, eine, die auf Nachspeisen stand. Für einen ordentlichen Kaiserschmarrn oder Palatschinken mit Marillenmarmelade würde sie töten.
Sie musste schlucken.
Getötet schien sie ja zu haben. Denn der Rettungswagen stand immer noch ein gutes Stück hinter der Absperrung und war nicht mit heulenden Sirenen davongefahren.
Es war also amtlich. Sie, die Hex, war eine Mörderin.
Was hieß das für sie? Nichts. Und alles. Eine Veränderung, die am Ende einer langen Reihe von unerfreulichen Ereignissen stand. Sie hatte den Tod in Kauf genommen, mehr noch, sie war davon ausgegangen, dass es keine Überlebenden geben würde.
Gut oder schlecht, sie urteilte nicht. Aber der Gedanke daran begann ihr zu gefallen.
Wenn sie zurück im Hotel Alte Post war, würde sie versuchen, noch eine Mütze Schlaf zu bekommen. Ihre geplante Wanderung morgen zur Wetterkreuzkirche wollte sie trotz allem durchziehen. Einmal selbst Touristin sein. Außer das Wetter machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Der Schneefall war in der letzten halben Stunde dichter geworden.
Der Rucksack verursachte Schmerzen am Rücken. Sie konnte spüren, wie die Spiritusflaschen gegen ihre Schulterblätter drückten. Selbst leer waren sie sperrig. Wenigstens würde ihr Koffer bei der Heimreise leichter sein. Entsorgen würde sie die Plastikflaschen erst zu Hause, nach und nach, einzeln, ganz nach Plan.
Apropos Koffer: Höchste Zeit, sich vom Ort des Geschehens zu entfernen. Was wollte sie immer noch hier? Über das Feuer würde sie im Internet nachlesen können, in den Nachrichten, in den Berichten in der Zeitung. Wobei es aufregend war, live dabei zu sein. Das musste sie zugeben.
»Hex«, sagte jemand hinter ihr. »Hex.« Noch einmal, noch lauter.
Sie wirbelte herum und stieß gegen eine Frau in ihrem Alter, die eine pinkfarbene Strickmütze mit einem großen Bommel trug. Was für eine Kopfbedeckung.
»Aufpassen, gell?« Die Stimme klang ungehalten. Der Bommel wackelte.
»Tut mir leid. Ich habe nur gedacht, Sie hätten etwas zu mir gesagt.«
Die Frau legte den Kopf schief, der Bommel neigte sich. »Nein, nicht zu Ihnen. Mein’ Mann hab ich angesprochen, gell, Max. Max!«
Der Angesprochene trug ebenfalls eine Mütze, hellblau ohne Schnickschnack. Er nickte, starrte jedoch konzentriert nach vorn.
»Dann entschuldigen Sie.«
»Schon gut. Wir wollen grad wieder gehen. Nicht, Max? Gibt eh nichts zu sehen. Und es is saukalt.« Sie rieb sich die Hände, blieb aber stehen.
»Max«, hatte die Frau gesagt. Nur »Max«. Nicht zu verwechseln mit »Hex«.
Hex.
Böses Schimpfwort. Zugleich der Anfang ihrer Geschichte. Nein, in Wahrheit das Ende einer langen Kette, deren einzelne Glieder sich vervielfältigt hatten, um ihr am Ende die Luft abzuschnüren. Wenn man es näher betrachtete, konnte man ihre Tat auch Notwehr nennen.
Einmal ein »Hex« zu viel, und das Fass war übergelaufen. Besser noch, der letzte Funke hatte das Feuer entfacht. Das klang gut.
Vielleicht war sie ja wirklich eine. Eine böse Hexe, die am dreizehnten Tag des neuen Jahres eine Katastrophe im beschaulichen Krems hergezaubert hatte. Hokuspokus Spiritus.
Jetzt musste sie sogar grinsen.
Das Feuer hatte ihr imponiert, deshalb war sie geblieben. Da war sie nicht die Einzige, wenn sie auf die Menge der Schaulustigen blickte. Das Zischen, das Knistern. Das Tosen. Die Hitze und nach und nach der Geruch. Die Feuerwehr war zu schnell an Ort und Stelle gewesen. Schade.
Doch nun war es an der Zeit. Bevor die Polizei sich an die Gaffer wandte und Personalien aufnahm.
Sie zog an den Riemen des Rucksacks und schob sich in der Menschenmenge eine Reihe hinter das Ehepaar. Links und rechts neben ihr hielten die Leute ihre Handys in die Höhe, knipsten und filmten das Ereignis. Die Menge drängte nach vorn wie bei einem Popkonzert, es war unglaublich.
Sie kam neben einem Mann zum Stehen, der nur einen Morgenmantel anhatte. Sein Zittern ließ darauf schließen, dass er mächtig frieren musste, aber er machte keine Anstalten, vom Schauplatz zurück in sein warmes Zuhause zu wechseln. Seine Füße steckten in Stiefeln, was einen seltsam bizarren Kontrast bildete. Hinter dem Morgenmanteltyp trug ein anderer sogar ein kleines Kind auf seinen Schultern. Wie konnte sich ein Vater nur derart verhalten? Es wäre besser, ihm das Kind wegzunehmen.
Diese Beobachtung ließ ihr erstes Triumphgefühl verschwinden. Die altbekannte Wut kam zurück. Der Groll, der nagte und auch durch das Feuer nicht befriedigt worden war.
Gaffer. Schäbige, gierige Katastrophenjunkies. Jeden Einzelnen sollte sie anrempeln und mit einem bösen Spruch belegen, um der Hex gerecht zu werden.
Nein, nichts dergleichen würde sie tun. Solch eine Aktion würde Aufmerksamkeit erregen. Aufsehen konnte sie überhaupt nicht gebrauchen. Es wurde ohnehin immer riskanter, sich weiter hier aufzuhalten. Zwanzig Minuten Fußweg lagen vor ihr, und es war wirklich arschkalt. Die Frau hatte recht gehabt.
Ihr Magen knurrte wieder. Bratkartoffeln mit Zwiebeln wären auch nicht schlecht.
Töten machte anscheinend hungrig.
»Zurücktreten, bitt schön, treten S’ alle jetzt zurück.«
Zwei uniformierte Beamte waren seitlich an die Menschenmenge getreten. Einer hob seine Hände und begann zu winken, um die Leute zu zerstreuen.
»Hörts alle zu. Hier gibt es nichts zu sehen.«
»War noch jemand in dem Haus? Ist einer umgekommen?«, rief der Mann im Morgenmantel laut den Beamten zu. Auf seinen Wangen zeigten sich rote Flecken. In seiner Stimme war die Gier nach einer Sensation zu hören.
»Keine Auskunft. Weitergehen.«
Keiner der Schaulustigen bewegte sich.
»Ich schreib gleich von euch allen die Namen auf, dann kann’s gut sein, dass jeder eine Anzeige kriegt.« Der Polizist winkte heftiger.
»Warum denn?« Wieder der Morgenmanteltyp. »Weil wir hier stehen? Das kann uns keiner verbieten. Ich kenne mich aus, ich bin Anwalt.«
Nie und nimmer bist du ein Anwalt, du dummer Idiot, dachte sie. Sie machte einen Schritt auf den Mann zu und zwickte ihn in den Oberarm. »Krepier, du Wappler.«
»Was?« Er griff sich automatisch mit der anderen Hand an die Stelle und sah sie konsterniert an.
»Kalte Nacht, habe ich gesagt«, antwortete sie und zeigte ihm ein breites Grinsen.
»Haben Sie mich grad in den Arm gezwickt?« Er starrte sie an, schien für den Moment vergessen zu haben, dass er eigentlich wegen des Feuers hier war und etwas über eventuelle Tote wissen wollte.
Schnell hob sie beschwichtigend ihre Hände in die Höhe. Die weißen Handschuhe ließen ihre Finger wie Knochen erscheinen. »Entschuldigung. Ich bin ausgerutscht und musste mich festhalten.«
»Aufpassen, Dschopperl, ja?«
Dschopperl?
Der Hass kam so schnell, dass sie sich auf den Typen hätte stürzen wollen. Ihn anspringen, von der Seite. Sich festkrallen an seinen Haaren, ihn in sein Ohr oder seine Wange beißen.
Stattdessen biss sie sich auf die Lippen. Der leichte Schmerz half. Brennender Zorn, der mit jedem Jahr, mit jedem Tag schlimmer wurde. Dafür gab es keine Feuerwehr, ihre innere Glut breitete sich aus.
Sie fuhr sich durch die Haare, um sich zu beruhigen und zugleich die Schneeflocken abzuschütteln. Auf ihren weißen Handschuhen waren schwarze Flecken. Mit einem Blick nach oben merkte sie, dass auch Ascheteilchen herabsegelten.
Vorne, direkt an der Absperrung, ging eine Sirene los. Sie zuckte zusammen. In der Menschenmenge waren vereinzelte Schreie zu hören. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, konnte aber über die vielen Köpfe hinweg nichts Genaues erkennen. Der Morgenmanteltyp hatte das Interesse an ihr verloren und quetschte sich nach vorne durch.
»Zurückbleiben. Herrschaften, es gibt nix zu sehen.« Einer der Polizisten war näher an sie herangekommen.
Keine Sekunde mehr durfte sie warten. Sie musste los. Nicht auf einem Besen reitend, sondern still und leise, einen Fuß vor den anderen setzend.
Sie sah auf ihre Armbanduhr. Gott, was war sie hungrig.
Fünf Stunden später saß sie bei Rührei und Würstchen. Dazu eine Buttersemmel und die zweite Tasse Kaffee. Im Frühstücksraum lief der Fernseher ohne Ton, ORF-Lokalnachrichten. Bilder von dem Feuer in Krems wurden gezeigt. Ein Feuerwehrmann wurde interviewt. Seine Lippen bewegten sich schnell, sie meinte mehrfach, das Wort Tod herauszulesen.
»Schrecklich, nicht! Dass so was bei uns passiert, ich glaub’s ja nicht.« Der Kellner wechselte die Kaffeekännchen aus.
Sie nickte, guckte betroffen, ohne etwas zu sagen. Zu einer dritten Tasse holte sie sich noch ein Kipferl vom Buffet. Draußen lag Schnee. Ein herrlicher Anblick. Ihre Wut verhielt sich heute still, und die Wanderung zur Wetterkreuzkirche würde traumhaft werden. Beim Gehen konnte sie weiter nachdenken und für die nächste Zeit planen. Es gab einiges zu tun.
Die nächsten Wochen mussten einfach besser werden als die letzten vor ihrer liederlichen und doch so befreienden Tat.
4
Inspektorin Agnes Kirschnagel betrat das Buchcafé im Lippott-Haus mitten in der Fußgängerzone in Kufstein und sah sie sofort. Maria Konstanze Schlager saß an einem der seitlichen Tische neben dem Regal für Kinderbücher und war vollkommen auf ihre Lektüre konzentriert.
Agnes blieb an der Eingangstür stehen und betrachtete die junge Frau, der man ansehen konnte, dass sie tief in die Geschichte, die sie las, eingetaucht war. Versunken oder absorbiert, diese Worte trafen es noch besser.
Mitzi, wie sie gerufen wurde, wirkte auf den ersten Blick so normal wie jeder andere Besucher im Buchcafé an diesem frühen Morgen. Das hellblonde kurze Haar, das hübsche Gesicht und der schlanke Körper machten sie zu einer attraktiven Erscheinung. Wäre Agnes ein Mann oder würde sie sich zu Frauen hingezogen fühlen, wäre sie an Mitzi interessiert gewesen.
Lernte man das Wesen Mitzi allerdings näher kennen, wurde einem schnell klar, dass diese Persönlichkeit alles andere als einfach und im gängigen Sinn »normal« war.
Seit dem Mord an dem deutschen Touristen Karsten Trinkas auf der Brücke über den Inn war nun schon fast ein Dreivierteljahr vergangen, aber immer noch musste Agnes bei Mitzis Anblick an die dramatischen Ereignisse im letzten Sommer denken. Wie war es so weit gekommen? Weil Mitzi in geheimnisvollen und schrägen Geschichten aufging, sich in Filmen und Büchern verlor. Und dabei auch die Realität aus den Augen verlieren konnte.
Nun, hier war der richtige Ort für sie. Inmitten der Bücher im Café im Lippott-Haus konnte sie auf gefährliche Phantasiereisen gehen, ohne sich wirklich zu verletzen oder gar zu sterben. Agnes überlegte, dass es eigentlich das Beste wäre, Mitzi hier festzuhalten, sie einzusperren mit Tonnen von Lesestoff und einer Kaffeemaschine.
Mitzi trug einen gelben Fleecepulli, der sie wie eine Butterblume aussehen ließ. Neben ihr stand ein prall gefüllter Reiserucksack. Agnes fragte sich, wie lange Mitzi bleiben wollte und wo sie sich einquartiert hatte.
Sie sah auf die Wanduhr mit den Tierbildern, die über dem Kinderbuchregal angebracht war. Der große Zeiger stand auf dem Hahn, der kleine auf der Katze. Halb zehn. Eine halbe Stunde, mehr konnte sie ihrer neuen Freundin nicht widmen, der Polizeidienst rief.
Gestern vor genau achtzehn Monaten hatte Agnes ihren Dienst als Inspektorin angetreten. Ihr Kollege Bastian hatte sie daran erinnert und ihr sogar einen kleinen Blumenstrauß gebracht, um diesen Tag des Diensteintritts zu feiern. Nicht ohne Hintergedanken seinerseits, doch Agnes hatte niemals vor, die kurze Affäre zwischen ihnen noch einmal aufzunehmen.
Seit dieser Liebelei fragte er sie regelmäßig nach Dates, manchmal eben auch mit Blümchen in der Hand und einer cleveren Ausrede für seine Anmache.
Am liebsten hätte sie die Dienststelle gewechselt, hätte sich in eines der Polizeipräsidien der österreichischen Hauptstädte versetzen lassen. Kufstein war wunderschön und superlangweilig, beides zur gleichen Zeit. Seit dem Fall, in dem Mitzi eine entscheidende Rolle gespielt hatte, war der dröge Alltag zurückgekehrt, und Agnes war meist damit beschäftigt, Betrunkene abzuführen und Diebstähle aufzuklären. Nun ja, niemand hatte sie zu diesem Beruf gezwungen.
Sie setzte sich in Bewegung. Erst als sie direkt vor Mitzi stand, hob diese ihren Kopf.
»Ja?«
Es war ihr anzusehen, dass sie ganz weit weg gewesen war. Agnes spähte auf den Titel. »Skulduggery Pleasant« – ein Skelett als Detektiv, das Kriminalfälle in einer magischen Welt löste. Das Buch passte zu Mitzi.
»Hey, Mitzi.«
»Agnes.« Jetzt erkannte die junge Frau die Inspektorin, und ihr Lächeln reichte von einem Ohr zum anderen. »Ich freu mich wie narrisch, dass du spontan gekommen bist.«
Die Umarmung war stürmisch, und Agnes musste sich einfach mitfreuen. Auch das war Mitzi, neben all ihren Verrücktheiten, ein liebevoller und überschwänglicher Mensch.
»Du wirfst mich gleich um, Mitzi.«
»Sorry.« Mitzi löste sich, und die beiden Frauen setzten sich einander gegenüber.
»Ich war von deiner WhatsApp völlig überrascht. Was machst du in Kufstein, Mitzi? Wieder Urlaub? Obwohl das Wetter ja gerade saumäßig schlecht ist.«
Dieser 29. Februar hatte mit Schnee begonnen, der schnell in einen matschigen Regen übergegangen war. Dazu wehte seit Tagen ein böiger, eiskalter Wind.
Ein Schatten huschte über Mitzis hübsches Gesicht. »Ja und nein. Ich fahre in der Gegend herum. Ich bin Richtung Wachau unterwegs. Hab mich aber entschlossen, über Kufstein zu fahren. Ich hab gehofft, dich endlich wiedersehen zu können. Wie super, dass es geklappt hat.«
»Wie? Du bist eben erst hier gelandet?«
»Um halb sechs war ich am Bahnhof in Salzburg und hab gesehen, dass ein Zug um sechs über Rosenheim hierherfährt. In den bin ich eingestiegen. Seit halb acht sitz ich im Buchcafé. Ich war die Erste.«
»So früh?«
»Ich konnt nicht schlafen. Wie öfter.« Mitzi sah auf ihre Finger, und ihre Mundwinkel gingen nach unten.
Eine kurze Pause zwischen ihnen entstand. Ohne Mitzis Schlafstörungen und ihre Vorliebe, schon mal mitten in der Nacht im Freien herumzulaufen, hätten sich die beiden Frauen nie getroffen. Aber auch vieles Schreckliche wäre nicht geschehen. Darüber redeten sie allerdings selten. Zumindest hatte Mitzi Agnes bald nach den Geschehnissen darum gebeten. Agnes hielt sich daran.
»Bist du nicht halb erfroren auf deiner frühen Reise bei der nassen Kälte, Mitzi?«
Nun lächelte Mitzi wieder. »Quatsch. Wofür gibt es Fleecepullis und Schals und Hauberl. Schau, alles in Gelb, die Farbe heitert mich auf. Außerdem is es im Zug sowieso angenehm warm. Man kann ein Schlaferl halten, einen Kaffee trinken, auf die Toilette, sooft man muss.«
»Du könntest einen Bahnwerbefilm machen.«
»Stimmt. Außerdem lese ich beim Fahren immer was Spannendes oder eine Story, die im Sommer spielt. Das macht innerlich warm. Im Gegenzug schau ich mir im Hochsommer Filme an, die in der Kälte oder unter Wasser spielen wie ›Roter Oktober‹ mit Sean Connery, ein klasse Film.«
»Kenne ich leider nicht.«
»Ach, Agnes, du bist ein Filmbanause.«
»In meinem Job sehe ich tagaus, tagein genug Spannendes. Oder Tragisches. Auch Ekelhaftes, glaub mir. Aber jetzt erzähl: Wie geht’s dir?«
Als hätte man einen Stöpsel aus einer Flasche gezogen, sprudelte Mitzi los. So verschlossen die junge Frau sonst anderen Menschen gegenüber war, so euphorisch nahm sie das Angebot an, Agnes über ihr Leben zu berichten.
Wobei sich nicht viel geändert hatte. Mitzi lebte nach wie vor mit dem Ungarn Fred Balogh in Salzburg zusammen, der meist auf Vertretertour war und sich zu Hause Sportübertragungen ansah. Mehr eine Nebeneinanderbeziehung, wie Agnes fand. Auch beruflich ließ sich Mitzi immer noch treiben, arbeitete als freie Korrektorin, besuchte an der Uni Vorlesungen und lief gern zu jeder Tages- und Nachtzeit kreuz und quer durch die Stadt.
Über Weihnachten hatte Mitzi ihre Oma im Seniorenheim besucht. Die demenzkranke Frau hatte gute Tage gehabt und ihre Enkelin wiedererkannt, worüber Mitzi unfassbar glücklich gewesen war. Schließlich war Therese Schlager Mitzis letzte lebende Verwandte.
Agnes konnte Mitzis Liebe zur Großmutter vollständig und Mitzis unstete Lebensart zumindest etwas nachvollziehen. Nach der schweren Kindheit, dem Verlust der Eltern und des kleinen Bruders, hatte Mitzi nie wieder richtigen Halt in ihrem Leben gefunden.
»Zum Allerneuesten, Agnes. Stell dir nur vor: Ich geh jetzt seit Anfang dieses Jahres einmal alle vierzehn Tage zur Therapie.«
»Wie bitte?« Das war eine Neuigkeit.
»Zu Dr. Rannacher in Wien. Unser Heinz hat ihn mir empfohlen. Er war auch bei dem.«
Hauptkommissar Heinz Baldur hatte letzten Sommer bei der dramatischen Mörderjagd an ihrer beider Seite gestanden. Oder anders und ehrlicher gesagt, er hatte die Lawine ins Rollen gebracht.
»Du fährst extra von Salzburg nach Wien?«
»Warum nicht? Zugfahren macht mir Freude. Und is umweltfreundlich. So weit is es auch wieder nicht.«
»Bringt es dir etwas?«
»Ja, schon.«
Wieder der Blick nach unten. Agnes konnte sich nie sicher sein, ob Mitzi ihr die Wahrheit erzählte.
»Was bestellen, das Fräulein?« Eine rundliche Kellnerin war neben Agnes aufgetaucht. Agnes orderte einen kleinen Braunen und wandte sich wieder Mitzi zu.
»Was zieht dich in die Wachau?«
In Sekundenschnelle war Mitzi wieder euphorisch. Mit ihr zusammen zu sein glich dem Wetterwechsel auf einer der Bergspitzen rund um Kufstein. Wobei Agnes seit ihrer Kindheit unter Höhenangst litt und ihr bereits dieser Vergleich ein mulmiges Gefühl im Bauch bescherte.
»Ganz was Tolles, Agnes.« Mitzi begann in ihrem Reiserucksack zu wühlen. »Schau.«
Sie hatte eine Klarsichthülle mit einem Zeitschriftenartikel darin herausgezogen. Das Papier war an einer Ecke eingerissen und wirkte zerknittert. Auf einem Hochglanzfoto war eine ältere Dame zu sehen, die in der einen Hand einen Telefonhörer, in der anderen einen Baseballschläger hielt. Dazu grinste sie breit. Auf derselben Seite im unteren Eck war noch eine Reklame für Waschmittel, was den etwas absonderlichen Eindruck der Darstellung verstärkte.
»Hilda V. (72) aus Melk lehrt Enkeltrickbetrüger das Fürchten«, lautete die Schlagzeile.
Agnes nahm das Papier von Mitzi entgegen. Sie überflog den Artikel unter dem Foto.
Diese Hilda V., von der die Rede war und die auch auf einem zweiten, kleineren Foto strahlte wie eine Lottogewinnerin, hatte anscheinend einem Betrüger das Handwerk gelegt. Ein junger Mann, der nur als K.W. (26) bezeichnet wurde, hatte sich kurz vor Weihnachten bei der alten Dame gemeldet und versucht, sich mit dem sogenannten Enkeltrick Geld zu ergaunern. Dabei gaben sich die Anrufer als Enkel oder Freunde der Enkelkinder von Senioren aus und erfanden eine Notsituation, die es dringend erforderte, eine höhere Summe zu überweisen oder abholen zu lassen. Auch in Kufstein hatte es derartige Tricksereien gegeben, aber Agnes hatte keinen dieser Fälle bearbeitet.
Jedenfalls hatte diese Hilda V. sich bereit erklärt, dem Betrüger das Geld zu übergeben, in der Zeit jedoch die Polizei verständigt, und der junge Mann war verhaftet worden. Wie es schien, galt Hilda V. (72) nun unter den Senioren in Melk als kleine Heldin.
Agnes sah auf das Datum am oberen Seitenrand. »Der Artikel ist von Anfang Januar. Doch etwas länger her.«
»Von der ersten Jahresausgabe, ich weiß. Es war reiner Zufall, dass beim HNO, wo ich vor drei Wochen war, alte Zeitschriften gelegen haben.«
»Und weiter, Mitzi?«
»Ist diese Geschichte nicht toll? Diese Hilda hat mich begeistert.«
»Nicht schlecht, ja. Besser, als sich reinlegen zu lassen, auf jeden Fall.«
»Ich will ihr gratulieren.«
»Du willst was?«
Mitzi nahm Agnes die Klarsichthülle wieder aus der Hand und legte sie neben dem Buch auf dem Kaffeehaustisch ab.
»Ich mach das nicht zum ersten Mal, Agnes, ehrlich gesagt. In der Vorweihnachtszeit hat ein Familienvater auf dem Weihnachtsmarkt in St. Pölten einen Betrunkenen, der randaliert und sogar ein Kind angegriffen hat, niedergerungen. Er wurde als Papa des Monats gefeiert. Ich bin hin und hab ihn beglückwünscht.«
»Wie? Bist du nach St. Pölten gefahren und hast einem völlig Fremden die Hand geschüttelt? Wie hast du den Mann gefunden?«
»Ich hab ihn über Instagram kontaktiert. Das war nicht schwer, weil er sich den Hashtag ›Superpapa‹ zugelegt hat. Darunter hat er Fotos veröffentlicht und Spenden für eine Kinderklinik gesammelt. Fans konnten ihm gratulieren. Es haben ihm wahnsinnig viele Menschen geschrieben. Ich eben auch. Als ich eine Reise nach St. Pölten gemacht hab, hab ich angefragt, ob er Lust hat, mit mir einen Kaffee zu trinken. Hatte er. Es war lustig und aufregend.«
»Ist das dein neues Hobby?«
»Nein, Agnes. Schau mich nicht so an. Ich versuche einfach, die Sache vom letzten Jahr aufzuarbeiten, und das hilft mir dabei. Zumindest hab ich das Gefühl, dass es mir guttut. Dr. Rannacher, mein Therapeut, hat gemeint, wenn ich es nicht übertreibe, wären ein oder zwei Treffen mit Leidensgenossen in Ordnung. Vorläufig.«
»Leidensgenossen?«
»Also Menschen, die auch in ein Verbrechen verwickelt waren. Wie ich.«
So ganz richtig war Mitzis Darstellung nicht, aber Agnes entschloss sich, nicht weiter darauf herumzureiten. »Hast du dich mit dieser Hilda V. auch über Insta verabredet?«
»Nein. Das ging nicht. Außer dem Artikel in der Zeitschrift habe ich nichts von ihr gefunden. Deshalb hab ich in der Redaktion angerufen. Schon allein der Anruf war spannend, kann ich dir sagen.«
Agnes zog die Augenbrauen hoch. »Die haben dir Auskunft gegeben? Das dürfen sie nicht. Stell dir vor, du bist einer, der nichts Gutes im Sinn führt. Ein nächster Verbrecher, der sie bestehlen oder ihr sogar wehtun will.«
»Keine Sorge. Nicht gleich aufregen, Agnes. Es is nichts Illegales passiert. Das Einzige, was die mir erzählt haben, war, in welchem Café in Melk Hilda V. am Samstagnachmittag oft und gern Kaffee trinkt, Kuchen isst und mit anderen Damen ein paar Partien Schnapsen spielt, wie es hier auch beschrieben steht. Es is das Café Mistlbacher. Jetzt versuch ich mein Glück. Is sie da, spreche ich sie an und gratuliere ihr. Is sie nicht da, lauf ich durch Melk und fahr am Abend wieder heim. Beides okay. Du kannst dich entspannen, Frau Inspektorin Kirschnagel.«
»Selbst diese Information hätten sie dir nicht geben dürfen, Mitzi.« Agnes schüttelte den Kopf. »Heutzutage muss man vorsichtig sein, es gibt so viele Irre.«
»Ich sag’s auch keinem weiter. Nur du weißt davon.«
»Darum geht es nicht, Mitzi.«
»Du hast ja recht. Aber komm, red du endlich. Was gibt es bei dir Neues, Agnes? Danke noch mal für das tolle Buch über Andreas Hofer, ich hab es in zwei Tagen verschlungen.«
»Hat mir meine Mama zukommen lassen. Ich selbst habe es nicht gelesen. Zu wenig Zeit.«
»Bist du immer noch rauchfrei?«
»Seit dem 1. Januar. Jawohl!«
Darauf war Agnes richtig stolz. Ihr Laster schien sie in den Griff zu bekommen, obwohl die Sehnsucht nach einer Zigarette gerade am Morgen beim ersten Kaffee weiterhin irre groß war.
»Super.« Mitzi klatschte in die Hände. »Was macht dein Hamster Jo? Den würd ich echt gern kennenlernen. Vielleicht nächstes Mal, wenn ich wieder über Nacht in Kufstein bleibe.«
Agnes überlegte kurz, ob sie die rasanten Themenwechsel von Mitzi mitmachen sollte oder ihr noch einmal erklären, dass sie Mitzis neue Idee, fremde Leute aufzusuchen, schlecht und ein wenig dreist fand. Aber Mitzi war keine Stalkerin, die sich festkrallte und die Leute nicht mehr in Ruhe ließ. Mitzi war einfach eine suchende Seele, die mit der Wirklichkeit nicht ganz zurechtkam. Man konnte nur hoffen, dass ihr die Therapie weiterhelfen würde.
Deshalb beantwortete Agnes Mitzis Fragen, erzählte vom Besuch bei ihren Eltern, vom letzten Familienfest und dem neuen Freund ihrer Schwester. Sie berichtete von der langweiligen Polizeiarbeit, und am Ende schwärmte sie von ihrem süßen Jo. Der Hamster war ihr Mitbewohner und ein Garant für gute Laune, wenn sie manches Mal erschöpft vom Dienst nach Hause kam.
Die beiden plauderten länger, als Agnes geplant hatte, und am Ende musste sie rennen, um nicht zu spät ins Polizeirevier zu kommen.
Gern hätte sie noch einmal die Geschichte mit Mitzis neuem Hobby angesprochen, aber dazu blieb keine Zeit. Ihr Dienst rief.
5
Das Café Mistlbacher in Melk war ganz nach Mitzis Geschmack.
Sie liebte es ohnehin, in Kaffeehäusern zu sitzen, bei einem und oft auch einem zweiten Kaffee zu lesen. Oder in die Luft zu gucken, Leute zu beobachten, sich zu ihnen Geschichten auszudenken, das eine oder andere Gespräch von den Nachbartischen zu belauschen. Meistens war sie allein, aber das Stimmengewirr und die wuselnden Kellner gaben ihr nie das Gefühl von Einsamkeit.
Beim Erkunden neuer Orte und Städte war der erste Blick, das erste Gefühl entscheidend. Plus das erste Kaffeehaus, das sie aufsuchte. Die Stadt Melk hatte Mitzi ohne Umschweife nach Verlassen des Bahnhofs in ihr Herz geschlossen.
Ähnlich wie sie in Salzburg stets gern zur beeindruckenden Festung hochsah, erging es ihr bei ihrer Ankunft mit dem Stift Melk, das die Aussicht dominierte. Eine Weile war sie stehen geblieben, mit in den Nacken gelegtem Kopf. Das Wetter war besser als in Kufstein. Es gab zwar auch leichten Schneeregen, aber keinen Wind. Die Temperatur schien höher zu sein und die Luft nicht derart schneidend kalt.
Nach dem Besuch im Café Mistlbacher würde sie hochlaufen und sich das Bauwerk aus der Nähe ansehen. Wenn es nicht schon zu dunkel war. Oder sich ein längeres Gespräch mit der Heldin von Melk, wie die Zeitschrift die alte Dame im Artikel bezeichnet hatte, ergeben würde.
Mitzi merkte, dass sie aufgeregt wurde. Würde ihr das Glück erneut hold sein? Würde Hilda V. (72) in ihrer wöchentlichen Kartenspielrunde sitzen und sich über die Gratulation einer Unbekannten freuen, auch nach den Wochen, die inzwischen verstrichen waren?
Der Familienvater aus St. Pölten fiel ihr ein. Er war von Mitzis Lob und Ansprache begeistert gewesen.
Mitzi hatte Agnes erzählt, dass ihr dieser Besuch gutgetan und ihr Therapeut sie dazu ermutigt hatte. Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Dr. Rannacher hatte ihr zwar geraten, Dinge zu unternehmen, die ihr Freude bereiteten. Sich selbst zu belohnen, um damit in der Gegenwart zu erleben, dass sie wertvoll war und ihre Schuldgefühle keinen Platz mehr hatten. Allerdings hatte die Therapie damals noch gar nicht begonnen, als sie den tapferen Vater in St. Pölten aufgesucht hatte. Insofern war es eine Lüge, die aber durch die spätere Ermutigung von Dr. Rannacher an Wahrheit gewonnen hatte. Es war eine gebastelte Verknüpfung, die Mitzi für sich gelten ließ.
Das Café war richtig gut besucht.