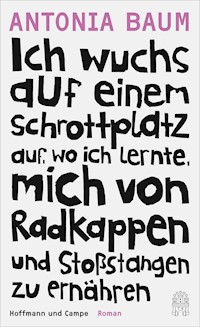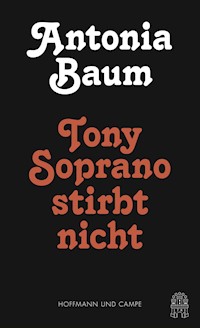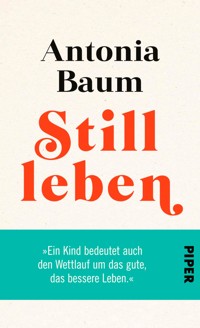
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Antonia Baum führt das typische Leben einer jungen, privilegierten Frau in der Großstadt: Sie hat einen interessanten Job, führt eine feste Beziehung und genießt die urbanen Annehmlichkeiten. Ihre Umgebung in einem sozial schwachen Bezirk kann sie dabei weitgehend ausblenden. Dann erwartet sie ein Kind – und plötzlich ist ihr Blick auf ihr Leben völlig verändert, und sie bekommt Angst. Nicht nur scheint ihr Platz in der Gesellschaft plötzlich unklar zu sein, ihre Identität ist in Gefahr und die Nachbarn wirken bedrohlich. In ihrem Buch macht Antonia Baum das Persönliche politisch, sie schildert ihr Erleben und kommt dabei auf die ganz großen gesellschaftlichen Themen: wie Erfolgreiche und Abgehängte nebeneinanderher leben , wie man Mutterschaft und ein eigenes Leben verbindet, weshalb man sich mit Kind plötzlich in altmodischen Beziehungsmodellen wiederfindet und warum Mütter es eigentlich niemandem recht machen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
ISBN 978-3-492-99062-2© Piper Verlag GmbH, München 2018Covergestaltung: zero-media.net, MünchenDatenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
1 – Es ist ganz einfach …
2 – Mein Freund und ich …
3 – Man merkte, dass draußen …
4 – Der Roman, den ich …
5 – Das Baby passierte …
6 – Stillen ist ein schönes Wort …
7 – Das Baby wusste nichts …
8 – Diese verfluchte Wohnung …
9 – Die Idee war, dass ich …
10 – Hatte ich vorher versucht …
11 – Seit das Baby da war …
12 – Die letzten Seiten lesen sich …
13 – Wenn ich mit dem Baby …
14 – Einmal saß ich mit dem Baby …
15 – Es gelang mir …
16 – Vor dem Baby …
17 – Es war kalt …
18 – Ich sprach nun häufiger …
19 – Die Polizei hatte gesagt …
20 – Wir saßen ohne Schuhe …
21 – Auf den Straßen liegt …
22 – Geld, Zeit und beides …
Danach gab es davor und danach. Es gab drinnen und draußen. Es gab Mann und Frau. Es gab arm und reich. Danach fürchtete ich mich, wenn ich durch das Treppenhaus des Hauses lief, in dessen oberstem Stock unsere Wohnung war, und drehte mich um.
1
Es ist ganz einfach, dachte ich etwa fünf Wochen vorher und stand am offenen Fenster, ich will ein Mann sein. Es war Nacht. Schräg gegenüber saß jemand in einem rot erleuchteten Fenster und hustete in regelmäßigen Abständen. Sein Husten klang krank. Es klang, als würde sich sein Körper für ihn beschweren. Ich konnte den Körper sehen. Er saß dick und unförmig auf einem Stuhl vor einem Rechner. Manchmal fuhr er sich durch das schwarze Haar. Wie eine hingegossene Masse lag er auf dem Stuhl und bebte, wenn er hustete. Dann war es wieder still. Das Licht aus dem Fenster warf den Schatten des mageren Baums an die Hauswand, was aussah, als würde eine böse Hand nach ihr greifen. Vielleicht würde sie sich das Haus und seinen Inhalt bald einfach nehmen und von dieser Erde schmeißen, dachte ich. Ich schloss das Fenster und drückte meine Stirn gegen das Glas. Ich will ein Mann sein, dachte ich, aber ich will nicht aussehen wie einer, das nicht (und vor allem nicht wie der Mann schräg gegenüber, nein, hier ging es um die Möglichkeiten eines gesunden, gut ausgebildeten Mannes, dessen schwarze Haare, sofern er überhaupt welche hatte, von seinem kulturellen und ökonomischen Kapital neutralisiert werden würden). Ich wollte nicht aussehen wie der Mann, der ich sein wollte. Aber die Möglichkeit aufzustehen, mich nicht zuständig zu fühlen und weiterzugehen, diese Möglichkeit wollte ich besitzen, für immer.
Die Menschen aus dem Haus, das wir bewohnten, hatten wenige Möglichkeiten, und seit Kurzem sah ich ihnen dabei zu. Wenn es abends dunkel wurde, stand ich in meinem Zimmer, ohne das Licht anzumachen. Nachts stand ich dort auch, denn ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte in die erleuchteten Fenster des Hinterhauses sehen. Unser Haus war ein Haus, in dem nachts Lichter brannten. Das rot erleuchtete Fenster des hustenden Mannes war jede Nacht rot, ein anderes Fenster leuchtete grell und kalt, darin sah ich einen Stuhl, einen Tisch und eine Menge Geschirr darauf, aber nie einen Menschen, und dann gab es noch zwei Fenster, hinter denen ebenfalls immer Licht brannte, das aber von zwei bunten Decken geschluckt wurde, die als Sichtschutz provisorisch aufgehängt worden waren. Tagsüber bemerkte man die Menschen aus unserem Haus nicht, sie waren erst nachts zu sehen, wenn sie das Licht anmachten und ihre Stimmen in fremden Sprachen durch den Hof hallten. Denn es wohnten dort Menschen, die nicht früh aufstehen mussten, oder solche, deren Verwandte weit entfernt lebten und die sie wegen der Zeitverschiebung, schlechter Internetverbindungen oder irgendwelcher günstigen Tarife am besten nachts erreichten. Wenn ich dort am Fenster stand, sah mich keiner. Aber ich sah die anderen.
Ich stand dort und hatte das Gefühl, unsichtbar geworden zu sein. Wie gestrichen. Arbeitslos und behindert. Das klingt schlimm und wird schlimmer, ich kann es kaum aufschreiben, also warte ich damit noch ein bisschen.
Ich übertrat die Grenze nicht mehr, hinter der das Geld und die Freiheit lagen. Rationalität, Nützlichkeit, Wettbewerb. Ich legte nicht mehr meinen täglichen Weg zur Arbeit (acht Kilometer) zurück. Ich übertrat somit nicht mehr jene Grenze, hinter der sich all das befindet, was Menschen brauchen, die, traurig und gestresst, versuchen, glückliche Menschen zu werden. Hinter der Grenze waren: Marni-Kleider, Spargelsalat mit Garnelen, Meditationsangebote, eine Übereinkunft darüber, dass die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zwar noch nicht komplett erreicht, aber unbedingt erstrebenswert ist, ebenso wie die Aufnahme und Integration von Geflüchteten und die Ablehnung rechtsnationaler Gedanken (Pegida, AfD), es gab dort gute Friseure, gute Feinkostläden, gute Kleidergeschäfte, und alle wussten, was distinguierte von gewöhnlichen Produkten (oder Menschen) unterscheidet, weswegen ich mich dort immer gerne aufhielt. Es war so sauber und interessant, der Welt von dort aus dabei zuzusehen, wie sie sich täglich zerlegte.
Zurück zum Schlimmen, das noch schlimmer wird, sobald ich es aufgeschrieben habe – denn eigentlich erwartete ich, als ich dort am Fenster stand und dachte, ich sei arbeitslos und behindert, einfach nur ein Kind. Und dabei war nicht das Kind das Schlimme, sondern das Gefühl, arbeitslos und behindert zu sein. Am allerschlimmsten aber war es, diesen Satz zu denken, und noch schlimmer ist es, ihn aufzuschreiben. Denn ein Kind, so dachte ich oft am Fenster stehend, ein Kind ist doch das Schönste, Beste, was man machen kann. Damit hört vielleicht auch diese verfluchte Gottlosigkeit auf. Man wird dann vollständiger, gerade als Frau. Ohne ein Kind fehlt einer Frau etwas. Ich dachte diese Sätze in unterschiedlicher Reihenfolge, ich wusste, dass es Klischees waren, denen ich da hinterherdachte, und sie ließen mich trotzdem nicht in Ruhe.
Wir lebten vor der Grenze, am Rand, von wo aus ich immer ins Zentrum gefahren war. Der Rand war: Müll auf der Straße, Discount-Supermärkte, Wettbüros, Dönerläden, Kürbiskernschalen auf dem Boden, Pfandhäuser, KiK, Shisha-Bars, Wohnungsauflösungsunternehmen, Läden, die für einige Monate da waren und dann wieder verschwanden. Ich hatte davon nicht besonders viel mitbekommen, denn ich war entweder nicht zu Hause oder in unserer Wohnung, die im vierten Stock lag. Morgens achtzig Stufen runter durchs Treppenhaus, über dunkelbraunen Linoleumboden, der so alt war, dass er Risse hatte, vorbei an grauen geschlossenen Wohnungstüren, aus denen niemals jemand kam. Es war, als lebte keiner in diesem Haus, man begegnete nur Spuren von Leben. Schrott, der auf dem Hof abgestellt wurde, Wurfsendungen, die auf den Boden geschmissen worden waren, der Geruch von vergammelndem Essen aus den Mülltonnen. Und es gab diese Tür, die an manchen Tagen nur angelehnt war. Der Spalt, der entstand, war so schmal, dass er dem Vorbeigehenden zuhauchte, dass diese Tür nur für sehr kurze Zeit offen sein würde und vor allem nicht für ihn, den Vorbeigehenden. Ich hielt dann trotzdem kurz inne und sah auf die angelehnte Tür. Ich lauerte und war mir sicher, dass auf der anderen Seite auch gelauert wurde. Ich war mir sicher, dass sich die Tür gerade eben noch bewegt hatte.
An den vielen Türen dieses Hauses standen Namen, die ich mir nicht zutraute richtig auszusprechen. Namen mit vielen Konsonanten und Vokalen an komischen Stellen, Namen, durch die ich hindurchstolperte, wenn ich es versuchte. Die Schilder, auf denen die Namen standen, waren selbst geschriebene und nachlässig angebrachte Zettelschilder, so, als würden die Menschen, zu denen die Schilder gehörten, nicht an Schilder glauben, weil sowieso niemand kam und sich für ihre Schilder interessierte, oder weil sie davon ausgingen, nicht lange zu bleiben.
Abends stieg ich die achtzig Stufen wieder hoch, gelegentlich im Dunkeln, denn manchmal funktionierte das Licht nicht. Die Hausverwaltung hatte die Bewohner irgendwie nicht mit der Macht über das Licht ausstatten wollen, weswegen sie eine Zeitschaltuhr installiert hatte. Lichtschalter waren zwar da, aber es passierte nichts, wenn man sie bediente. Es gab nur das verordnete Licht, die Zeitschaltuhr, die hin und wieder falsch oder gar nicht schaltete. Wenn es dunkel war, konnte man nichts dagegen machen, dann blieb es dunkel. Im dritten Stock roch es oft stark nach gebratenem Fleisch, und dann überlegte ich, hinter welcher der Wohnungstüren da wohl gekocht, also gelebt wurde. Es war immer still in diesem Treppenhaus. Nur ausnahmsweise begegnete ich einem Menschen. Etwa dem Jungen mit den schwarzen Haaren und der Adidas-Hose, der vielleicht zwei Mal an mir vorbeigehuscht war, davon einmal in Begleitung seiner Mutter, von deren Gesicht ich nur Augen und Nase sah, weil sie den Rest unter einem Kopftuch verbarg. Wir grüßten einander, als wären alle Beteiligten Schuld an irgendeinem Fehler, den wohl keiner hätte benennen können. Oder der große, dicke Mann mit der Einkaufstasche auf Rädern, die er hinter sich herzog und dabei Wörter, die ich nicht verstand, vor sich hin murmelte. Ein Mann mit langen Haaren und dünnen Beinen, den ich, obwohl ich ihn nie wieder sah, nicht vergaß, weil er so stank.
Das war es, mehr sah ich nicht von dem Rand. Wir bestellten unsere Lebensmittel, an den Wochenenden gab es Netflix und Deliveroo, oder wir gingen an Orten essen, deren Besucher laut und lächelnd den Restaurant-Sound machten, zusammen mit glänzenden Gläsern, die beim Anstoßen sangen, und freundlichen Bedienungen, die stolz komplizierte Gerichte erklärten; Orte, deren Bewohner kein Misstrauen in ihren Gesichtern hatten und die nur zugänglich waren für Menschen, die all das auch bezahlen konnten. Ich sah also nichts von dem Rand, an dem wir wohnten. Natürlich, ich hatte die Teenager von der nahe gelegenen Schule gesehen und dass sie alle schwarze Haare hatten und auf der Straße und in unserem Hausflur rumhingen und Zigaretten rauchten und manchmal die Briefkästen aufbrachen. Yalla, ich ficke deine Mutter, deine Schwester, deine Lehrerin, deine Tante, deine Großmutter, dein Leben und so weiter, hörte ich sie sagen, wenn ich an ihnen vorbeiging. Oder die Mädchen, die sich nach der Schule bei uns im Treppenhaus das Gesicht sauber machten, damit ihre Eltern nichts von der Schminke sahen. Mein Freund regte sich über die Jungs auf. Ich verteidigte sie und fand das irgendwie gut von mir. Einmal sortierte ich Kleider aus und wollte sie den Mädchen schenken, weil es für mich früher das Größte war, alte Kleider geschenkt zu bekommen (vintage hätte ich das genannt). Es waren gute und besondere Kleider, aber sie wollten sie nicht haben. Sie wirkten beinahe angewidert. Ich überlegte, was der Grund dafür war, und vermutete schließlich, dass es für sie eine Beleidigung gewesen sein könnte, aussortierte Kleider angeboten zu bekommen. Als könnten sie sich keine neuen leisten.
Die Idee bei diesem Haus war vor allem: günstige Miete. Und: Nicht nur Menschen um mich herum, die aussehen wie ich. Menschen, die das Gleiche wollen und das Gleiche tun wie ich, unausweichlich und als sei es, oh Gott, alternativlos. Deswegen wegziehen aus der totalen Gleichheit. Wegziehen und irgendwie etwas Wirklichkeitssalz auf diesen Alltag in Nullen und Einsen und seine Folgenlosigkeit draufschütten. Salz auf ein Leid, das nach nichts schmeckt. Ein Leid ohne Konkretion, ein Leid auf einem sehr hohen Niveau. Ein Leid, das man nicht einmal behalten darf, weil es ein vergleichsweise unproblematisches Leid ist (denn ging es mir, ging es uns, denn nicht eigentlich verdammt gut? Warum aber, fragte ich mich dann häufig, muss es mir besser gehen, weil es anderen schlechter geht?). Die Medizin, die ich zur Behandlung dieser reichen, auf mich beinahe kokett wirkenden Probleme wählte, war eine schlechte Gegend, in der ich mir ein bisschen anders vorkommen konnte. Sie bedeutete also auch einen Distinktionsgewinn, einen billigen außerdem. Aber die Mädchen hatten kein Interesse an meinen Kleidern, und die Salz-auf-diese-Wirklichkeit-Idee blieb ebenfalls komplett folgenlos, was ich aber zu dem damaligen Zeitpunkt (also: davor) nicht erfassen konnte.
Davor war die Welt ein Theater, und die Kulissen ließen sich reibungslos aneinander vorbeischieben. Was an Welt und Geschlecht zu viel war, konnte ich mir mit Geld vom Leib halten.
Du willst dich nicht von fremden Männern vollquatschen lassen, wenn du nachts alleine auf dem Weg nach Hause bist? Taxi. Du hast Angst vorm Autofahren, willst aber trotzdem das Gefühl haben, ein selbstbestimmtes Frauenleben zu leben, das keinen Freund oder Ehemann braucht, um irgendwo anzukommen? Taxi. Du willst dich nicht damit auseinandersetzen, wie man Möbel zusammenbaut, und hast keine Lust darauf, deinen Freund darum zu bitten? Montageservice. Dir sind die Einkäufe zu schwer, um sie in den vierten Stock zu tragen, aber du legst Wert darauf, dass dein Freund nicht für die Dinge zuständig ist, für die Männer typischerweise zuständig sind? Lieferservice. Du willst nicht darüber nachdenken, wer kocht? Lieferservice. Jede Arbeit, die getan werden musste und die mich, beziehungsweise uns, meinen Freund und mich, zuverlässig in die für uns vorgesehenen Ecken gestellt hätte, lagerte ich aus, was – bedenkt man die Absicht, die dahinterstand – natürlich komplett lächerlich ist, aber es funktionierte. Es war eine fantastisch funktionierende Täuschung, und sie gefiel mir (und ich habe gar nichts gegen sie, aber sie lässt sich eben nur bedingt aufrechterhalten). Ich liebte meine Täuschung, weil sie es mir erlaubte, nicht in diese mühsamen Alltäglichkeiten verwickelt zu sein. Ich liebte sie, weil ich ganz grundsätzlich nicht in diese Welt verwickelt sein wollte. Sie sollte mich nicht betreffen.
Ich schätzte Masseure und Therapeuten, weil es ihr Job war, mich zu massieren oder mir zuzuhören, sie also Geld dafür bekamen und ich mich nicht darum sorgen musste, wie es ihnen ging, was ich natürlich trotzdem tat. Mit Freunden traf ich mich am liebsten draußen und am besten nicht länger als zwei Stunden. Ich schätzte Arbeitsbeziehungen, weil ihre Modalitäten klar waren und ich gehen konnte. Meine Familie war entweder weit weg oder ähnlich beschäftigt wie ich. Wenn wir uns sahen, konnte ich wieder gehen. Den Leib an sich hielt ich ebenfalls auf Distanz, indem ich ihn als Werkzeug begriff, das ich pflegte, zerstörte und wieder pflegte. Yoga fand ich albern, aber es war eben nicht zu ändern – wobei der zweite Teil dieses Satzes wohl vor allem darauf verweist, dass ich mich schämte für dieses mitunter leere, unverbundene, wohlständige, auf vollkommen vertrottelte, aber natürlich nachvollziehbare Weise in Tätigkeiten wie Yoga Sinn und Ausgleich suchende Leben. Der zweite Teil jenes Satzes verweist also darauf, dass ich mich für das Leben schämte, dessen Freiheiten ich so liebte, weil es mir stellenweise komplett egal und folgenlos erschien.
Denn alles was anfing, hörte wieder auf. Das war gut und schrecklich zugleich. Ging es aber um meinen Freund, fand ich die Vorstellung, dass alles irgendwann aufhören könnte, beängstigend. Dann lief ich durch unsere Wohnung und überlegte, welche der Gegenstände (Sofa, Espressomaschine, Bettwäsche) meine waren, um mir auszurechnen, wie gut ich auf die Möglichkeit, wieder ganz alleine zu sein, vorbereitet war. Er war es, der kein Problem damit hatte, in Orte einzuziehen und sie zu bewohnen. Er war der Grund dafür, dass wir einen Teppich besaßen und Nägel in die Wand schlugen.
Er und ich, wir schwebten. Ich liebte, dass er aussah wie ein Mann, und er liebte, dass ich aussah wie eine Frau. Ich liebte, dass wir verschieden und trotzdem gleich sein konnten. Viele der Eigenschaften, die man typischerweise Frauen zuschreibt, trafen auf mich zu. Umgekehrt trafen viele der Eigenschaften, die man typischerweise Männern zuschreibt, auf ihn zu. Körperliche Stärke, größer als ich, handwerklich begabt, der bessere Autofahrer, eher in sich gekehrt, eher wenige Worte über Gefühle. Ein faszinierendes Rätsel, wenn ich ihm dabei zusah, wie er schwieg und irgendwelche Dinge reparierte. Das war alles er, und ich war das Gegenteil. Aber es gab bei uns auch viele Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die gar nicht typisch waren. Und so konnte ich mich mit einem guten Gefühl wie ein alter Film verhalten, in dem eine Frau in einem schönen Kleid von ihrem Mann irgendwelche Treppen hochgetragen wird, und dabei den alten Feministinnen in meinem Kopf zuflüstern, dass inzwischen alles ganz anders sei. Hört auf zu nerven, ich verdiene Geld, ich kann mir alles kaufen, das ich nicht selber machen kann. Seid still und lasst mir diesen alten Moment, in dem ich ihn so anziehend finde. Ich liebte, wie er war, und ich liebte vor allem, dass unsere Verschiedenheit kein Machtgefälle bedeutete. Ich liebte, dass sie nicht wehtat.
Wir mochten Hotels, und ich mochte sie besonders, weil ich durch sie tageweise in meine geliebte Einsamkeit einziehen und schreiben konnte. Und schlafen. Ich schrieb nicht gerne, aber es war das Beste, geschrieben zu haben und dann zu schlafen. Ich schlief ganze Wochenenden durch. Augen zu, im Kopf Sätze machen, dabei immer mehr vergessen, dass man da ist, also körperlos werden und nur noch in Gedanken sein, bis sie ein Traum geworden sind. Ohne jede Pflicht den Räumlichkeiten oder dem Ort gegenüber.
Am besten ging das in Hotels, und das allerbeste war einmal in Singapur. 14. Stock, weiche Teppiche, angenehmer Raumduft, im Badezimmer Päckchen für bestimmte Erfordernisse (Shampoo, Wattestäbchen, Mundwasser) in so kleinen Portionen, dass man sich von ihnen bereits im Moment des Gebrauchs für immer verabschieden konnte. Glatte Oberflächen, glänzende Spiegel, knisternde Bettwäsche, und all das aufgeräumt und instand gehalten von unsichtbaren Frauen, denen ich, hätte ich sie je zu Gesicht bekommen, bestimmt ein Gespräch aufgezwungen hätte, um ihnen zu zeigen, dass ich mich auf keinen Fall für besser hielt, und an dessen Ende ich vielleicht ein bisschen unzufrieden gewesen wäre, weil ich hätte einsehen müssen, dass sie und ich erst dann erlöst sein sollten, wenn ich ihnen etwas Trinkgeld gegeben hätte.
Diese Gegenwart des Davor war eine superartistische und genau geplante Aneinanderreihung von verwaltbaren Einheiten, und man kann so nur leben, wenn man Geld hat und Bildung und keine Verbindlichkeiten.
Das klingt kalt und traurig. Manchmal war es das, und dann wünschte ich mir etwas Heiliges. Ein Kind.
Es war aber auch gut. Manchmal richtig gut. Ob ich glücklich war, zufrieden oder einverstanden, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube allerdings auch nicht, dass das Kriterien eines gelungenen Lebens sind.
So oder so, ich wollte die Gegenwart behalten, wie sie war, ich war doch nach einer komplizierten Ewigkeit voller Praktika und Matratzen auf Böden, die fremd blieben, gerade erst in dieser Gegenwart angekommen. Alles sollte bleiben, wie es ist, mit der Möglichkeit, dass es irgendwann anders werden könnte.
Aber die Gegenwart war schneller, und ich wusste, dass ich sie nicht behalten konnte, es sei denn, ich würde mich dafür entscheiden, kein Kind zu bekommen. Und dass diese Rechnung, egal, wie man sie aufstellte, nicht aufgehen würde, wusste ich ebenfalls.
So oder so würde dieses Leben bald einen Unfall haben. Die Wirklichkeit, die ich mir aufgebaut hatte, würde sich nicht unbegrenzt aufrechterhalten lassen. Der kurze Schwebezustand im Leben einer Frau, in dem sie finanzielle Unabhängigkeit erreicht hat und jung ist, jung genug, um nicht negativ aufzufallen, weil sie noch keine familiären Verpflichtungen eingegangen ist, würde bald beendet sein. Texte über die Unmöglichkeit, Kinder zu haben, die Arbeit nicht aufzugeben, nicht in der kompletten Selbstverwahrlosung zu enden, sich nicht scheiden zu lassen, das heißt keine absolute Lebenskatastrophe zu vollziehen, waren überall.
Über Frauen – und es waren meist erfolgreiche Frauen –, die keine Kinder hatten, hörte ich bei Abendessen und auf Bürofluren, dass »ihnen etwas fehle«. Sie hatten irgendetwas falsch gemacht.
Mitarbeiterin A hat keine Kinder und zudem mal wieder mit den Türen geknallt, als es Unstimmigkeiten gab. Mitarbeiterin B und Mitarbeiter C dazu in der Mittagspause beim Sushi-Essen:
»Man sieht es ihr an, sie ist nicht glücklich«, sagt Mitarbeiterin B (Mitte vierzig, zwei Kinder, Akademikerin, Teilzeit) zu Mitarbeiter C. »Wäre ich aber an ihrer Stelle auch nicht.«
C (Ende vierzig, Akademiker, zwei Kinder, Vollzeit) zunächst mitleidig: »Wie soll sie glücklich sein? Sie hat ja nichts in ihrem Leben.«
B: »Allen Frauen, die keine Kinder haben, fehlt irgendwann etwas, da können sie mir erzählen, was sie wollen. Sie tut mir ja auch irgendwie leid. Aber sie ist …«
C: »… eine unerträgliche Zicke, die sich benimmt, als wäre sie zwanzig.«
C weiß, dass er, indem er die kinderlose Frau »Zicke« genannt hat, ein frauenfeindliches Klischee bedient hat, hat aber das Gefühl, mit seiner Aussage so dermaßen richtigzuliegen, dass man ihn mutig nennen sollte, diese Wahrheit zu formulieren.
B: »Sie ist es gewöhnt, dass sich alles um sie dreht. Aber jetzt ist sie vierzig, und es wirkt einfach nur lächerlich.«
Tja, sagen B und C. Sie haben ihre Pflicht bereits erfüllt und schenken sich dieses »Tja« als verdienten Lohn für ihr Opfer.
Und selbst wenn nicht direkt gesagt wurde, dass Frauen ohne Kinder (wie sagt man das nur, ohne einen Mangel auszudrücken?) egoistisch, bitter, leer, alleine und defizitär seien, weil sie keine Kinder hatten, schlich dieser Zusammenhang von ganz alleine durch die Gespräche. Diese Frauen waren zu bedauern. Wahrscheinlich fand ich dieses frauenfeindliche Schreckensbild auch und vor allem in mir selbst. Denn es war ja aus irgendwelchen Gründen schon immer klar gewesen, dass ich einmal Mutter sein würde, nicht zuletzt mir selbst. Nichtmutter war in dem Lebensprogramm, das ich in meinem Umfeld für Frauen vorfand, ganz einfach nicht vorgesehen. Dieses Umfeld sagte zu keinem Zeitpunkt: Du musst Mutter werden. Vielmehr nahm ich diese Bestimmung als selbstverständlich gegeben hin. Wenn ich »Umfeld« schreibe, meine ich: akademisches Milieu, Mittelschicht, Provinz. Mit Umfeld meine ich: Eltern, Großeltern, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern von Freunden und vor allem: die Mütter dieser Freunde, denn in meiner Generation war das Muttersein in der Regel ihre Hauptbeschäftigung. Das war, was Frauen überwiegend taten, auch wenn sie studiert hatten. Einige von denen, die ich sah, arbeiteten ein bisschen, aber das war nie, was sie ausmachte. Und ich weiß noch, wie entsetzt ich war, als meine Mutter, als ich etwa 11 Jahre alt war, begann, ein bisschen zu arbeiten, wenngleich es natürlich weiterhin mein Vater war, der morgens das Haus verließ und abends wieder zurückkam. Trotzdem, ich fand, das gehörte sich nicht, die anderen Mütter waren doch auch zu Hause. Und dennoch waren es später immer meine frühen Erinnerungen an meine Mutter und ihre finanzielle Abhängigkeit, die mich dazu motivierten, nicht in eine ähnliche Situation zu kommen.
Ab meinem dreißigsten Geburtstag jedenfalls wollte ich mich für meine Kinderlosigkeit entschuldigen. Es war, als würde ich allein als Grund zum Feiern nicht ausreichen, weil ich annahm, in den Augen der anderen fehle etwas. Ich wollte nicht bedauert werden. Ich wollte nicht leer, alleine, traurig, bitter und egoistisch werden. Niemand will so sein, auch wenn es ungleich schwerer wiegt, wenn eine Frau soist (böse, verrückt, unheimlich, all das, was man über Hexen immer gesagt hat). Es wäre allein meine Schuld gewesen, wenn ich mich dafür entschieden hätte. Oder dagegen.
Ich beantwortete dieses Dilemma schließlich, indem ich einfach gar nichts machte (ich ließ mir also weder irgendetwas einbauen, noch nahm ich die Pille etc.). Ich machte gar nichts und tat dabei so, als wäre nichts. Einige Monate später war ich schwanger.
Ein Kind, einfach nur ein Kind., dachte ich, als ich davon wusste und abends am Fenster stand. Jeder Mensch auf jeder Straße ist mal in irgendeiner Frau drin gewesen. Die U-Bahn geht auf, Menschen quellen heraus, Menschen, die allesamt aus einer Frau gekommen sind, und sie gehen alle irgendwohin, als wäre nie etwas gewesen. Frauen machen das. Was ist denn so schwierig daran? Warum stellst du dich so an?
Der Stell-dich-nicht-so-an-Imperativ ist eine häufige (und der Funktion nach systemerhaltende) Reaktion auf Frauen beziehungsweise Mütter mit Problemen. Genau wie die Hausarbeit und das Kümmern um die Kinder gering geschätzt werden, genau wie Jobs, in denen unsichtbare Kümmer- und Welterhaltungsarbeiten erledigt werden, mit denen man garantiert keine Preise gewinnt – genau wie diese Jobs schlecht bezahlt werden, werden auch die Anliegen von Frauen und Müttern abgewertet (zuletzt fantastisch zu beobachten bei der #MeToo-Debatte). Auch ich trat mir so gegenüber, auch ich wollte ganz einfach kein Problem sein. Ich wollte meine Pflicht tun (heißt: sexuell befreit sein, ein gepflegtes Äußeres und eine heterosexuelle Partnerschaft haben, eine gute Konsumentin und Mutter sein), ich wollte all diesen Pflichten nachkommen, sie nicht als solche empfinden und glücklich sein. Ich wollte mich freiwillig dafür entscheiden, was von mir erwartet wurde. Diese Feststellung klingt, als gebe es irgendeine externe normative Kraft, deren Erwartungen ich hilflos ausgeliefert gewesen sei. Diese normative Kraft ist da, aber sie ist eben immer eine Zusammenarbeit zwischen dem Außen (soziales Milieu, Facebook etc.) und dem Innen, also der Bereitschaft, bestimmten Normen zu entsprechen. Natürlich hatte ich eine Reflektionsebene über die Schwachsinnigkeit bestimmter Ideale. Natürlich wusste ich, dass es das Rezept zum Unglücklichsein ist, sich zu vergleichen, und machte Witze über jene Ideale. Dennoch und auch, wenn ich es nie zugegeben hätte, behielten die Bilder ihre Macht.
Diese Bilder, die man, wenn man als Frau ein bestimmtes Alter erreicht hat, in der Timeline hat: geile Aufnahmen mit geilem Sepia-Filter von geilen Babys, die mit geilem Spielzeug spielen, das ihnen ihre geilen Mütter geschenkt haben, die jene Bilder mit »#dasgeilstewasmanmachenkann« beziehungsweise »#minime« beziehungsweise »#innerpeace« überschreiben (worauf man eigentlich nur »#Arschlöcher« entgegnen kann). Oder diese permanent schwangeren Stars (die Bunte führt dazu die Rubrik »Stars im Baby-Glück«, in der Gala heißt sie »Schwangere Stars«). Oder Beyoncé, die ihre Schwangerschaft mit Zwillingen auf Instagram bekannt gab, indem sie sich in Unterwäsche kniend vor einem üppigen Blumenarrangement aus Dahlien, Rosen und Grünzeug zeigte, die Hände hielten den nackten Babybauch, das ebenfalls üppige Haar trug sie lang und offen, ein zartgrüner Schleier lag über den Haaren und dem dezent geschminkten Gesicht, dessen Züge sanft wirkten und ein seliges, weltüberlegenes Lächeln andeuteten, und natürlich war die Idee dabei, den Betrachter popkulturellversiert und very appealing an katholische Heiligenbilder voller Madonnen, Vergebung, Aufopferung und weiblicher Stärke zu erinnern. Die Ruhe und Seligkeit, die das Bild vermittelt, sagten dem Betrachter, dass diese Frau ihr Ziel erreicht hat. Dieser Frau stellt man keine Fragen, diese Frau ist dort angekommen, wo ihre Bestimmung liegt.
Als ich begann, mich an meinen Geburtstagen schlecht zu fühlen, begann ich gleichzeitig, das Extremistenthema Mutterschaft und die darin liegende Obsession zu begreifen. Einerseits die Fetischisierung der schwangeren Frau und der Mutter (das Glück, der Heiligenschein, die Freude der Gesellschaft darüber, dass hier, bei dieser schwangeren Frau, bei dieser Mutter etwas ganz augenscheinlich ist, wie es sein soll). Andererseits das Bild von Mutterschaft als dem totalen Albtraum (dem Ende des Lebens, Game over, Feierabend, bist du verrückt?), wobei jene, die darüber schrieben, dass sie mit ihrem Dasein als Mutter Probleme hätten, von den Müttern, die mit sich und ihrem Leben einverstanden waren, im Internet regelmäßig öffentlich gegrillt wurden. Heiligenverehrung und Hexenverbrennung liegen selbstverständlich nah beieinander, selbstverständlich, weil die Heiligen Angst vor den Hexen in sich haben, und ja, man kann sich darüber wundern, dass das heute immer noch so ist, aber das führt leider zu gar nichts. Wichtiger wäre erst mal, anzuerkennen, dass es so ist.
Der Exponent der Kinderangst, die mich damals vollkommen fertigmachte, ist die israelische Soziologin Orna Donath mit ihrer 2015 veröffentlichten Studie »Regretting Motherhood«. Donath befragte 23 Frauen, die allesamt angaben, ihre Mutterschaft lang anhaltend zu bereuen. Die Frauen waren unterschiedlich alt, lebten in unterschiedlichen Konstellationen (Ehe, alleinerziehend, Kinder aus dem Haus) und kamen aus unterschiedlichen sozialen Milieus. Donath betont in ihrem 2016 erschienenen Buch »Regretting Motherhood«, dass es ihr nicht darum gehe, die bei vielen Müttern vorhandenen Ambivalenzen zu beleuchten. Sie konzentrierte sich auf Frauen, die, wenn sie noch einmal die Wahl hätten, keine Kinder bekommen würden oder die ihre Entscheidung gar rückgängig machen würden, wenn das ginge. In Deutschland wurde die Studie enorm engagiert diskutiert. Einerseits wurde entsetzt auf den Tabubruch reagiert, die anonym im virtuellen Raum herumstehende bereuende Mutter wurde beschimpft und pathologisiert (»Meine Mäuse sind das Wichtigste, was ich habe, wenn ich in ihre Augen sehe … ich kann einfach nicht verstehen, wie man so kalt sein kann! Krank, einfach nur krank«), und man gab ihr immer wieder diesen heißen Tipp, dass sie sich nicht so anstellen solle. Andererseits bewirkte die Veröffentlichung der Studie aber auch, dass sich zahlreiche Frauen trauten, in Blogs und unter dem Hashtag #regrettingmotherhood darüber zu schreiben, wie belastend und schrecklich die Mutterrolle für sie war. Es wirkte, als sei ein streng bewachtes Geheimnis verraten worden, deren Hüterinnen extrem erleichtert darüber waren, endlich einmal gestehen zu dürfen, dass es dieses Geheimnis gab und wie es ihnen damit ging.
Dass es schwierig und eigentlich völlig unmöglich war, ein Kind zu bekommen, hatte ich also längst begriffen. Ich sah es an den angestrengten Gesichtern der arbeitenden Mütter, die ich kannte. Ich glaubte, ihre Wut darüber zu spüren, dass ich mir über so vieles noch keine Gedanken machen musste, während sie sich Woche für Woche ihren Terminkalender ins Hirn tätowieren lassen mussten, in dem nicht ein Zentimeter Platz mehr für sie war. Ich hörte es an ihrem höhnischen, explodierenden Lachen, wenn ich fragte, wie lange ihr Mann denn Elternzeit genommen habe. Ich sah es an den durch die Gewichte der Babys in den Tragetüchern schwankenden Frauen, die die Vormittage bevölkerten und die so schrecklich langsam gingen. Die dabei diesen Warte-nur-Ausdruck wissender Überlegenheit im Gesicht hatten. Ich sah, mit welcher Skepsis und Angst ich diese Bevölkerungsgruppe observierte und dachte, so würdest du dann auch angesehen werden. Und du würdest dann auch diese unzähligen grauenhaften Wörter verwenden müssen, die nur dazu da sind, ihre Benutzer zu entwürdigen: Kita, Pekip, Geburtsvorbereitungskurs, Snuggle, Bugaboo, Manduca, Dudu, Schwangerenyoga, schwanger (überhaupt, dieses runde, geschwollene Wort, das mir nie gefallen hatte, was möglicherweise daran liegt, dass die Abwertung von allem, was damit zu tun hat, in einem bestimmten Milieu so verbreitet ist, doch dazu später).
Ich sah das alles, und es sah schrecklich aus. Sicher, weil mein Kopf ein eigenes Problem hatte (gibt es das? Ein eigenes Problem, das nichts mit dem Außen zu tun hat?). Aber auch, weil überall und wahrscheinlich zu Recht davor gewarnt wurde. Denn tatsächlich wurde die Mutterschaft als Schreckensszenario genauso beschrieben wie als das erfüllendste, beste, schönste Dasein überhaupt. Allerdings wurde die Schreckensszenariofraktion publizistisch eher von dem Milieu abgebildet, von dem ich mich angesprochen fühlte (etwa als es um das Thema Regretting Motherhood ging), während die Mami-Glück-Abteilung eher in Blogs, Werbung und außerordentlich idiotischen Frauenzeitschriften zu finden war. Das heißt: Ich fand, was ich suchte, aber ich suchte auch dort, wo man mich ansprechen wollte. Und genauso verhielt es sich im Real Life: Ich sprach eher mit Müttern, die Akademikerinnen waren und über den ständig laufenden Vereinbarkeitsdiskurs informiert waren und die somit keine Schwierigkeiten damit hatten zu erzählen, wie unerträglich sie ihr Leben mitunter fanden. Ich sprach eher mit ihnen als mit Frauen, die ihr Glück kaum fassen konnten.
Durch die Regretting-Motherhood-Studie wurde also auch noch davor gewarnt, dass man sein Leben durch ein Kind für immer ruinieren könnte, weil man jemand sein könnte, der für die Mutterrolle nicht gemacht ist. Wie ein Virus, das man hat oder eben nicht, und man erfährt es natürlich erst, wenn es zu spät ist.
Unmittelbar nachdem ich erfuhr, dass ich schwanger war, war ich deswegen davon überzeugt, dass mein Leben vorbei war. Egal, wie ich mich entschied. Das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber das war es nicht.
Möglichkeit eins: Kein Kind, das heißt leer, alleine, traurig und verrückt werden. Würdelos altern unter den Blicken der anderen. Da man das Altern betreffend ja als Frau besonders aufpassen muss, keine gute Option, zumal sie die ebenfalls schreckliche Möglichkeit beinhaltet, dass man irgendwann mit vierzig feststellt, dass man doch ein Kind braucht, worüber man dann noch mal separat verrückt und traurig werden kann.
Möglichkeit zwei: Ja zum Kind und auf der Stelle gestresst, verrückt und leer werden. Mittelfristig Freund und Beruf verlieren. Ggf. nachdem das Kind da ist feststellen, dass man es bereut und gefangen sein wird, forever.
Ende der Leseprobe