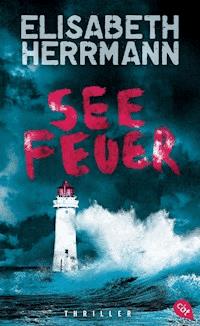9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Judith-Kepler-Roman
- Sprache: Deutsch
Judith Kepler ist Tatortreinigerin. Sie wird gerufen, wenn der Tod Spuren hinterlässt, die niemand sonst beseitigen kann. In einem großen Berliner Bankhaus ist ein Mann in die Tiefe gestürzt. Unfall oder Selbstmord? Judith entdeckt Hinweise, die Zweifel wecken. Als sie die Polizei informiert, ahnt sie nicht, welche Lawine sie damit lostritt: Sie gerät ins Visier einer Gruppe von Verschwörern, die planen, die Bank zu hacken. Ihr Anführer ist Bastide Larcan, ein ebenso mächtiger wie geheimnisvoller Mann, der Judith zur Zusammenarbeit zwingt. Denn er kennt Details aus ihrer Vergangenheit, die für sie selbst bis heute im Dunklen liegen. Und in Judith keimt ein furchtbarer Verdacht – kann es sein, dass Larcan in die Ermordung ihres Vaters verstrickt war? Sie weiß, sie wird nicht ruhen, bis sie endlich die Wahrheit erfährt, was als Kind mit ihr wirklich geschah …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 728
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Judith Kepler ist Tatortreinigerin. Sie wird gerufen, wenn der Tod Spuren hinterlässt, die niemand sonst beseitigen kann. In einem großen Berliner Bankhaus ist ein Mann in die Tiefe gestürzt. Unfall oder Selbstmord? Judith entdeckt Hinweise, die Zweifel wecken. Als sie die Polizei informiert, ahnt sie nicht, welche Lawine sie damit lostritt: Sie gerät ins Visier einer Gruppe von Verschwörern, die planen, die Bank zu hacken. Ihr Anführer ist Bastide Larcan, ein ebenso mächtiger wie geheimnisvoller Mann, der Judith zur Zusammenarbeit zwingt. Denn er kennt Details aus ihrer Vergangenheit, die für sie selbst bis heute im Dunklen liegen. Und in Judith keimt ein furchtbarer Verdacht – kann es sein, dass Larcan in die Ermordung ihres Vaters verstrickt war? Sie weiß, sie wird nicht ruhen, bis sie endlich die Wahrheit erfährt, was als Kind mit ihr wirklich geschah …
Weitere Informationen zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Elisabeth Herrmann
Stimme der Toten
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Das vorangestellte Gedicht ist ein Textauszug aus: Arthur Rimbaud, »Das trunkene Schiff«. Aus dem Französischen von Paul Celan, in: Arthur Rimbaud, »Poésies«. Gedichte. Zweisprachige Ausgabe. © Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 2007. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Insel Verlag Berlin.
Auszüge aus »Zeugin der Toten« von Elisabeth Herrmann mit freundlicher Genehmigung des List Verlages. © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2011
Copyright © der Originalausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Haus: Hayden Verry / Arcangel;
Himmel: FinePic®, München
CN · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-17158-2V006
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Shirin, immer wieder!
Und gäb es in Europa ein Wasser, das mich lockte, so wärs ein schwarzer Tümpel, kalt, in der Dämmernis, an dem dann eins der Kinder, voll Traurigkeiten, hockte und Boote, falterschwache, und Schiffchen segeln ließ’.Si je désire une eau d’Europe, c’est la flacheNoire et froide où vers le crépuscule embauméUn enfant accroupi plein de tristesses, lâcheUn bateau frêle comme un papillon de mai.
Arthur Rimbaud, Das trunkene Schiff
Prolog
Berlin-Biesdorf, August 2010
Mit einem lauten Knall explodierte die Fensterscheibe. Risse durchzogen das Glas wie ein riesiges Spinnennetz. Wieder ein Knall. Judith konnte sich nicht schnell genug ducken. Die Scheibe des Aquariums zersprang in tausend Splitter, sie zerfetzten Kleider und Haut, und bevor sie mit Kaiserley zu Boden geschleudert wurde, sah sie für den Bruchteil einer Sekunde das Wasser wie eine Säule im Raum stehen. Noch im Fallen ergoss sich eine einzige meterhohe Welle ins Zimmer. Kaiserley und sie prallten auf den Couchtisch, dann auf den Boden. Die Pistole wurde ihr durch die Wucht des Aufschlags aus der Hand geschleudert und landete außer Reichweite unter der Couch. Ein weißer Fisch schlug direkt neben Judiths Gesicht auf. Er zappelte und schnellte wie verrückt nach oben. Kaiserley presste seine Hand auf ihren Mund. Er war klatschnass, Wasser rann aus seinen Haaren auf sie herab. Judiths Herz hämmerte gegen ihre Rippen. Sie schnappte genauso verzweifelt nach Luft wie der Fisch neben ihr.
Dann war es still. Ein letztes Klirren, es tropfte in die Pfützen auf den Boden. Gegenüber, keinen Meter entfernt, hinter dem Couchtisch, lag Merzig. Blut strömte über sein Gesicht. Er zuckte. Und das Funkeln in seinen Augen war nicht mehr der Widerschein seiner merkwürdigen Seele, sondern kam von messerscharfen Splittern aus Glas. Sein Kopf fiel zur Seite. In der Schläfe war ein kleines schwarzes Loch. Horst Merzig, ehemaliger Generalleutnant der Hauptabteilung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit, war tot. Judith spürte Kaiserleys Atem auf ihrem Gesicht. Langsam zog er seine Hand weg und legte den Zeigefinger auf seine Lippen. Reglos blieb sie liegen. Und dann knirschten die Scherben hinter ihnen, als jemand darüberschritt.
»Wie schön«, sagte eine Frauenstimme. »Ein bisschen viel Wasser für eine harmlose Teeparty.«
Kaiserley wollte sich aufrichten.
»Ganz ruhig. Nichts überstürzen. Einer nach dem anderen, Hände über den Kopf, Gesicht zur Wand.«
Er rollte von Judith herunter und stand auf. Sie sah noch einmal zu der Pistole, aber die Frau war so nah, dass jede falsche Bewegung Judiths letzte sein könnte. Als sie mühsam auf die Beine kam, schlug der weiße Fisch noch einmal mit dem Schwanz. Dann blieb er reglos liegen. Nur sein Maul öffnete sich, wieder und wieder.
Die Frau war vielleicht Ende vierzig und ausgesprochen schön. Ein südländischer Typ mit schmalem, grazilem Knochenbau, aber durchtrainiert bis in die letzte Faser ihres perfekten Körpers. Sie trug einen dunklen, sportlichen Anzug und schwarze Lederhandschuhe. Ihre braunen Augen blickten bemerkenswert ruhig in die Runde – dafür, dass sie eine klobige Waffe mit Schalldämpfer hielt.
»Kaiserley«, sagte sie.
Judith sog scharf die Luft ein. Natürlich. Wo immer es auf dieser Welt so richtig dreckig zuging, kannte man sich. »Sie sind …?«
»Warrant Officer Angelina Espinoza, Central Intelligence Agency.« Als sie in Judiths verständnisloses Gesicht sah, setzte sie hinzu: »CIA.«
»Du hast nicht nur für die CIA gearbeitet«, sagte Kaiserley.
»Hände hoch! KGB, FSB, MfS … ich arbeite für den, der mich bezahlt. Und im Moment auf eigene Rechnung.«
Sie schritt um die Couch herum und trat so nahe an Judith heran, dass sie sich beinahe berührten.
»Wo sind die Mikrofilme?«
Judith spuckte ihr ins Gesicht. Espinoza holte aus, und Judith duckte sich nicht rechtzeitig. Der Schlag erwischte sie am Hinterkopf. Sie stürzte auf die Knie und sah aus den Augenwinkeln, wie Kaiserley sich auf Espinoza werfen wollte. Der Schuss klang wie ein knallender Champagnerkorken. Kaiserley stieß einen Schrei aus und brach zusammen. Seine Hände pressten sich auf den linken Oberschenkel. Ungläubig starrte er auf den roten dunklen Fleck, der sich in rasender Geschwindigkeit ausbreitete.
»Keine Angst, ich habe das Schießen nicht verlernt.« Espinoza zielte auf Kaiserleys Kopf. »Ich arbeite heute nur im Stil von Sekretärinnen. Die treffen meistens nicht beim ersten Mal.«
Merzig rührte sich nicht mehr. Seine blutunterlaufenen Augen starrten zur Decke. Die Agentin beugte sich zu Judith herab.
»Die Filme.«
»Was haben Sie mit meinem Vater gemacht?«
»Ich habe ihn erschossen. Keine Zeugen, kein Risiko. Er wusste, auf was er sich einließ. Man kann nur Sieger oder Verlierer sein.« Sie hob die Waffe und machte einen Schritt auf Judith zu. »Wo sind die Filme?«
»Ich weiß es nicht!«, schrie Judith. »Und wenn Sie uns beide abknallen, sie sind weg!«
»Die Polizei hat sie nicht gefunden. Der BND auch nicht. Aber Sie, die Putzfrau, Sie haben etwas. Sie wissen etwas.«
»Nein!«
»Diese Filme sind wertvoll. Man trägt sie bei sich. Man behält sie im Auge. Man versucht, sie erst in letzter Sekunde verschwinden zu lassen. Wo haben Sie sie gefunden? Im Müllschacht? Im Keller? Auf dem Dach?«
Sie drückte ab. Judith warf sich zur Seite, der Schuss verfehlte sie haarscharf. Espinoza spielte mit ihr Katz und Maus. Beim nächsten Mal würde sie treffen. Nicht tödlich. Noch nicht. Sie würde sie jagen, stellen und ausbluten lassen, genauso wie Kaiserley, der mit aschfahlem Gesicht halb ohnmächtig auf die Couch geworfen worden war. Sie dachte an die Flecken und die Scherben und das Wasser und die Königsbarsche, und dass sie unter Schock stehen musste, wenn die letzte Sorge ihres Lebens dem Saubermachen galt.
Sie griff den glitschigen, zuckenden Leib eines sterbenden Fischs und schleuderte ihn Espinoza ins Gesicht. Die Frau schrie auf und taumelte einen Schritt zurück. Ekel verzerrte ihr Gesicht und lenkte sie für den kurzen Moment ab, den Judith brauchte.
Ihre Hand schnellte unter das Sofa. Sie griff die Pistole und hechtete aus der Tür. Zwei weitere Champagnerkorken knallten, Putz rieselte von der Wand. Gehetzt sah sie sich um. Die Wohnungstür war zu weit entfernt. Sie lief in Merzigs Schlafzimmer und stellte sich hinter die geöffnete Tür. Sie versuchte, sich zu erinnern, wie groß Espinoza war. Dann legte sie den Lauf der Waffe in der Höhe an die Tür, in der sie Espinozas Kopf vermutete, und wartete.
Ihre Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Sie hörte das Klirren von Glas und leise Schritte, die sich über den Flur näherten. Sie sah Merzigs schmales Bett und das matte Linoleum auf dem Fußboden. Ein paar Urkunden und alte Sportpokale, ein kleiner Stapel Bücher auf einem Regal über dem Bett. Ein Foto auf dem Nachttisch in einem schmalen, billigen Rahmen. Auf dem Digitalwecker leuchteten die Ziffern 21:04. Die Zeit, die auf ihrem Totenschein stehen würde. Die Schritte kamen näher.
»Renn!«, schrie Kaiserley. »Judith! Renn!«
Sie hielt den Atem an. Im diffusen Halbdunkel spürte sie mehr, als dass sie sah, wie ein Schatten durch den Türspalt ins Zimmer glitt. Sie drückte ab. Ein ohrenbetäubender Knall zerriss ihr fast das Trommelfell, der Rückstoß schleuderte sie an die Wand. Die Tür hatte ein faustgroßes Loch. Sie hörte, wie ein Körper zu Boden fiel, aber sie wagte nicht, sich zu rühren. Dann sah sie, wie die Tür sich langsam, ganz langsam öffnete.
Kaiserley griff den Kristallaschenbecher, der auf dem Boden neben Merzig gelandet war. Eine andere Waffe hatte er nicht zur Verfügung. Sein Bein schmerzte, und als er den großen, dunklen Fleck auf dem Sofa sah, ahnte er das Ausmaß des Blutverlusts, den er gerade erlitt. Er stand auf und versuchte, sein linkes Bein so wenig wie möglich zu belasten.
Das Wohnzimmer war im wahrsten Sinne des Wortes ein Scherbenhaufen. Er wunderte sich, warum die Nachbarn noch nicht die Polizei gerufen hatten. Dann überschlug er, dass keine drei Minuten vergangen waren, seit Angelina hier aufgetaucht war. Sie kamen ihm vor wie eine Ewigkeit. Die Sorge um Judith ließ ihn fast wahnsinnig werden. Seit dem Schuss drang kein Laut mehr aus dem Flur. Er hob den Ascher und humpelte zur Tür. Dann ließ er ihn sinken.
Angelina Espinozas Körper lag in Merzigs Schlafzimmer. Sie rührte sich nicht. Welche Waffe auch immer sie getötet hatte, von ihrem schönen Gesicht war nur noch ein blutiger Klumpen übrig. Die Frau, die Judiths Leben und das ihrer Eltern zerstört hatte, die durch Verrat eine Familie in den Abgrund getrieben und dem kleinen Mädchen, das Judith damals gewesen war, alles genommen hatte – sogar seinen Namen –, sie war tot.
»Judith?«
Mühsam stieg er über Angelinas Leiche und betrat das Zimmer. Judith saß auf Merzigs Bett. Die Pistole lag in ihrem Schoß. Sie hielt einen kleinen Bilderrahmen in den Händen und schaute nicht auf, als er zu ihr kam und sich neben sie setzte.
Das Foto zeigte drei Personen: Stasi-Agent Richard Lindner – Judiths Vater, eine hübsche blonde Frau – Judiths Mutter und ein Kind, das wie ein Engel in die Kamera strahlte. Über Judiths Gesicht liefen Tränen, aber sie blinzelte nicht und wischte sie auch nicht fort.
»Merzig hat den Haftbefehl für seine eigene Tochter unterschrieben«, sagte sie.
Kaiserley sah wieder auf das Foto. Er wollte den Arm heben und sie an sich ziehen, doch er spürte, dass er sogar dazu zu müde war.
»Er hat … O mein Gott. Merzig war mein Großvater.«
Kaiserley schwieg. Er spürte, wie sie sich an ihn lehnte und den Kopf auf seine Schulter sinken ließ. Sie hatte das schon einmal getan. Er versuchte, sich nicht zu bewegen. Vielleicht verharrte sie dann noch eine Weile so.
»Es tut mir leid«, flüsterte er. »Judith, es tut mir so entsetzlich leid.«
Tränen tropften auf das Bild in ihrer Hand. »Ich hätte ihn umgebracht. Bei Gott, das hätte ich. Und er wusste das.«
»Das hätte ich nicht zugelassen.«
Sie nahm den Kopf weg. Augenblicklich war auch die Wärme fort.
»Was du dir immer einbildest«, sagte sie. Aber es klang nicht mehr so hart wie sonst. Es klang, als ob sie das gewusst hätte.
1
Berlin, sechs Jahre später
Friedrichstraße, sieben Uhr morgens. Rushhour. Judith Kepler war bereit, für einen Parkplatz einen Mord zu begehen.
Rund um den S-Bahnhof kollabierte der Verkehr. Pendler stürzten sich bei Rot über die Straße und streiften die Kühlerhauben der stehenden Wagen mit ihren Aktentaschen und Wintermänteln. Autos fuhren Stoßstange an Stoßstange und bewegten sich nur zentimeterweise vorwärts, die Fahrer degradiert zu machtlosen Revoluzzern, die wütende Hupkonzerte anstimmten. In der eiskalten Morgenluft lag ein Hauch von Anarchie. Falling down, dachte Judith. Sie liebte diesen Film. Aussteigen, die Uzi vom Beifahrersitz nehmen und eine Salve in den bleigrauen Himmel jagen. Hey, Leute, es ist nur ein ganz normaler Novembermorgen. Ich hatte auch keine Lust aufzustehen. Kein Grund, in euren Blechbüchsen verrücktzuspielen.
Sie schnitt den Irren auf der rechten Spur, der sich mit einem Nummernschild aus dem Landkreis Oder-Spree in den Hauptstadtverkehr gewagt hatte, setzte ihren Transporter mit der Aufschrift Dombrowski Facility Management halb auf den Bürgersteig direkt vor seine Nase und würgte den Motor ab. Der Mann am Steuer hinter ihr kollabierte beinahe.
Er hielt neben ihr und ließ das Seitenfenster herunter. »Sie wollen da doch nicht stehen bleiben? Das ist Absolutes! Absolutes!«
Judith Kepler achtete nicht weiter auf ihn. Sie nahm ihre Arbeitstasche, legte die Ausnahmegenehmigung, für die Dombrowski ein Vermögen bezahlt hatte (an wen eigentlich?), auf das Armaturenbrett, stieg aus und ignorierte die Geste, mit der ihr der Mann im Schutz seines Blechkastens deutlich zu erkennen gab, was er von ihr hielt. Dann holte sie den Zettel aus ihrer Overalltasche und verglich die angegebene Adresse mit dem Haus auf der anderen Straßenseite. Es wäre nicht nötig gewesen, denn die beiden Streifenwagen und das Absperrband, das die gläserne Drehtür freihielt, hielten die Passanten auf dem Gehsteig zurück, die sich nun ebenfalls stauten und ineinander verkeilten. Es sah aus, als warteten sie alle miteinander frühmorgens vor einem Hotel auf die Ankunft eines Rockstars. Dabei war es nur eine Bank.
CHL. Judith wusste nicht, was diese drei Buchstaben bedeuteten. Sie standen, von blauem Neonlicht angestrahlt, auf dem Dach des Gebäudes, das sich mit seiner funktionalen Glasfassade in nichts von der eintönigen Moderne des Regierungsviertels unterschied. Sie überquerte die Straße und drängte sich durch die Wartenden hindurch bis zu einem uniformierten Polizisten, der sie aufhalten wollte.
»Weitergehen!«, brüllte er sie an. »Hier gibt es nichts zu sehen!«
»Ich muss da rein.«
Judith hielt ihm ihren Firmenausweis entgegen, der erwartungsgemäß nicht den geringsten Eindruck machte.
»Später.«
»Ich habe den Auftrag, hier so schnell wie möglich …«
Ein Mann im Kamelhaarmantel rempelte sie an. Seine Aktenmappe aus Leder glänzte, als würde er sie jeden Abend mit Hingabe wienern.
»Hören Sie«, unterbrach er Judiths Erklärung, »ich müsste schon längst an meinem Arbeitsplatz sein. Wie lange dauert das denn noch?«
Der Polizeibeamte ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenden Sie sich an den Einsatzleiter.«
»Ich muss da rein«, wiederholte Judith.
»Ich auch«, knurrte der Kamelhaarmann.
Er war einen Kopf größer als Judith, roch nach teurem Rasierwasser, strich sich nervös über die millimeterkurzen, dunklen Haare und konnte nicht stillstehen. Ein Läufer, der den Startschuss herbeifieberte. Oder ein Getriebener, der feststellt, dass er die Orientierung verloren hat, dachte Judith. Offenbar war er es nicht gewohnt, in seine Schranken gewiesen zu werden, denn er holte ein Smartphone aus der Jackentasche und checkte stirnrunzelnd die eingegangenen Meldungen. Dabei murmelte er mehrmals: »Das wird Konsequenzen haben«, und zwar so laut, dass es jeder hören musste.
Judith stellte sich auf die Zehenspitzen, um einen Blick in das Innere der Bank zu werfen. Das Gebäude war wohl nicht für den Publikumsverkehr gedacht, denn sie konnte weder Geldautomaten noch Kontoauszugsdrucker sehen, nur eine weite, menschenleere Eingangshalle mit einem Tresen neben den geöffneten Fahrstühlen. An den Wänden hingen riesige Gemälde, die modern wirken sollten, aber in Judiths Augen auch nicht viel mehr waren, als ein paarmal mit dem Farbroller über die Leinwand zu gehen. Links befand sich eine Sitzgruppe, die so neu aussah, als ob sie noch nie jemand benutzt hätte. Alles glänzte. Bis auf die orange-weißen Leitkegel in der Mitte der Halle auf dem spiegelnden Granitboden. Die Spurensicherung benutzte sie, um Tatorte zu markieren. Dort musste die Leiche gelegen haben.
»Selbstmord«, hatte Dombrowski gesagt und den Kopf geschüttelt. »Selbstmord in einer Bank. Davor könnte ich es ja noch verstehen. Bei der Auftragslage momentan denke ich auch manchmal an den Strick. Was ich mir von meinem Geldautomaten so alles anhören muss … Also, Judith. Schnelle, saubere Sache. Publikumsverkehr. Leichenfundort freigegeben. Viel Vergnügen.«
Das war seine Art, mit dem Tod umzugehen. Judith kannte ihren Chef lange genug, um sie ihm zu verzeihen. Sie rekapitulierte, was sie bei ihm über die verschiedenen Gesteinsarten gelernt hatte und wie man sie sauber bekam. Granit – Wasseraufnahme weniger als 0,32 Gewichtsprozent. Tiefengestein. Extrem hohe Reindichte und Belastbarkeit. Nässeresistent, aber säureempfindlich. Wenn poliert, dann Finger weg von Dampf- und Hochdruckreinigern. Sie überlegte, ob sie zum Transporter zurückgehen und weitere Arbeitsutensilien holen sollte, und entschied sich dagegen. Schrubber, Chlor und Steinwachs müssten reichen.
Zwei Männer, beide von mittlerer Größe und Statur, gekleidet wie Menschen, die es jederzeit vom Schreibtisch für Stunden hinaus in die Kälte treiben kann, tauchten von irgendwoher am Ende der Halle auf. Sie unterhielten sich konzentriert und kamen langsam auf die Eingangstür zu. Vor dem zentimeterdicken Panzerglas blieben sie stehen und schauten während ihrer Unterhaltung auf die wartenden und frierenden Menschen da draußen. Irgendetwas sagte Judith, dass die beiden zur Kripo gehörten. Der Anblick der Wartenden war ihnen egal. Sie machten ihren Job.
Langsam wurde es hell. Ein grauer windiger Morgen. Der Himmel demotivierend wie Judiths Kontostand. Der Wetterbericht verhieß Regen bei Temperaturen zwischen fünf und sieben Grad. November. Der Monat der Selbstmorde.
»Ich kann auch wieder gehen«, sagte Judith zu dem Polizisten.
Auf den machte ihre Drohung einen ähnlichen Eindruck wie die gemurmelten Verwünschungen des Kamelhaar-Bankers: gar keinen.
Die beiden Männer hinter der Scheibe drehten sich um und schlenderten gemächlich durch die Halle zurück. Wir haben Zeit, hieß das. Wahrscheinlich Leute vom Kriminaldauerdienst, die auf die Ablösung warteten. Der Banker neben Judith versuchte noch, sich bei den beiden bemerkbar zu machen, doch es gelang ihm nicht. Zum wiederholten Mal sah er auf seine Armbanduhr, dann suchte er in der Menge nach Arbeitskollegen, mit denen gemeinsam er größere Chancen hatte, die Absperrung zu überwinden. Als er niemanden entdeckte, nahmen seine hellbraunen Augen wieder Judith ins Visier. Er sah eine schmale, durchtrainierte Frau Mitte bis Ende dreißig in einem blauen Reinigungsoverall, die sich Gedanken darüber machte, wie lange sie ihren Transporter wohl noch quer auf dem Bürgersteig im absoluten Halteverbot stehen lassen konnte.
»Was halten Sie davon?«
»Was?«
Der Banker musste mit ihr geredet haben. Seine Augen standen eine Winzigkeit zu eng beieinander und verliehen dem schmalen Gesicht dadurch einen Ausdruck von Überheblichkeit. Ohne diesen kleinen Makel wäre er im landläufigen Sinne gutaussehend: leidlich groß, harmonische Gesichtszüge und ein charmantes Lächeln, das ihm in diesem Moment allerdings nicht hundertprozentig gelang.
»Wir gehen hintenrum. Zum Lieferanteneingang. Wenn ich mich einfach an die Schöße Ihres überaus kleidsamen Overalls hängen dürfte?« Er grinste. Er fand sich witzig und hatte die Lösung seines Problems direkt vor sich stehen. »Adrian Jäger, Customer and Press Relationship Manager der CHL.« Auch die letzten Buchstaben sprach er englisch aus. Siie Äitsch Ell. »Kurz: Ich mache hier die Öffentlichkeitsarbeit.«
Er sah den alten Rollkragenpullover, den Judith unter dem Overall trug, und den aufgestickten Firmennamen. Den unausgeschlafenen Blick und die nachlässig zurückgenommenen Haare. Er reimte sich zusammen, wer sie war und was sie hier wollte, und vielleicht bemerkte er in diesem Moment sogar noch etwas anderes. Sein Blick wurde intensiver. Er übte seine Auftritte wohl an jedem lebenden Objekt, das ihm in die Quere kam. Solange es weiblich war.
»Und Sie? Was machen Sie hier?«
Jäger bahnte sich eine Gasse durch die Umstehenden. Judith folgte ihm. Ein paar Meter weiter blieb er stehen und wartete auf sie.
»Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Judith Kepler. Ich bin der Cleaner.«
2
Weiße Kreidestriche erinnerten an die Lage der Leiche, die längst abtransportiert worden war. Dort, wo der Kopf gelegen haben musste, hatte eine Blutlache von den Außenrändern her zu trocknen begonnen. Der Wachmann, der sie begleitet hatte, verabschiedete sich mit einem kurzen, verunsicherten Gruß. Judith stellte die Arbeitstasche ab, ging in die Knie und betrachtete den Boden. Sanft fuhr sie mit dem Finger über die Kreide. Dann sah sie hoch.
Das Atrium reichte hinauf zu einem gläsernen Dach. Jedes der sieben Stockwerke hatte eine eigene Galerie, von der aus man die Büros erreichte. In der obersten Etage stand ein Mann in weißem Overall am Geländer und strich vorsichtig mit einem Grafitpinsel über das schimmernde Metall. Vielleicht war das Opfer ja über die Brüstung geklettert und gesprungen. Judith schätzte die Höhe auf knapp dreißig Meter. In freiem Fall auf Granit. Sie beneidete die Bestatter nicht, die oft den weitaus schlimmeren Job hatten als sie.
Jäger, der Mann, für dessen Berufsbezeichnung man ein Fremdsprachenstudium brauchte und der sich hinter der Sicherheitsschleuse beim Pförtner hastig, das Handy am Ohr, mit einem Nicken und einem flüchtigen Lächeln von ihr abgewandt hatte, betrat das Atrium. Er ging direkt zu den Fahrstühlen, stutzte, kehrte um und kam zu ihr herüber.
»Ich kann es immer noch nicht glauben.«
Vor den Kreidestrichen blieb er stehen. Sein Gesicht, ungeübt in der Mimik des Mitgefühls, verzog sich zu etwas, das Bedauern ähneln sollte.
»Gestern waren wir noch zusammen beim Lunch. Wenn ich das gewusst hätte …«
Er sagte nicht, ob und was das geändert hätte. Beugte sich herab. Strich wie Judith über die Kreide. Betrachtete seine weiße Fingerkuppe. Erhob sich. Folgte mit den Augen den weißen Linien auf dem Boden.
»Warum hier?«
Judith schwieg.
»Warum?«
Er machte ein paar Schritte auf den Eingang zu. Die Drehtür bewegte sich nicht, Schaulustige und Mitarbeiter standen immer noch vor der Absperrung.
»Da geht man zusammen auf Geschäftsreisen und schickt die Kinder auf dieselbe Schule. Da glaubt man, man kennt sich.«
»Vielleicht war es ein Unfall?«
Judith kannte die Reaktionen auf den plötzlichen Tod. Fast immer waren sie eine Mischung aus Ratlosigkeit und Reue. Reue, die Chancen und Zeichen nicht erkannt zu haben. Ratlosigkeit, weil es vielleicht keine gegeben hatte.
»Das halte ich für unwahrscheinlich.« Jäger drehte ihr immer noch den Rücken zu.
Ein weiterer Bankangestellter durchquerte die Halle. Gleiches Alter, gleiche Größe, gleiche Frisur. Die Sohlen seiner Schuhe quietschten auf dem blanken Boden. Er trug wie alle hier Anzug, weißes Hemd und Krawatte. Wahrscheinlich hielten sie sich einzig durch Farbe und Muster ihrer Binder auseinander.
»Morgen, Herr Jäger.«
Jäger nickte. Alle Hast, alle Unruhe waren angesichts der Tragödie von ihm abgefallen. Er stand in der Mitte der leeren Halle und sah aus wie jemand, den man auf einer einsamen Insel ausgesetzt hatte.
»Schreckliche Sache.« Der Kollege stellte sich neben ihn. »Die Abteilungsleiter wissen schon Bescheid. Außerordentliche Betriebsversammlung um zehn. Können Sie das koordinieren? Kleine Ansprache und so. Übrigens, Harras will Sie sprechen. Zwei Herren von der Kriminalpolizei warten im Konferenzraum. Sieht nach Selbstmord aus.«
»Selbstmord … Und Harras ist in Berlin?«
»Landet gerade in Schönefeld und hat den Heli bestellt.«
Der Name Harras wirkte wie ein Weckton. Jäger drehte sich um und lief an Judith vorbei, als hätte er sie noch nie gesehen.
Sie öffnete die Tasche und stellte die Arbeitsutensilien bereit. Irgendwo in diesem großen Haus musste es einen Putzraum geben. Die Fahrstuhltüren schlossen sich, die Etagenanzeige blinkte. Immer mehr Menschen kamen über den Lieferanteneingang ins Atrium, schielten beklommen zu der Kreidesilhouette mit dem dunkelroten Fleck und nahmen, wenn der Lift zu lange brauchte, lieber den Weg übers Treppenhaus. Eine junge Frau mit verweinten Augen eilte auf den Empfangstresen zu, stellte ihre Handtasche ab und zog ein Papiertaschentuch aus ihrer Kostümjacke.
»Entschuldigen Sie«, sagte Judith. »Wo gibt es hier Wasser?«
»Wasser?«
Die Angesprochene erkannte Judiths Overall mit der Aufschrift »Dombrowski«. Dann warf auch sie einen scheuen Blick auf die Stelle, wo die Leiche ihres Kollegen gelegen hatte. »Ja, natürlich. Kommen Sie bitte.«
Ihr Make-up löste sich gerade rund um die Augen auf. Sie öffnete eine Tür, die so geschickt in die graue Wandverkleidung eingelassen war, dass Judith sie niemals selbst gefunden hätte. Augenblicklich flammte eine Neonröhre auf und beleuchtete einen schmalen Flur.
»Die zweite Tür rechts. Neben den Toiletten. Wie lange werden Sie ungefähr brauchen? Normalerweise öffnen wir um halb acht. Das schaffen Sie wohl nicht mehr, oder?«
Judith warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Sieben Uhr zweiundzwanzig. »Könnte knapp werden. Ich beeile mich.«
Die junge Frau tupfte sich die Tränen ab und warf einen sorgenvollen Blick auf das Papiertaschentuch in ihrer Hand. »Kann ich Sie allein lassen? Ich muss noch mal vor den Spiegel.«
»Natürlich.«
Judith betrat einen kleinen, gefliesten Raum mit einem tiefen Waschbecken. Im Wandschrank entdeckte sie Schrubber, Besen und Eimer. Während das Wasser in den Eimer lief, griff sie nach dem Schrubber und klemmte sich mehrere Putztücher unter den Arm, ließ eines fallen, bückte sich und stutzte.
Es war nur eine Kleinigkeit. Aber Judith war geschult, kein Detail zu übersehen. Wer einen professionellen Tatortreiniger rief, der wollte nach seiner Rückkehr nichts mehr vorfinden, was an Tod und Verbrechen erinnerte. Keine Gerüche. Keine Flecken. Kein Blut. Judith schuf der Erinnerung eine weiße Leinwand, auf der man von vorne beginnen konnte. Da störte ein halb verwischter, blutiger Abdruck an der Unterseite des Beckens nur, den jemand in der Eile vergessen oder nicht bemerkt hatte. Und dieser Jemand war vor ihr da gewesen.
Sie setzte den Eimer ab, stellte den Schrubber an die Wand, legte die Tücher auf den Waschbeckenrand, ging in die Knie und betrachtete den Abdruck so genau, wie es das trübe Licht zuließ. Jemand musste sich mit blutgetränkten Handschuhen für einen Moment am Waschbecken abgestützt haben. Dann hatte er sie ausgezogen, sich lange und sorgfältig gewaschen und das Becken gereinigt. Nur die Spuren unter dem Rand hatte er vergessen. Sie waren auf der weißen Keramik getrocknet, hatten aber noch nicht die typische dunkelbraune Färbung angenommen, die entstand, wenn Monosacccharide, Harnstoff, Proteine, Salze und niedrigmolekulare Stoffe längere Zeit der Luft ausgesetzt waren.
Es war Blut. Frisches Blut.
Judith nahm den Eimer und kehrte zurück in die Empfangshalle. Vor den Kreidestrichen blieb sie stehen. Die Silhouette des Körpers erinnerte sie an die Ascheskulpturen von Pompeji. Im Tod hatte das Opfer noch versucht, sein Gesicht zu schützen. Ein Arm angewinkelt, der andere weit ausgestreckt. Die Spurensicherung hatte sorgfältig gearbeitet, die Kollegen von der Rechtsmedizin auch. Die Blutlache war in der Mitte kaum noch feucht.
Spuren waren eine heikle Sache. Sie mussten gemeldet werden, auch wenn sie in den seltenen Fällen, von denen sich die Cleaner untereinander erzählten, ermittlungstechnisch keine Rolle gespielt hatten. Judith stellte den Eimer ab. Theoretisch könnte sie jetzt anfangen. In einer Viertelstunde wäre sie fertig, und nichts mehr in dieser kühlen, strengen Halle würde daran erinnern, dass hier ein Toter gelegen hatte. Der Reinigungstrupp der Bank würde mit seinen Kehr- und Wischmaschinen noch einmal über den Boden fahren, die Drehtür nach draußen würde den Betrieb wieder aufnehmen, die Besucher könnten kommen, ebenso die Gleitzeitmitarbeiter, die Zeitungs- und Postboten. Sie alle würden durch die Halle zu den Fahrstühlen strömen, hinauf in die Büros fahren und den Arbeitstag beginnen. Freeze? Der Tod war ein lausiges Stoppschild.
Sie hörte ein leises, unterdrücktes Schluchzen. Es kam von der jungen Frau am Empfangstresen, die gerade versuchte, ihr Namensschild am Revers zu befestigen, ohne sich dabei in die Finger zu stechen. Judith ging auf sie zu.
»Wer hat den Toten gefunden?«
Die junge Frau schluckte und wischte sich wieder über die Augen. »Der Kollege vom Wachdienst auf der Runde heute Morgen.«
»Wann war das?«
»Ich glaube so gegen sechs.«
Auf ihrem Schild stand Corinna Wrede, Front Officer CHL.
»Ist noch jemand von der Polizei im Haus?«
»Ja. Warum?«
»Ich muss etwas melden.«
Frau Wrede mochte Anfang zwanzig sein. Ihr gesamtes Auftreten war makellos. Nur die verschmierte Wimperntusche verlieh ihrem puppenhaften Gesicht etwas Pandahaftes. Oder es lag daran, dass sich ihre Augen vor Überraschung weiteten.
»Was denn?«
»Das möchte ich mit den Beamten besprechen.«
»Einen Moment bitte.«
Während sie telefonierte, rechnete Judith nach, wie lange das Blut auf dem Granitboden schon trocknete. Sie kam auf nicht mehr als sechs oder sieben Stunden. Der Tod musste um Mitternacht eingetreten sein. Wahrscheinlich hatte der Wachmann die Leiche bewegt und sich anschließend die Hände gewaschen. Es gab für alles eine Erklärung. Sie ärgerte sich über sich selbst und hätte den Anruf am liebsten rückgängig gemacht.
Es dauerte nicht lange, und die rechte Fahrstuhltür öffnete sich. Einer der beiden Männer vom KDD, die sie von der Friedrichstraße aus durch die Glasscheibe gesehen hatte, nickte der jungen Frontoffizierin zu und steuerte dann auf Judith zu. Er war vielleicht Anfang vierzig, hatte das blasse Herbstgesicht eines Angestellten, der nicht oft an die frische Luft kam, und müde, rot geränderte Augen. Der Kriminaldauerdienst arbeitete meist dann, wenn alle anderen schliefen. Man sah dem Beamten an, dass er für die Schichtarbeit nicht geboren war.
Er streckte ihr die Hand entgegen. Judith zog den rechten gelben Handschuh aus und wischte sich die Finger verlegen am Overall ab, bevor sie seinen Gruß erwiderte.
»Jobst Wagner, Kriminaldauerdienst«, stellte er sich vor. »Sie wollten uns sprechen?«
»Kepler von der Firma Dombrowski. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen.« Wagner folgte ihr in den Flur. Als sie die Tür zum Waschraum öffnete und ihm aufhielt, hob er verwundert die Augenbrauen, trat dann aber ein. Frau Wrede lugte um die Ecke und sah ihnen nach.
»Jemand war vor mir hier«, sagte Judith. »Und er ist kein Profi. Zumindest nicht, was das Reinigen von Tatorten angeht.«
»Sie sind Cleaner?«
»Ja.«
Wagner kannte ihren Beruf, denn er stellte keine weiteren Fragen. Sie deutete auf die Blutspuren unter dem Waschbeckenrand. Er ging in die Knie und betrachtete die verwischten Abdrücke.
»Waren Sie das?«
»Nein. Ich bin eben erst gekommen.«
»Aber Sie tragen doch auch Handschuhe. Zeigen Sie mal her.«
Wie ein Schulkind streckte Judith die linke Hand aus und hielt ihm auch noch den rechten Schutzhandschuh zur Begutachtung entgegen. Wagner kontrollierte beides und entschuldigte sich dann.
»Sie glauben ja nicht, was wir alles erleben.« Er griff zu seinem Handy. »Kommando zurück. Ich hab noch eine Kleinigkeit für euch. Im Waschraum hinter den Personaltoiletten, Erdgeschoss.« Er nickte Judith zu. »Danke. Wir kümmern uns darum.«
»Darf ich trotzdem draußen schon anfangen?«
»Nein.«
Judith hatte es nicht anders erwartet. Sie kannte auch seinen Beruf.
3
Wenig später kam die Spurensicherung zurück. Frau Wrede mit den Panda-Augen verfiel in hektische Betriebsamkeit und telefonierte sich die Finger wund. Draußen standen nur noch einige ratlose Angestellte, die an der verschlossenen Tür rüttelten, die Augen abschirmten und durch die Scheiben versuchten, einen Grund für ihre Aussperrung auszumachen, bis sie irgendwann ebenfalls den Weg über den Hintereingang nahmen. Judith rief in der Firma an, hatte aber nur Dombrowskis Anrufbeantworter am Apparat. Zu geizig für eine Sekretärin.
Sie verzichtete darauf, ihren Chef über das Handy zu erreichen, und ließ sich in einen der nagelneuen schwarzen Ledersessel neben einem Ficus Benjamini sinken, der so groß und prächtig war, dass Judith ihn für falsch hielt. Die Zeit verging. Wieder herrschte geisterhafte Ruhe in der Empfangshalle. Nur die leisen Telefonate der jungen Frau hinter dem Tresen drangen an Judiths Ohr, aber sie konnte und wollte nichts verstehen. Ab und zu huschte jemand über die Gänge der Galerien. Die Fahrstühle waren ständig in Bewegung, doch sie fuhren nur zwischen den Stockwerken hin und her und nicht bis hinunter ins Erdgeschoss. Sie fragte sich, ob Wagner vom KDD sie vergessen hatte und wann sie endlich loslegen durfte.
Vor der Bank baute sich ein Kamerateam vom RBB auf, die Schaulustigen hatten sich zerstreut. Nur ein Mann stand noch auf der anderen Straßenseite und sah herüber. Die Gründlichkeit und Ruhe, mit der er das tat, standen in großem Gegensatz zu der Geschäftigkeit des beginnenden Arbeitstages um ihn herum. Mehrfach wichen ihm Passanten aus, weil er ihnen nicht aus dem Weg ging. Er trug weder Schal noch Handschuhe, was bei diesem Wetter dafür sprach, dass er entweder bis aufs Mark abgehärtet war oder längst eine fiebrige Erkältung mit sich herumschleppte. Judith tippte auf Letzteres, denn er wirkte trotz seiner kräftigen Statur angeschlagen. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke über die Straße hinweg. Dann fuhr ein Bus vorbei. Als Judith wieder freie Sicht hatte, war der Mann verschwunden.
Auf dem Glastisch lagen einige Prospekte. Investment Fund Services. Global Securities Financing. CHL Liechtenstein. Auf dem Umschlag das Foto einer trutzigen Burg mit einem mächtigen viereckigen Wehrturm. Judith griff nach dem Heft, das noch nach Druckerschwärze roch und das wohl bisher niemand in der Hand gehabt hatte. Schneebedeckte Berggipfel vor strahlend blauem Himmel, vermutlich die Schweizer Alpen. Sie müsste mal in einem der alten Atlanten nachsehen, wo dieses winzige Land lag, das aus nicht viel mehr als dieser Burg und ziemlich vielen Banken bestand. Sie mochte die Burg, die auf einem sanft begrünten Bergrücken thronte und wuchtig und uneinnehmbar aussah.
»Frau Kepler?«
Judith fuhr zusammen. Jäger, der Mann für die Öffentlichkeit, hatte sich so leise angeschlichen, dass sie ihn nicht bemerkt hatte. Er setzte sich auf die Couch ihr gegenüber, sie legte den Prospekt zurück.
»Interessieren Sie sich für unser Portfolio?«
Judith war noch nicht einmal die Bedeutung dieses Begriffes geläufig. Seine Frage war nicht ernst gemeint. Keiner unterstellte einer Putzfrau, dass sie sich für internationale Bankengeschäfte interessierte.
»Peanuts«, sagte sie. »Ich hab mein Geld auf den Caymans.«
»Hoffentlich keine Hedgefonds.« Er grinste schon wieder. Trauer war bei ihm wohl streng rationalisiert. »Die Zeit der ungehemmten Spekulationen ist vorbei. Denken Sie an mich, und suchen Sie sich was Sicheres.«
»Werde ich mir merken. Das war hoffentlich kein Insidertipp.«
»Würden Sie mich denn dafür ans Messer liefern?«
Eine seltsame Frage in einem Raum, in dem erst vor wenigen Stunden jemand in den Tod gestürzt war. Jäger merkte es und wurde ernst. Er konnte seine Stimmungen austauschen wie Karten in einem schlecht gemischten Spiel.
»Was haben Sie entdeckt?«
Judith sah sich um, aber vom KDD war weit und breit keiner zu sehen. Allmählich lief ihr die Zeit davon. Auf ihrer Dispo hatte sie den Einsatz mit zwei Stunden eingeplant, inklusive An- und Abfahrt. Nun schlich der Zeiger ihrer Armbanduhr langsam in Richtung neun. Kai und Liz waren schon mal zur Fassadenreinigung Richtung Warschauer Straße vorausgefahren. Judith hatte ihren Kollegen versprochen, so schnell wie möglich nachzukommen, und Kai freute sich vermutlich über die unerwartete Zeit der Muße. Hoffentlich hatte er genug Geld dabei, um mit Liz irgendwo einen Kaffee zu trinken, damit die beiden nicht draußen auf ihre Kolonnenleiterin warten mussten.
»Reden Sie mit der Kripo«, wich sie Jägers Frage aus.
»Würde ich ja gerne, aber die sagen nichts. Warum ist das Haus immer noch nicht freigegeben? Warum soll hier die Mordkommission ermitteln? Sie tauchen hier auf und entdecken etwas, das bisher niemandem aufgefallen ist. Wissen Sie eigentlich, was Sie damit in Gang gesetzt haben?«
Judith schwieg.
»Wir sind Ihr Boss.«
Irrtum. Das war Dombrowski. Aber immer wenn man den Kerl mal brauchte, war er nicht da.
»Sie haben Ihrem Auftraggeber gegenüber eine gewisse Pflicht zur Aufrichtigkeit. Als internationaler Kapitaldienstleister wüssten wir gerne vor der Kriminalpolizei, was sich in unseren Räumen tut. Alles andere ist illoyal.«
Er fixierte sie mit einem Blick, der auf Putzfrauen wohl einschüchternd wirken sollte. Aber er schien nicht viel Erfahrung mit Menschen zu haben, die diesen Beruf ausübten. Schüchternheit war etwas, das man sich ziemlich schnell zugunsten der Selbstachtung abgewöhnte. Jäger spürte, dass er einen Tick zu weit gegangen war.
»Frau Kepler, gleich kommt mein Chef aus Liechtenstein und will wissen, was hier passiert ist. Ich muss ihm etwas sagen können.«
»Sie haben den Toten gekannt. Ich nicht.«
»Das ist richtig. Wenn es kein Selbstmord war, muss es ein Unfall gewesen sein. Haben Sie Hinweise gefunden, die einen solchen Verdacht erhärten?«
Judith stand auf. In dieser Welt aus unsichtbarem Geld standen die Räder still, und es war nicht ihre Schuld. Aber sie saß hier genauso fest wie Jäger. Am liebsten hätte sie die Bank auf der Stelle verlassen. Wenigstens hatte sie den Transporter im Blick. Noch war er nicht abgeschleppt.
»Ich muss wissen, was passiert ist.« Jäger erhob sich ebenfalls und kam um den Couchtisch herum auf sie zu. Er blieb neben ihr stehen und sah hinaus in den kalten Morgen, blass und grau wie der verwaschene Beton der Bahnhofsbrücke.
»Der Tote war mehr als ein Kollege. Er war mein Freund. François Merteuille. Er hat eine Frau, Inés, und ein zehnjähriges Mädchen, Annabelle. Heute Abend werde ich meiner Tochter sagen müssen, dass ihre beste Freundin keinen Vater mehr hat. Sie wird Fragen stellen. Alle werden das tun. Geben Sie mir eine Antwort.«
War es Trauer, die sie in seiner Stimme zu hören glaubte? Vielleicht hatte er aber auch einfach nur die richtige Karte gezogen. Judith steckte die Hände in die Overalltaschen. Ihre Rechte berührte den Autoschlüssel. Vorsichtig warf sie einen Blick über die Schulter zu den Aufzügen. Bis auf die Frontoffizierin waren sie allein, und die hatte genug mit ihren verschmierten Augen zu tun.
»Etwas an diesem Selbstmord stimmt nicht.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil jemand zwischen dem Eintreten des Todes und dem offiziellen Auffinden der Leiche bei ihm war. Er oder sie hat alle Spuren beseitigt. Bis auf eine.«
»Welche?«
Judith hob die Schultern. Dombrowski würde ihr den Kopf abreißen, wenn er erfuhr, dass sie Täterwissen preisgab. Auch das lernte man als death scene cleaner: Abstand halten. Zur Tat, zu den Hinterbliebenen, erst recht aber zu denjenigen, die neugierige Fragen stellten. Jäger fuhr sich über die raspelkurzen Haare. Wieder roch sie sein Rasierwasser. Holzig, frisch. Etwas, das an Wald, Jagd und Wiesen erinnern sollte oder vielleicht auch nur daran, dass es solche Dinge außerhalb dieser Glasfassaden noch gab.
»Frau Kepler, haben Sie etwas gefunden und der Polizei übergeben, das dieses Haus vielleicht verlassen sollte? Wenn ja, dann sagen Sie es mir jetzt. Es könnte sehr, sehr wichtig sein.«
»Nein.«
»Hardware vielleicht? Unterlagen? Eine CD? Einen Stick?«
»Nein.«
»Akten? Ausdrucke? Kontoinformationen?«
»Nein. Hören Sie …«
»Notizen, etwas Handschriftliches?«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt …«
»Was dann? Was zum Teufel haben Sie entdeckt?«
»Blut«, antwortete Judith. »Einfach nur Blut.«
Jäger trat einen Schritt zurück und wies mit dem Kopf auf den schwarzroten Fleck, der noch immer den reinen, spiegelnden Fußboden verunzierte.
»Ja. Nicht zu übersehen. Aber deshalb wurde doch nicht unser ganzer Betrieb lahmgelegt. Ich brauche eine Antwort. Und zwar jetzt.«
Judith presste die Lippen aufeinander. Es gefiel ihr nicht, wie Jäger sie in die Enge trieb. Wie er sie ansah dabei. Fast so, als ob er sich wirklich dafür interessieren würde, was sie dachte. Dabei ging es ihm doch nur darum, einen Informationsvorsprung zu haben.
»Die Waschräume sind abgesperrt«, fuhr er fort und tat, als ob er mit sich selbst reden würde. »Vermutlich ist es dort. Was ist da? Abfalleimer. Seife. Toiletten. Vielleicht …«
Erneut hob er sein Handy ans Ohr, ließ es aber unverrichteter Dinge wieder sinken und richtete seinen Blick auf etwas, das sich hinter ihrem Rücken abspielte. Sie drehte sich um.
Durch die Halle bewegte sich eine Prozession auf Judith und Jäger zu. Voran schritt – gemessen, aber zielstrebig wie ein römischer Kaiser – ein breitschultriger Mann mit silbergrauen Haaren. Sein kantiger Kopf ging beinahe halslos in die Schulterpartie über. Er hätte trotz seiner Größe gedrungen gewirkt, wäre die Eleganz seiner Kleidung nicht exakt darauf abgestimmt, diesen Makel auszugleichen. Der knielange, offene Kaschmirtrenchcoat streckte seine Gestalt und wehte hinter ihm her wie ein Krönungsmantel. Selbst Judith konnte erkennen, dass der Anzug darunter offenbar Maßarbeit war. Seine Schuhe glänzten wie Jägers Aktenmappe, und höchstwahrscheinlich war er nicht derjenige, der sie allabendlich polierte.
Hinter ihm, mit drei Schritten Abstand, folgten die Patrizier. Sie trugen die Uniform der Leistungselite: dunkle Anzüge, teure Uhren, dezente Seidenkrawatten. Eine Frau war auch darunter. Hochgewachsen, blond, vielleicht Ende zwanzig, mit eisigem Hochmut in den klaren, fast nordischen Zügen – jener Maske, die man trug, wenn man von allen um einen herum unterschätzt wurde. Sie hatte eine Aktenmappe dabei, die nicht ihre eigene sein konnte, denn alles an ihr strahlte kühle Zurückhaltung aus. Die Mappe hingegen protzte mit dem Logo eines Taschenherstellers, dessen Linie im Jargon auch gerne »Nuttenerstausstattung« genannt wurde. Sie musste jemand anderem gehören. Als die Meute stehen blieb und sich hinter dem Anführer hierarchisch aufreihte, stand sie neben einem Italo-Manager mit gerötetem Gesicht, der am Wochenende wohl zu lange in der Sonne gelegen hatte.
Im Vergleich zu ihnen wirkte Jäger wie ein Sitzenbleiber auf der Karriereleiter. Hastig steckte er das Handy weg und änderte seine Haltung. Strammstehen. Der hohe Senat des Bankhauses hatte ihn zum Ansprechpartner auserkoren.
Justinian, dachte Judith. In einer staubigen, unbeachteten Bücherkiste, wie sie immer wieder bei Entrümpelungen anfielen, derer sich Judith annahm, wie andere ausgesetzte Tiere mit nach Hause schleppten, hatte sie Felix Dahns Ein Kampf um Rom gefunden. Tejas Tod. Gebt Raum, ihr Völker, unsrem Schritt. | Wir sind die letzten Goten. | Wir tragen keine Krone mit, | Wir tragen einen Toten …
»Harras.« Cäsar ließ den Blick von Jäger zu Judith wandern. Sie kam ein paar Schritte näher. »Adolf Harras.«
Er musste um die siebzig sein, die letzte deutschsprachige Generation, deren Väter ihren Söhnen diesen Vornamen zugemutet hatten. Es gelang ihm scheinbar mühelos, jünger zu wirken. Seine Züge waren straff und leicht gebräunt, der Händedruck war kräftig. Judith gefiel es, dass er sie in die Begrüßung einbezog.
»Ich bin über die tragischen Ereignisse informiert, aber offenbar nicht auf dem letzten Stand. Bitte ändern Sie das.«
Jäger konnte seine Nervosität nur schlecht verbergen. Vor ihm standen die Alphamännchen seines Stammes, und er wollte sich ihrer Aufmerksamkeit würdig erweisen. »Es gibt noch einige offene Fragen zu den genauen Todesumständen von François Merteuille«, sagte er. »Wir gehen von einem tragischen Unfall aus.«
»Bis zum Beweis des Gegenteils?« Harras’ Stimme, bei Judiths Begrüßung noch sanft und freundlich, verschärfte sich. »Das ist zu spät. Ich erwarte, dass die Geschäftsleitung umfassend informiert wird.«
»Es soll Hinweise auf Fremdverschulden geben. Das ist aber noch nicht bestätigt.«
Jäger warf einen schnellen Blick zu Judith, die so tat, als hätte sie nichts bemerkt. Es gab nur einen Menschen, vor dem sie eine Rechtfertigungspflicht hatte, doch der ging nicht ans Telefon und würde ihr die Wartezeit hier als unbezahlten Urlaub abziehen.
Harras hob die buschigen, dunklen Augenbrauen, das einzig Ungezähmte in seinem glatten Gesicht. Ihm war der stumme Hilferuf seines Mitarbeiters an Judith nicht entgangen.
»Sie sind von einer Fremdfirma?«
»Judith Kepler, Dombrowski Facility Management«, antwortete sie. »Ich soll hier den Tatort saubermachen.«
Harras sah sich um. »Den Tatort?«
»So bezeichnet man jeden Raum, in dem etwas von einem Toten übrig bleibt, das normale Leute nicht entfernen wollen.«
»Normale Leute«, wiederholte Harras. Er hatte schnell begriffen, was Judith von anderen unterschied. »Ein Glück, dass die Welt nicht nur aus ihnen besteht.«
Die Patrizier versuchten, den Gedankengang ihres Chefs nachzuvollziehen, und scheiterten. Die Miene der blonden Aktentaschenträgerin verzog sich keinen Millimeter.
»Ein Glück«, sagte Judith.
Harras’ Blick wanderte über ihre Gestalt. Im Gegensatz zu vielen anderen weder amüsiert noch abschätzend und schon gar nicht ungehalten darüber, dass eine Putzfrau am Gespräch der Herren beteiligt war. Eher so wie Dombrowski, wenn er sie alle paar Wochen ins Büro winkte, ihr eine zerfledderte Bewerbungsmappe auf den Tisch warf und fragte, was sie von Menschen hielt, die noch nicht einmal ein Anschreiben ohne Fettfleck hinbekamen. Dann zog sie die Mappe zu sich heran und studierte sie. Las zwischen den Zeilen und Rechtschreibfehlern. Betrachtete das Foto einer alleinerziehenden Mutter ohne Schulabschluss und stellte fest, dass ihr Kind zur Welt gekommen war, als die Klassenkameraden gerade ihre Hauptschulzeugnisse erhielten. Las von jungen Männern, die trotz einer guten Gesellenprüfung keinen Job fanden, weil sie die Ausbildung im Pädagogischen Zentrum in Tegel gemacht hatten – dem Jugendknast. Bemerkte, dass der Umschlag mehrmals verwendet worden war und der Fettfleck nicht auf dem Anschreiben, sondern auf der beglaubigten Kopie des Führungszeugnisses prangte. Und Judith wusste, was Beglaubigungen kosteten.
»Sparsam, ordentlich und effizient«, hatte sie gesagt und Dombrowski die letzte Mappe, zu der er sie befragt hatte, zurückgeschoben. »Der Fettfleck ist übrigens von dir.«
Erschrocken hatte Dombrowski erst auf seine kräftigen Hände, dann auf die dick mit Leberwurst beschmierte Stulle vor sich gesehen. So war Liz zu ihnen gekommen, kaum zwanzig und dünn, als hätte sich das Leben wie ein Vampir über sie geworfen und alle Kraft aus ihr gesaugt. Es war ihr erster fester Job nach ihrem Auszug aus der Notunterkunft, wohin es sie nach einer zweimonatigen Flucht aus Algerien verschlagen hatte. Deutschland. Ausgerechnet dieses kalte, fremde Land, in dem der kurze Zauber des Willkommens längst verflogen war und die Herkunft Nordafrika keinen Schutz und auch kein Bleiberecht mehr bot. Wenn Judith jemals Zweifel gehabt hätte, dass geldwerte Arbeit einem Menschen Stolz und Selbstachtung gaben, dann hätte sie Liz innerhalb weniger Tage zerstreut.
Hoffentlich hatten Liz und Kai einen Platz zum Aufwärmen gefunden. Schließlich konnten sie nichts dafür, dass Judith gerade den kompletten Einsatzplan über den Haufen geworfen hatte, nur weil ihr eine verwischte Blutspur aufgefallen war. Lächerlich. Idiotisch.
Harras schien das nicht zu denken. Seine dunklen Augen hatten wieder ihr Gesicht erreicht. Er nickte ihr anerkennend zu und wollte gerade etwas sagen, als Jäger das kurze Aufflackern von Sympathie zwischen einem Bankdirektor und einer Putzfrau als seine Chance begriff.
»Frau Kepler ist dafür verantwortlich, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind«, sagte er hastig. »Ihr ist etwas aufgefallen, woraufhin sie umgehend die Polizei informiert hat. Was das war, wollte sie mir allerdings nicht sagen.«
»Es könnte Täterwissen sein.« Judith ärgerte sich, dass Jäger es immer noch versuchte. »Die Polizei wird Sie bestimmt bald informieren. Ich stehe hier genauso ratlos rum wie Sie.«
»Das lässt sich zumindest in unserem Fall ändern. Fürs Rumstehen bezahlen wir uns nicht.« Harras wartete einen Moment, ob jemand aus seinem Tross geneigt war, diesem Witz zu folgen. Aber Judith war die Einzige, die grinste. Ein schnelles, kaum wahrnehmbares Lächeln huschte als Abschiedsgruß über sein Gesicht, er wandte sich zum Gehen. »Herr Jäger, schicken Sie die ermittelnden Beamten umgehend zu mir. Danke, Frau …«
»Kepler.«
Die Patrizier machten ihm Platz, damit er durch ihre Reihen hindurchschreiten konnte. Mitten unter ihnen überlegte Harras es sich anders und kam noch einmal zu Judith zurück.
»Das war sehr aufmerksam von Ihnen. Ein Unfall, der vielleicht keiner war, hat nicht nur strafrechtliche Konsequenzen. Er bedeutet auch, dass wir alles, woran Merteuille gearbeitet hat, genau prüfen müssen. Herr Jäger, vorerst keine Stellungnahme für die Presse. Bereiten Sie aber für den Fall der Fälle etwas vor.«
Jäger zuckte nicht mit der Wimper.
Harras reichte erst ihm, dann Judith die Hand. »Ich weiß Ihre Verschwiegenheit zu schätzen. Kann ich mich auch in Zukunft darauf verlassen?«
»Ein Cleaner arbeitet, er redet nicht.«
»Gut. Wenn Sie noch etwas brauchen, wenden Sie sich bitte an Herrn Buehrli.«
Herr Buehrli identifizierte sich in der Reihe der Wartenden durch ein knappes Nicken. Er war der Typ, der aussah, als würde er in einem Spaghetti-Western als Erster vom Pferd geschossen werden. Widerspruchslos würde er jeden Wunsch seines Chefs erfüllen. Judith glaubte nicht, dass er sie an der nächsten Straßenecke wiedererkennen würde.
»Wie heißt Ihr Chef?«, fragte Harras.
»Klaus-Rüdiger Dombrowski.«
»Herr Buehrli wird dafür sorgen, dass Sie eine lobende Erwähnung erhalten.«
Buehrli flüsterte der Blonden etwas zu, die nach unten nickte, da sie ihn um mindestens eine Haupteslänge überragte. Sie trug Schuhe mit hohen Absätzen, was andere in ihrer Position bei einem klein gewachsenen Chef vielleicht vermieden hätten.
Harras wandte sich noch einmal an Judith. »Wie lange brauchen Sie, bis die Halle wieder begehbar ist?«
»Nach Tatortfreigabe keine Viertelstunde.«
»Sind Sie gut in Ihrem Job?«
»Die Beste.«
Erneut ließ er den Blick über ihr Gesicht wandern. Sie wusste nicht, was hinter seiner Stirn vorging, aber sie hielt der Prüfung stand.
»Auf Wiedersehen, Frau Kepler.«
Gefolgt von seiner Nachhut verließ er die Halle in Richtung Aufzug.
Jäger atmete auf. »Wie haben Sie das denn geschafft?«
»Was denn?«
»Harras mag Sie. Er hat sich sogar Ihren Namen gemerkt. Und meinen auch. Daran arbeite ich seit über sechs Jahren. Und Sie schaffen das in drei Minuten.« Jäger strahlte sie an. Er hatte die Karte mit dem Joker gezogen. »Wir sollten mal zusammen essen gehen.«
Den ganzen Weg zum Fahrstuhl kicherte er über diesen Scherz leise in sich hinein.
4
Spuren?«
Kai riss eine von den Bierbüchsen auf, die trotz aller Verbote nach Dienstschluss immer wieder in den Umkleideräumen von Dombrowskis Firma auftauchten. Er war gut einen Kopf größer als Judith, schlank, aber mit breiten, muskulösen Schultern. Der dreieckige Kinnbart sollte seinem runden Gesicht und den weichen, kindlichen Zügen wohl etwas mehr Männlichkeit verleihen, allerdings ähnelte es dadurch in Momenten großer Enttäuschung – und dies war offenbar einer – eher einem Schaf. Kai stand halb im Flur, halb in der Tür, immer auf der Hut, seinen Schatz vor Kontrollen zu verbergen. Wenn es sein musste sogar in den unendlichen Tiefen seiner Overalltaschen. Außerdem war die Frauengarderobe für ihn eine Tabuzone.
Er hatte gehofft, Liz abzupassen, doch die war schon ein paar Minuten vorher gegangen, nicht ohne Judith eine ihrer spontanen Umarmungen zu schenken, vor denen diese immer noch zurückschreckte. Solche Berührungen waren Judith fremd. Aber Liz verteilte sie im Vorübergehen wie ein Kind, das seiner Freundin ein für sie gestohlenes Bonbon zusteckt. Vielleicht weil dieses Mädchen mit seinen kaum zwanzig Jahren schon so viel erlebt hatte und es in Judith eine Seelenverwandte spürte? Liz, die immer noch den Blick senkte, wenn Dombrowski sie ansprach (was diesen zwischendurch an den Rand der Verzweiflung gebracht hatte, was er aber mittlerweile akzeptierte), die selbst nach einem Tag in der Fassadengondel noch nach Kakao und Vanille duftete, der keine Arbeit zu schwer war und die trotz ihrer Zartheit einen unbezähmbaren Willen hatte, diesen Job zu meistern. Und für die Judith immer noch eine unausgesprochene Verantwortung trug, weil sie bei Dombrowski zur Fürsprecherin der jungen Algerierin geworden war. Nur diese Anfasserei, dieses sorglose, nichtssagende Berühren, das eigentlich nichts anderes bedeutete als »Bitte«, »Danke«, »Mach’s gut«, »Komm gesund nach Hause« oder »Iss das. Ist gut für dich«, war Judith suspekt. Genauso wie die Mahlzeiten, die Liz ihr in kleinen Frischhalteboxen zusteckte.
»Was ist das?«
»Couscous mit Zaghlough. Sehr gut für dich. Du machst schwere Arbeit. Hast du keinen, der sich um dich kümmert?«
Wenn Judith in der Mittagspause den Deckel öffnete, stieg der Duft von Kardamom und Fenchel empor, von Safran und Zhatar, Sumach, Datteln und Zimt. Über Liz’ schmales, schönes Gesicht huschte dann ein beinahe mütterliches Lächeln, wenn sie ihr all diese Gewürze und Zutaten erklärte. Es war ein seltsames Gefühl, von diesem Mädchen quasi adoptiert worden zu sein. Judith war nicht sicher, ob sie das wollte. Kai hingegen schien geradezu darum zu betteln, aber Liz beachtete ihn nicht. Meist sah sie zu Boden, machte einen Bogen um ihn und vermied es, allein mit ihm zur Schicht zu fahren. Judith hielt sie für grenzenlos schüchtern.
Als Kai bemerkte, dass Judith die Letzte war, trank er einen tiefen Schluck aus seiner Bierdose und versuchte, weniger enttäuscht auszusehen, als er sich fühlte.
»Du hast in der Bank echt noch Spuren gefunden, die die Kripo übersehen hatte?«, fragte er.
Sie schloss den Spind und griff nach ihrer Tasche. »Ja, ein bisschen Blut am Waschbeckenrand im Putzraum. Das konnte wohl kaum vom Opfer selbst stammen, denn das war auf der Stelle tot und lag in der Eingangshalle.«
Kai nickte. Er hielt Judith die Büchse entgegen. Sie lehnte ab.
Und ich darf nun diesen verhinderten Romeo nach Hause schicken, dachte sie. Prompt zuckte sie innerlich zusammen.
Romeo.
Ein paar Splitter waren in Judiths Herz stecken geblieben. Sie schmerzten manchmal, wenn ihr unverhofft Schlüsselwörter aus der Vergangenheit in den Sinn kamen. Romeo war eines davon. Es gab Nächte, in denen sie kurz vor dem Einschlafen die Kontrolle über ihre Gedanken verlor. Dann stellte sie sich vor, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn ihre Eltern nicht auf der Flucht aus der DDR gestorben wären. Wenn sie nicht in ein Kinderheim auf Rügen gekommen wäre, wo sie als Fünfjährige ihre Herkunft und ihren Namen verloren hatte. Wenn sie vor Jahren nicht gezwungen gewesen wäre, in einem Einfamilienhaus in Biesdorf jene Frau in Notwehr zu töten, die ihr all das angetan hatte.
Sie atmete tief durch und wandte sich ab, wobei sie beide Hosentaschen nach ihrer Chipkarte abklopfte und so tat, als könne sie sie nicht finden.
»Und was macht man in so einem Fall?«, fragte der Quälgeist in ihrem Rücken.
»Man informiert die Polizei.«
»Kommt das oft vor?«
Gleich neun Uhr abends. Es war ein langer Tag gewesen, und sie wollte nach Hause. Der feine Regen, eher eine Art nasser Nebel, hatte ihnen schon den ganzen Tag zu schaffen gemacht. Judith sehnte sich nach einem heißen Bad mit einem Glas Wein auf dem Wannenrand und Lou Doillons Places auf dem Plattenteller. Etwas rüde drängte sie sich an Kai vorbei in den Flur und suchte in den Taschen ihres Anoraks nach ihrem Hausausweis. Während sie gemeinsam die Baracke verließen, erklärte sie ihrem Kollegen, wie Tatortreiniger sich zu verhalten hatten und welche Hierarchien einzuhalten waren.
Der Regen hatte sich zu dem verstärkt, was man gemeinhin ergiebig nannte. Auf dem riesigen Hof standen Dombrowskis Umzugswagen. Dahinter, durch löchrige Wellblechdächer mehr oder weniger geschützt, die Flotte der privaten Müllabfuhr, mit der sich der Chef mittlerweile eine goldene Nase verdiente. Judith sah, wie Josef, der Herr des Fuhrparks, hastig um einen der LKW herumlief und die Reifen prüfte. Die Nässe hatte sich wie dunkle Epauletten auf seine Schultern gelegt. Ein hagerer General, der ein letztes Mal die ihm anvertraute Artillerie überprüfte, bevor auch er in den Feierabend ging. Josef war vor langer Zeit ihr Vorarbeiter gewesen. Ob er mit ihr auch so oft ungeduldig gewesen war wie sie mit Kai?
»Normalerweise ist schon alles passiert, wenn du kommst.« Sie hob die Hand, um Josef zu grüßen. Der nickte ihnen zu und drehte an einer Ventilkappe. »Die Rechtsmedizin war da, Ärzte, Bestattungshelfer, manchmal auch Kripo und Spurensicherung. Da bleibt nicht mehr viel zum Detektivspielen.«
»Aber es kommt vor«, beharrte Kai. »Wie unterscheide ich denn, welche Spur schon entdeckt worden ist und welche nicht?«
»Das ist verdammt selten. Mir ist es in all den Jahren nur zwei- oder dreimal passiert. Frag Josef, der war früher auch Cleaner. Vielleicht hat der ja den richtigen Riecher.«
Kai trank den Rest seines Bieres aus und drückte die Büchse zusammen. Judith betrachtete das als Ende der Nachhilfestunde. Sie ging ins Haupthaus und wollte gerade ihren Arbeitsausweis durch den Schlitz des Automaten ziehen, der das alte Stechkartensystem ersetzt hatte, als sie Dombrowski sah. Er lehnte mit verschränkten Armen an der Wand und kaute auf seinem unvermeidlichen kalten Zigarillo herum.
Es kam nur selten vor, dass er sich hier unten zeigte. Früher, vor Judiths Zeit, war er angeblich sogar stichprobenartig bei Einsätzen aufgetaucht. Auf der Ladeklappe eines Umzugswagens, in einer der Fassadengondeln und manchmal sogar auf dem Recyclinghof. Keiner konnte sich sicher sein, von Klaus-Rüdiger Dombrowski nicht genau beobachtet und kontrolliert zu werden.
Das war lange her. Vielleicht hatte er bei der Vielzahl seiner Expansionen irgendwann den Überblick oder die Lust verloren. Vielleicht war er auch einfach nur bequemer geworden, runder, das krause Haar schlohweiß, das Herz trotz mehrerer Operationen die stete Mahnung kürzerzutreten, was jemand wie Dombrowski geflissentlich ignorierte. Er war immer noch der Letzte, der hier abends das Licht ausmachte. Und der Erste, der morgens den Schalter umlegte. Allerdings verbrachte er fast den ganzen Tag in seinem Sperrmüllbüro und ging immer öfter nicht ans Telefon. Manchmal glaubte Judith, dass ihm die alten Zeiten fehlten. Etwa dann, wenn sie mit dem Transporter den Hof verließ, noch einmal zurücksah und er am Fenster stand und den Blick nicht eher abwandte, bis sich das gewaltige Rolltor hinter ihr schloss.
»Ich habe einen Anruf bekommen«, sagte er. Judith nahm es zur Kenntnis. Sie zog die Karte durch den Schlitz und wartete darauf, dass auf dem Display ihre Personalnummer und die Arbeitsstunden auftauchten.
»Siie-Äitsch-Ell.«
Vierzehn Stunden, zwölf Minuten. Wenn das so weiterging, konnte sie für jeden abgearbeiteten Monat einen frei machen.
»Was war da los?«, fragte er.
»Die Kripo hat schlampig gearbeitet.«
»Und da hast du natürlich nichts Besseres zu tun, als sie mit der Nase draufzustoßen und den ganzen Betrieb aufzuhalten. War das der Grund, weshalb du so spät bei deiner Kolonne aufgetaucht bist? Dir ist ja wohl klar, dass ich dir die Zeit abziehe.«
Er schnaufte ärgerlich. Im Lauf der Jahre war er einem Walross immer ähnlicher geworden. Neugierige, runde Augen und ein wohlgenährter Wanst. Die grauen Haare hatte er straff zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, doch über der Stirn standen ein paar Strähnen drahtig ab. Er trug immer das gleiche karierte Hemd und darüber einen Blaumann. Als ob er noch selbst ausrücken würde.
Judith wollte sich an ihm vorbeischieben, doch er trat ihr in den Weg. Sie bemerkte sein verräterisches Blinzeln. Er nahm sie auf den Arm.
Ganz sicher konnte sie nie sein. Ihr Verhältnis war schwankend wie eine Trauerweide im Frühlingssturm. Mal ausschlagend in Richtung Big Daddy, der für alle seine Schäfchen ein offenes Ohr hatte, dann wieder ins andere Extrem: streng, schlecht gelaunt, unfair. Und wenn es hart auf hart kam? Dann stand er zu seinen Leuten wie ein Fels in der Brandung.
»Versuch’s«, konterte sie. »Vielleicht gründe ich doch noch einen Betriebsrat.«
»Le roi c’est moi.« Dombrowski bildete sich eine Menge darauf ein, in alten Studentenzeiten ein paarmal ordentlich mit Daniel Cohn-Bendit gezecht zu haben. »Also, schieß los, was du mit Harras angestellt hast.«
Judith brauchte einen Moment, um sich an den Namen zu erinnern. Ihr Boss machte Platz, und gemeinsam traten sie aus der Baracke hinaus in Richtung Einfahrt. Sie blieb unter dem Vordach stehen. Regen pladderte in die Pfützen.
»Harras?«, wiederholte sie.
Sie war neugierig, warum ihm der Name eines Chefbankers so leicht über die Lippen ging. Dombrowski tat ihr den Gefallen und fiel auf sie herein.
»Adolf Harras. Steht doch jeden zweiten Tag im Wirtschaftsteil. Einer von den Ackermännern und Winterkörnern. Ohne den geht derzeit nichts im innereuropäischen Zahlungsverkehr. Na ja, zumindest bei den Geschäften, von denen wir nichts mitkriegen sollen.«
Dombrowski warf einen Blick in den düsteren Himmel und seufzte. Judith hatte schon lange den Verdacht, dass ihr Chef mehr über die Schattenmänner der Berliner Republik wusste, als sein alter Blaumann vermuten ließ. Er war seit vierzig Jahren im Geschäft. Er kannte alle links der Mitte. Und einige rechts davon auch. Es hätte sie nicht gewundert, wenn seine gepflegte Feindschaft zum Establishment auch die persönliche Bekanntschaft mit dem Vorstand eines Liechtensteiner Bankhauses einbezog.
»Also. Was war da?«
»Nichts.«
»Warum ruft mich dann sein Assi an und lobt dich unverdientermaßen?«
»Weil ich es verdient habe?«
Dombrowski schnaubte, was so ziemlich alles bedeuten konnte. Von »Erzähl mir keine Märchen« bis »Da wisst ihr beide wohl mehr als ich«. Er geruhte, den Blick von den Regenschnüren abzuwenden, die wie silberne Fäden aus der Dachrinne fielen, und sie anzusehen. »Ich soll bis nächste Woche einen Kostenvoranschlag ausarbeiten. Reinigungsarbeiten im Hochsicherheitsbereich. Für ebendieses hohe Haus. Für über zweitausend Quadratmeter Fläche.«
»Wow.«
Judith fischte sich eine vorgedrehte Zigarette aus ihrem Tabakspäckchen und zündete sie an. Dombrowski schnupperte wie ein Hund, der Mortadella roch.
»Sie wollen dich. Du sollst die Kolonne leiten.«
»Mich? Für Hochsicherheit? Aus Knast und Banken halte ich mich raus.«
»Ich brauche bis morgen dein Führungszeugnis. Bist du vorbestraft?«
Judith hustete. Es klang nach: »Verjährt. Hoffentlich.«
Dombrowskis Gesicht verdüsterte sich. »Hör mal, Mädchen. Ich hab dich damals von der Straße geholt und weiß selbst, dass es da nicht immer zugeht wie bei Hofe. Was genau hast du auf dem Kerbholz? BTM? Beschaffungskriminalität? Sag es mir lieber jetzt, bevor ich mich bei den feinen Herren in die Nesseln setze.«
Judith unterdrückte den Impuls, sich die Arme zu kratzen. Manchmal juckten die Narben noch. Immer im unpassenden Moment.
»Es waren alles Jugendstrafen. Die müssten längst raus sein aus den Akten.«
»Welchen Akten?«
Akten. Wieder so ein Schlüsselwort aus ihrer Vergangenheit.