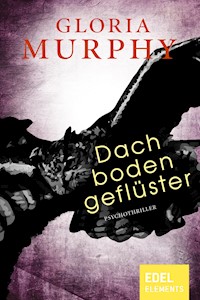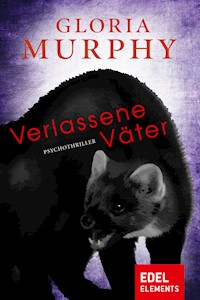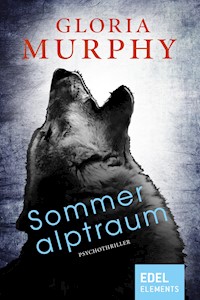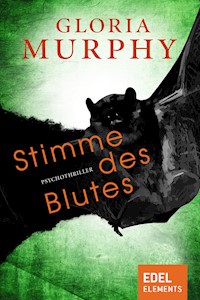
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spannend bis zur letzten Seite - raffinierter Nervenkitzel von einer Meisterin des Psychothrillers! In einem Vorort von Boston wird der dreijährige Kevin Matthews entführt. Die Eltern sind verzweifelt; von dem Entführer fehlt jede Spur. Als Monate später die Leiche eines Kindes gefunden wird, identifiziert Neil Matthews sie offiziell als die seines vermissten Sohnes. Nur Chris, seine Frau, kann sich mit dem Verlust ihres Kindes nicht abfinden und glaubt fest daran, daß Kevin noch lebt. Und eines Tages scheint die Vergangenheit aufzuerstehen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gloria Murphy
Stimme des Blutes
Psychothriller
Aus dem Amerikanischen von John S. Southard
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
PROLOG
»Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex’.«
Mutter und Kind saßen sich auf dem Rasen gegenüber und klatschten rhythmisch in die Hände. »Entschuldigen Sie«, sagte Chris.
»Morgens früh um sieben...«
»Verzeihung, aber...«
»... schabt sie gelbe Rüben.«
»Hören Sie, bitte!«
Die Mutter blickte auf und sah Chris blinzelnd an. Sie hielt ihre Hand vor die Augen, um sie gegen die Sonne abzuschirmen. Chris kniete sich neben sie ins Gras und spürte sofort die angenehme Kühle des Bodens an ihren nackten Beinen. Sie nahm ein Bild aus ihrer Handtasche und hielt es der Frau hin: blondes Haar, blaue Augen; auf dem zerknitterten Foto zog sich ein Knick durch das markante Lippenprofil eines Jungen.
»Das ist mein Sohn Kevin«, sagte sie. »Haben Sie ihn vielleicht gesehen?«
Das Kind stand auf und ließ sich in den Schoß seiner Mutter plumpsen. Sie zog es dicht an sich – fast zu dicht. Sie starrte auf Chris, dann auf das Bild und wieder auf Chris. Oje, dachte Chris, war sie vielleicht eine von den vielen, die sie schon gefragt hatte?
Endlich antwortete die Frau mit einem Kopfschütteln: »Nein, es tut mir leid. Wo haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Hier ... im Park.«
»Haben Sie die Polizei schon verständigt?«
»Ja, natürlich. Sie suchen ja auch schon.«
Chris begann auf einmal, mit dem Kopf zu nicken. Sie schnalzte mit der Zunge und rang um die richtigen Worte, die aber nicht kamen, weil es keine gab.
»Falls Sie ihn doch noch sehen... Ich heiße Chris. Chris Mathews. Ich bin jeden Tag hier.« Sie stand langsam auf und deutete auf ein rotes Sandsteinhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. »Ich wohne gleich da drüben.«
Die Frau folgte zuerst Chris’ Handbewegung, dann richtete sie ihren Blick wieder auf deren Gesicht.
»Selbstverständlich. Ich werde Ausschau halten. Seit wann vermissen Sie ihn denn?«
»Heute sind es genau neun Monate.«
Chris vernahm das Atemstocken und drehte sich gleich weg. Sie konnte die wortlose Anklage in dem Gesicht dieser Frau einfach nicht ertragen – die gleiche Anklage, die sie täglich in Neils Augen lesen konnte: So schwer kann es doch nicht sein, auf einen kleinen Jungen aufzupassen.
Wenn er nur einmal die Worte aussprechen würde, nur ein einziges Mal. Eine Anschuldigung wäre leichter zu ertragen als dieses Schweigen. Aber Neil wünschte sich nichts sehnlicher, als zu vergessen, daß Kevin je gelebt hatte. Und im Grunde wollten das alle – alle außer ihr.
Chris hatte schon stundenlang die Gegend nach Kevin abgesucht. Sie war müde, und die Hitze machte ihr zu schaffen. Am Vormittag, als sie das Haus verließ, zeigte das Thermometer schon über fünfunddreißig Grad an. Jetzt fühlte sich ihre Kleidung auf der Haut an, als sei sie festgeklebt. Sie setzte sich auf eine Bank, öffnete die obersten zwei Knöpfe ihrer Bluse und schaute zu den Kindern hinüber, die spielten, Sandwiches aßen und Limonade tranken. Ein kleiner Junge mit strohblondem Haar teilte gerade sein Eis mit einem Irish Setter, dessen traurige Augen überhaupt nicht zu dem buschigen Schwanz paßten, den er mit Freuden in der Luft wedelte.
Kevin liebte Tiere. Wenn er jetzt hier wäre, hätte er sich schon längst mit dem Hund angefreundet... Chris ließ ihren Blick auf die riesige Eiche am Rande des Spielplatzes hinüberschweifen und versank erneut in Erinnerungen...
»Schau mal, Mami! Schau doch her!«
Sie hatte ihr Buch gerade auf die Decke fallen lassen und sich gegen den Baumstamm gelehnt. Kevin kam auf sie zugerannt. Neben ihm trabte ein Hund, der fast doppelt so groß war wie er selbst.
»Mann, was für ein Riesenkerl! Wo hast du ihn nur aufgegabelt?« hatte sie gefragt, während sie den neuen Begleiter ihres Sohnes streichelte.
Kevin stellte sich vor sie hin. Der Hund legte sich daneben. »Am Sandkasten, und weißt du was?«
Sie lächelte. »Nee, weiß ich nicht. Sag’s mir doch.«
»Ich konnte ihn behalten.«
Chris beugte sich vor und streichelte den flauschigen Hals des Hundes. »Ja? Und wer sagt das?«
Kevin wandte sich dem Hund zu, preßte sein Gesicht an die feuchte Schnauze und umarmte ihn. »Er sagte es. Er ist nämlich mein Freund.«
»Aber er gehört doch jemand anderem, Kevin. Vielleicht sogar einem anderen kleinen Jungen. Was denkst du, wie er sich fühlt, wenn wir seinen Hund mit nach Hause nehmen?«
Kevin schluckte und schaute Chris kopfschüttelnd an. Nach langem Zögern antwortete er: »Vielleicht nicht so toll?«
Chris erinnerte sich nun an ihre Überlegung von damals: Wenn Kevin ein bißchen älter sein würde, dann könnten sie und Neil ihm einen Hund kaufen...
Plötzlich wurde aus der einzelnen, riesigen Eiche ein ganzer Wald voller Bäume, und es war ein ganz anderer Tag. Und Kevin war irgendwo in diesem Wald. Sie rannte wie eine Besessene zwischen den Bäumen hin und her, doch sie konnte ihn nirgends finden. Aber er mußte da sein, sie wußte es. Warum konnte sie ihn nicht finden?
Auf einmal sprang sie auf. Rasch wandte sie ihren Blick von der Eiche ab, Richtung Teich, und da sah sie ihn! Atemlos starrte sie auf den kleinen Jungen, der am Wasserrand kauerte und die Enten mit Popcorn fütterte. Zunächst blieb sie still stehen, bis er ihr das Gesicht zuwandte und sie ganz sicher war. Im nachhinein würde sie sich nicht mehr daran erinnern können, zum Teich gelaufen zu sein. Aber im Nu war sie dort, ganz nahe bei ihm, und streckte die Arme nach ihm aus.
»Kevin«, sagte sie so ruhig, daß sie ihre eigene Stimme kaum wiedererkannte.
Er schaute zu ihr auf, sagte aber nichts.
»Es ist doch Mami, Kevin.«
Seine blauen Augen wurden plötzlich ganz groß. Dann stand er auf und ließ langsam seine Popcorntüte fallen. »Jetzt ist alles wieder gut, Liebling. Mami ist da, um dich nach Hause zu bringen.«
Er trat einen Schritt zurück.
»Kevin, komm her!«
Jetzt machte er den Mund auf. Schrille, entsetzliche Schreie ließen Chris erstarren. Sie blieb wie angewurzelt stehen. In dem Augenblick erschien wie aus dem Nichts eine Frau, die Kevin hochriß und ihn fest in ihre Arme schloß.
»Lassen Sie ihn herunter!« rief Chris.
Im Nu bildete sich eine Menschenmenge – sie huschten aus dem Gebüsch und hinter den Bäumen hervor, so als seien sie schon immer dagewesen und auf der Lauer gelegen. Sie gingen auf Chris zu und bildeten um sie einen großen Kreis. Schließlich kam sie wieder auf die Beine und begann, sich auf den Jungen zuzubewegen. Es war, als würden Hunderte von Armen nach ihr greifen, sie festhalten, sie immer fester umklammern, je mehr sie versuchte, sich zu befreien.
Zwei Polizisten bahnten sich einen Weg durch die Menge. Chris versuchte, ihnen zuzurufen, den steigenden Lärm und die durcheinanderpurzelnden Worte zu übertönen.
»Schauen Sie sich das Bild an!« Sie streckte ihnen ihre Handtasche entgegen. Einer der Polizisten öffnete die Tasche, aber statt des Bildes holte er ihre Brieftasche hervor und begann, ihre Papiere und Kreditkarten durchzublättern. Von dem Foto, das dabei auf den Boden flatterte, nahm er überhaupt keine Notiz. Chris versuchte, sich wieder loszureißen, um das Bild aufzuheben, aber Hände und Arme griffen wieder nach ihr. Dieses Mal war sie es, die aus lauter Verzweiflung schrie.
Einige Zeit verging, doch so sehr sie sich bemühte, die Minuten zu zählen, konnte sie sich nicht erklären, wohin sie so schnell entschwanden.
Plötzlich wurde es still in der Menge. Die Leute zogen sich zurück. Dann kam durch eine Gasse, die sie gebildet hatten, Neil auf sie zugerannt. Er weinte – mein Gott, warum denn? Chris zeigte auf den kleinen Jungen. »Es ist Kevin. Ich habe ihn gefunden!«
Neil schaute flüchtig auf das Kind, drehte sich aber sofort wieder weg, als könnte er den Anblick seines eigenen Sohnes nicht ertragen.
»Verstehst du denn nicht? Es ist doch Kevin!«
Neil packte sie mit beiden Händen an den Schultern und fing an, sie kräftig zu schütteln.
»Chris, bitte! Hör auf. Er kommt nicht zurück!«
Sie holte aus und schlug mit beiden Fäusten gegen seine Brust. Sie krallte ihre Fingernägel in sein Gesicht, so daß es blutete.
»Du Schwein, du verlogenes Schwein!«
Er drückte sie zu Boden und setzte sich auf sie. Mit einer Hand hielt er ihre Handgelenke fest, mit der anderen kraulte er ihr durchs Haar.
»Chris!« Mit tränenerstickter Stimme redete er auf sie ein:
»Kevin ist tot... Kevin ist tot...«
Er wiederholte immer nur den einen Satz, bis schließlich der Krankenwagen kam.
Kapitel 1
Der fünfjährige Junge kniete neben dem Mann auf dem Holzboden und wiederholte dessen Worte: »Lieber Gott, mach aus Davie einen besseren Jungen. Laß dieses verrückte Zeug aus seinem Kopf verschwinden und begrab es irgendwo. Amen.« Danach hüpfte der Junge ins Bett und zog sich die Decke über. Der Mann stand auf und fuhr mit seinen Fingern, denen das Nägelkauen anzusehen war, durch seine störrischen, roten Haare.
»Gute Nacht, Davie.«
Stille.
»Gute Nacht, Davie«, wiederholte der Mann.
Mit beiden Fäusten hielt der Junge den Saum der rauhen Wolldecke fest. »Gute Nacht, Fletcher«, sagte er schließlich, obwohl er wußte, daß Davie nicht sein richtiger Name war.
Die Tür ging zu, und wie immer war der Junge froh, daß es dunkel war und daß er endlich allein war. Dies war die Zeit, in der er mit ihnen sprach. Er drehte sich auf den Bauch, schloß die Augen und wartete...
Endlich sah er sie, und er hörte, wie sie ihm zuriefen: »Hallo, wo bist du, Kevin?« fragte Mami. »Ich kann dich nicht sehen.«
»Hier bin ich, Mami, hier in Fletchers Haus«, antwortete er leise in sein Kopfkissen. »Kannst du mich jetzt sehen?«
Sie lächelte – dasselbe Lächeln, das immer all die unheimlichen Gedanken aus seinem Kopf verschwinden ließ.
»Ich vermisse dich, Kevin. Ich liebe dich.«
»Ich dich auch«, sagte er, dann holte er tief Luft und zeigte seine Zähne. »Guck mal. Heute habe ich mir dreimal die Zähne geputzt.«
»Du bist aber ein braver Junge, Kevin«, sagte sie. Er wußte, daß er nicht wirklich ein braver Junge war. Aber Mami fragte nie nach den schlimmen Dingen, die er tat, und so erzählte er ihr auch nichts davon.
»Kann ich jetzt nach Hause kommen, Mami, Daddy? Bitte?«
»Bald, Kevin«, antwortete Daddy. »Eines Tages, sehr bald, wirst du aus deinem Schlafzimmerfenster hinausschauen, und wir werden dasein, direkt vorm Haus.«
Er wollte aber jetzt nach Hause gehen! Ihm brannten die Tränen unter den geschlossenen Lidern, und er vergrub sein Gesicht im Kopfkissen, so daß Mami es nicht sehen konnte. »Vielleicht morgen, Daddy?«
»Ja, vielleicht morgen, Kevin.«
Und da war Mami wieder. »Möchtest du jetzt eine Geschichte hören, Kevin?«
Er nickte.
»Also dann ... Du darfst dir etwas aussuchen. Willst du etwas Lustiges, etwas Fröhliches, oder lieber etwas Abenteuerliches?«
»Etwas Lustiges«, sagte er.
»Gut. Aber als erstes mußt du dich entspannen, ganz locker sein. Alles ausschütteln, Beine, Arme, Finger, damit die großen Muskeln ganz locker sind.«
Leise kichernd wälzte sich der Junge im Bett herum.
Als er wieder ruhig lag, begann Mami zu erzählen: »Es war einmal ein Kauz, der Oskar hieß. Alles in allem war er ein ganz normaler Kauz, denn er tat alles, was seine Freunde auch taten – bis auf eine Sache. Und diese Sache war für einen Kauz absolut unerhört: Oskar kaute Kaugummi.«
Kevin lächelte – dies war keine Geschichte aus irgendeinem Buch, sondern eine von Mamis selbstgemachten Geschichten. Kurz bevor er einschlief, hörte er Mamis vertrautes Flüstern noch einmal an seinem Ohr: »Hab Geduld, Kevin. Bald bist du wieder zu Hause.«
Am nächsten Morgen rannte Kevin gleich zum Fenster, voller Hoffnung, daß heute der besagte Tag sei. Aber alles, was er auf dem Rasen vor Fletchers Haus sah, waren zwei leere Bierdosen. Er konnte nicht verstehen, warum es so lange dauerte, bis sie zu ihm kamen. Mami sagte immer, er müsse sich gedulden, und er gab sich wirklich Mühe, große Mühe sogar ... Und so würde er sich eben weiterhin gedulden müssen.
Bis zu seinem siebten Lebensjahr hatte David die beiden Menschen in seinem Kopf, doch dann verschwanden sie eines Tages jäh aus seinem Bewußtsein, als hätte man sie mit einem großen Radiergummi einfach wegradiert. Das merkwürdigste an der ganzen Sache war, nachdem er so lange an ihnen festgehalten und sie für das allerwichtigste in seinem Leben gehalten hatte, daß er selbst es war, der sie schließlich ausradiert hatte. Wenn aber diese Leute tatsächlich seine Eltern waren und sein richtiger Name auch Kevin, wie es seine innere Stimme behauptete, dann müßte er jetzt tot sein.
Es war zehn Jahre her, aber dennoch konnte er sich gut daran erinnern, wie Fletcher sich neben ihn setzte und ihm ein Foto aus dem BOSTON GLOBE SO vor seine Augen hielt, daß ihm nichts anderes übrig blieb, als es anzuschauen.
»Es wird langsam Zeit«, begann er, »daß ich dir das zeige«, und deutete auf das Foto. »Sind das die Leute?«
Der Junge starrte auf ihre Gesichter – zum ersten Mal erschienen sie nicht bloß in seinem Kopf, sondern auf Papier gedruckt. Er sah, daß ihre Blicke – die traurigsten Blicke, die er je gesehen hatte – auf einen Sarg gerichtet waren, der gerade in ein Grab gelassen wurde.
»Was steht da drunter?« fragte Fletcher und deutete auf den Bericht unter dem Bild. Obwohl David noch nie eine Schule besucht hatte, war es ihm gelungen, sich das Lesen selbst beizubringen. Bedächtig fügte er die kleingedruckten Buchstaben zu Wörtern zusammen und las sie laut vor. »Christine und Neil Mathews ... « Er zögerte und blickte erneut auf die Gesichter, die bisher für ihn namenlos gewesen waren.
»Weiter«, sagte Fletcher ungeduldig. »Lies doch weiter.«
»... bei der Beisetzung ihres Sohnes Kevin, der nach sechzehnmonatiger Suche tot aufgefunden wurde. Das dreijährige Kind war am 8. November 1971 aus dem Keeny Park in Brookline spurlos verschwunden...« Der Rest des Berichtes war abgerissen. David schaute zu Fletcher empor und fragte sich, wie er gewußt haben konnte, daß dies die Gesichter waren, die er stets in seinem Inneren verborgen hatte. Zwar hatte Fletcher immer behauptet, in Davids Kopf hineinschauen zu können, doch bisher hatte ihm der Junge einfach nicht geglaubt.
»Wenn das deine Alten sind und du Kevin heißt«, sagte Fletcher, »dann würde ich meinen, daß du tot bist. Schau doch... Dieser Junge hier ist schon seit drei Jahren tot.«
Einen Augenblick lang stand David wie erstarrt da, als müßte er Fletchers Worte erst einmal abwägen. Dann schlang er seine Arme um Fletchers Hals und drückte sein Gesicht an die breite, warme Brust. Seine Tränen hinterließen einen großen, nassen Fleck auf Fletchers T-Shirt, dennoch ließ er ihn eine Weile so ruhen.
Schließlich schob er den Jungen sanft von sich und sah mit seinen wäßrigen, blauen Augen den Jungen an.
»Also, wie ist’s nun, Davie? Wessen Junge bist du denn? Bist du mein Junge oder bist du dieser tote Junge von den Mathews?«
Er mußte nicht lange darüber nachdenken.
»Deiner, Fletcher.« Es war das allererste Mal, daß er so etwas ausgesprochen hatte, obwohl Fletcher den ersten Teil der Frage schon dutzendemal gestellt hatte. »Ich bin dein kleiner Junge.«
»Jetzt bist du ganz sicher, ja? Wenn nicht, und wenn du weiterhin dieses wirre Zeug redest, kann ich ein großes Loch graben und ...«
Fletcher strich dem Jungen übers Haar und grinste ihn an. »So ist’s brav. Sieht so aus, als könnten wir dir dieses verrückte Zeug ein für allemal aus dem Kopf schlagen. Jawohl, wir bringen dich schon wieder auf Trab ... Dann kannst du vielleicht auf eine richtige Schule gehen wie die anderen Kinder.«
Andere Kinder kannte David lediglich aus dem Fernsehen oder aus Fletchers Zeitschriften; manchmal konnte er sie von seinem Schlafzimmerfenster aus beobachten. Die Idee, zur Schule zu gehen und mit richtigen Kindern zusammenzusein, machte ihn glücklich, aber er versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen, denn er befürchtete, Fletcher könne es sich noch anders überlegen.
»Geh schnell und hol das Buch«, befahl Fletcher. Der Junge sprang vom Stuhl und rannte los, um das schwere Fotoalbum zu holen, dann eilte er zurück und legte es auf Fletchers Schoß.
»Ich klebe das Bild hier ins Album, Davie, damit du dich immer erinnerst, wer du wirklich bist. Wenn du mal wieder unsicher wirst, brauchst du bloß einen Blick auf den armen, toten Jungen zu werfen, den sie ins Grab gelegt haben. Verstehst du?«
Während Fletcher den Deckel des Albums aufschlug, sah David wieder das dunkelrote, herzförmige Muttermal an der Innenseite seines Handgelenks. Er schaute weg, als Fletcher durch das Album blätterte und anschließend das neue Foto einklebte. Als er das Zuschlagen des schweren Deckels hörte, nahm er das Buch und stellte es auf seinen vorgesehenen Platz im Wohnzimmerregal zurück.
Fletcher hielt sein Versprechen. Bald nach jenem Gespräch meldete er David für die zweite Klasse der WENTWORTH ELEMENTARY SCHOOL in Laconia, New Hampshire, an. David hielt ebenfalls sein Wort. Von dem Tag an, als Fletcher ihm den Zeitungsbericht gezeigt hatte, waren alle Gedanken, er könnte Kevin sein, verschwunden – genauso wie die Idee, nicht Fletchers Junge zu sein. Seitdem fanden auch jene zwei Gesichter keinen Zutritt zu seinem Inneren mehr – bis zum Tag seiner Schulabschlußfeier, dem Tag, an dem er das Album noch einmal öffnete, um sich das inzwischen vergilbte Bild anzusehen. Und es war auch der Tag, an dem er beschloß, nach Massachusetts zu ziehen. Irgendwo mußte er hingehen, nach dem, was er mit Fletcher getan hatte, und Massachusetts schien ein ebenso guter Platz wie jeder andere, um sich vor der Polizei zu verstecken.
Erst als er die Landesgrenze passiert hatte, begann er sich zu fragen, ob der Beschluß, nach Massachusetts zu flüchten, wirklich so zufällig gewesen war. Oder hatte er diesen Zufluchtsort gewählt, weil sie dort lebten – die Eltern des toten Kindes, das auf so mysteriöse Weise vor langer Zeit in sein Innerstes gekrochen war? Aber wie auch immer, für ihn spielte es momentan keine große Rolle... wenngleich er nichts dagegen hatte, sie einfach mal zu sehen.
Dieser Gedanke ließ ihm von da an keine Ruhe mehr. Einen anderen Plan hatte er sowieso nicht ... Wem könnte es denn schaden? Und vielleicht hätte es sogar einen Vorteil. Ein instinktives Gefühl in ihm sagte: wenn er seine inneren Phantome jemals besiegen wollte, müßte er ihnen in Fleisch und Blut begegnen.
Mehr als zwei Monate lang hatte er die Frau beobachtet und ihre flüchtigen Blicke von seinem Auto aus erhascht, wenn sie gerade kam oder ging. Einige Male hatte er auch ein Mädchen gesehen, wie es das Haus verließ, doch für sie interessierte er sich fast gar nicht. Er machte sich nichts vor; was er tat, war plumpes Spionieren, ein ganz klarer Fall. Nicht etwa, daß er sich ausschließlich in der Nähe ihres Hauses aufgehalten hätte. Das tat er nicht. Er wollte auf keinen Fall riskieren, daß die Polizei auf ihn aufmerksam wurde und anfing, Fragen zu stellen. Meistens fuhr er einfach in der Stadt spazieren; mal besorgte er sich etwas zu essen, mal ging er ins Kino. Nachts fuhr er auf ein verlassenes, unbebautes Grundstück oder gelegentlich ins CVJM-Heim, um zu übernachten. Doch irgendein unheimlicher Zwang zog ihn immer wieder dorthin zurück.
Eines Tages sah er, wie ein Schild – ›Zimmer zu vermieten – in ihr Fenster gehängt wurde, und er fragte sich, ob das nicht eine sonderbare, persönliche Einladung für ihn war. Und als sich dieser Gedanke erst einmal in seinem Bewußtsein festgesetzt hatte, wurde er ihn gar nicht mehr los. So war er eben: er konnte sich von bestimmten Dingen einfach nicht leicht trennen.
Bislang hatte er sie nur aus der Entfernung gesehen. Als sie aber auf sein Klingeln hin die Tür aufmachte, war ihm, als würde sich ein Schleier in seinem Bewußtsein lüften: er erinnerte sich an das Gesicht, als hätte es ihn nie verlassen, sogar an den kleinen Schönheitsfleck neben ihrem Mundwinkel. Er mußte seine ganze verfügbare Willenskraft aufbringen, um sich das Wiedererkennen nicht anmerken zu lassen.
Durch das Fliegengitter der Tür schaute sie ihn an, und für einen Augenblick dachte er, sie würde auch sein Gesicht wiedererkennen. Aber sie lächelte nur freundlich und fragte: »Was kann ich für Sie tun?«
»Das Schild«, sagte er etwas verdutzt. »Zimmer zu vermieten.«
Sie machte die Tür etwas weiter auf und ging einen Schritt zurück. »Kommen Sie bitte herein.« Er trat ein. »Ich bin Chris Mathews«, sagte sie und streckte ihm die Hand entgegen.
David wischte sich die verschwitzte Hand an seiner Jacke ab und nahm dann ihre. Zwar hatte er sich an diesem Morgen im Wohnheim wieder ein Zimmer genommen, damit er sich duschen und umziehen konnte, aber er fühlte sich dennoch nicht sauber genug.
»David Crane«, sagte er. Eigenartig, er hatte beinahe erwartet, daß sie sich erschrecken würde, wenn er seinen Namen nannte, doch es war natürlich ohne Bedeutung für sie.
Sie führte ihn durch einen breiten Flur in das Wohnzimmer. Weiße Gardinen schmückten eine ganze Wand. Auf dem Kaminsims standen zwei Bilder: das Foto eines Jungen und das eines Mädchens. Ein Flügel, spiegelblank poliert, nahm die Hälfte des großen Zimmers ein. Die Frau bat ihn, sich zu setzen.
»Spielen Sie Klavier?«
Er schüttelte den Kopf und ließ sich vorsichtig auf die braunen, mit Velour bezogenen Polster des Sofas sinken.
»Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber Sie sehen zu jung aus, um ganz allein auf sich gestellt zu sein«, sagte sie.
»Ich bin siebzehn. Im ersten Studienjahr. An der Boston University.«
»Also, dann erzählen Sie mir etwas über sich, David. Wo kommen Sie her?«
»Aus New Hampshire. Laconia.« Er hielt einen Moment inne und versuchte, sich zu beruhigen. Ihm war, als hätte sich das Zimmer plötzlich aufgelöst, und, obwohl er wußte, daß sie nur wenige Meter von ihm entfernt saß, wirkte sie, als säße sie am anderen Ende eines Tunnels. Von weit her sah sie ihn mit ihren sanften, braunen Augen an und wartete darauf, daß er weiterredete.
»Mein Vater ist gestorben. Dieses Jahr, im Frühling. Wir waren nur zu zweit.«
Sie beugte sich vor – sie schien auf einmal den Tunnel zu verlassen, und auch das Zimmer wurde wieder sichtbar – und nahm seine Hand.
»Es tut mir sehr leid«, sagte sie.
Er zog seine Hand zurück. »Er hatte eine Versicherung. Das Geld reicht für mein Studium.«
»Wäre es für Sie nicht besser, in einem Studentenwohnheim auf dem Campus zu wohnen, mit Menschen in Ihrem Alter?«
»Eigentlich nicht«, antwortete er. »Ich glaube, ich würde mich bei einer Familie wohler fühlen.«
»Wie haben Sie denn von dem freien Zimmer erfahren? Boston ist doch fast acht Kilometer von hier entfernt.«
Er zuckte die Achseln. »Bin herumgefahren und hab’ das Schild gesehen, und als ich das Haus sah ...«
»Ja, was dann?«
»Haben Sie schon einmal etwas im Traum gesehen, was Sie so deutlich erkennen konnten, daß es Ihnen wie die Wirklichkeit vorkam?«
»Na ja, ich denke, die meisten von uns haben schon mal eine solche Erfahrung gemacht«, erwiderte sie.
Er zögerte, nicht ganz sicher, ob er nun weiterreden sollte, doch er sah, daß sie offenbar darauf wartete.
»Also, mit diesem Haus war es irgendwie ähnlich«, erklärte er schließlich. »Fast so, als würde ich es schon kennen, als wäre es in einem Traum von mir vorgekommen.«
Chris holte tief Luft und atmete wieder aus. »Um ganz ehrlich zu sein, David, hatte ich eigentlich nicht vor, an einen jungen Mann zu vermieten. Ich wohne zur Zeit mit meiner Tochter allein, solange mein Mann noch im Krankenhaus ist. Er erlitt vor einigen Monaten einen Schlaganfall.« Für einen Augenblick unterbrach sie ihre Rede und legte ihre Hände in den Schoß. »Er kommt aber bald wieder nach Hause, und er wird Pflege brauchen. Deswegen dachte ich bei der Vermietung an eine Frau, vielleicht eine ältere Dame, die ein bißchen aushelfen könnte, wenn er wieder hier ist.«
»Aber ich könnte auch helfen«, sagte David lauter als beabsichtigt. Verlegen senkte er den Blick und schaute auf seine Turnschuhe. »Tut mir leid, ich wollte nur sagen, daß ich es von klein auf gewöhnt bin, im Haus zu helfen. Und ich könnte auch den Garten machen. Und bei Ihrem Mann könnte ich auch behilflich sein – ihn heben und so was.«
Er merkte die Anspannung in ihrem Gesicht und wußte, daß sie ihn genau musterte und sich womöglich fragte, warum ihm ausgerechnet an diesem Zimmer so viel gelegen war. Aber das Haus hatte er ins Herz geschlossen, dafür konnte er nichts. Er befürchtete, sie so weit abgeschreckt zu haben, daß ihr gar nicht mehr danach war, ihn in ihrer Nähe zu haben. Aber dann stand sie auf, und er merkte, wie sich ihre Mundwinkel zu einem breiten Lächeln entspannten.
»Okay, David, warum probieren wir es nicht einfach? Den Mietpreis wirst du wahrscheinlich verkraften können – zwanzig Dollar pro Woche und ein paar Stunden Arbeit im Haus.«
»Vielen Dank, Mrs. Mathews.«
»Sag ruhig Chris zu mir, David«, erwiderte sie. »Und jetzt zeige ich dir dein Zimmer.«
Er folgte ihr über eine Treppe in die zweite Etage zu einem Zimmer am Ende des Flurs. Sie faßte die Türklinke behutsam an und zögerte für einen langen Augenblick, bevor sie schließlich die Tür öffnete und David ins Zimmer führte. Als er es sah, wußte er sofort, daß es Kevin gehört hatte. Es war so groß wie zwei normale Kinderzimmer. Der Boden war mit blauem Teppichboden ausgelegt, die Wände bis etwa eineinhalb Meter Höhe mit weißlackiertem Holz getäfelt. An zwei Wänden waren Regalbretter angebracht, auf denen viele Kinderbücher und einige Puppenfiguren aus Disneyfilmen ordentlich in einer Reihe standen. Oberhalb der Regalbretter waren die Wände mit einer blaukarierten Tapete beklebt. Sie paßte farblich zu der Bettdecke und den Vorhängen vor den großen, geteilten Fenstern, die Aussicht zur Straße gewährten. Von der Decke baumelte über einem weißen Einbauschreibtisch eine feuerrote Laterne an einer dicken Messingkette. Das alles hätte direkt aus einer Zeitschrift wie »Schöner Wohnen« sein können – das war natürlich etwas ganz anderes als die Zeitschriften, die bei Fletcher herumlagen, aber David hatte beim Zeitungshändler auch schon solche durchgeblättert.
»... ein ganz besonderes Zimmer.«
Er drehte sich schnell um, als er plötzlich bemerkte, daß sie schon länger mit ihm geredet hatte.
»Ganz nett«, sagte er und wußte sofort, daß es sich dumm anhörte. Jeder hätte gleich erkannt, daß es mehr als nur ›nett‹ war. Es war mit Sicherheit das schönste Zimmer in ganz Massachusetts.
»Ich werde die Regale leerräumen, David.«
Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen wollte er, daß alles genauso blieb, wie es war. Würde sie ihn für verrückt halten, wenn er es sagte? »Muß das unbedingt sein?« fragte er. »Mir gefällt es, so wie es ist.«
Schweigen. Ein prüfender Blick, dann: »Nein, ich denke, das ... ist schon in Ordnung.« Sie öffnete eine Tür. »Der eingebaute Schrank ist hier«, sagte sie und deutete auf eine weitere Tür. »Du hast auch dein eigenes Bad.«
Er nickte und schaute zum Fenster hinaus. In dem Moment bog ein Streifenwagen in die Straße ein und fuhr langsam an dem Haus vorbei. David sah den Park auf der anderen Seite der Straße. »Ein schöner Blick.«
»Das ist der Keeny Park«, antwortete sie. »Er ist wirklich wunderschön, besonders im Herbst ... Wann willst du einziehen, David?«
Er spürte einen Kloß im Hals. »Ich dachte ... sofort.«
Sie lächelte sanft und unbeschwert, und er merkte, wie sich seine Spannung löste. »Du bist wohl einer von der schnellen Truppe, was?«
»Wenn ich mich einmal zu etwas entschlossen habe, dann möchte ich es gleich in die Tat umsetzen. Warum auch nicht?«
Mit verschränkten Armen stand sie da und sah ihn erneut an. »Nun gut. Und was hältst du von italienischer Küche heute abend?«
»Wie bitte?«
»Zum Essen. Magst du italienische Küche?«
»Ja, sicher.«
»Gut. Wir essen um sechs Uhr. Ich kümmere mich ums Essen, und inzwischen kannst du deine Sachen ins Zimmer bringen und es dir ein bißchen bequem machen.« Chris ging zur Tür, wo sie sich noch einmal umdrehte. »Fühl dich wie zu Hause, David.«
Er schaute ihr nach, dann warf er sich aufs Bett. Seine Gedanken rasten. Es war alles so schnell gegangen. Er hatte jetzt ein Zimmer – und nicht nur irgendeines, sondern Kevins, genau das Zimmer des Jungen, der es vor so langer Zeit geschafft hatte, sich in seinen Kopf hineinzuschleichen. Wie würde Chris reagieren, wenn sie wüßte, daß er nicht das Haus im Traum gesehen hatte, sondern sie?
Er wusch sich und zog ein frisches Hemd an. Dann setzte er sich auf den Bettrand und starrte den Wecker an. Bis zum Essen würde es noch eine ganze Stunde dauern. Er hatte nicht lange gebraucht, um seine Sachen hereinzubringen und seine Koffer auszupacken. Es waren nur zwei Koffer, ein Pappkarton, sein Fotoapparat, die Ausrüstung fürs Fotolabor – und das schwarze Fotoalbum. Eigentlich hatte er es nicht mitnehmen wollen, doch einfach zurücklassen hatte er es auch nicht können. Immerhin war es ein Bindeglied zu seiner Vergangenheit, das einzige, was ihn daran erinnern könnte, wer er wirklich war ... Mit der Überlegung, daß er es wahrscheinlich nur selten ansehen würde, hatte er das Album mit den Koffern in den Schrank verstaut. Den Karton hatte er ebenfalls in den Schrank gestellt – lauter Sachen, von denen er sich auch nicht trennen konnte: ein altes, in Folie gewickeltes Vogelnest, ein Eichhörnchenzahn, den er vor Jahren gefunden und lange unter seinem Kopfkissen versteckt hatte, und ein rostiger Wurfpfeil. Fletchers Jagdmesser hatte er im Auto gelassen.
Um fünf Minuten vor sechs ging er noch einmal ins Badezimmer. Als er sich im Spiegel sah, mußte er die Stirn runzeln. Seine Augen waren leuchtend blau – man hatte ihm immer erzählt, daß seine Augen das Schönste an ihm waren, aber er selbst wußte, daß sie zu sehr leuchteten. Im übrigen war sein Gesicht sehr lang, richtig schmal, so daß seine verformte Nase, die Fletcher irgendwann mit einem Schlag gebrochen hatte, noch gewaltiger wirkte. David dachte dabei an die Nase Pinocchios, die mit jeder Lüge wuchs. Er zählte die Lügen an den Fingern ab, die er allein heute erzählt hatte. Er war kein Student. Er war nicht einfach zufällig vorbeigekommen. Es gab kein Versicherungsgeld; sein ganzes Vermögen bestand aus zweihundert Dollar in bar und einem abgewrackten Chevy Nova, Baujahr ‘76. Es waren schon drei. Nein, vier – denn Fletcher war nicht einfach so gestorben, wie er Chris hatte weismachen wollen. Ja, es waren schon vier Lügen.
Er schaute konzentriert in den Spiegel, dann schloß er die Augen und versuchte, sich sein eigenes Gesicht vorzustellen. Komisch, dachte er, wie schwer es einem fällt. Unter all den Gesichtern, die man sich im Laufe eines Lebens eingeprägt hat, war das eigene – das zweifellos wichtigste – das am wenigsten vertraute. Wenn man sich vorstellte, daß alle Spiegel der Welt auf einmal zersplittern würden, müßte jeder zu einem Fremden in der eigenen Haut werden, dem man nur gelegentlich auf Fotos wiederbegegnet. Dann wäre es einem egal, wie man selbst aussähe. Viel wichtiger wäre dann die Frage: Wie sieht denn der andere aus?
Er öffnete die Augen, machte seine Haarbürste naß und versuchte, einen dunklen Haarbüschel, der immer wieder hochstand, glattzukämmen. Dann verließ er das Bad und ging nach unten. Er wünschte, das flaue Gefühl in seinem Magen würde verschwinden; denn das würde ihm gerade noch fehlen, ihr feines Essen zu sich zu nehmen und dann gleich zu kotzen.
Chris mußte ihn auf der Treppe gehört haben, denn sie rief ihn schon, bevor er das Zimmer betrat. Ehe er sich umschaute, hatte sie ihm sein Essen gebracht, und über die dampfenden Ravioli hinweg blickte er auf einen Mund mit weißen Zähnen, die mit silbrigen Drähten umflochten waren und auf ein strahlendes Lächeln, das nur ihm gelten konnte.
Chris deutete auf das Mädchen. »Das ist meine Tochter Erin.« Und dann auf David. »Und das ist David, der junge Mann, der bei uns einzieht.«
David nickte ihr kurz zu und sagte »Hallo, Erin«, während er seine Serviette auseinanderfaltete und auf seinen Schoß legte.
Erin schob ihre langen, schwarz glänzenden Haare hinter die Ohren.
»Meine Mutter sagt, daß du an der BU bist«, sagte sie. »In welchem Fachbereich studierst du?«
»Ich habe mich noch nicht festgelegt.«
»Ich werde Rechtsanwalt, wie mein Vater.«
»Ich welcher Klasse bist du?«
»Achte.«
»Dann hast du noch einen langen Weg vor dir.«
»Mag sein, aber ich weiß wenigstens, was ich machen will.«
Chris schaute ihre Tochter an. »Es ist gar nicht so ungewöhnlich, daß man ein Studium beginnt, ohne genau zu wissen, in welche Richtung man schließlich gehen will.
Und was das betrifft, Liebes, wirst du deine Meinung vielleicht auch noch ändern, bis du soweit wie David bist.«
»Nie«, sagte sie.
Chris wandte sich David zu und sagte lächelnd: »So ist Erin nun einmal. Sie gehört einfach zu den Menschen, die auf die Welt kommen und schon gleich wissen, was sie aus ihrem Leben machen werden.«
Erin legte ihre Gabel weg. »Wenn du das so sagst, klingt es, als wär’s was Schlimmes.«
»Aber keineswegs, Liebes. Nur, nichts ist so sicher, wie du es gerne glauben möchtest. Pläne ändern sich, die Umstände auch – Leben verändert sich, ohne daß wir eigentlich einen Einfluß darauf haben.«
»Jetzt redest du von Dad.«
»Vielleicht hast du recht.« Chris schaute wieder zu David. »Was machst du sonst gerne, David? Hast du Hobbies?«
»Fotografieren. Hauptsächlich Tiere, Landschaften und solche Sachen. Mein Vater war Zeitungsfotograf bei der Laconia Daily Sun. Er hatte eine eigene Dunkelkammer im Haus, und er hat mir viel über die Arbeit beigebracht.«
»Hervorragend!« sagte Erin aufgeregt. »Würdest du mir das auch beibringen?«
»Na ja, ich weiß nicht. Man braucht schon den richtigen Platz und die Einrichtung und so weiter.«
»Wenn du möchtest«, warf Chris ein, »wir haben eine Kammer, einen alten Waschraum, gleich gegenüber von deinem Zimmer. Warum nimmst du ihn nicht und richtest ihn als Dunkelkammer ein?«
»Ich will euch doch keine Umstände machen.«
»Tust du nicht. Das Zimmer steht sowieso leer. Niemand benutzt es.«
»Mal sehen ... Die Ausrüstung von meinem Vater habe ich schon dabei ...«
»Dann ist doch alles klar. Ich suche morgen den Schlüssel.«
»Wirst du’s mir jetzt beibringen?« fragte Erin noch einmal.
David schaute sie an und wußte, daß er bereits in der Falle saß. Und er wußte auch, daß sie es wußte. Er nickte.
»Kann ich ein paar deiner Arbeiten sehen?«
»Was denn für Arbeiten?«
»Mensch, wenn du Fotograf bist, mußt du doch irgendwelche Bilder haben. Ich meine, Fotografen machen doch Bilder, oder?«
David trank einen Schluck Wasser und stellte das Glas vorsichtig neben seinen Teller.
»Ich habe aber keine mitgebracht«, sagte er schließlich.
»Warum denn nicht?«
»Sie waren nicht gut genug. Ich wollte eine neue Serie beginnen.« Aus seinen Augenwinkeln sah er, wie Chris sein Gesicht prüfte, als suche sie etwas Bestimmtes darin.
»So was Dummes«, sagte Erin. »Warum machst du denn so etwas?«
Wieder war es Chris, die ihn aus der Verlegenheit rettete. »Erin, Davids Vater ist erst vor kurzem gestorben. Es ist manchmal schwer, mit Erinnerungen fertigzuwerden, die Bilder hervorrufen. Und außerdem geht uns das nichts an. Es ist ganz allein Davids Angelegenheit.«
Er sagte nichts dazu. Statt dessen saß er nur da und kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit.
»Tut mir leid«, sagte Erin kleinlaut.
Chris stand auf. »Wie wäre es mit einem Nachtisch?« David stand ebenfalls auf und griff nach seinem Teller, aber sie nahm ihn ihm ab. »Schon in Ordnung, David. Ich mache das heute allein. Ihr zwei habt frei.« Während sie in die Küche verschwand, setzte er sich wieder; er mied Erins Blick und schaute auf das Klavier im Wohnzimmer.
»Ich hab’s nicht so gemeint, David. Sei bitte nicht böse mit mir.«
Er antwortete nicht. »Weißt du«, sagte sie, »du würdest gar nicht so übel aussehen, wenn du dir ab und zu mal ein Lächeln abringen würdest. Hast du’s schon mal probiert?«
Jetzt schaute er sie wieder an. »Weißt du«, erwiderte er, »du wärst auch gar nicht so übel, wenn du ab und zu mal den Mund hieltest. Hast du das schon mal probiert?«
Obwohl sie errötete, wich sie seinem Blick nicht aus.
Etwas später am Abend klopfte es an seiner Tür. Er zog schnell seine Jeans an und öffnete. Auf dem Flur stand Erin.
»Was willst du denn?« fragte er.
Sie schaute sich kurz im Zimmer um, bevor sie ihm antwortete. »Ich dachte nur, ich sollte dich vielleicht warnen. Sonst wäre es nicht fair.«
»Was soll das denn heißen?«
»Meine Mutter wollte eigentlich das leere Zimmer im zweiten Stock vermieten, aber dann kamst du, und sie hat dir einfach dieses Zimmer gegeben. Niemand hat es bisher benutzt, nicht einmal ich. Es gehörte nämlich meinem Bruder, und er ist tot.«
»Na und ...?«
»Meine Mutter scheint den Eindruck zu haben, daß an dir etwas Besonderes ist. Wenn du mich fragst, ich finde dich einfach seltsam. Ich werde alles über dich herausfinden, was man herausfinden kann, das verspreche ich dir. Aber ich wollte es dir wenigstens vorher sagen.«
Als David am nächsten Morgen die Küche betrat, war ihm sofort klar, daß er ein Gespräch unterbrochen hatte, in dem es um ihn ging. Erst die angeregten Stimmen, dann das plötzliche Schweigen. Sogar Chris wirkte nicht so gelassen wie sonst. Sie begrüßte ihn schnell, und noch schneller deckte sie seinen Platz am Frühstückstisch. Erins Blick strotzte vor Selbstgefälligkeit, als würde sie sich über seine Verlegenheit köstlich amüsieren und ihn geradezu herausfordern, etwas dagegen zu unternehmen. Schließlich warf ihr Chris einen Blick zu, der wortlos warnte, und Erin schaute auf ihren Teller hinunter. Chris reichte David die Platte, die auf dem Tisch stand. »Hier, nimm dir.«
Mit der Gabel angelte er sich zwei Pfannkuchen, die er auf seinen Teller legte. Währenddessen überlegte er, was er Heiteres und Belangloses sagen konnte, aber solche Gespräche waren nie seine Stärke gewesen. In dem Moment glitt Chris’ Hand in ihre Bademanteltasche, und sie zog einen großen, silbernen Schlüssel hervor.
»Ehe ich es vergesse«, sagte sie, »hier ist der Schlüssel zur Kammer oben. Daraus läßt sich bestimmt eine tolle Dunkelkammer machen. Es gibt Regale, ein Waschbecken, fließendes Wasser – und keine Fenster. Natürlich aber auch viel Dreck.« Sie deutete mit Daumen und Zeigefinger eine mehrere Zentimeter dicke Schicht an. »Ich sag’s lieber gleich. Da muß gründlich geputzt werden.«
David war es nicht gewöhnt, daß man sich seinetwegen Mühe machte. Jetzt, wo es so war, wußte er nicht, wie er reagieren sollte. Er wählte seine Worte sorgfältig, um sicherzugehen, daß Chris ihn nicht für undankbar hielt. »Das ist großartig, wirklich toll. Ich hole gleich heute Chemikalien aus Boston. Und vielleicht schaffe ich’s bis heute abend, alles einzurichten.«
»Und ich helfe auch«, warf Erin ein.
David beachtete sie überhaupt nicht.
»Wann ist denn Vorlesungsbeginn, David?« fragte Chris. »Erst nächste Woche.«
Sie nickte, nahm ihre Kaffeetasse vom Tisch und ging zur Spüle, dann drehte sie sich lächelnd zu Erin um. »Heute habe ich einen Termin bei Dr. Frank. Ich gehe davon aus, daß er mir sagen wird, wann dein Vater nach Hause kommen kann.«
Erins Gesicht überzog sich mit einem breiten Grinsen, so daß ihre Zahnspange und eine Menge halbzerkauten Pfannkuchens zum Vorschein kamen. David zog eine Grimasse – nicht übertrieben, aber ausreichend, daß sie es ihm hätte übelnehmen können. Aber dieses Mal ignorierte sie ihn. Sie sprang vom Stuhl auf, lief auf ihre Mutter zu und schlang die Arme um ihren Hals. Beide hielten sich fest in den Armen und tanzten durch die Küche, so daß es David vorkam, als folgten sie irgendeinem überzogenen Indianerritual, das von Erins lautstarkem Gekreische begleitet wurde.
Chris löste sich allmählich aus der Umarmung, sie lachte noch immer. »Du mußt uns entschuldigen, David, aber wir haben beide eine Ewigkeit auf diesen Tag gewartet.«
Er nickte, und wieder suchte er nach den richtigen Worten. In Wahrheit war er genauso gespannt darauf wie sie, Neil zu sehen, wenngleich aus anderen Gründen. Neil war für ihn immerhin das zweite der beiden Gesichter, die so lange seine Gedanken begleitet hatten. Aber David wäre ohnehin nicht zu Wort gekommen; Erin war in Fahrt gekommen und überschüttete nun ihre Mutter unentwegt mit Fragen, so lange bis David dachte, Chris’ Kopf müßte platzen.
Um sie zu beruhigen, legte Chris einen Finger auf Erins Mund. »Das Krankenbett wird morgen geliefert. Ja, du kannst mir natürlich helfen, das Zimmer zurechtzumachen. Ja, er wird für immer bleiben. Ja, er wird noch in Behandlung sein, und nein, er wird nicht wieder zur Arbeit gehen, noch nicht. Habe ich jetzt alle Fragen zu deiner vollen Zufriedenheit beantwortet?« Sie nahm ihren Finger weg und wartete.
»Ich glaube schon. Fürs erste.«
»Gut, dann beeile dich mit dem Frühstück, damit du den Schulbus nicht noch verpaßt. Ich muß mich anziehen, damit ich rechtzeitig ins Krankenhaus komme.«
Chris verließ die Küche, und Erin setzte sich wieder. Sie übergoß den Pfannkuchen, der noch auf ihrem Teller lag, mit Sirup, und das Ganze sah aus wie ein Ölteppich. David betrachtete ihren kleinen, schmächtigen Körper; ein dicker Pullover verbarg ihre kaum vorhandenen Brüste; ihre Jeans saßen sehr eng. Sie blickte auf.
»Hast du irgendein Problem?« fragte sie.
Er zuckte mit den Achseln. »Nein, kein Problem.«
»Dann würde ich dir raten, dich aufs Frühstück zu konzentrieren. Vielleicht tut das deinem ausgemergelten Körper ganz gut.«
»Schon mal gehört, daß Leute, die im Glashaus sitzen, nicht mit Steinen werfen sollen?«
»Ist der Spruch wirklich von dir, David, oder hast du ihn in einem deiner schmutzigen Hefte gelesen?«
Ihm brannten die Ohren. Sie hatte offensichtlich gestern abend das Heft auf seiner Kommode gesehen. Er wollte es erst gar nicht aus dem Karton holen, und nun bereute er, es doch getan zu haben. Er betrachtete ihren langen, dünnen Hals und stellte sich vor, wie es sich wohl anfühlen würde, wenn er ihn mit beiden Händen umfaßte und zudrückte – ganz fest.
Erin schaute auf die Wanduhr, stand auf, griff nach der Jacke, die sie vorher auf die Küchenablage gelegt hatte, und schlüpfte hinein. »Sag meiner Mutter, daß ich gegangen bin.« Sie stopfte ihre Schulbücher in eine vergammelte, braune Umhängetasche und ging zur Tür. Noch einmal blieb sie stehen.
»Falls du dich fragst, David, ob wir über dich geredet haben, als du kamst ... Ja, haben wir. Und ich wette, daß du nur zu gerne wüßtest, was wir gesagt haben, nicht wahr?«
Ohne auf seine Reaktion zu warten, ging sie hinaus und knallte die Tür hinter sich zu.
Kapitel 2
Als Chris wieder nach unten kam, waren David und Erin bereits gegangen. Der Frühstückstisch war abgedeckt, das Geschirr schon vorgespült und in die Spülmaschine geräumt. Anscheinend hatte es David noch erledigt, bevor er gegangen war. Chris schaute auf die Uhr – 8.30 Uhr. Der Termin beim Arzt war erst um zehn. Sie schenkte sich eine zweite Tasse Kaffee ein und setzte sich an den Küchentisch. Zufrieden betrachtete sie ihre sauber aufgeräumte Küche.
Trotz Erins erster abweisender Reaktion, stellte Chris fest, daß es ihr überhaupt nicht leid tat, David aufgenommen zu haben. Im Gegenteil, allein seine Anwesenheit schien alles ein bißchen aufzuheitern. Das Haus mit seinen zwölf Zimmern war für ihre dreiköpfige Familie wirklich viel zu groß. Ursprünglich hatte sie mit Neil zusammen eine große Familie geplant, aber das war vor Kevins Zeit ... und Erins. Ihre zweite Schwangerschaft hatte nichts von dem wunderbaren Zauber der ersten; in einem Moment war sie aufgeregt, im nächsten voller Panik. Ihre Gefühlswelt war wie eine Achterbahn, in der nur zählte, daß sie heil ankam. Schließlich wurde Erin geboren, und Neil überredete sie danach, die Pille zu nehmen. Er versuchte sie auch zu überreden, wegzuziehen – weg vom Haus, weg vom Park. Aber Chris weigerte sich hartnäckig. Oft fand Neil sie in Kevins Zimmer vor dem großen Fenster, ihr Blick auf den Park fixiert. »Wozu nur?« fragte er. »Was bringt das noch?«
Sie hatten sich auf Kevins Geburt gründlich vorbereitet und waren auf alles gefaßt gewesen: das nächtliche Stillen, den Keuchhusten, die ersten Zähne ... Aber es kam alles ganz anders, so als wollte er ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Kevin schlief schon von der ersten Woche an durch. »Soll er so viel schlafen?« hatte Neil immer wieder gefragt. »Vielleicht langweilt er sich mit uns.«