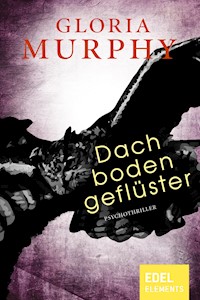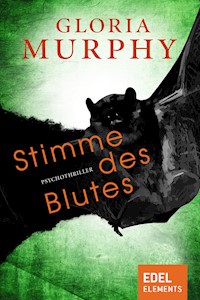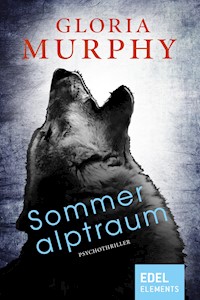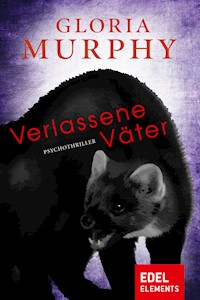
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spannend bis zur letzten Seite - raffinierter Nervenkitzel von einer Meisterin des Psychothrillers! Für den schüchternen Ben Shandling bricht eine Welt zusammen, als sich seine Frau Claire von ihm scheiden lässt und der gemeinsame Sohn Adam der Mutter zugesprochen wird. Trotz aller Bemühungen gelingt es dem verzweifelten Vater nicht, die Entscheidung des Gerichts rückgängig zu machen. Kurz darauf erschüttert eine Reihe von Mordfällen die Stadt Boston. Bei den Opfern handelt es sich um alleinerziehende Mütter, denen bei Gericht das Sorgerecht für ihre Kinder übertragen wurde. Die Anwältin Maggie Grant übernimmt die Verteidigung von Frank Chandler, der verdächtigt wird, die Morde begangen zu haben. Kurz darauf steht Maggie, die ihrem alkoholkranken Mann Paul das Sorgerecht für ihren Sohn Richie entziehen lassen will, vor Gericht...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gloria Murphy
Verlassene Väter
Psychothriller
Aus dem Amerikanischen von Gabriela Schönberger-Klar
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Impressum
PROLOG
Es war Lucas aus der Diätküche des Krankenhauses, der Benny als erster die Rechtsberatungsstelle empfohlen hatte. Als Bennys Frau die Scheidung einreichte – sein Sohn war eben zwei Jahre alt –, wandte er sich dorthin, und mit Hilfe seines Anwalts und des Rechtsanwalts seiner Frau wurde eine schlichte, außergerichtliche Einigung erreicht: Claire wurden das Sorgerecht für Adam und fünfundsiebzig Dollar wöchentlich für das Kind zugesprochen, und Benny bekam die Erlaubnis, seinen Sohn sonntags von zwei bis fünf Uhr nachmittags zu besuchen. Er hatte darum gebeten, mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können, ihn vielleicht einen ganzen Tag oder sogar über eine Nacht bei sich behalten zu dürfen. Damals hatte er eine billige Dreizimmerwohnung in Cambridge in Aussicht gehabt; sie lag etwas außerhalb von Boston.
Doch Barry Millerman, sein Anwalt, hatte vorgeschlagen, sich mit diesem Kompromiß abzufinden und realistischer zu sein. Denn Claire hatte sein Ansinnen von vornherein abgelehnt. Selbstverständlich war Millerman bereit, vor Gericht zu gehen und Bennys Sache durchzukämpfen, aber es war auch seine Pflicht, ihn darauf hinzuweisen, daß solch ein Rechtsstreit nicht nur mit hohen Kosten verbunden sein würde – vielleicht sogar zu hohen Kosten für Bennys Verhältnisse –, sondern daß es auch noch höchst unwahrscheinlich war, ihn zu gewinnen.
»Wenn der Junge ein paar Jahre älter ist, dann gelingt es uns vielleicht, die Vereinbarung abändern zu lassen«, hatte Millerman erklärt. »Aber wenn die Kinder noch so klein sind, dann neigen die Richter zu der Annahme, daß sie in der Obhut einer Mutter besser aufgehoben sind.«
Als Benny nun in der Rechtsberatungsstelle angerufen hatte, um den heutigen Termin zu vereinbaren, hatte er ausdrücklich darum gebeten, mit Millerman zu sprechen. Nicht, daß Benny etwa viel für Rechtsanwälte übrig gehabt hätte, aber Millerman war mit seinem Fall bereits vertraut. Wie war gleich noch mal das Wort, das die Anwälte so gerne benutzten? Kontinuität. Ja, Kontinuität war wichtig.
Der Anwalt beugte sich über seinen Schreibtisch, streckte Benny seine feuchte Hand hin und spähte dann durch seine dicke Brille, die tief auf seiner Hakennase saß, auf eine Aktennotiz, die eben auf seinen Schreibtisch gelegt worden war. Schließlich schob er den Aktendeckel beiseite, faltete die Hände auf dem Schreibtisch und wandte seine Aufmerksamkeit wieder Benny zu.
»Nun, das ist ja bereits eine ganze Weile her, nicht wahr? Wie ist es Ihnen in der Zwischenzeit ergangen, Mr. Shandling?«
Benny rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her und versuchte, sich in einer Umgebung wohl zu fühlen, die alles andere als dafür geeignet war. »Nicht so gut«, erwiderte Benny und fuhr sich mit seiner großen Hand über seinen dunklen, sorgfältig gekämmten Hinterkopf. »Wissen Sie, ich habe immer diese Kopfschmerzen.«
Millerman runzelte höflich die Stirn. »Es tut mir leid, das zu hören. Nun, was kann ich heute für Sie tun?«
»Es geht um meinen Jungen … Adam.«
»Aha. Wie alt ist er denn jetzt, sechs, sieben? Du meine Güte, sie werden so schnell größer, finden Sie nicht auch?«
»Fünf ist er jetzt, vergangenen Monat hatte er Geburtstag. Die Sache ist die, daß ich ihn nicht mehr sehr oft zu Gesicht bekomme.«
»Der Scheidungsvereinbarung zufolge …« Der Anwalt beugte sich vor, holte Bennys Akte aus dem Korb auf seinem Schreibtisch, schlug sie auf und blätterte auf die zweite Seite des dreiseitigen Dokumentes. »… sollten Sie den Jungen drei Stunden am Sonntag sehen dürfen.«
Benny nickte. »Stimmt, so sind die Vereinbarungen. Aber so läuft es nicht.«
»Nun, warum erzählen Sie mir nicht, was inzwischen passiert ist?«
»Es ist Claire. Ich würde sagen, es ist hauptsächlich ihre Schuld«, begann er. »Sie nutzt jede Chance, die sich ihr bietet, um mich daran zu hindern, den Jungen zu sehen. Wenn nicht aus dem einen, dann aus dem anderen Grund: ein kleiner Schnupfen, Müdigkeit, alles mögliche; oder der Junge darf nicht mit mir kommen, weil es draußen regnet oder weil die Straßen zu rutschig sind.« Benny listete diese Gründe mit demselben heuchlerischentschuldigenden Tonfall auf, den Claire immer benutzte. »Nennen Sie irgendeinen Grund, Mr. Millerman – sie hat ihn bestimmt schon vorgebracht.«
»Vielleicht sind die Entschuldigungen ja gerechtfertigt. Schließlich muß man bei Kindern mit diesen Dingen rechnen.«
»Nein, nein, Sie verstehen nicht. Sie lügt. Zuerst hat sie es nur ab und zu getan, aber im Lauf der Zeit immer öfter. Jetzt macht sie das regelmäßig. Nach der Scheidung ist sie an die Nordküste, nach Salem, gezogen, um in der Nähe ihrer Familie zu sein. Ich fahre jedesmal von Boston aus mit dem Zug dahin. Eineinhalb bis zwei Stunden brauche ich, um hinzukommen. Sobald ich dort bin, kommt sie mit einer dieser billigen Entschuldigungen daher. Es ist wie ein Spiel, das keiner zugibt – ich weiß, daß sie mir ins Gesicht lügt, und sie weiß, daß ich es weiß.«
»Wie reagieren Sie denn dann?«
Benny zuckte mit den Achseln. »Ich gehe wieder. Was soll ich denn sonst tun? Mir den Jungen packen und mit ihm davonlaufen?«
»Nein, nein, selbstverständlich nicht. Es ist immer ratsam, sich an den Rechtsweg zu halten.«
»In sechs Monaten habe ich Adam vielleicht dreimal gesehen, und jetzt schon seit zwei Monaten gar nicht mehr.«
Mr. Millerman nahm einen Kugelschreiber und machte sich ein paar Notizen.
»Welche Art von Mutter ist Mrs. Shandling?«
»Sie heißt jetzt Cranston, das ist ihr Mädchenname.«
»Ich verstehe. Nun, was für eine Mutter ist sie denn?«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich meine, kümmert sie sich gut um Adam, sorgt sie dafür, daß er sauber gekleidet ist und gut versorgt wird? Solche Dinge eben.«
Benny nickte. »Ja, ich nehme schon an, daß sie das tut.«
»Dann können wir also keine stichhaltigen Beschwerden vorbringen, was ihre Pflichterfüllung gegenüber dem Kind betrifft?«
Nach einer Pause meinte er: »Nein, ich glaube nicht. Es ist nichts zu beanstanden außer dem, was ich Ihnen erzählt habe. Sehen Sie, ihre Lügen, ihre Weigerung, mich den Jungen sehen zu lassen – das ist es, was mir zu schaffen macht. So etwas sollte eine Mutter doch nicht tun.«
Millerman nickte. »Und Sie – sind Sie mit Ihren wöchentlichen Zahlungen auf dem laufenden?«
»Ja, fast jedenfalls.« Das entsprach nur teilweise der Wahrheit, aber Benny wollte jetzt nicht näher darauf eingehen.
Millerman lehnte sich in seinem Stuhl zurück, überlegte und beugte sich dann wieder vor: »Nun, wir haben die Möglichkeit, eine Zwangsvollstreckung gegen sie zu beantragen. Bei Ihrer Scheidung wurde die Vereinbarung, die von Ihnen und der Mutter Ihres Sohnes unterschrieben wurde, vom Gericht zu den Akten genommen. Das heißt, daß sie nicht nur ihren Teil der Abmachung nicht einhält, sondern sich auch noch ganz offensichtlich einem Gerichtsbeschluß widersetzt.«
»Dann können Sie das also wieder in Ordnung bringen?«
»Nun, wir können es versuchen. Doch denken Sie daran, Mr. Shandling, die Gerichte haben nur beschränkte Möglichkeiten. Vielleicht wird sie verwarnt und sogar dazu verurteilt, Ihre Gerichtskosten zu zahlen. Aber grundsätzlich ist zu sagen, daß Urteile bei Familienrechtsangelegenheiten nur sehr schwer durchzusetzen sind. Immer wieder hat man es mit einem Vater oder einer Mutter zu tun, die ständig gegen eine gerichtliche Anordnung verstoßen.«
»Das verstehe ich nicht. Wenn das so funktioniert, was hat das Ganze dann für einen Sinn? Ich meine, ein Richter – soll er denn nicht das letzte Wort haben?«
»Selbstverständlich, und das hat er auch. Er hat die Macht, die schuldige Partei ins Gefängnis zu schicken; er kann sogar das Sorgerecht ändern, wo es ihm angebracht erscheint, aber in den vielen Jahren, in denen ich mich nun mit dem Familienrecht befasse, ist es mir nur selten untergekommen, daß ein Richter so etwas getan hätte. Das ist ein ganz besonderes Rechtsgebiet: Die Interessen des Kindes haben immer Vorrang. Was sollte es da schon nützen, den Elternteil, der das Sorgerecht hat, oder den Verwandten, der sich in erster Linie um das Kind kümmert, ins Gefängnis zu stecken? Oder das Sorgerecht zu ändern, wenn nicht gewährleistet ist, daß es auch funktioniert? Die Bestrafung würde nur dazu führen, dem Kind einen weiteren seelischen Schock zuzufügen.« Millerman seufzte. »Nein, normalerweise führt das nur zu einem langen Rechtsstreit, der erst dann endet, wenn das Kind schließlich volljährig ist.«
Ein vertrauter Schmerz durchzuckte plötzlich Bennys Kopf, und nicht zum erstenmal diagnostizierte er an sich selbst einen Gehirntumor. Manchmal wünschte er sich, nicht als Pfleger in einem Krankenhaus zu arbeiten und soviel über Krankheit und Tod zu wissen. Er hielt die Luft an, strich sich mit der Handfläche über den Kopf, wo der Schmerz noch nachpochte, und sah dann Millerman an: Dem Anwalt war nicht anzusehen, ob er etwas bemerkt hatte oder nicht.
»Aus Ihrem Mund klingt das ja so, als sei jeder Versuch hoffnungslos«, sagte Benny, als ihm Millermans Worte wieder ins Bewußtsein drangen.
»Das liegt nicht in meiner Absicht. Nein, es ist ganz und gar nicht hoffnungslos. Zum Glück lassen sich die meisten Leute von einem wütenden Richter einschüchtern. Warten wir doch mal ab, ob das nicht auch in Ihrem Fall passiert.«
Benny nickte. »Da gibt es noch etwas, was ich bisher nicht erwähnt habe.«
»Dann raus mit der Sprache. Es ist besser, ich erfahre es jetzt als im Gerichtssaal, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin.«
»Es geht um den Jungen.«
Schweigen.
Benny seufzte. »Nun, sehen Sie, es sind ihre Lügen … jetzt fangen sie bereits bei ihm zu wirken an. Als ich ihn das letzte. Mal abholte, kam Claire nicht mit einer ihrer, Entschuldigungen daher; das mußte sie gar nicht mehr.«
»Ich begreife nicht ganz.«
Benny rieb mit der Fingerspitze über einen imaginären Fleck am Knie seiner Jeans. »Sehen Sie, das letzte Mal war es Adam selbst … Als ich ankam, da wollte er nicht zu mir kommen. Es war, als fürchtete er sich. Können Sie das begreifen, sich vor mir, seinem eigenen Vater, zu fürchten?« Schließlich hob Benny den Kopf und blickte Millerman an. »Also dachte ich mir, ich würde die Situation etwas entkrampfen und ihn zum Lachen bringen, wissen Sie. Eines habe ich fertiggebracht, seit er ein kleines Baby war, ich habe Adam immer zum Lachen gebracht. Wissen Sie, ich kann ganz gut Stimmen imitieren … Geräusche nachmachen. Manchmal mache ich das, was ich und Adam unser "Mäusespiel"ʼ nennen. Ich verstelle meine Stimme, die dann ganz hoch und seltsam quietschend klingt, und –« Benny hielt mitten im Satz inne. So, wie der Anwalt ihn jetzt musterte, schien er einen Narren aus sich zu machen.
»Aber das war keine Lösung des Problems, habe ich recht?« sagte Millerman.
Benny nickte.
Der Anwalt setzte die Brille ab und musterte Benny.
»Warum sollte er denn Angst vor Ihnen haben, Mr. Shandling?«
»Ich wüßte keinen Grund. Es sind ihre Lügen, die daran schuld sind. Sie hat ihn dazu gebracht, Dinge über mich zu glauben, Dinge, die nicht stimmen.«
»Was für Dinge denn?«
Benny zuckte mit den Achseln. »Ich weiß nicht, Dinge eben.«
»Und es gibt keinen Grund für die Ängste des Jungen – nicht einen einzigen?«
»Ich schwöre Ihnen, ich habe dem Jungen nie weh getan. Niemals. Wissen Sie, ich hatte keinen Vater, zumindest erinnere ich mich nicht daran, einen gehabt zu haben … Aber ich habe mir selbst und meiner Mutter geschworen, daß ich ein guter Vater sein würde, wenn ich jemals selbst ein Kind hätte. Und das war ich auch. Ich habe mit Adam immer viel unternommen – bin mit ihm in den Zoo, ins Kino, in den Park, an den Strand gegangen; Claire wohnt nicht sehr weit vom Meer entfernt. Einmal bin ich mit ihm im Regen zum Beverly-Flughafen gefahren, um mir mit ihm die startenden Flugzeuge anzusehen.«
Der Anwalt lehnte sich in seinem Stuhl zurück, rieb sich die Augen und klemmte sich dann die Bügel seiner Brille hinter die Ohren.
»Das Gericht kann eine Menge Dinge bewerkstelligen, Mr. Shandling, aber einen Fünfjährigen davon zu überzeugen, daß er sich nicht fürchten muß, gehört nicht dazu. Selbstverständlich kann es darauf bestehen, daß er sich mit Ihnen trifft – immer vorausgesetzt natürlich, daß wir dem Gericht beweisen können, daß seine Ängste unbegründet sind. Aber die Frage ist doch, können Sie mit dem Jungen umgehen, wenn er sich weigert, mit Ihnen zu kommen?«
Benny saß mit geschlossenen Augen da und versuchte, sich solch eine Szene vorzustellen. Würde er Adam tatsächlich dazu zwingen können, mit ihm zu gehen? Nicht ein einziges Mal hatte er die Stimme oder die Hand gegen ihn erhoben, selbst in Zeiten, wo er es vielleicht getan haben sollte. Würde er den Jungen mit sich zerren können, obwohl dieser weinte und klagte, daß er zu seiner Mutter zurückwollte? Benny saß schweigend da und kaute auf seiner Unterlippe.
»Das ist es, was mir dabei durch den Kopf geht, Mr. Shandling, ich habe eine solche Situation bereits früher erlebt, öfter sogar. Und sie sind nicht schön. Die Eltern leiden, die Kinder leiden … Lassen Sie mich Ihnen einen Vorschlag machen – gehen Sie irgendwann einmal zum Familiengericht und überzeugen Sie sich selbst. Und vergessen Sie nicht – die erbitterten Kämpfe und Beschimpfungen sind nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den man den Kindern zufügt. Und alles wird von den Menschen verursacht, die die Kinder doch eigentlich über alles lieben sollten.«
»Dann wollten Sie also sagen, daß ich alles so lassen soll, wie es ist?«
Millerman zuckte mit den Schultern. »Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Aber wie Sie sicher wissen dürften, wird die Sache sehr kostspielig werden, wenn Sie sich zur Klage entscheiden. Und selbstverständlich kann ich für einen Erfolg nicht garantieren. Aber wenn Sie sich entscheiden, nicht zu kämpfen, dann heißt das noch lange nicht, daß alles verloren ist. Ich habe es oft genug erlebt – Kinder werden älter, sie begreifen, was geschehen ist, und bestehen dann von sich auf darauf, Kontakt mit dem abwesenden Elternteil zu haben.«
Benny ballte seine Hand zur Faust, fuhr sich mit den Knöcheln über die Lippen und sagte lange Zeit nichts.
»Es ist ziemlich schwer für mich«, meinte er schließlich.
»Fast zu schwer. Manchmal habe ich Angst, daß ich wie ein dummer Junge zu heulen anfange, aber es kommen keine Tränen. Und ich fühle mich … ich weiß nicht, enttäuscht vielleicht. Wie bei diesen Feuerrettungsübungen in der Schule: Man läuft ganz schnell ohne Mantel und Schal nach draußen und friert sich den Hintern ab. Und dann ist da gar kein Feuer. Man will natürlich gar nicht, daß es wirklich brennt, aber wer weiß, vielleicht will man es doch.« Er sah Millerman an. »Verstehen Sie, was ich meine?«
Der Rechtsanwalt nickte. »Ich glaube schon.«
»Dann kommen mir manchmal diese verrückten, exzentrischen Gedanken.«
»Welche Gedanken?«
Benny zuckte mit den Achseln. »Ach, ich weiß nicht so recht, Gedanken eben, die in meinem Kopf rumoren.« Millerman warf einen Blick auf seine Uhr, ließ Bennys Akte in den Kasten zurückgleiten, stand auf und erklärte ihr Gespräch damit für beendet.
»Der beste Rat, den ich Ihnen geben kann, Mr. Shandling, ist der, nicht mehr soviel über die Sache nachzugrübeln. Leben Sie Ihr Leben. Eines Tages wird Ihr Junge vor Ihnen stehen – Sie werden schon sehen.«
Auf dem Weg zurück zur Arbeit fragte sich Benny, warum er sich überhaupt die Mühe gemacht hatte, zum Anwalt zu gehen. Sechzig Dollar, um herauszufinden, was er bereits vorher gewußt hatte: Claire hatte es so eingerichtet, daß der Junge nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte, und es gab keinen, der das hätte ändern können. Man kann niemanden zur Liebe zwingen, wenn sie nicht vorhanden ist. Genauso, wie es unmöglich ist, die eigene Liebe abzutöten, wie sehr man sich auch anstrengt.
Doch etwas hatte Millerman vorgeschlagen, das einer ernsthaften Überlegung wert sein könnte – ins Gericht zu gehen und sich selbst davon zu überzeugen, was dort vor sich ging; einen Schritt zurückzutreten und sich mit etwas Abstand anzuschauen, was dort den anderen Männern geschah.
Das erschien ihm sinnvoll. Wenn er sich nicht mehr so allein fühlte, dann würde es vielleicht auch nicht mehr so schrecklich weh tun.
1. KAPITEL
Obwohl Benny in Boston geboren und aufgewachsen war, hatte er erst kurz nach seinem Gespräch mit Millerman zum erstenmal die Gerichtsgebäude am Pemberton Square gesehen. In seinem marineblauen Sergeanzug, den er extra für diesen Anlaß günstig bei Filenes erstanden hatte, hatte Benny den Außenfahrstuhl in der Tremont Street genommen und dann den aus Ziegeln erbauten Gerichtshof betreten: Zu seiner Linken lag ein Bürogebäude, Dutzende kleiner Geschäfte und Restaurants säumten die Seite, die sich zur Tremont Street hin erstreckte, und direkt vor ihm lag schließlich das Gerichtsgebäude des Verwaltungsbezirks Suffolk, das einen einschüchternden Anblick bot. Benny kroch ein Schauer über den Rücken. Ein ähnliches Gefühl empfand er sonst nur, wenn er vor einem Spiel der Boston Redsock im Fenway Park der amerikanischen Nationalhymne oder den Klängen einer Blaskapelle lauschte, die hinter einer im Wind flatternden amerikanischen Fahne die Commons hinabmarschierte.
Jetzt, acht Monate später, war Benny wohl vertraut mit den Gerichtsgebäuden – sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Bau –, so, wie er sich auch in den verschachtelten unterirdischen Gängen im Krankenhaus auskannte, wo er fünf Tage in der Woche in der Schicht von drei Uhr nachmittags bis nachts um elf arbeitete. Doch es war das alte Gerichtsgebäude, das, in dem Familienrechtsangelegenheiten verhandelt und verurteilt wurden, in dem Benny den größten Teil seiner Vormittage verbrachte und das er am besten kannte: die höhlenartige, steinerne Eingangshalle, über der sich die drei Stockwerke öffneten, die veralteten Aufzüge, die Sitzungssäle, die Arbeitsräume, das Büro des Geschäftsstellenleiters, Dutzende von kleineren Gerichtszimmern, die Konferenzräume und den Aufenthaltsraum der Richter – ein elegant eingerichteter Raum, in dem sich die Richter jeden Morgen versammelten, bevor sie ihren Tag begännen.
Und dann war da noch Rufus … Rufus Choate, die bronzene Statue eines Rechtsanwalts aus dem achtzehnten Jahrhundert, die sich fünf Meter hoch in der Eingangshalle des alten Gerichtsgebäudes erhob. So, wie Benny es sah, war die Statue des großen Streiters für Gerechtigkeit – Benny hatte sich beim Gerichtsbibliothekar über Rufus' Meriten erkundigt – aus dem Grund dort aufgestellt worden, um einen hohen Standard für das gesamte Rechtssystem zu setzen. Doch es dauerte nicht lange, bis Benny dahinterkam, daß das nichts als Makulatur war: Das, was in diesen Gebäuden vor sich ging, hatte nicht sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun.
Der kleine Kaffeeausschank, der sich im hinteren Teil der Eingangshalle befand und vom Blindeninstitut geführt wurde, war normalerweise von ungeduldigen Kunden umlagert. Aber Benny, der jetzt ein regelmäßiger Besucher bei Gericht war, kam bereits immer vor dem Ansturm um acht Uhr dreißig dort an. Er bestellte sich jedesmal einen Kaffee, und das pausbäckige schwarze Mädchen hinter der Theke erkannte ihn bald an der Stimme.
»Wieder einmal in der Gegend, Benny, hmm?« fragte Celia und legte ihre Finger vorsichtig um den Pappbecher, um zu ertasten, wie die heiße Flüssigkeit darin aufstieg. »Haben Sie heute eine Verhandlung?«
»Ja, Sie kennen mich doch … wieder eine große Sache.«
»Nun, dann wünsche ich Ihnen viel Glück«, sagte sie, als Benny das abgezählte Kleingeld auf den Teller legte, seine Kaffee nahm, mit der freien Hand seine Aktenmappe packte und sich dann auf eine Bank setzte. Er hatte die Aktenmappe in einem Second-hand-Laden für Lederwaren erstanden und sie so lange poliert, bis sie glänzte. Und die kleine blaue Karte, die er in seiner Brieftasche mit sich führte und die besagte, daß Ben Shandling Mitglied der Anwaltskammer von Massachusetts war, die hatte sein Freund Lucas gegen ein kleines Entgelt für ihn drucken lassen.
Benny gab sich nur dann als Anwalt aus, wenn es nicht zu umgehen war – zum Beispiel im Büro des Geschäftsstellenleiters, wenn er eine Akte von dort benötigte. Dann unterschrieb er die Empfangsbestätigung immer mit R. Choate, wobei das R selbstverständlich für Rufus stand – ein kleiner Scherz, den nie jemand verstand. Und was das blinde Mädchen betraf – sie ging einfach davon aus, daß er Anwalt war, und es erschien ihm unnötig, ihr den wahren Sachverhalt zu erklären.
Er sah sich unter den Leuten um, die die Halle betraten; er konnte immer diejenigen darunter erkennen, die wegen einer Verhandlung kamen, konnte die Angst vor dem Unbekannten auf ihren Gesichtern lesen. Und dann die Anwälte … wie viele hatte er hier bereits gesehen: so aufgeblasen, so selbstsicher, so wichtigtuerisch.
Heute war Benny mehr als nur ein bißchen aufgeregt wegen der Verhandlung, der er beiwohnen wollte. Es war ein komplizierter Fall, den er verfolgte, seit die erste einstweilige Anordnung auf Sorgerecht vor einigen Monaten eingereicht und abgelehnt worden war; der Vater, Frank Chandler, der mit seiner baldigen Exfrau um das Sorgerecht für den neunjährigen Sohn Andrew stritt, wurde von Rechtsanwältin Margaret Grant vertreten.
Benny hatte fast die gesamten Akten dazu gelesen, und obwohl ein Teil davon nur dummes Geschwätz und der andere nur Lügen enthielt, hatte er ein gutes Gespür für die Situation. Wenn man ein paar Einzelheiten außer acht ließ, dann hätte er sogar so weit gehen und behaupten können, daß das genau sein Fall war, für den Millerman sich nie Mühe gemacht hatte, einen Schriftsatz einzureichen. Der große Unterschied war der, daß Frank Chandler, im Gegensatz zu Benny, immer noch eine Chance hatte, den Jungen zu bekommen: den Aussagen eines Psychologen zufolge hatte dessen Frau bis jetzt noch kein Glück dabei gehabt, den Jungen gegen seinen Vater aufzubringen.
Doch der Fall wurde vor Richter Malcolm Greenspon verhandelt. Von den fünf Vormundschaftsrichtern des Verwaltungsbezirkes Suffolk waren alle – bis auf Campbell, den Oberrichter – eindeutig auf der Seite der Frauen. Aber Greenspon – ein kleingewachsener Mann, dessen Ego aufblühte, wenn er in seine schwarze Robe stieg – war der Schlimmste von allen.
Maggie Grants dickes, schwarzbraunes Haar schwang um ihre Schultern, als sie von den Akten aufblickte und sich ihrem Mandanten zuwandte, der neben ihr saß.
»Entspannen Sie sich, Frank«, sagte sie.
»Wie kommen Sie darauf, daß ich nervös sein könnte?«
Sie deutete auf seine Finger, die auf dem Tisch lagen.
»Trommeln Sie immer so mit Ihren Fingern?«
Er zog seine Hand vom Tisch zurück, schaute auf die Uhr und faltete dann seine Hände im Schoß, wobei er es sorgfältig vermied, einen Blick auf den ähnlich aussehenden Mahagonitisch zu werfen, an dem Sondra und ihr Anwalt saßen.
»Wann geht es denn endlich los?«
«Jeden Augenblick. Greenspon soll angeblich bereits im Amtszimmer sein.« Sie drehte sich wieder um und holte einige Dokumente aus den Akten. Die Gerichtsstenographin, um die Maggie gebeten hatte, ging zu ihrem Platz vor der Richterbank und baute flink ihre Transkriptionsmaschine auf.
»Was ist aus Richter Campbell geworden?« fragte Frank.
»Ich dachte, er sollte diesen Fall hier verhandeln.«
»Kennen Sie den Satz, daß selbst die besten Pläne schiefgehen können? Campbell scheint wegen einer Grippe auszufallen … seit letzter Woche, und Greenspon springt für ihn ein. Ich hatte eigentlich gehofft, er würde rechtzeitig wieder zurücksein.«
»Dann ist der hier nicht so gut?«
»Das habe ich nicht gesagt. Hören Sie, vergessen Sie's, es macht keinen Unterschied. Wir müssen uns darauf konzentrieren, den Fall verständlich und solide zu präsentieren. Und genau das habe ich auch vor.«
»Hören Sie, es tut mir leid, ich will Ihnen nicht auf die Nerven gehen. Ich fühle mich in meinem Maklerbüro, ja vielleicht sogar in einer Küche zu Hause, aber nicht in einem Gerichtssaal. Himmel, ich habe das Gefühl, daß mein Herz gleich stehenbleibt.«
Maggie wandte sich ihm lächelnd wieder zu. Dabei funkelten ihre grünen Augen, was ihre allzu scharfen Gesichtszüge – unter denen sie als schüchterner Teenager gelitten hatte – anziehender machte.
»Ich finde, Sie sehen ganz gesund aus.«
»Ich fühle mich aber nicht so. Ich habe seit fast einer Woche nicht mehr schlafen können. Dauernd geht mir im Kopf herum, daß ich in den Zeugenstand treten und irgend etwas Dummes sagen könnte, etwas, das meinem Fall schadet.«
»Antworten Sie einfach nur auf die Fragen, ohne Reden zu halten oder theatralisch zu werden. Wenn etwas geklärt werden soll, dann erledige ich das im Kreuzverhör. Halten Sie sich in erster Linie an die Wahrheit.«
»Was ist mit Sondras Version der Wahrheit? Und Palmers aufgeblasener Bericht, was machen wir damit?«
»Das überlassen Sie mir.«
»Was ist, wenn –«
»Frank, lassen Sie das.«
Maggie wandte sich wieder ihrer Arbeit zu und ordnete die Dokumente zu vier Stapeln; Frank sah sich im rückwärtigen Teil des kleinen Gerichtssaales um: Ungefähr zwölf Leute saßen auf den Bänken. Ein paar von ihnen kannte er … in einer Frau erkannte er Sylvia Palmer, eine nicht mehr ganz junge Psychologin, die als Jugendamtsvertreterin vom Gericht dazu bestellt worden war, die Aussagen beider Parteien zu überprüfen. Frank hatte vom ersten Moment an, als die ältliche Frau in seine Wohnung marschiert war, das Gefühl, daß sie ihm Probleme bereiten würde, so wie eine dieser lästigen Sozialarbeiterinnen, die die Wohnung nach Staub absuchten. Und ihrem Bericht nach zu schließen, mußte sie eine Menge davon entdeckt haben.
Vor der Palmer saß Kevin O'Malley, ein vom Gericht bestellter Rechtsanwalt, der die Interessen seines Sohnes Andy vertrat. Es war Maggie gewesen, die erbittert um dessen Anwesenheit gekämpft hatte; die gegnerische Seite hatte sich gegen eine Vertretung von Andy mit dem Einwand gewehrt, man könne von einem Neunjährigen nicht verlangen, daß er wisse, was am besten für ihn sei. Andy wollte bei seinem Vater leben, nicht bei seiner Mutter, und das war Frank nur recht. Und wenn jeder Pfennig seines Geldes dafür benötigt werden sollte, er mußte es versuchen. Seine Anwältin war offen zu ihm gewesen, als sie ihm im voraus erklärt hatte, daß die Karten schlecht für ihn standen. Aber wenn er schon kämpfen mußte, dann war er froh, es mit Maggie Grant an der Seite zu tun. Auch wenn sie es herunterspielte: Ihr Ruf, auch für die Väter das Sorgerecht herauszuschlagen, war ausgezeichnet.
Frank warf einen flüchtigen Blick auf den Mann in der letzten Bank … er war ihm völlig fremd. Sein schlecht sitzender, marineblauer Anzug und sein blaugestreiftes Hemd paßten überhaupt nicht zu seiner grellgrünen Krawatte. In der Geschäftswelt hättest du nicht die geringste Chance, Freundchen, dachte er. Frank drehte sich wieder um, fixierte die Richterbank und rang seine schweißnassen Hände. Wann, zum Teufel, wollte dieser Richter Greenspon wohl endlich auftauchen?
Plötzlich stieß ein Gerichtsdiener eine Seitentür auf und wies die Anwesenden an, sich zu erheben. Alle standen auf, und der Gerichtsdiener leierte seinen Spruch herunter.
»Zum Aufruf kommt die Sache Chandler gegen Chandler. Jeder, der vor den ehrenwerten Richtern des Vormundschaftsgerichts von Suffolk gehört werden will, der möge näher treten, und er wird gehört werden. Gott segne das Commonwealth von Massachusetts. Bitte setzen Sie sich wieder.«
Gegen Ende des Vormittags stellte Clyde Wentworth, der gegnerische Anwalt, den Antrag, mit dem Bericht der Jugendamtsvertreterin in die Beweisaufnahme einzutreten, damit Sylvia Palmer den Gerichtssaal verlassen könne, um einen beruflichen Termin wahrzunehmen. Maggie legte Einspruch ein, und Greenspon rief beide Anwälte zur Richterbank.
»Ich sehe kein Problem darin. Schließlich spricht der Bericht für sich selbst«, sagte der Richter und fuhr sich über seinen kurzen, stachligen Bart.
»Hohes Gericht«, sagte Maggie, »es ist mein Recht, sowohl den Bericht als auch die Person, die ihn verfaßt hat, in Frage zu stellen.«
»Mit welcher Begründung?«
»Teile des Berichts basieren lediglich auf ungenauen Aussagen, die Miss Palmer gegenüber von Personen geäußert wurden, die ein persönliches Interesse an dem Fall haben.«
»Ja, wie bei jedem Bericht dieser Art, Frau Rechtsanwältin. Und ich bin mir ziemlich sicher, daß es mir nicht schwerfallen wird, diese Teile als solche zu erkennen.«
»Zusätzlich enthält er eine Reihe ungünstiger Schlußfolgerungen über meinen Mandanten, die auf einer falschen und veralteten psychologischen Theorie beruhen.«
»Mit anderen Worten, Sie wollen Miss Palmers Fähigkeiten in Frage stellen?«
»Ja, wenn es notwendig sein sollte.« Maggie drehte sich um, trat ein paar Schritte zurück, nahm einen Stapel Papiere vom Tisch und wandte sich dann wieder der Richterbank zu. »Ich habe hier drei Artikel aus kürzlich erschienenen Ausgaben psychologischer Fachzeitschriften, die in direktem Widerspruch zu –«
Richter Greenspon klopfte mit seinem Hammer auf den Tisch. »Genug!« Dann, sich zu ihr vorbeugend: »Sagen Sie doch mal, Frau Rechtsanwältin, haben Sie Psychologie studiert?«
»Nein. Aber ich sehe nicht, daß das von Bedeutung sein sollte.«
Die Falten auf Greenspons Stirn vertieften sie zu gezackten Furchen.
»Die Vertreterin des Jugendamtes ist seit mehr als dreißig Jahren als anerkannte Psychologin des Staates Massachusetts zugelassen. Ich würde also vorschlagen, daß wir sie ihre Arbeit machen lassen. Und Sie, Frau Rechtsanwältin, wären besser damit beraten, sich auf Ihr eigenes Fachgebiet zu konzentrieren.«
»Herr Vorsitzender, wir haben es hier mit einem rechtmäßigen Anspruch zu tun! Es ist mein absolutes Recht –« Greenspon blickte zu dem Gerichtsdiener hinüber. »Einspruch abgelehnt. Mit dem Bericht der Jugendamtsvertreterin wird in die Beweisaufnahme eingetreten. Und Miss Palmer ist umgehend von der Teilnahme an dieser Verhandlung befreit.«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis Maggie ihre Fassung wiedererlangt hatte, aber dann sagte sie: »Ich würde gern ein Beweismittel zu Protokoll nehmen lassen, Hohes Gericht.«
»Ich sehe nicht ein, daß das notwendig ist.«
»Im Gegenteil, es ist notwendig.« Ohne seine Zustimmung abzuwarten, wandte Maggie sich an die Gerichtsstenographin und sagte: »Wenn die Anwältin des Klägers die Gelegenheit gehabt hätte, Sylvia Palmer zu befragen, dann hätte sie gezeigt, daß Miss Palmers Meinung nicht auf Tatsachen beruht, die in dieser familiären Situation begründet sind, sondern auf vorgefaßten Meinungen und auf einer veralteten psychologischen Theorie, die davon ausgeht, daß nur eine Mutter dazu in der Lage ist, ein Kind aufzuziehen. Darüber hinaus hätte die Anwältin aufgezeigt, daß Miss Palmers Karriere auf ihrer Auseinandersetzung mit den emotionalen Problemen von Frauen begründet ist und daß sie niemals – ich wiederhole niemals – einen Mann oder ein Kind unter ihren Klienten gehabt hat.«
»Sind Sie fertig?«
Maggie nickte.
Er ließ seinen Hammer auf den Tisch sausen. »Mittagspause. Die Verhandlung wird um zwei Uhr fortgesetzt.« Maggie ging zu dem Tisch zurück, an dem Frank saß. »Nicht so gut, hmm?« meinte er.
In der Sitzung am Nachmittag gelang es Maggie, Sondra Chandler als eine kalte, materialistische Frau hinzustellen, die mehr Gedanken an ihr reges Gesellschaftsleben als an ihren neun Jahre alten Sohn verschwendete. Dennoch hatte sich Greenspon nur wenig Notizen von dieser Zeugenbefragung gemacht.
Bis er vor sieben Monaten das eheliche Heim verlassen hatte, war es Frank Chandler gewesen, der regelmäßig die Einkäufe gemacht, das Pausenbrot für seinen Sohn eingepackt, den Jungen ins Bett gebracht, seine Hausaufgaben überwacht und einen großen Teil seiner Abende und Wochenenden zusammen mit Andy verbracht hatte. Es war Frank gewesen, den im letzten Jahr die Schulschwester zweimal verständigt hatte, als Andy krank geworden war. Sondra Chandler war nur selten zu erreichen gewesen.
Doch trotz dieser Zeugenaussage und der Einrede, die am folgenden Tag OʼMalley, Andys Anwalt, erheben wollte, würde der Bericht der Jugendamtsvertreterin für Greenspon der Beweis mit der größten Wirkungskraft sein. Maggie wußte, daß sie keine Chance hatte, wenn es ihr nicht gelang, die überholte Meinung von Miss Palmer zu entkräften. Und obwohl sie Frank Chandler gegenüber nicht ganz so offen gewesen war, so war er doch nicht dumm. Am Ende dieses Tages würde er die Chancen selbst beurteilen können.
Ausgerechnet dieser Greenspon … Natürlich hatte sie durch das Beweismittel ihr Recht auf Berufung gesichert, aber bei Familienrechtsangelegenheiten bei einem höheren Gericht Berufung einzulegen war oft ein nutzloses Unterfangen. Die Zeit war das Problem. Die Kinder wurden zwangsläufig älter, während der Prozeß sich im Schneckentempo dahinschleppte.
Zu Zeiten wie diesen fragte Maggie sich oft, ob ihr Vater vielleicht nicht recht gehabt hatte, als er versuchte, sie zu überreden, doch in seine Anwaltspraxis in Manhattan einzutreten. »Um auf einem weniger unerfreulichen Rechtsgebiet tätig zu sein«, wie er gesagt hatte. Wie hätte der ehrenwerte Seymour Templeton angesichts eines skrupellosen Richters wie Greenspon wohl reagiert?
Ja, das Familienrecht hatte viele unangenehme Begleiterscheinungen: verbitterte, empörte Eheleute, die sich rächen, ihre schwer angeschlagene Psyche wieder zusammenflicken wollten. Und doch war der unangenehmste Teil der Angelegenheit – die Regelung des Sorgerechts, das, was mit den Kindern geschehen sollte – für Maggie zugleich auch der lohnendste. Zumindest war es so, wenn eine vernünftige Lösung gefunden werden konnte.
In den acht Jahren ihrer Berufserfahrung hatte Maggie nur einmal einen Mandanten angenommen, an den sie nicht wirklich geglaubt hatte. Nach einer schrecklichen Schlacht vor Gericht gewann sie das Sorgerecht für diese Mutter, litt anschließend aber wochenlang Seelenqualen wegen des Urteils und schwor sich dann, nie mehr wissentlich auf der falschen Seite eines Sorgerechtfalls zu stehen.
Obwohl sie versuchte, sich an den Schwur zu halten, bedeutete es keine große Gewissenserleichterung für sie. Zwei Jahre später las sie im Boston Globe einen Artikel über eine junge Mutter, die verhaftet worden war, nachdem sie ihren vier Jahre alten Sohn in der Badewanne ertränkt hatte: Die junge Mutter war die Mandantin gewesen, die Maggie vor Gericht vertreten hatte.
Als Maggie an diesem Abend ihr kleines, eineinhalbstöckiges Haus erreichte, das auf einem großen, baumbestandenen Grundstück in Brookline lag und das sie kurz nach ihrer Scheidung erworben hatte, blockierte Pauls gelbe Corvette die breite Auffahrt. Sie schluckte ihren Ärger hinunter und parkte am Straßenrand.
»Du bist spät dran«, rief Paul ihr aus dem Wohnzimmer zu, als sie ins Haus trat. Sie ging durch die Küche und dann zwei Stufen hinunter in das Wohnzimmer, wo ihr Exmann neben der eingebauten Bar stand.
»Hallo, wo ist Richie?« fragte sie.
Mit den Fingerspitzen rührte Paul vorsichtig die Eiswürfel im Glas um und führte dann die bernsteinfarbene Flüssigkeit zum Mund.
»Paul, wo ist Richie?«
»Du bist eine Viertelstunde zu spät zu Hause«, sagte er.
»Tut mir leid, der Verkehr war mörderisch.« Sie zog ihren dunkelblauen Trenchcoat aus, warf ihn zusammen mit ihrer Aktenmappe auf das Sofa und wandte sich wieder den Stufen zu.
»He, wo gehst du hin?«
»Unseren Sohn suchen. Aus dir scheine ich ja keine Antwort herauszubekommen.«
Er deutete mit dem halbvollen Glas in eine Richtung.
»Draußen im Hof.«
Sie warf einen Blick aus dem Fenster, entdeckte Richie auf dem verwitterten Abenteuerspielplatz und drehte sich wieder zu Paul um. Er trug einen dicken, weißen Pullover und enge Designer-Jeans … er war immer noch so jungenhaft schlank wie an dem Tag, an dem sie ihn kennengelernt hatte. Und als hätte er ihre Gedanken gelesen, fragte er: »Sag mal, hast du zugenommen?«
Verlegen strich sie sich mit der Hand über die Hüften.
»Ein paar Pfund vielleicht.«
»Steht dir aber nicht schlecht«, meinte er und musterte sie.
»Du siehst dadurch sehr sinnlich aus. Aber mehr solltest du nicht zunehmen.«
»Danke für die Warnung. Aber wenn du nichts dagegen hast, Paul, ich muß jetzt das Abendessen machen.«
»Ja bitte, laß dich von mir nicht stören.« Er hob die Flasche mit dem Whiskey und füllte erneut sein Glas.
Maggie ging zu ihm und legte ihre Hand über das Glas.
»Ich möchte gern, daß du gehst, Paul. Sofort.«
Er packte sein Glas und verschüttete dabei die Hälfte des Drinks auf der Bar. »Warte, ich wisch es weg«, sagte er, zog ein Taschentuch aus der Hosentasche und beseitigte die Pfütze.
Sie blickte ihm in seine blauen Augen und entdeckte dort die vertraute Glasigkeit.
»Du hast schon getrunken, bevor du hierhergekommen bist, stimmt’ʼs?«
»Beruhige dich, Maggie, ich hatte nur ein paar Drinks.«
»Ich möchte nicht, daß du trinkst und dabei mit Richie im Auto fährst.«
»Richie geht es gut, überzeug dich selbst. Würdest du jetzt zur Abwechslung mal von etwas anderem reden? Himmel, hast du schon mal was von dem Wort Dankbarkeit gehört?«
»Das ist mir im Zusammenhang mit dir nicht mehr geläufig.«
»Dankbarkeit. Mir scheint, du solltest wirklich deinem Glücksstern danken, daß ich bereit bin, mich so oft um Richie zu kümmern. Und dürfte ich vielleicht noch erwähnen, daß ich dir damit eine große Last abnehme.«
»Du bist doch derjenige, der eine freizügige Umgangsregelung wollte, und du hast sie auch bekommen … sooft du willst. Wenn du jetzt die Verantwortung nicht mehr übernehmen willst oder damit nicht mehr umgehen kannst, dann sag es einfach. Aber ich werde nicht zulassen, daß du unseren Sohn irgendwelchen Gefahren aussetzt … verstehst du mich?«
»Mommy, ist das Abendessen schon fertig?«
Maggie drehte sich um und sah, daß Richie auf den Stufen stand. Der Sechsjährige war ein getreues Abbild sowohl von ihr als auch von Paul. Er hatte Pauls sandblondes Haar und seine ebenmäßigen Züge, aber ihre olivdunkle Haut und grünen Augen. Maggie mochte es gar nicht, wenn er ihre Streitereien mitbekam – in den Jahren vor ihrer Scheidung hatte er bereits zu viele davon mit anhören müssen.
»Noch nicht, Liebling«, sagte sie. »Also gut, erzähl mir doch, ob es dir heute in Daddys Wohnung gefallen hat?« Endlich lächelte er und zeigte dabei seine beiden Zahnlücken. »Und wie. Und weißt du was?«
»Was?«
»Da ist jetzt ein Mann, der den Swimmingpool saubermacht. Mit einer großen, langen Bürste, mit der er überall hinkommt. Im nächsten Monat, meint Daddy, wird der Pool wieder gefüllt, und dann können wir schwimmen gehen.«
Sie lächelte, kniete sich hin und gab ihm einen Kuß auf den Nacken.
»Klingt gut.« Dann, mit dem Kopf in Richtung Paul deutend, sagte sie: »Sag Daddy auf Wiedersehen, er geht jetzt.«
Dann rannte Richie nach oben, um sich die Hände zu waschen, und Maggie schaute vom Vorderfenster aus zu, wie Pauls Sportwagen quietschend aus der Auffahrt fuhr. Er trank wirklich zuviel. Aber vielleicht hätte sie ihn doch nicht so schnell aus dem Haus werfen sollen …
Sich vom Fenster abwendend, kehrte sie in die Küche zurück und ging zum Kühlschrank – aufgetaute Ravioli und ein rasch angemachter Salat würden für heute abend genügen müssen. Ihre Gedanken wanderten wieder zu der Verhandlung zurück. Sie hatte sie verpatzt, und Frank Chandler würde das wahrscheinlich teuer zu stehen kommen: Sie hätte versuchen sollen, die Sitzung zu verschieben, sobald sie erfahren hatte, daß Greenspon Campbell vertreten würde.
2. KAPITEL
Wenn sie genauer hätte sagen sollen, was ihr zuerst an ihm aufgefallen war, dann hätte sie geantwortet, daß es die Traurigkeit in seinen Augen war. Natürlich hatte er außerdem auch noch gut ausgesehen – nachdem sie ihn mehr als einmal verstohlen gemustert hatte, war ihr sein kantiges Profil bereits tief ins Gedächtnis eingegraben. Doch als ihr auffiel, wie seine grauen Augen wie zufällig aufblickten und sie in dem Spiegel hinter der Reihe von Whiskeyflaschen ansahen, sich aber sofort wieder auf sein Bierglas senkten, da wußte sie, daß er sie niemals ansprechen würde. Wenn sie ihn kennenlernen wollte, dann mußte sie ihren ganzen Mut aufbringen und die Sache selbst in die Hand nehmen.
Als sie gegen halb zwölf abends in Bennigans Grillbar im Norden Bostons kam, setzte sie sich neben ihn, bestellte sich ein Bier vom Faß, riß umständlich das Papier von einer Packung Marlboroughs und zog eine Zigarette heraus. »Entschuldigen Sie«, sagte sie und hoffte, man möge ihrer Stimme ihre Unerfahrenheit nicht anmerken, »haben Sie vielleicht Feuer?«
Zuerst dachte sie, er hätte sie nicht gehört oder, schlimmer noch, würde sie ignorieren. Es folgte ein langes Schweigen, aber dann beugte er sich unvermittelt vor und fischte ein Streichholzbriefchen von Bennigans Bar aus einem Korb auf der Theke.
Sie spürte, wie ihr warm im Gesicht wurde. »Daß es mich nicht gebissen hat … «
Er brach ein Streichholz ab, zündete es an, schützte die Flamme mit der hohlen Hand und meinte: »Und, wollen Sie sie auch rauchen?« Ihr fiel auf, daß seine grauen Augen mit winzigen schwarzen Punkten gesprenkelt waren.
Sie steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und hielt sie an die Flamme; sie nahm einen Zug, hustete ein paarmal, nahm dann noch einen tiefen Zug, und die Flamme setzte ihre Zigarette in Brand. Sie riß sich die Zigarette aus dem Mund und drückte sie im Aschenbecher aus.
»Vergessen Sie's«, meinte sie.
Er warf das Streichholz weg, wandte sich wieder seinem Bier zu, und sie saß da und versuchte so zu tun, als wäre das Fiasko nicht passiert. Schließlich schaute er sie doch an.
»He, Sie rauchen doch eigentlich gar nicht, stimmt's?«
»Sagen Sie bloß nicht, das haben Sie eben erst bemerkt.« Er zuckte mit den Achseln und wandte sich wieder ab. »Hören Sie, es tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe nur das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Sie wissen doch sicher, wie es ist, wenn man bemerkt, daß man sich zum Narren gemacht hat.« Sie lächelte und entblößte dabei einen Schneidezahn, an dem ein Stück fehlte. »Wer weiß, vielleicht wissen Sie es ja auch nicht.« Ohne auf ihre Bemerkung einzugehen, sagte er: »Ich sehe es nicht gerne, wenn Frauen rauchen.«
Schweigen.
»Wollen Sie damit sagen, Sie haben das alles nur auf sich genommen, um mich kennenzulernen?«
»Reicht es nicht schon, daß ich es getan habe, muß ich es Ihnen auch noch schriftlich geben?«
»Warum?«
»Warum was?«
»Warum wollten Sie mich kennenlernen?«
»Nun, mir ist aufgefallen, daß Sie immer nach elf Uhr hier hereinkommen. Dann sitzen Sie einfach so eine oder zwei Stunden herum und machen dabei einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck. Ich habe nie bemerkt, daß Sie mit jemandem gesprochen hätten.« Sie zögerte und lachte dann verlegen. »Ich weiß nicht, warum will man wohl jemanden kennenlernen?«
Er schien eine Weile über die Frage nachzudenken, als wäre sie von großer Bedeutung.
»Wie heißen Sie?« fragte er schließlich.
»Es ist ein ziemlich alberner Name … versprechen Sie mir, daß Sie mich nicht auslachen werden, wenn Sie ihn hören?«
Er nickte. Er hatte schmale Lippen, die nicht oft zu lächeln schienen.
»Daisey … so wie das Gänseblümchen, Daisey Bradley.« Er nickte ein paarmal und sagte dann: »Ich kannte einmal ein Mädchen namens Rose, und in der siebten Klasse saß ich neben einer Violet. Aber ich habe noch nie eine Daisey kennengelernt. Das ist ein hübscher Name, der ist schon in Ordnung.«
»Sie wollen doch nur höflich sein. Aber trotzdem, vielen Dank.«
Sie schwiegen ein paar Minuten. »Ich heiße Benny Shandling«, sagte er schließlich. »Wo haben Sie sich Ihren Schneidezahn abgebrochen?«
»Beim Rollschuhlaufen … als ich noch klein war. Sieht fürchterlich aus, stimmt's?«
»Nein. Ich war nur neugierig, das ist alles.«
»Aha.« Nach einer Pause fragte sie: »Sind Sie verheiratet, Benny?«
»Wenn ich es wäre, was würde ich dann hier treiben?«
»Wenn Sie sich ab und zu mal umhörten, dann kämen Sie vielleicht dahinter, daß die Hälfte der Männer, die in solchen Bars verkehren, verheiratet ist. Die andere Hälfte ist natürlich geschieden.«
»Ich interessiere mich nicht sehr für Dinge, die außerhalb meines Kreises passieren.«
»Aus welchen Menschen besteht denn Ihr Kreis, Benny?«
»Oh, das ist nicht so wörtlich zu nehmen. Ich versuche einfach nur, meine Nase nicht in Dinge zu stecken, die mich nichts angehen. Natürlich passiert mir das manchmal ohne mein Zutun, aber dann kann ich nichts daran ändern.«
Sie nahm einen Schluck Bier und stellte dann das Glas auf die Theke.
»Ich gehe auch nicht sehr viel unter die Leute. Ab und zu gehen Liz, das ist meine Freundin und Arbeitskollegin, und ich nach der Arbeit zusammen weg. Ich arbeite als Verkäuferin in einem Antiquariat … nicht gerade ein sehr aufregender Job.«
Er nickte zustimmend.
»Hierher komme ich natürlich ziemlich regelmäßig. Das ist die einzige Bar, in die ich es wage, alleine zu gehen. In den meisten anderen Kneipen fühle ich mich unwohl. Hier fühle ich mich fast wie zu Hause.« Sie zuckte mit den Achseln. »Vielleicht weil ich daran gewöhnt bin.«
»Als ich noch verheiratet war, da bin ich nicht oft in Bars gegangen. Ich halte eigentlich nicht viel davon. Wenn man verheiratet ist, dann sollte man meiner Meinung nach daheim bei seiner Familie sein. Aber wenn man allein ist, dann bleibt einem natürlich nicht viel anderes übrig, oder?«
»Wann wurden Sie denn geschieden?«
»Es ist jetzt mehr als drei Jahre her.« Ein paar Minuten lang herrschte verlegenes Schweigen, dann fragte Benny: »Wollen Sie ein Foto von meinem Jungen sehen?«
»Sicher – ich habe Kinder sehr gern.«
Benny holte eine abgewetzte Schweinslederbrieftasche aus der Gesäßtasche seiner Jeans und schlug das Bild eines ungefähr dreijährigen Jungen auf: er hatte braunes Haar und dunkle Haut wie er selbst. Dann blätterte er zu einem anderen Foto weiter, das aber so unscharf war, daß sie kaum etwas darauf erkennen konnte.
»Was ist denn damit passiert?« fragte sie.
»Ich stand ziemlich weit weg. Das ist die beste Aufnahme, die ich machen konnte.«
»Warum haben Sie ihn nicht näher vor die Kamera gestellt?«
»Das hätte ich ja auch, aber Adam will mich nicht sehen. Ich habe das Foto heimlich aufgenommen, ohne daß er es bemerkt hat.«
Daisey musterte ein paar Augenblicke Bennys Gesicht und schaute dann wieder auf das erste Foto.
»Wie alt ist Adam jetzt?«
»Fünf. Es ist kaum zu glauben – er geht bereits in die Schule.«
»Er ist ein richtig hübsches Kind. Er sieht Ihnen ähnlich.«
»Ja, finden Sie?«
»Das finde ich nicht nur, das ist so.«
Er nickte und deutete dann auf das Handgelenk des Jungen. »Ich weiß nicht, ob Sie das auf dem Foto erkennen können, aber er hat ein Muttermal. Sehen Sie, es ist wie ein Hammer geformt.« Auf der Innenseite des linken Handgelenks deutete Benny stolz auf sein eigenes rotes, hammerförmiges Muttermal.
Als Daisey schließlich die Bar verließ, hatte sie einiges über Benny erfahren. Seit seinem sechzehnten Lebensjahr arbeitete er als Krankenpfleger am Massachusetts General Hospital. Er hatte ein schäbiges Zimmer in einer Pension ohne Fahrstuhl im Norden der Stadt, um Geld für seinen Sohn auf die Seite legen zu können; obwohl seine Exfrau ihm immer die Schecks zurücksandte, die er ihr nach der Scheidung für das Kind geschickt hatte, ging er jeden Freitag auf die Shawmut-Bank und zahlte dort fünfundsiebzig Dollar, manchmal auch mehr, auf ein Konto ein, das auf Adams Namen lautete und ihn selbst als Treuhänder auswies.
»Eines Tages wird er eine Menge Geld haben«, erklärte Benny ihr. »Wer weiß, vielleicht macht er sogar sein eigenes Geschäft auf.«
Daisey hatte eine Menge geschiedener Männer in Bars kennengelernt, aber noch nie einen wie Benny. Etwas begriff sie nicht und wagte auch nicht, danach zu fragen – schließlich kannten sie einander kaum –, aber warum sollte sich ein Fünfjähriger weigern, seinen eigenen Vater zu sehen, besonders einen so netten wie Benny?