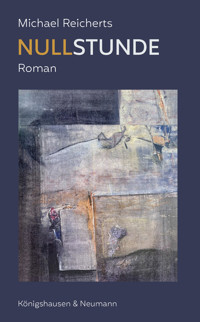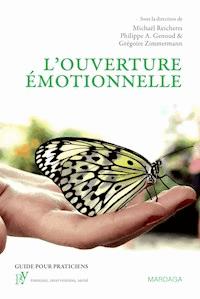Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Königshausen & Neumann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman führt in eine Welt individueller Endzeiten, wo Lina Engels mit ihrem Pflegedienst die letzten Bande knüpft, gesund und am Leben hält. Sie kämpft einfallsreich und beherzt um ihre Klientinnen und Klienten, um deren Stoffwechsel – die elementaren Prozesse ihres Lebens –, um deren Lebensmut und Würde. Lina ist mit ihrem Team von Engels Pflege erfolgreich, doch ihre Arbeit hat einen hohen Preis: Ihr Betrieb ist feindlichen Übernahmeversuchen ausgesetzt, Hackerangriffen und Abwerbungen – und sie selbst gerät dabei immer tiefer in eine psychische Krise: Burnout. Ihr Weg zurück zu sich selbst scheint unendlich schwer – und sie würde Pflege neu erfinden müssen: Vielleicht mit einem Konzept wie Aurora, das den Menschen Lebensfreude und Selbstbestimmung über ihre letzten Tage wiedergeben soll. Im Berlin der Jahre 2015–2016 folgen wir dem Weg von Lina Engels. Sie wird begleitet von ihrer Freundin Alma Berman, einer klinischen Psychologin, von ihrem neuen Kollegen Paule Jecker, dem Juristen Werner Wohlgenannt und ihrem Team engagierter Pflegerinnen und Pfleger – und einem imaginierten Papagei. Dabei begegnet sie einer schier unerschöpflichen und faszinierenden Vielfalt von Schicksalen, Lebensfäden, Persönlichkeiten und Schwierigkeiten, Menschen verschiedenster Herkunft und Lebenskraft – immer neuen, wechselnden Stoffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Reicherts
Stoffwechsel
Roman
Königshausen & Neumann
Neben wissenschaftlichen Publikationen als Professor der Psychologie schreibt Michael Reicherts auch Erzählungen und Romane. Nach dem Erzählband «Liebe[n] & Tod[e]» ist der Roman «Stoffwechsel» sein zweites Werk bei Königshausen & Neumann. Für ihn ist Literatur auch eine Fortsetzung psychologischer Erkundung mit anderen Mitteln. Er lebt in Fribourg/Schweiz und Berlin.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg 2023
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
Umschlag: skh-softics / coverart
Umschlaggestaltung unter Verwendung eines Bildes von Andrea Schedle
Bindung: docupoint GmbH, Magdeburg
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
ISBN 978-3-8260-8161-3
eISBN 978-3-8260-8162-0
www.koenigshausen-neumann.de
www.ebook.de
www.buchhandel.de
www.buchkatalog.de
Eins
Ein Morgen
Geschmack und Hauch der Berührung, rötlich-blass, unbezwingbar, unentrinnbar, breiteten sich in zarten Wehen aus, und Lina wollte mehr davon. Um sie war Brocante-Gerümpel, Lampen, Etageren, Vitrinen, Porzellan, Puppen, alles zwischen Schrott und verstaubtem, vergangenem Glanz, Jugendstil, Art-Déco… Aber sie wollte nur mehr Berührung, Hauch und Geschmack.
Die Zähne des Weckers, der dicht vor ihren Augen eisern tickte und dann schrillte, rissen sie heraus aus dem Traum, aber der Geschmack blieb. Er war umwerfend: Der Kuss aus solcher Ferne, aus solcher Vorzeit, bevor sie begannen, sich wirklich zu nähern, sich ganz nah zu kommen. Wir dürfen das nicht, flüsterte sie – es ist zu gefährlich – und sie ahnte, sie könnte hineinstürzen in den flüssigen Kern des Vulkans. Und er: glitt die Treppen hinunter, in die Vorhölle des Hinterhofs, schwarze Wände wie in einer Szenetoilette der Achtziger, mit eingeritzten obszönen Graffiti. Sie ging hinter ihm her.
Heute Nacht also hatte Oliver sie im Traum besucht! Das erste Mal seit Jahren. Genauer: Sie hatte ihn getroffen in einer Wohnung, die ihre und nicht die ihre war, vollgestellt mit Unnötigem, man musste staksen wie ein Wasservogel, um hindurchzugehen. Der kleine Wecker hatte seine schnarrenden Zähne hineingetrieben in den Kuss, den er ihr, den sie sich gegeben hatten. Ein getupfter Kuss, die Lippen berührten sich ganz leicht, und gehauchte Feuchte und köstlicher Geschmack blieben auf ihrem Mund, wollten in ihren Mund. Es fuhr ein Gefühl in sie, so überwältigend, so überraschend, so endgültig, entrückt… bis sie die Augen aufschlug. Doch der Kuss blieb bei ihr. Den ganzen wirbelnden Tag würde sie mit ihm verbringen, in einem Wachtraum im Traum. Sie verstand, wie wichtig der Kuss war, wie wichtig Küsse für sie waren, immer noch – in dieser schon langanhaltenden Trockenzeit des Alleinseins.
Lina schaute kaum über den Rand des Tages… Kaffee – Kaffee!, blinkte der innere Alarm: schwarzes Gold! Und dieser seltsame Traum ragte noch in den Morgen – die Fäden hingen noch an ihr, während sie mühsam aus dem Kokon des Schlafs kroch. Ihre Bewegungen waren noch etwas tapsig, «unrund», wie sie in einer Diagnose sagen würde. Ohne schwarzes Gold war sie ein Muffel, ein Wrack und Junkie – und nahm ihre schöne neue Le-Corbusier-Liege gar nicht wahr, über die sie fast stolperte. Stattdessen stapfte sie mit der großen Bechertasse in der Hand durch die Wohnung: Nach zwei dicken, heißen, betäubenden Schlucken schob sie sich in die Dusche und zog den Einhandmischer auf, in der Rechten noch die Tasse. Der Kaffeegeschmack spülte ihren Gaumen, das warme Wasser rann über ihr Gesicht, umquirlte ihren Körper, den sie nun in den hundertfachen Strahl hineinräkelte. Es war purer Luxus, ein Moment des Behagens, und sie genoss ihn – sie wusste, nichts war selbstverständlich! Und die meisten ihrer Klienten und Patientinnen lebten fern von solchem Luxus, konnten ihn sich kaum vorstellen: Den Mund mit edlem Arabica gefüllt (sie trank sogar unter der Dusche einen weiteren dicken Schluck), das sprinkelnde Wasser aus einem Duschkopf breit wie ein Regenschirm, ein milder Sommerregen. Darin wand sie sich mit ihrem Traumfragment, drehte sich und tänzelte jetzt, erst beschwingt, mit ein paar angedeuteten Tanzschritten, doch zunehmend beunruhigt. Sich duschen können, sich mit der Hand über die Haut fahren, über den Bauch, die Brüste, das Gesicht den feinporigen Schaum verteilen, im flüsternden Kuss des flirrend-warmen Wassers! Nicht dass sie gezweifelt hätte – aber es war ein Privileg, in dem sie leben durfte – und immer wieder wünschte sie mit ganzem Herzen, wie in einem kleinen Morgengebet, dass viele – alle! – solche Momente umfassenden körperlichen, organischen Genießens erleben sollten! Und wie schon oft, gab ihr das «Gebet» die Kraft, in einen schwierigen Tag hinaufzusteigen.
Sie ging die Grobplanung des Tages durch. Mit dem heutigen Tag würde eine Phase beginnen, wo sie selbst wieder mehr Pflege-Touren übernehmen würde, drei Personen ihrer Equipe waren krank, zwei neue mussten eingearbeitet werden. Daneben waren, wie sonst auch, ihre Kontrollbesuche bei den Klientinnen und Klienten zu machen: Sie würde prüfen, wie es ihnen ging, mit ihnen sprechen und die Pflegeverträge checken, ob sie erhielten, was sie brauchten – und nach dem Rechten sehen, auch wegen der Unregelmäßigkeiten bei zwei ihrer Pflegerinnen: bei Nicole Goppert, vor allem aber bei Priska Karlova. Sie ging die Klienten durch, die sie später besuchen würde, sie dachte an das quälende Meeting mit den Sozialverantwortlichen vom Bezirksamt und das Hearing im Sozialministerium – über die Vorlage für die neuen, verschärften Datenschutz-Richtlinien! So vieles war in den vergangenen Jahren gut und rund gelaufen, abgesehen von dem einen oder anderen Missgeschick, von manchem schwarzen Schaf unter ihren Mitarbeitern und einigen prekären Situationen, Verkettungen unglücklicher Umstände bei den Klienten. Doch in den letzten Monaten häuften sich Probleme, Notfälle, Anrufe von Klientinnen, externe Kontrollen vom Sozialamt, Kündigungen und Unruhe unter den Mitarbeitenden. Sie musste sich darum kümmern, aktiv werden. Und sie wusste: Ein gutes Stück Arbeit lag vor ihr – doch in drei Monaten würde sie sich mit einem kleinen Urlaub belohnen, Wind, Sand und Sterne. Alle diese Gedanken vermischten sich beim Abtrocknen und wurden schließlich verwirbelt, während sie sich die Haare föhnte und die Stirn freiblies.
Das Frühstück war nur ein Happs – gesund, aber zu kurz: eine Banane, eine Scheibe Vollkornbrot, ein Joghurt. Trotz aller Routine war es später geworden, und sie musste sich beeilen, wollte sie wie üblich die Erste im Service sein. Der Traum, dessen Tentakeln immer noch nach ihr griffen, und den sie auch mit der zweiten großen Tasse Kaffee nicht auflösen, nicht herunterspülen konnte, blieb um sie, wohlwollend, lockend und beunruhigend: Er gaukelte ihr von der Möglichkeit der Fülle eines anderen Lebens, das sie – so ähnlich – früher einmal hatte…? Warteten nicht überhaupt viele Möglichkeitsleben auf sie, wenn sie nur im rechten Moment (Kairos!, sie wusste) offen war dafür? Ja, offen musste sie sein! Offen!
Sie versuchte, den Tag «vorzusichten», obwohl sie wusste, dass fast alle Planung im Verlauf des Tages überrollt wurde – Unvorhergesehenes, kleinere und größere Katastrophen, die einbrachen in ihre Ordnungsversuche, Zeiteinteilung und Organisation. Jetzt endlich fiel ihr Blick auf die Corbusier-Liege, die vorgestern Abend geliefert wurde, eine elegante Design-Ikone, wie man sagte, Symbol für kühle Originalität und edle Entspannung. Eine Chromstahlliege ohne Armlehnen, wie eine Design-Bahre!, dachte sie und musste lächeln: ein eleganter Operationstisch mit schwarzer Lederauflage – auf dem sie sich für die kleinen Unterbrechungen des Abends, des Wochenendes ausstrecken und hingeben würde einem Powernap oder einer kleinen lässigen Lektüre… Wie sehr ihr das fehlte zurzeit! Viel mehr als ein großer, anderer Lebensentwurf!
Und schlagartig tauchten die Gesichter ihrer heutigen Klienten vor ihr auf: Die gehbehinderte, kettenrauchende Katschnig, der magenkranke Nebel, der kein Wasser trank, das symbiotische Geschwisterpaar Horst und Lilly Eggert, die Horsts gefährlichen Zucker dickköpfig fehlbehandelten – alles Fälle, die in letzten Wochen Schatten geworfen hatten… Und sie sah Priska Karlova vor sich, eine ihrer schwierigen Pflegerinnen, wie sie wieder zu lügen versuchte, sie dachte an die Not, in die man geraten konnte, wenn man auf ihre Pflege angewiesen war und ihr nicht entkommen konnte. Wie nur sollte sie ihre Klientinnen, wie die ängstliche Hilde Breuer, vor Priskas Übergriffen und ihrer Raublust schützen – sie musste endgültig abklären, was ihr zu Ohren gekommen war – und handeln. Wieder einmal sah sie sich für einen Moment als Kriminal-Ermittlerin unter naiven, arglosen, wehrlosen Klienten, umgeben von einigen stumpfen oder gerissenen Pflegekräften, vor einer Wand des stillen Leidens, des Munkelns und Schweigens.
Unten in der Garage, ein paar Häuser weiter, stieg sie in ihren Fiat 500, Sportausführung, kompakt, mit einem Hauch von Luxus. Sie war keine Raserin, rasen interessierte sie nicht in der zähflüssigen, autogefluteten Stadt, in den Adern dieses grotesken, urbanen Traums, der hier in entfesselten Straßen-Rennen immer wieder Tote und Verletzte forderte. «Geschwindigkeit» als solche fand sie völlig überbewertet, ja pervers unter solchen Bedingungen. Aber sie genoss die Beschleunigung, den Start aus dem Stand vor einer Ampel, die auf Grün schaltete, diesen kraftvollen kurzen Schub, der von hinten Becken, Rücken und Hinterkopf nach vorne trieb, sie genoss, wie sie von den 140 PS in dem kleinen Wagen nach vorne katapultiert wurde, um dann bei 60 plus abrupt vom Pedal zu gehen und das jähe Nachlassen der Schubkraft zu spüren, denn im Gipfel der Geschwindigkeitskurve lockte ein kostbarer Augenblick von Schwerelosigkeit. So genoss sie die vier, fünf Antritte, bei denen sie losjagte, sich anderen Wagen vorauskatapultierte.
Vorfrühling mit Goldrand
Der goldgeränderte, rötlich behauchte Morgenhimmel über dem Osten Berlins, als sie nach «Kreuzkölln» unterwegs war – kurz bevor sie die Morgensonne traf! Allererste Zeichen des Vorfrühlings zeigten sich in dem blassen Grün des Tempelhofer Felds und dem noch winterkalten Gras vor den Fassaden des Flughafens. Als sie an der Hasenheide vorbeirollte, schienen die Spitzen der winterschwarzen Baumskelette überzogen von einem violetten Hauch, den Vorboten der ersten Knospen. Versöhnlich lag ein Keim von Glück über ihrem morgendlichen Realismus, der bisweilen hin und her kippte zwischen ihrem Optimismus des Anpackens, Machens, ihrer Tatkraft und manchem pessimistischen Schatten.
Aus diesem Bild startete sie jetzt an der Ampel los, schoss davon in den Augenblick der Schwerelosigkeit… Doch bald, auf der Karl-Marx-Straße wurde alles mühsam, ein zäher Spießrutenlauf zwischen ein- und ausbiegenden Wagen, den Fahrrädern, die aus dem Nichts auftauchten, von den Bürgersteigen auf die Straße schossen und sich überall hineinmogelten, die den zahllosen Kleintransportern auswichen, die die rechte Fahrspur hemmungslos zugeparkt hatten und aus dem breiten Boulevard einen winzigen Durchlass machten, durch den sich Busse, Lastwagen, Ambulanzen und Polizeifahrzeuge mit dem Normalverkehr hineinzwängen und hindurchkämpfen mussten. Lina rollte im Schritt und wenn sie, wie jetzt, das Martinshorn einer blinkend festsitzenden, ausgebremsten Ambulanz hörte, fürchtete sie um die Patienten, die womöglich in einem lebensrettenden Transport zum Krankenhaus unterwegs in diesem anarchischen Verkehr kostbare Zeit verloren, ihr Leben verwirkten.
In den Vierteln um die Karl-Marx-Straße, wo Engels Pflege ihren Sitz hatte, wo sich die Zentrale mit den Büros befand, wo die Flotte der kleinen Wagen mit den Engelsflügeln auf den Türen in der Tiefgarage bereitstanden, herrschte Multikulti: Türken, Araber, Chinesen und Inder, eine Diaspora von Polen und Russen. Neben viele älteren lebten hier auch zugezogene junge Berliner, Engländer, Franzosen und viele Menschen vom Drogen- und Alkohol-Prekariat, Hausbesetzer und Anarchos… So litten die Eingangstür und der Hauseingang von Engels Pflege unter häufiger Verunreinigung mit Graffiti, Müll und Urin.
Ankunft in der Zentrale von Engels Pflege
Die Zentrale des Engels Pflege Service war im ersten Stock einer 250-qm-Wohnung untergebracht, die Eingangstüre stahlarmiert, mit dreifachen Querriegeln. Man betrat einen großen Flur, auf der rechten Seite ein langer Tresen, darauf eine bunte Bonbonschale und links eine Schale mit kleinen Schokoladen und Gebäck, für die alle einmal etwas mitbrachten, und wenn nicht, füllte Lina nach. Dahinter lag das Büro von Lina, daneben das von Angela Becher und Hanne Haggert, der stellvertretenden Leiterin. Dem Tresen gegenüber, auf der linken Seite des Eingangsbereichs, stiegen Einbauschränke hinauf bis zu der hohen Decke. Am hinteren Ende des Eingangsbereichs lagen zwei Toiletten, das große Bad und neben dem Archivraum zwei Lagerräume, in denen Medikamente, medizinisches Pflegematerial, Putzzeug, Toilettenpapier, Werkzeug, Bereitschaftstaschen und diverses Reserve-Material untergebracht waren, aber auch Rollatoren, Polsterkeile, Krücken und andere Pflegehilfsmittel. In der Schrankwand auf der linken Seite war ein Durchbruch zu einem großen Raum mit einem gewaltigen Tisch, umstellt von zwölf Stühlen: Er war Aufenthaltsraum, Pausen- und Sitzungsraum für das gesamte Team. Auf dem Tisch ein großer Blumenstrauß, den Lina alle paar Tage wechselte. Über einem langgestreckten Sideboard, auf dem zwei Kaffeemaschinen, ein Wasserkocher, zwei Kochplatten und Geschirr standen, sah man eine lange Reihe kleiner Fächer mit seltsamem Inhalt: Postkarten, Fotos, bemalte Kiesel, Plastikblümchen, Püppchen, Kerzen, winziger Nippes, gehäkelte Lappen, ein Origami-Kranich, ein Rosenkranz, der hinaushing – der «Friedhof der armen Socken». Auf der anderen Seite zog sich eine Reihe schlanker stählerner Spinde für die Mitarbeitenden bis zu der breiten Fensterwand, durch die aus dem großen Innenhof wuchtiges Morgenlicht drang, grün gefiltert von dem ersten, frischen Blattwerk der stattlichen Kastanien.
Der Morgen in der Zentrale
Nach dem Aufschließen stellte Lina fest, dass Priska Karlova schon angekommen war, flink Sachen in ihren Spind räumte und wortlos verschwand. Lina stellte als Erstes einen großen Strauß leuchtender Tulpen auf den Tisch und räumte im Empfangsbereich noch etwas auf. In ihrem Büro ordnete sie die Neuigkeiten, notierte die Agenda für den Tag und legte die Dossiers für heute bereit, darunter die Personalakte von Paule Jecker, der heute als Mitarbeiter eingeführt werden sollte. Sie verteilte Handzettel auf dem Tresen mit neuen Hygienerichtlinien, die wieder einmal präzisiert und angemahnt werden mussten!
Inzwischen war Hanne Haggert angekommen, vom Treppenaufstieg schnaufend, mit einer dichten Aura aus scharfem Zigarettenrauch, den sie noch schnell vor der Eingangstür erzeugt hatte. Noch außer Atem, überprüfte sie zunächst an ihrem Zentralrechner, ob sich die Mitarbeitenden schon mit ihren Handys eingeloggt und ihre Tour begonnen hatten – pünktlich, darauf legte sie Wert! Die geplanten Touren – die Einsätze – hatte sie am Vortag an ihrem Computer aktualisiert und schon online auf die Handys übertragen. Spezielle Instruktionen für den Patientenbesuch – eine besondere Situation, ein Arztbesuch, eine Anfrage zu Pflegeleistungen – wurden mit den Wohnungsschlüsseln der Klienten in das Fach der betreffenden Pflegekraft gelegt. Gelegentlich waren Medikamente und Pflegehilfsmittel, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel aus dem Lager zu holen und für einzelne Klienten bereitzulegen. Angela Becher half dabei.
Am Nachmittag oder Abend, je nach ihrer Tour, kehrten die Pflegekräfte in die Zentrale zurück. Sie loggten sich aus, legten Handy und Schlüssel zurück und schrieben ihren Tagesbericht mit den Besonderheiten dieses Pflegetages, allfällige Informationen, die weiterzugeben waren.
Das Pflegeteam
Neben dem Leitungsteam – Lina, Hanne Haggert und Angela Becher – hatte Engels Pflege rund dreissig Angestellte verschiedenen Alters, in der Mehrzahl Frauen. Sie kamen aus verschiedenen Berufen: Die Pflegekräfte mit einer mehrjährigen Fachausbildung waren in der Unterzahl. Die anderen, angelernte Pflegehilfskräfte, waren aus den unterschiedlichsten Berufen zur Pflege gewechselt: Konditorinnen, Maurer, Hausfrauen, Frisörinnen, Bürokaufleute… Ihre Begabungen zur Pflege waren sehr verschieden, doch bei Engels Pflege waren die meisten hoch motiviert.
Sie waren kein Arbeitsteam, alle waren allein tätig, Einzelkämpfer. Wie es das Prinzip der Bezugspflege wollte, hatten sie alle «ihre» Klientinnen und Klienten; nur in besonderen Situationen, bei Krankheit oder Urlaub wurden sie mit «ihrer Tour» durch eine andere Pflegekraft vertreten. Dies sorgte für Kontinuität in der Betreuung der Klientel, für ein gutes Pflegeverhältnis, aber auch für eine bisweilen problematische Nähe, in der Gefälligkeitsleistungen erbracht, Diebstahl begünstigt, Erbversprechungen gemacht wurden. Manche Mitglieder des Teams mochten sich, waren befreundet – manche gingen sich aus dem Weg, wenn irgend möglich; andere waren Einzelgänger, die jeden weiteren Kontakt vermieden.
Gemeinsam waren nur die monatlichen Teamsitzungen, an denen alle teilzunehmen hatten. Gemeinsam war auch die jährliche Betriebsfeier, zu der fast alle kamen: Hier aß man, trank man, prostete einander zu, ein vielstimmiges Erzählen hob an, immer lauter – und mit dem Alkohol gab es im Laufe des Abends spitze Bemerkungen, Angriffe und Bloßstellungen, wurden Freundschaften geschlossen oder neu besiegelt. Für Lina war die Betriebsfeier stets eine besondere Herausforderung, sie musste aufpassen, abwiegeln, vermitteln, versöhnen und Impulse geben… Doch ein besonderer, oft einender, Moment war die Preisverleihung für «Neue Pflege-Ideen» bei Engels Pflege. Zu Beginn der Feier wurde geheim abgestimmt – ausgezählt wurde gegen Ende, dann folgte die Verleihung des Hundert-Euro-Preises! Im vergangenen Jahr gewann Valentina Smolenska den Preis für den «Friedhof der armen Socken», den sie mit Inbrunst pflegte.
Gegen Ende des Abends verabschiedete sich Lina von allen persönlich und spendete noch einen 100-Euro-Schein für die «Absacker»-Runde, an der sie, erschöpft, meist nicht mehr teilnahm. Mit dem Taxi fuhr sie nach Hause.
Antrittsgespräch mit Paule Jecker
Pünktlich um sieben kam Paule Jecker, der Neue, in der Zentrale an. Lina hatte ihn schon am Tresen erwartet, nahm zwei Handys, die Schlüssel und Instruktionen für die heutigen Klienten aus dem Fach, das man schon für den Neuen angelegt hatte. Lina würde ihn heute Morgen einführen, bei einer ersten Tour zu denjenigen Patientinnen und Patienten, die er übernehmen würde. Paule Jecker, halb Berliner, halb Türke, 35 Jahre alt, angenehme Erscheinung, dachte sie, gepflegte Frisur und treue braune Augen, ein attraktiver Mann, sehr wach, geschmeidig und – ruhig. Voll ausgebildet und erfahren kam er von der stationären Pflege im Altenheim, doch die Arbeitsbedingungen hier waren teilweise neu für ihn: nicht nur Alten- und Krankenpflege, sondern auch Hauspflege, alles mobil, mit Tourenplänen und Leistungsprofilen – und den Handys. Es war ein bunter Strauß von Klienten, die er übernehmen sollte. Er ersetzte Katrin Mester, die mit erstaunlichen 43 Jahren in Mutterschaftsurlaub gegangen war!
Sie hatte Paule engagiert, gutes Dossier, hatte ihn schon beim Vorstellungsgespräch gut in ihrer Nähe haben können und war jetzt überrascht über die kollegialen Strömungen. Paule war Deutschtürke: Mehr Deutsch als Türk, Mama Deutsch, Papa Türk, früh verschwunden, Nachnamen der Mutter angenommen!, so hatte er sich vorgestellt. Er war ursprünglich Sanitär-Handwerker, der dann Sanitäter wurde (!) – sie musste lächeln – und danach eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht hatte. Paule war sehr wach und hatte eine angenehme Ausstrahlung, er war attraktiv (was in der Branche nicht nur ein Vorteil war) und ledig. Ledig? «Aktuell ohne», wie er sagte, deshalb flexibel in den Einsatzzeiten. Ich bin sehr flexibel!, hatte er betont, aber über seine Polung war sich Lina nicht im Klaren.
Morgenbegrüßung der Smolenska, Haggert & Becher
Nach und nach trafen die Mitarbeiter der Morgen-Touren ein. Die runde, muntere Valentina Smolenska stand um Viertel nach sieben am Tresen der Zentrale und rief:
Für alle ein guter Morgen, ein schöner Morgen!
Oh ja, alles schön beschissen an diesem Morgen!, maulte Hanne Haggert zurück – und sah auf ihre kranke Katze Mitzi hinunter, der sie gerade eine Spritze für 80 Euro hatte verpassen lassen.
Angela Becher rief freundlich aus ihrem Büro hinaus: Allen einen schönen, gutbezahlten Morgen!
Die Handys des Pflege-Service
Auch Lina rief einen freundlichen Morgengruß zum Tresen hinaus und erklärte Paule, der bei ihr im Büro saß:
Das hier werden Sie noch nicht kennen – auch wir haben das System erst seit vergangenem Jahr: Jeder Mitarbeiter hat sein persönliches Masterhandy, eine mobile Workstation mit seinen täglichen Tourenplänen und Daten, wo die Pflegeleistungen eingetippt und kontrolliert werden; sie werden später in der Zentrale zusammengeführt und mit den Kassen abgerechnet. Das Masterhandy ist ein Segen – und ein Fluch!, wie Sie sich denken können. Es hilft bei der Planung der Fahrwege und ist Ihr persönliches Fahrtenbuch; es nimmt Schreibarbeit ab und gibt Auskunft über Leistungskomplexe und Materialien, die für eine Tour oder einen bestimmten Klienten nötig sind. Es hilft uns – aber ist auch unerbittlicher Zeuge unserer Aufenthaltsorte, der Route und der Zeiten.
Der Handyflotte stehen zwei Server in der Zentrale gegenüber: ein Haupt- und ein Backupserver für die Datensicherung. Denn bei einem Datencrash – oder einem Hackerangriff womöglich! – kann ein monströser Datenverlust entstehen: Namen, Patientendaten, Orte, Uhrzeiten, Details des Klienten-Haushalts, spezielle Hinweise, wo Einkäufe, Spritzen, Medikamente und auch Geld zu deponieren sind… Sie wissen ja, unser Dienst verwaltet auch das monatliche Haushalts- oder «Taschengeld» der Klienten und händigt es ihnen aus.
Nun hatte sie viel gequasselt, aber Paule schien nicht erschöpft oder gar überfordert. Sein Blick war weiterhin so offen und aufmerksam, als könne er nicht genug bekommen, Neues zu erfahren, sie anzusehen, ihr zuzuhören… Hatte sie mit ihm vielleicht das große Los gezogen? Den Top-Pfleger?
Hier, Ihr Exemplar, Herr Jecker!, und fast feierlich überreichte sie ihm sein Handy. Konzentriert quittierte er den Empfang, nahm die Bedienungsanleitung entgegen, unterschrieb Kenntnisnahme der Nutzungspflichten zu Geheimhaltung und Verlust.
Lina startet mit Paule zur ersten Tour
Paule wog sein Handy in der Hand und nickte respektvoll, lächelte, als sie in Linas Wagen stiegen. Er hat erstmal verstanden, dachte Lina, hat keine schrägen Fragen gestellt… In dem Wagen war es eng zu zweit, mit den Betreuungstaschen und dem medizinischen Material – eng, als würde man auf Reisen gehen (hey, wäre ja auch mal wieder Zeit – obwohl: Mit diesem Zwergenauto? Etwa noch mit Paule?). Der Gedanke schoss kurz ein, doch mit einem kurzen Kopfschütteln verscheuchte sie ihn und konzentrierte sich ganz auf die Ausfahrt hinaus auf die wilde Karl-Marx-Straße. Paule Jecker sah respektvoll zu ihr hinüber und erkundigte sich neugierig nach dem Auto.
Ein Fiat 500 Abarth, sagte Lina: quasi mein Racing-Modell undercover, unauffällig, klein und ziemlich stark, mit dem man auch mal losröhren kann – falls irgendwo mal eine Straße frei ist, und sie lachte. Denn sie hasste es, wie entfesselt hier gefahren wurde, regelfrei! Und diese Fußgänger, die hier irgendquer über die Straße gingen, und oft noch einen Kinderwagen voraus in die vorbeirasenden Autos hineinstießen, und all die Fahrräder, die im Ego-Anarcho-Stil alle Regeln kippten! Die über die Bürgersteige, durch die Fußgänger schossen, sich zwischen den Autos mit Todeswunsch durchmogelten, als wollten sie zerrieben werden! Lina dachte laut, zu laut! Es schimpfte aus ihr heraus, bei jeder Fremd-und Selbstgefährdung, die auf sie zukam. Sie wusste: Heute früh war sie nicht sehr souverän. Aber darauf legte sie heute, bei dem Neuen, auch keinen besonderen Wert, stellte sie überrascht fest.
Sie waren auf dem Weg zu Elsbeth Katschnig. Lina führte Paule Jecker ein wenig in ihre Situation ein, mit ein paar biografischen Notizen, Wohnung, Lebenssituation und Details zu ihrem Pflegeprofil.
Sie werden zu Kurt Nebel gerufen
Plötzlich rief Hanne Haggert aus der Zentrale an: Kurt Nebels Tür verschlossen, Schlüssel innen. Und er nahm das Telefon nicht ab!
Lina wendete und nahm Richtung Karl-Marx-Straße. Mit dem Ampelgrün beschleunigte sie mit voller Kraft, und die blanke Power des Autos schleuderte sie in die Kopfstütze – bis sie den Fuß vom Gas nahm – und der kurze, köstliche Moment des «freien Falls» eintrat. Sie fuhr weiter mit recht hoher Geschwindigkeit, denn die Straße lag ausnahmsweise frei vor ihnen – bis zur nächsten Ampel.
An Kurt Nebels Tür klingelten sie Sturm, schlugen mit der Faust gegen die Türe, riefen seinen Namen, auch durch den Briefschlitz… Nichts regte sich.
Die beiden Feuerwehrleute, die Lina schon aus dem Wagen angerufen hatte, kamen schnell. Sie waren geübt: Sie zielten mit dem Rammbock auf das Schloss und brachen die Wohnungstür auf. Ein lauter Schlag, ein verzweifeltes Knirschen, und mit grellem Ächzen splitterte die Türe auf und riss ein Loch in dichten Gestank, der den Flur erfüllte. Der schreckliche Geruch schien sich mit jedem Schritt zu verwandeln, als sie sich hineintasteten: Abgestandenes, Spülicht, Fäkalien? Eine vollgestopfte, verwahrloste Wohnung, verkommene Gerüche, ranzig-säuerlich, kaltes Fett, Abgelebtes, wie ein Haufen abgestoßener, alter Hautschuppen, dachte Lina. Doch sie rief laut nach Kurt Nebel, sie war besorgt. Sie durchquerten den kleinen, überstellten Flur, bahnten sich den Weg durch die enge Küche gefüllt mit ungewaschenem Geschirr in das enge, mit Abfällen vermüllte Wohnzimmer: Nur vor dem alten Fernseher war etwas Platz, die Antenne erhöht daneben auf einer wackligen Etagere, auf der früher einmal Blumentöpfe standen, Lina erinnerte sich; nur ein Blumentopf, mit einer zum grünlichen Schrumpfkopf verdorrten Kaktee, war übriggeblieben, ein letzter Funke Leben! Davor ein schäbiger, durchgehockter Sessel mit verspeckten Armlehnen. Schließlich das verwirrte Schlafzimmer, mit einem eingepferchten Doppelbett, eine Betthälfte zugestapelt mit Pappschachteln, aus denen alle möglichen «Dinge» herausquollen: Kleidungsstücke, Werkzeuge, elektrische Geräte und Bauteile, Rohre, verbogene Blechstücke. Von Kurt Nebel war nichts zu sehen.
Dass keine Reaktion kam, war ungewöhnlich, seine Wohnung – wie bei vielen ihrer Klienten – war ungeordnet, chaotisch, aber er freute sich auf die Besuche, erwartete die medizinische Unterstützung und die Hilfe bei der Hauspflege, stand meist mit offenen Armen im Eingang.
Sie fanden ihn, nach vorne zusammengesunken, im Unterhemd auf der Toilette sitzend. Vor ihm ein altes Kassettenradio, das Berliner Evergreens spielte. Hier erreichte der Gestank seinen Höhepunkt. Ja – Nebel hatte seit Jahren Probleme mit der Verdauung, inzwischen war der Magenkrebs und die spezielle Diät dazugekommen, so musste er oft lange warten und verschanzte sich auf der Toilette, mit Zigaretten, Aschenbecher – und Musik für ein wenig Ablenkung bei der oft quälend langwierigen Mission. Der Gestank zeigte, dass er Erfolg gehabt hatte. Es schien, als hätte er sein monströses Geschäft gemacht und wäre dabei verschieden.
Der Arzt, den Lina inzwischen gerufen hatte, kam schon bald und nachdem er sich in den dichten Gestank hineingearbeitet hatte, bescheinigte er Nebel einen «natürlichen Tod». Er kannte den Patienten, alles schien in Ordnung. Obwohl Lina wusste, dass er damit nur den natürlichen metabolischen Niedergang meinte: ohne Fremdeinwirkung oder suizidale Geste… Der halbnackte Nebel auf der Toilette, in den Klängen von Berliner Evergreens schmerzlich zusammengekauert, hatte für sie absolut nichts Natürliches! Es war ein sehr trauriges Bild, das verlorene, freundliche Männchen so geendet zu wissen! Sie sah Paule Jecker an – und der erwiderte betroffen und verunsichert ihren Blick. Irgendetwas schien nicht in Ordnung für Lina! Etwas war anders in der Wohnung, etwas war anders in Nebels Ausdruck. Hatte man ihn überrascht, hatte er hier angstvoll gesessen? Doch was hätte er gefürchtet – außer den Tod? Lina war sehr betroffen – und marterte sich das Hirn – wollte verstehen!
Er ist wohl gestern Abend gestorben, meinte der Arzt – viel länger ist es nicht her!
Geruch der Armut
Normalerweise roch Nebels Wohnung nach jener Armut, die einen allmählich ersticken kann, weil sie die Kreise, in denen wir uns selbst umrunden, immer kleiner macht. Sie roch nach dem Verlust des Zugriffs auf die Welt, sie roch nach der Unfähigkeit, sich und seinen engsten Lebenskreis zu ordnen, wenn Hände unsicher wurden, kraftlos, zitterten, wenn Schmerzen in den Schultern und Handgelenken nisteten und jeden Griff bremsen wollten, wenn die Wünsche nach Welt nicht mehr weit hinausreichten…
Kurt Nebel gehörte zu den Stillen, den Angenehmen unter den Klienten. Lina erinnerte sich an sein Versteck, dort hatte er Geld und Dokumente verborgen. Bei einem Bier und ein paar Gold-Fischlis, die er ihr anbot, damals als sie bei ihm mit den ersten Pflegetouren begann. Sie sind ja meine Familie!, hatte er gesagt. Er tat wichtig – und umständlich erklärte er ihr das Versteck und die Gründe dafür. Doch fast immer war es das berührend simple Misstrauen: Misstrauen gegenüber Nächsten, nächsten Nachbarn oder nächsten Resten der Familie, die sich längst abgewandt hatten – aber oft, wie sie wusste, ein Misstrauen, das stimmig war – ein Schutzmechanismus vor terminalem Raub und Diebstahl. Man wollte das letzte Hemd schützen, die letzte Illusion: Mit den gehüteten Zweitausend Euro noch einmal eine große Reise machen, einmal noch ausholen, sich öffnen, auf Entdeckung gehen, sich überwältigen lassen: Sylt, Capri…! Es ging nicht um das übliche Körnchen Realität in einer Paranoia, sondern es war die erdrückende Sorge, der erdrückende Verlust von Vertrauen, verschwistert mit der Einsamkeit.
Es gab eine Nachbarin, Frau Druse, die öfter nach Nebel sah, ihm manchmal Gesellschaft leistete, kleine Erledigungen machte: die öltriefenden Fritten, Räucherfisch, Puffreisschokolade. Lina wusste, dafür gab’s auch schon mal ein Küsschen von Kurt, aufgedrückt mit schmalen Lippen auf ihr empfängliches, weiches und breites Gesicht: Einen Schmatz. Oder besser: einen Schmutz, dachte Lina, denn Nebel war oft ungewaschen – aber Achtung! Warum? Seine Arme machten nicht mehr mit: Er konnte sie nicht mehr richtig heben, geschweige denn zu Hals, Nacken und Rücken hochdrehen. Seine Schultern, Ellenbogen und Handgelenke waren schmerzhaft unbrauchbar, vermutlich schollige Kalkeinlagerungen. Und plötzlich stand Frau Druse hinter ihnen, mit einer Kittelschürze, herabhängenden Schultern und einer gezausten Frisur. Sie war entsetzt und schluchzte, als sie einen Blick über die Schulter des Feuerwehrmanns geworfen hatte: Ich habe ihn ja niemals nackt gesehen! Immer noch ein ansehnlicher Mann, der Nebel! Sie schien unempfindlich gegen den Gestank. Wie viele der Älteren litt sie unter einem Verlust des Geruchssinns.
Lina sagte zu Paule: Schon längst hätte Nebel sein Servicepaket um ein-zwei Tranchen Ganzkörper-Reinigung aufstocken müssen. Aber er hasste Bürokratie, wie er sagte, doch tatsächlich hasste er es, Forderungen zu stellen. Bei seinem Betreuer, bei der Krankenkasse – oder nur schon bei uns. Er wollte Menschen! Er hätte wohl besser auf die Waschtranche verzichtet und dafür 30 Minuten Reden bekommen! Jemanden, der sich um ihn sorgte, der da war, mit ihm sprach… So aber hing er fest, zögerte zwischen dem, was er eigentlich brauchte – und dem, was er am liebsten wollte. Und er sah tatenlos zu, wie seine Kreise langsam immer enger wurden, wie er langsam fettig-grau wurde, verranzte – nur die Hände waren fast obsessiv gepflegt: Schön wie Ballerinen in den Bühnenferien, konnte er auf sie herabsehen und ihre Untätigkeit honorieren.
Sie sahen sich Kurt Nebel länger an, trotz seiner entsetzlichen Aura, sie besprachen sich mit dem Arzt und dem Feuerwehrmann und riefen schließlich doch die Polizei.
Verdacht auf «Fremdeinwirkung»?
Paule war berührt und ratlos:
Für Sie scheint Nebels Tod nicht so klar – haben Sie einen Verdacht, Frau Engels?
Sagen wir so: Es ist ungewöhnlich, nicht verabredungsgemäß, dass er die Türe abschließt – und von innen den Schlüssel ins Schloss steckt! Wenn er gestern Abend gestorben ist, wäre das wohl nach dem Besuch von Priska Karlova, die seit letzter Woche Vertretung für die zuverlässige Betty Boltzmann hatte.
Paule kannte Priska schon länger, sie hatten eine Zeit in der gleichen Einrichtung gearbeitet. Er mochte sie nicht, weil sie Kollegen und Klienten zu manipulieren versuchte. Auch Lina hatte schon früher mehrmals den Verdacht gehegt, dass sie stahl, zuletzt bei Frau Mester, aber Priska war die Einzige, die bei Kurt Nebel kurzfristig einspringen konnte. Und verdächtig war, dass viel Geld in Nebels Versteck fehlte, Lina hatte nachgesehen.
Das klingt gar nicht gut! Vielleicht sollten wir die Nachbarin, Frau Druse, nochmal befragen, Paule dachte laut.
Lina nickte abwesend, nahm das Handy und fragte bei Hanne Haggert in der Zentrale nach. Sie erfuhr, dass Nebel gestern am Nachmittag in der Zentrale angerufen hatte; die Haggert aber hatte alle Hände voll zu tun, wie sie sagte, und die Nachricht nicht gleich abgehört. Später stellte sich heraus, dass Nebel einen Diebstahl melden wollte, er hatte ihn gleich nach dem Besuch der Karlova entdeckt – zehn Hunderter-Noten fehlten! (Sie hatte das Versteck wohl wieder verschlossen; er aber hatte plötzlich diesen Verdacht und nachgesehen). Nebel war außer sich, besorgt, dass auch seine anderen Verstecke ausgeräumt werden könnten, «mit mehr drin!» – und die Karlova hatte einen Schlüssel. Er hatte unbedingt sie, Lina, sprechen wollen, was er tun sollte – auch wegen der Polizei.
Ich denke, Nebel wollte sich so vor Priska Karlova schützen: Er hatte das Schloss gesichert – und hätte so auch gehört, wenn sie hereinwollte, während er auf der Toilette saß.
Lina war aufgebracht und fuhr ruppig und schnell zurück in die Zentrale. Sie schimpfte. Sie beschleunigte, bremste, beschleunigte, zog die Kurven ganz eng… Sie würde die Karlova ins Büro bestellen, gleich nachher – doch die war nicht zu erreichen. Paule klammerte sich an den Haltegriff über der Türe.
Lina kehrt nochmals in Nebels Wohnung zurück
Später musste Lina noch einmal in Nebels Wohnung zurück, musste Utensilien des Pflegedienstes abholen (Toilettenstuhl, Rollator etc., die nur vermietet waren), vor allem die Pflegemappe, die Priska Karlova bei ihrem Besuch vergessen hatte; sie enthielt alle Dokumente und Informationen zu Kurt Nebel, Patienten-Daten, Pflegestatus, Arzt-Informationen (auch für den Notarzt), Details zur Ernährung… Nun ging sie fast ehrfürchtig in den Gestank hinein, aus dem man den toten Kurt Nebel noch nicht geborgen hatte. Sie würde noch das Beerdigungsinstitut abwarten; er würde kremiert. Lina hielt eine Schweigeminute, überflog die Jahre, in denen Kurt Nebel in ihren Händen war. Sie wusste, was es bedeutete, dass Nebel sie als «seine letzte Familie» bezeichnete. Sie erinnerte sich noch an dieses Gespräch. Er war Handwerker, hatte lange als Feinmechaniker im Maschinenbau gearbeitet. Dann, bald nach der Pensionierung, hatte er seine Frau verloren, fand sich nicht mehr zurecht, ein guter Mensch, der vielen anderen half, der sich kümmern konnte (Ging sie bei der Druse nochmal vorbei?). Der aber unfähig war, einen Haushalt, ein gesundes Leben zu führen, und sie würde sich nicht wundern, wenn man noch ein «Vermächtnis» fand von ihm, einen Brief, ein Testament…? Sie würde nochmals die Verstecke durchsehen, soweit sie sich daran erinnerte. Da hörte sie, wie die Tür aufgedrückt wurde, vorsichtige Schritte. Sie zückte schon ihr Handy. Sie glaubte Priska zu erkennen, die kurz um die Ecke peilte, aber die Gestalt verschwand ebenso schnell wie lautlos. Lina rief hinterher: Frau Karlova – sind Sie es? Bleiben Sie, warten Sie! So bleiben Sie doch stehen! Aber die Gestalt war von der Stille verschluckt.
Besuch bei Elsbeth Katschnig
Nach der dramatischen Unterbrechung durch Kurt Nebels Tod nahm Lina die Einführungstour mit Paule am frühen Nachmittag wieder auf. Man hatte Elsbeth Katschnig über die Verschiebung informiert und Lina neu auf halb drei angekündigt.
Auf dem Weg dorthin erzählte Lina: Bei Elsbeth Katschnig wurde ich immer schon erwartet. Als ich einmal bei der Ankunft sagte: welch eine schöne Frau! War sie hingerissen von dem Kompliment, wurde geradezu süchtig danach! So bereitete sie sich immer schon lange vorher auf mein Eintreffen vor. Und ich mache ihr die Freude und packe das Kompliment gelegentlich wieder aus.
Auch heute, schon Stunden bevor Lina mit Paule eintraf, hatte sich Elsbeth Katschnig die Nägel lackiert, ungenau, mit groben Strichen, aber sie leuchteten im Spiegel und als sie sich «nachdenklich» in die Hand stützte, Zeige- und Mittelfinger auf die Schläfe, den Daumen neben das Ohr, dann sah das immer noch ganz schön nach was aus… fast geheimnisvoll! Der Mund war scharfrot geschminkt, die Brauen mit einem dünnen schwarzen Strich nachgemalt, die lange Zigarette, schon gezündet, in der Linken. So stand sie stolz vor dem Spiegel… immer noch irgendwie die Alte!, nickte sie sich zu, die krasse «Chefsekretärin» von einst. Krass, beherrschend, ganz Schlampe, mit einem Anflug von Geheimnis. Darauf war sie stolz! Mit diesen leuchtenden Fingernägeln und ihrer «Nachdenklichkeit» hatte sie noch alle rumgekriegt, sie zu sich ins Bett zu nehmen, um nach ihrem Geheimnis zu suchen.
Dass sie «Bescheid wusste», über das Leben und die Männer, ließ sie oft durchblicken bei Lina. Auch bei Sascha Wüthrich, der früher ihr Pfleger war: Ihn hatte sie dann ein paarmal nackt an der Tür empfangen, bis Lina ihn «abzog», wegen des Geredes. Vieles, zu vieles sprach sich schnell, zu schnell herum, sogar unter den Klienten und Klientinnen, die eigentlich kaum je Kontakt untereinander hatten. Doch plötzlich hatten sie «etwas gehört», «wussten etwas» und versuchten ihre Pflegerin beim nächsten Besuch auszufragen.
Lina erklärte Paule: Ich habe der Katschnig ins Gewissen geredet und ihr gesagt, dass sie zu weit geht: Exhibitionismus ist im Servicevertrag nicht enthalten! Und sie entgegnete mir frech: Dann bestelle ich mir Ganzkörperpflege – zahle privat – und er muss mich waschen! Nackt wohlgemerkt!
Paule lachte etwas gequält, fand Lina, und sagte: Aber ich soll die Katschnig hoffentlich nicht übernehmen…?
Ist zurzeit nicht geplant…, Lina konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Lina dachte daran, wie erfolgreich die Katschnig war bei den Männern, aber mit dem Erfolg wohl nicht aufhören konnte, bis nur noch Ulf Katschnig übrig war, der mit ihr, goldverziert, vor den Altar getreten ist und sie über eine blankgebohnerte Schwelle im Wedding trug: Verkaufsleiter bei einem kleinen Zulieferbetrieb für Zahnbedarf (Zahnbürsten, Mundwasser, Zahnseide…). Immerzu Dental, sagte die Katschnig abfällig, solange ihre Ehe ging, aber ausgelaugt und einfallslos, doch war er «immer gut zu mir», bis zu dem großen «Hack», wie sie es nannte. Dann war Schluss! (Sie konnte, wegen der Dental-Langeweile, mit den Männern nicht aufhören; bis zum großen «Hack».)
Immer, wenn Lina zu Elsbeth Katschnig ging, meist zur Fallkontrolle oder in Vertretung der angestammten Pflegerin, die krank oder unabkömmlich war, machte sie sich auf ein kämpferisches Hin und Her gefasst, ein krasses Besenreißen, wie die Katschnig es nannte, einen Kampf zwischen Dominas oder Ex-Hexen… Lina hoffte auf Aufhellung der dunklen Teile der Geschichte von Katschnigs «Hack». Nicht, dass sie besonders neugierig war, aber sie konnte viel besser mit den Menschen, wenn sie eine möglichst breite, aus- und wieder eingefädelte Biografie mit schlüssigen Lebensstapfen im Blick hatte, und ihre Sprüche und Bewegungen, die Krampfadern und OP-Narben mit dem Dialekt in Verbindung sehen konnte, von ihrer Persönlichkeit ein Bild hatte – ein Stück weit zumindest.
Aber Chefin, keen Häcker, wie se vielleicht denken, Ulf hatte gar nüscht mit Computern, nee, er hat mir einmal mit dem Hackmesser «Leid zujefügt, janz einfach»: hat mich bedroht und jeschnitten, ausjerastet, weil ick nen Freund besucht hatte, Sie wissen schon – und sie hob ihre steife blonde Perücke und zeigte Lina vom Hinterkopf zum Hals eine lange Schnittnarbe, die mit dem Alter ausgeufert war… Aber mehr jibt et nich zu sehn heute, sagte sie, und zu sagen och nüscht, und zurrte die Perücke wieder an ihren Platz.
Mit ihrer herrschsüchtigen Hand winkte die Katschnig die Pflegehelferinnen an die Töpfe in der Küche, um wieder mal große Spüle zu machen, oder sie ließ den unzähligen Nippes abstauben. Alles aufräumen! Auch den Schrank! Und den Herd – unter dem Herd putzen! Alles Tätigkeiten, die in ihrem Betreuungs-Vertrag nicht vorgesehen waren. So kam es immer wieder zu Diskussionen mit Lina, die ihr schließlich drohte, den Service zu kündigen, wenn sie nicht aufhörte, die Pflegerinnen herumzukommandieren.
Und wer soll det denn machen – icke?
Ja, das können Sie!, sagte Lina, Sie sind noch großartig fit, Sie können einen Haushalt führen – oder wir erweitern den Dienstleistungsvertrag, ganz einfach. Das zahlt aber nicht das Sozialamt, sondern Sie selbst…
Heute sahen sie nur nach dem Betreuungsstand; obwohl die Katschnig ein wenig herumjammerte, waren die rheumatischen Schwellungen an den Beinen, und die Operationsnarbe an der Hüfte weiter zurückgegangen, wie Lina feststellte. Auch die Wohnung war recht sauber und aufgeräumt. Paule stellte die Tüten mit den Einkäufen auf den Tisch, legte die Zigaretten daneben und half der Katschnig dann beim Einräumen in den Kühlschrank.
Die Katschnig sah ihm begeistert zu: Sie sehn ja richtig jut aus – wow! Könnten nich Sie mich übernehmen?
Paule Jecker ist ganz neu bei uns, er muss sich erst einarbeiten, und Lina nickte Paule mit einem kaum merklichen Lächeln zu.
Det macht doch nüscht!, sagte die Katschnig, ick bin janz pflegeleicht… Aber ick vastehe, da hat de Chefin die Hand drauf, auf den Paule!, und sie grinste, als wollte sie ihre Schminke absprengen, in tausend Fältchen reißen.
Am späten Nachmittag: Priska Karlova in Linas Büro
Lina sagte: Sie wissen, warum ich Sie herbestellt habe?
Priska hob erstaunt die Brauen, ihr Mund verzog sich, wurde Trotz, drehte zu Verachtung.
Sie hatten gestern Nachmittag Vertretung bei Kurt Nebel, «Kleiner Haushalt und Einkäufe»?
Priska nickte wortlos.
Was sagte Nebel? – Nichts. Nebel lässt mich machen, wie immer. Bleibt in Zimmer.
Ihre Handydaten zeigen, dass sie gestern später am Abend nochmal bei ihm waren, aber ohne einen Eintrag zu machen? Priska schien irritiert, wollte protestieren.
Sie wissen, Ihr Servicehandy zeichnet alle Touren auf. Also: Was haben Sie dort gemacht?
Habe vergessen Klientenmappe. Aber Schlüssel von innen steckt; Nebel nich aufgemacht.
Sie wissen es schon: Kurt Nebel ist tot!, sagte Lina, ein Zittern in der Stimme. Priska nickte düster.
Er wurde heute Vormittag gefunden, die Nachbarin hat bei uns angerufen – und wir fuhren hin. Seine Tür war abgeschlossen, Schlüssel innen, er hat nicht reagiert. Wir mussten die Tür aufbrechen. Sie waren die Letzte, die ihn lebend gesehen hat! Was ist geschehen?
Nichts. Habe aufgeräumt und Essen hingestellt. Und gegangen…
Kurt Nebel hat nach ihrem Besuch aufgeregt in der Zentrale angerufen, wollte einen Diebstahl melden: Es fehlten tausend Euro aus seinem Versteck! Was sagen Sie dazu?
Weiß nichts von Geld, weiß nichts von Versteck, mache nur meinen Dienst und sauber.
Sie wurden schon einmal verdächtigt: bei Frau Mester. Die Sache wurde zwar, wie üblich, der Polizei gemeldet, aber Frau Mester hat nicht gegen Sie ausgesagt. Doch jetzt ist es anders: Ganz offensichtlich steht ein Diebstahl in Verbindung mit dem Tod eines langjährigen Klienten. Wenn Sie das Geschehene plausibel erklären und das Geld zurückgeben, können wir der Polizei sagen: Es ist wieder aufgetaucht. Und Sie sind raus aus dem Verdacht… Unseren Pflegedienst müssen Sie aber auf jeden Fall verlassen!
Priska wurde böse: Was soll ich mit Scheiße Geld von Nebel? Ihr Scheiße Verdacht ist Rassismus! Immer wieder schimpfen Sie, nur mit mir!
Lina blieb geduldig und zäh: Das ist keine Erklärung, das ist eine plumpe Ablenkung! Um die Diskussion abzukürzen, werde ich Ihnen sagen, was unser Verdacht ist: Als Sie bei Nebel saubergemacht haben, haben Sie das Versteck entdeckt – eines der Verstecke, er hat mehrere…
Priska schien beunruhigt, wich Linas Blick aus.
Sie haben die tausend Euro an sich genommen und sind schnell weggefahren, haben dabei die Pflegemappe liegen lassen. Aber Nebel hat Verdacht geschöpft und gleich in der Zentrale angerufen. Er hatte große Angst, dass Sie wiederkommen, nach anderen Verstecken suchen, ihn womöglich bedrohen und ausrauben. Damit Sie nicht hereinkommen, während er auf der Toilette war, hat er die Türe abgeschlossen, den Schlüssel stecken lassen! Als Sie tatsächlich wiederkamen und vergeblich versucht haben, hereinzukommen, hat er in seiner Angst einen Herzinfarkt bekommen. Sie wissen, er war sehr gefährdet. Aber damit nicht genug: Offenbar hatten Sie später nochmals versucht, in die Wohnung zu kommen, um Nebels andere Verstecke zu suchen.
Priskas Mund zuckte, die Lippen fest aufeinander gepresst. Sie schwieg, explosiv.
Nach einer längeren, geduldigen Pause sagte Lina:
Also, Frau Karlova: Ich werde Sie nicht