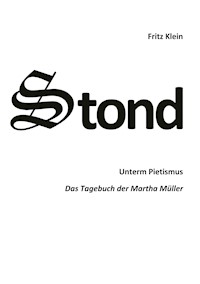
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nach einem halben Jahrhundert entdeckt der Ich-Erzähler das Tagebuch seiner frühverstorbenen Mutter. Anhand ihrer Aufzeichnungen reist er zurück in eine Welt, die auch einmal seine war: die Welt der "Stond". Im intimen Gespräch mit der Tagebuchschreiberin, im Kommentar, in Erinnerungen, in eigener Spurensuche und kritischer Selbstreflexion entfaltet sich eine Familiengeschichte im Bann des Pietismus, die sich über mehr als hundert Jahre quer durch das 20. bis ins 21. Jahrhundert und über drei Generationen erstreckt. Geschildert wird das Leben der Martha Müller als "Stondenschwester" und Mitglied der "Hahnischen Gemeinschaft", der sprichwörtlich "Stillen im Lande". Sie sind das Zentrum des Pietismus, wie er als kulturelle DNA den Südwesten Deutschlands bis heute prägt. Das Buch erlaubt authentische Einblicke in die Vorstellungswelt und in die vom religiösen Eifer geprägten Alltagspraktiken, es verdeutlicht die Funktion dieses Glaubens im Kontext der kleinbäuerlich-handwerklichen Kultur Württembergs während der Zwanzigerjahre und ihrem Wandel durch Nationalsozialismus, Nachkriegs- und Wohlstandsjahre, ein Wandel, der zwar das Schwinden der Mitglieder zur Folge hat, deren fundamentalistische und mystizistische Glaubenselemente aber in Metamorphosen bis in die Gegenwart weiterleben. Das Buch, gleichzeitig Biografie, Familiengeschichte, Ethnografie, ist ein authentisches Zeugnis schwäbischer Kultur- und Mentalitätsgeschichte und eine einfühlsame aber auch kritische Würdigung des schwäbischen Pietismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1068
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Nach einem halben Jahrhundert entdeckt der Ich-Erzähler das Tagebuch seiner frühverstorbenen Mutter. Anhand ihrer Aufzeichnungen reist er zurück in eine Welt, die auch einmal seine war: die Welt der „Stond“. Im intimen Gespräch mit der Tagebuchschreiberin, im Kommentar, in Erinnerungen, in eigener Spurensuche und kritischer Selbstreflexion entfaltet sich eine Familiengeschichte im Bann des Pietismus, die sich über mehr als hundert Jahre quer durch das 20. bis ins 21. Jahrhundert und über drei Generationen erstreckt. Geschildert wird das Leben der Martha Müller als „Stondenschwester“ und Mitglied der „Hahnischen Gemeinschaft“, der sprichwörtlich „Stillen im Lande“. Sie sind das Zentrum des Pietismus, wie er als kulturelle DNA den Südwesten Deutschlands bis heute prägt. Das Buch erlaubt authentische Einblicke in die Vorstellungswelt und in die vom religiösen Eifer geprägten Alltagspraktiken; es verdeutlicht die Funktion dieses Glaubens im Kontext der kleinbäuerlich-handwerklichen Kultur Württembergs während der Zwanzigerjahre und ihrem Wandel durch Nationalsozialismus, Nachkriegs- und Wohlstandsjahre, ein Wandel, der zwar das Schwinden der Mitglieder zur Folge hat, deren fundamentalistische und mystizistische Glaubenselemente aber in Metamorphosen bis in die Gegenwart weiterleben.
Gleichzeitig Biografie, Familiengeschichte, Ethnografie, ist das Buch ein Zeugnis südwestdeutscher Kultur- und Mentalitätsgeschichte und eine einfühlsame aber auch kritische Würdigung des schwäbischen Pietismus.
Der Autor
Fritz Klein wurde im Schwäbischen geboren und verbrachte dort die ersten drei Jahrzehnte seines Lebens. Er studierte in Tübingen Theologie, Germanistik, Philosophie und Kulturwissenschaften und arbeitete als Lehrer auf der Schwäbischen Alb, in Stuttgart und Berlin, wo er auch heute lebt. Das Buch ist autobiographisch geprägt.
Den Stillen
Hinüber wall ich, Und jede Pein Wird einst ein Stachel Der Wollust sein. Noch wenig Zeiten So bin ich los, Und liege trunken Der Lieb‘ im Schoß.Novalis
Inhalt
‚Before they disappear‘
Pfannkuchen
Im Gehäuse
Die Römer
Im Dunkeln
Sonne und Schild
Irdisches
Das hahnische Zeitalter
Bis ins dritte und vierte Glied
Nachsätze
Textquellen
Danksagung
Personen und Handlungen sind zwar ‚nach dem Leben gezeichnet‘, aber durch die erzählerischen Vorstellungen des Autors geformt und verändert.
Die Namen der Personen, auch die in verwendeten Zeitungszitaten und auf der zitierten Gedenktafel, wurden geändert.
Zur leichteren Aussprache wird dem üblichen „hahnsch“ zwischen Name und Ableitungsendung ein „i“ eingefügt, also „hahnisch“. Die damit verbundene verstärkte adjektivische Bedeutung kommt den Intentionen des Autors entgegen.
Durchgängig, auch in verwendeten Zitaten, wird für den Begriff „Bibelstunde“ und für seine Ableitungen und Komposita jeweils entsprechend der Begriff „Stond“ verwendet.
I. ‚Before they disappear‘
1.
„Herniederfahren!“ Genau so war es, so würde es sein. Wie von einer Sehne geschnellt, schoss das Wort in meinen Kopf. Ich hatte Google Earth hochgeladen und als sich mir die Erde zudrehte und unaufhaltsam näherte, war es wieder da, das Wort, das seit Jahrzehnten tief in mir verschüttet lag: „Herniederfahren“. So fährt der Heiland auf die Erde hernieder. Das Bild aus meinen Kindertagen erschien vor mir: ein Superman der heranschwebte. Jetzt sah ich das ungeheuerliche Geschehnis aus seiner Perspektive, der des Wiederkommenden. Und die Erde würde sich ihm zuwenden, bereit für ihn, für sein Kommen, und er würde auf sie zustürzen, genau wie jetzt ich in der Gaukelei auf dem Bildschirm: Stürzen, fallen, schweben, auf die Welt, auf das Land zu, da zwischen Fluss und Gebirge, auf den Ort, auf das Haus zu, auf die Auserwählten zu, dort im Stondenhaus, in dem auch ich, das Kind, wohnte und wartete. Hier im Stondenhaus würde der Herniederfahrende mich finden, in Furcht und Schrecken und Hoffen. ‚Von dannen er wiederkommen wird‘, hieß es in den wieder und wieder erzählten Geschichten, ‚zu richten die Lebenden und die Toten‘. Hier jetzt am Laptop war es nur eine simple Bewegung des virtuellen Erdballs, aber sie bedeutete für mich plötzlich wieder das Ende der Welt.
Deutlich sehe ich - neugierig geworden, hatte ich die Adresse meiner Kindheit eingegeben - das Dorf, das Grundstück, das Haus heranschweben. Jetzt ist dort alles bebaut, die weitläufigen Obstgärten sind verdrängt von Parkplätzen und Dächern mit Solaranlagen. Und doch: Der Grenzverlauf des Grundstücks ist noch derselbe, und im Neubau darauf zeichnet sich immerhin das Alte noch ab. Der schmale Grund, eingezwängt zwischen den Nachbarhäusern, konnte offensichtlich anders kaum genutzt werden. Wieder steht da ein U-förmiger Bau. Wo einst der Misthaufen saß, ist ein grünes Beet auszumachen. Alte Spuren sind da, Erinnerungen.
Ich stehe gut fünfjährig in der sengenden Sommersonne, zwergenhaft klein, kaum zu erkennen auf dem Schwarzweißfoto, in kurzen Hosen und mit Kniestrümpfen. Hinter mir steigt im grellen Sonnenlicht weiß eine Hauswand auf, in der sich im Kontrast eine Haustür schwarz abzeichnet, rechts davon eine Stalltür und darüber mit weißen Kreuzen ein paar vorhanglose Fenster, an manchen sind wegen der Hitze die Läden vorgeschlagen. Linkerhand im Bild, von der Kamera gerade noch angeschnitten, ebenfalls schwarz, das Scheunentor. Ein Zwerchhaus ragt noch einmal wie eine Eiszinne über die Hausfront und über das Dach hinaus. Das Haus mächtig in meinem Rücken, davor ich vernichtend klein, das Haus meines Vaters und meiner Mutter, das Haus meines Mutter-Vaters und meiner Mutter-Mutter und so weiter, das Haus meiner Ahnen, eine Wand, woraus ich jetzt gekrochen war, aus den Klüften, Höhlen, ein Alberich, der sein Reich und seine Schätze hütete, oder ein Ureinwohner in der blanken Sonne pygmäisch vor dem tabugeschützten Kulthaus, der als Einziger noch die Geheimnisse seines Stammes kannte. Noch einmal in diese weiße Wand hineingehen, in die Welt hinter dieser weißen Wand mit den vielen Geschichten: Öffne dich, Simsim!
Damals, zu meiner Zeit, stieg man über eine altersschwarze Eichenholzstiege in die Wohnräume und Kammern über dem Stall, dessen Ausdünstungen die Holzbalken über die Jahrhunderte abfaulen ließen. Durch undichte Dachfenster an verwinkelter, geflickter Dachlandschaft regnete es herein, die Zimmerdecken und Fußböden neigten sich vom Alter, der Heuboden war so hoch, dass sich von ihm Franz in den Tod stürzen wollte, die Gewölbekeller so tief, dass sie im Krieg vor den Bomben Schutz boten, und die dort aufbewahrten Vorräte Mensch und Tier durch den Winter brachten. In der großen, lichtlosen Küche gab es ein Herdfeuer, kaltes Wasser aus dem Hahn und einen steinernen Ausguss. Vor dem Haus der Walnussbaum. Über Jahrzehnte wuchs er da prächtig hinauf, warf im Sommer gnädig seinen Schatten auf das Haus und bot unter seiner Baumkrone Sitz und Aufenthaltsort. In meiner frühesten Kindheit stand er noch und war dann nur mehr ein Schemen in Gesprächen, die seinen Verlust beklagten.
Neben dem Üblichen, was solche Häuser beherbergten, das Leben von Bauernfamilien mit ihrem Stallgetier und landwirtschaftlichen Gerät, den Lebenden und Toten, Gebärenden und Neugeborenen bei Mensch und Tier, den Ehen unter seinem Dach gestiftet, geschlossen und gebrochen, Hochzeits- und Sterbenächten, Gebeten, Schreien, Kinderlachen, in schrägen Wänden und unter schiefen Decken, bewohnten seine Kammern über die Jahre, und das war schon außergewöhnlich für ein Bauernhaus, auch Industriearbeiter aus Italien, Griechenland, der Türkei, gingen durch seine Tür Tänzerinnen aus Holland, Neuseeland und Südafrika, Flüchtende aus Russland und Schlesien, aus der Ostzone und aus Ostpreußen, Soldaten, Barpianisten, Animierdamen und Hausmädchen, Lehrer und Professoren, Tischler und Elektriker. Tiefflieger brachten seine Mauern zum Erzittern, Panzer rissen seine Böden auf. Das alles nur in den paar Jahrzehnten, der kurzen Zeit dieser Geschichte von zwei, drei Generationen. Aber neben, in dem allem und durch das alles hindurch war dieses Haus dadurch ausgezeichnet, dass es ein Stondenhaus war. Die Stond war sein geheimnisvolles Kraftzentrum, um das herum das Leben kreiste, wie Planeten um die Sonne, durch die Gravitation angezogen und auf näherer oder fernerer Distanz gehalten.
Das alte Haus, in dem ich und meine Vorfahren groß geworden waren und das schon lange vor unsrer aller Zeit existierte, das älter, größer war als wir, vor gut zwei Jahrzehnten wurde es abgerissen. An seiner Stelle stand jetzt die Replik, die mir, in Google Earth herniederfahrend, entgegenschwebte.
2.
Marthas Tagebücher, die Familienalben, das Gästebuch hatten bei meiner Schwester überdauert. Neulich ließ ich mir die Tagebücher schicken. Ein Heftchen und ein schmales Büchlein, mehr war es nicht.
Eingeschlagen war das Heftchen mit einer Doppelseite aus dem ‚Christenboten‘, einem allsonntäglich erscheinenden Blatt. Viel Platz nahm darauf die Passage eines Fortsetzungsromans ein, in dessen Verlauf ein Samuel nach verschmähter Liebe und einigem Hin und Her doch noch als Pfarrer seine wahre Braut in der zu betreuenden christlichen Gemeinde fand. In weiteren Artikeln wurde die Schwäche der herrschenden Regierung beklagt, die willenlos den Reparationsforderungen nachkomme, und gejammert, dass der ‚Versailler Gewaltfriede‘ die Entfaltung der Gotteskräfte lähme, selbst die Bibel sei für Gemeindeglieder und die Schuljugend nicht mehr erschwinglich. Für ein glückliches Christenleben gebe es aber auch in bösen Tagen den Trost, dass der Herr durch das Schwerste helfe, hieß es da erbaulich und eine ‚zielbewußte Reichsgottesarbeit unter den Männern‘ wurde gefordert, um diese aus ihrer ‚religiösen, sittlichen und sozialen Not‘ zu retten. Stellenanzeigen suchten nach jungen Mädchen zwischen siebzehn und neunzehn, ‚zur Erlernung des Haushalts‘, ‚für etwas Haus- u. Gartenarbeit‘, oder ‚um gegen Dienstleistung das Kleidernähen zu erlernen‘ (‚Bett mitbringen, Bettlade vorhanden‘).
Derlei an Aktuellem wurde damals im Zuhause der Martha gelesen und die Zeitungsseite dürfte noch einigermaßen frisch gewesen sein, als die Zehnjährige sie als Schutz für ihr Schulheft verwendete. Wohl auf Anraten des Lehrers: „Schlagt bis zum nächsten Mal euer Heft ordentlich ein, damit sein Umschlag geschont wird, sonst sieht er ja gleich aus, als ob ihr im Weltkrieg gewesen wärt!“
Erst hundert Jahre später löste ich die schützende Zeitungsseite ab. Darunter kam der rötlich-blaue Heftdeckel zum Vorschein, dessen Farbe trotz Schutzumschlag sichtlich durch die Jahre abgeschossen war. Auf der Vorderseite klebte ein Etikett, das mich in seiner Zierlichkeit an ein spitzengesäumtes Schürzchen für eine Hausbedienstete erinnerte. Beschriftet war es mit schwarzer Tinte, ‚Geschichte‘ stand da in Sütterlin und darunter ‚Martha Müller‘ in lateinischer Ausgangsschrift, so hatte es der Lehrer befohlen.
Den 9. Jan. 1922 las ich auf der ersten Seite und dann folgte der seitenweise Hefteintrag eines einzigen Schulvormittags im engen Auf und Ab der Sütterlinschrift. Ganz ohne Verschreiber und Kleks liefen die Zeilen über die Blätter. Mit kindlichem Eifer, aufrecht, Ellbogen am Oberkörper, die Zöpfe im Nacken sah ich die Zehnjährige vor mir auf der Schulbank in der ersten Reihe sitzen, in Kleid und sauberer Schürze. Das Kratzen der Feder war zu hören, ab und zu ein klirrendes Eintunken in das Tintenfass, das vorne im Pult eingelassen war, und das Bollern der Flammen im großen Kohleofen, manchmal ein scharfes Kracken der Schulbank oder dass ein Kind die Nase hochzog. „Schneuz deine Nase, Helene!“, befahl dann der Lehrer durch die Zähne und die so angeredete zog umständlich, weil sie in der richtigen Hand die Feder noch hielt, das Taschentuch aus der Schürzentasche und schnaubte laut hörbar, damit auch der Lehrer sich zufrieden geben konnte. Eine Schulstunde, durch die ansonsten still die Geschichte Württembergs und Deutschlands rieselte, in langen Zahlenreihen, angefangen mit Konrad von Beutelsbach, dem Gründer der Burg Württemberg auf dem Rotenberg bei Untertürkheim im Jahr 1083. Dann folgten unter der Überschrift Die Geschichte Württembergs Grafen auf Grafen und Herzöge auf Herzöge. „Und wenn ihr damit fertig seid, schreibt ihr das auch ab!“, und der Lehrer wand mit der Kurbel die große Tafel unter lautem Geratter nach oben und zeigte die nächste vorbereitete Tafelfläche, auf der sich die Deutsche Geschichte von der Völkerwanderung über Barbarossa bis zum Westfälischen Frieden mit Zahlen und Herrschergeschlechtern und Schlachten zusammendrängte. Die Schüler seufzten, machten sich an die Arbeit und spürten die Dominanz und Unterdrückung der Herrschenden bis in ihre Federspitze hinein. Frauen kamen in dem Aufmarsch der Zahlenkolonnen und Namen so gut wie nicht vor. Die Gemahlin des württembergischen Herzogs Ulrich, Sabina von Bayern, war eine Ausnahme, allerdings eine traurige, denn sie wurde wegen ihrer Verschwendungs- und Prunksucht angeprangert, von der sich die Tugend des Herzogs nur umso löblicher abheben konnte. Immerhin durften auch Die tapferen Weiber von Schorndorf nicht fehlen, die sich während der Franzosennot in Württemberg erfolgreich gegen Kapitulation und Übergabe der Stadt an die Franzosen gestemmt hatten.
Was sagte das alles der kleinen Martha? Interessierte es sie? Was bedeuteten ihr Herrscherfolge und Kriege? Ihre frühe Kindheit war ja geprägt davon. Vier Jahre vor dem Eintrag, damals war sie sechs, ging der Weltkrieg zu Ende, dankten der letzte König von Württemberg und der letzte deutsche Kaiser ab. Obrigkeiten kamen und gingen und auch Kriege, schicksalhaft wie ein Naturereignis, und ihre Folgen waren wie die einer Naturkatastrophe zu schultern, bis man darunter zerbrach oder weitermachte, irgendwie und nach Gottes ewigem Ratschluss. Spielte das hier mit hinein? Was sagte der Lehrer dazu? Warum brach der Schulhefteintrag mitten im Schuljahr schon auf den ersten Seiten ab? Wurde er jemals, in einem anderen Heft fortgeführt? Das alles musste jetzt unbeantwortet bleiben.
Wenn Martha das Heftchen sieben Jahre später wieder öffnen wird, werden die Zeitungsspalten immer noch gefüllt sein mit den Folgen der Versailler Reparationsleistungen und zwölf Jahre nach Verdun werden dort noch immer die Leichen der Soldaten gefunden.
Sieben Jahre nach dem Geschichtsüberblick also setzten auf den leeren Folgeseiten die Tagebuchnotizen ein.
Was war in der Zwischenzeit passiert? Und was noch davor? Über Marthas Kindheit war nichts bekannt, auch nicht, wie sehr sie vom Krieg geprägt war, der gleichzeitig auf der weltpolitischen Bühne stattfand. Eine Kindheit auf dem Land, eine Kindheit im Krieg. Wer aus dem Dorf, wer aus der Familie war auf dem Schlachtfeld geblieben oder kriegsversehrt zurückgekehrt? Welche Einschnitte erzwangen der verlorene Krieg und die Reparationslast im Haushalt und im Dorfleben?
Neben der Schule ging es, das konnte man so annehmen, früh mit aufs Feld. Das jüngste Kind wurde von Eltern und älteren Geschwistern in die Tätigkeiten eingewiesen: Disteln stechen, Kartoffeln auflesen, Obst pflücken, Hühner füttern, Heu zusammenrechen, Ähren lesen. Die Mitarbeit in Haushalt und Landwirtschaft neben der Schule war für die Mädchen selbstverständlich. Vor allem abends, nach getaner Tagespflicht, blieb noch Zeit für Spiele zusammen mit den Nachbarskindern „auf der Gass‘“ und unter den Augen der Männer, die nach der Stallarbeit zum Schwatz auf den Einfassungen der Misthaufen saßen und sich über Gott und die Welt unterhielten und den Kindern beim Spiel zuschauten, wie diese Radfahren lernten oder die Kreisel sausen ließen. Es war ein allgemein entspanntes Ausatmen nach den Anstrengungen des Tages. Wo waren die Mutter und die älteren Geschwister, der Bruder immerhin acht, die Schwester sieben Jahre älter? Otto kam von der Lehre zum Baumgärtner nachhause und Marie half der Mutter bei der Küchenarbeit oder brachte die gemolkene und geseihte Milch zur Sammelstelle. Spätestens beim Geläut der Abendglocke mussten die Kinder nachhause.
Meine Schwester hatte noch die Puppe der Mutter. Kopf und Hände aus Porzellan immer noch makellos, ihr Haar stammte vom Schopf der Martha und war in dicke, brünette Zöpfe geflochten. „Wie konnte man mit einer solchen empfindlichen Kostbarkeit spielen“, fragte ich mich, „eine so fragile Pracht ins kindliche Herz schließen?“
Ob Marthas Kindheit glücklich war? Nie hörte ich die Mutter klagen über Entbehrungen oder Erinnerungen an finstere Tage und Ereignisse. Auch wehrte sie meine Wünsche nicht mit einem Verweis auf eigene Entbehrungen im gleichen Alter ab, ich vernahm kein: „Ich in deinem Alter hatte das alles nicht! Wenn du wüsstest, wie ich aufgewachsen bin!“
Ich rief meine Schwester Rebekka an, sie solle mir die Fotoalben der Familie zukommen lassen. Vor ein paar Wochen erst die Tagebücher, jetzt auch die Alben.
Die Familie war das erste Foto in dem Album beschriftet, gleichzeitig das früheste Bild, das es von Martha gab. Aufgenommen zwischen dem Schulhefteintrag und dem ersten Tagebucheintrag, war sie, vierzehnjährig, gerade fertig mit der Schule und konfirmiert. Anders als von den beiden älteren Geschwistern gab es von ihr keine Kleinkinderaufnahme.
Jetzt aber hatte sich ein junger Fotograf am Ort installiert. Jahrzehntelang würde er hier seine Tätigkeit ausüben und sich den zweifelhaften Ruf des „Laggai“ erwerben, was auf schwäbisch nichts weniger bedeutete als „Lakai“, vermutlich, weil er auf Abruf eilfertig mit seiner Kunst zu Diensten stand und weil er um seine Objekte flink herumwieselte und dienerte, und mit einer Art Bückling hinter der Kamera unter seinem schwarzen Tuch hantierte, so dass er mit diesem Gehabe wohl immer ein seiner Kunst zuträgliches Lächeln in die auf Ewigkeit getrimmten Gesichter brachte.
Die ganze Familie macht sich im Sonntagsstaat zu ihm auf. Sophie ist es, die Mutter, die sie zusammen da hintreibt. Alle Kinder erwachsen und sie mit fünfzig im hohen Zenit ihres Lebens, will sie jetzt dieses Bilddokument, um die Flüchtigkeit des Daseins nun doch einmal festzuhalten, in seinem höchsten Moment, die Pracht der Familie: drei großgezogene Kinder und alle im besten, im allerbesten Alter.
Im Studio werden sie vom jungen Künstler hindrapiert, die Körper in den gewollten Haltungen und Posen festgezurrt. Der Laggai ist noch jung und ehrgeizig und holt heraus, was das Motiv hergibt. „Weiter nach links! Kinn raus, junges Fräulein, Zöpfe nach hinten, wenn‘s beliebt!“ sagt er und denkt: „Wenn du schon keinen Bubikopf hast. Bist doch kein Kind mehr. Ach, eigentlich wäre ja Bubikopf angesagt oder wenigstens ein paar eingedrehte Locken, aber jetzt sind es halt Zöpfe, du lieber Himmel, die verstecken wir, obwohl zu diesem Anlass noch ein besonders schönes und breites Zopfband eingeflochten war. Die Mädchen auf dem Land haben halt Zöpfe und die Weiber einen Dutt, und hier bin ich eben auf dem Land“, denkt sich der aufstrebende Fotograf, seufzt und sagt dann: „Und Brust raus und lächeln!“ „Und die junge Frau“, befiehlt er der älteren Schwester, „die Hand in die Hüfte! Ein bisschen flott wollen wir das doch, so machen das heute die jungen Frauen, keck und burschikos! - Einen Hauch von Charleston möchte ich da ins Bild bekommen. Die neue Frau!“, denkt der Laggai und weist an: „Na ja, und der junge Herr ganz in die Mitte, linke Hand in die Tasche, da steckt doch das Portmonee.“ Da müssen alle lachen. Jovial, so will er es. Ein Hauch von Galan, aufrecht und lässig die Hand in die Jackentasche, dass ein bisschen Pfiff, ein bisschen Zack ins Bild kommt. Die Mutter verkneift sich ein Lächeln, streckt aber brav, wie befohlen, den Finger ins aufgeschlagene Brevier, das ihr der Künstler in den Schoß gelegt hat. Nur die Mimik unterwirft sich nicht so ganz seiner Regie. Und das alles, weil die Mutter es wollte. Vorne links sitzt sie, künstlich aus dem falschen Büchlein aufsehend, halb vergessen den Finger darin. Es stimmte schon, sie wusste immer, wo es lang ging, führte das Wort, dirigierte, immer noch straff, aufrecht, im hochgeschlossen zugeknöpften, schwarzen Kleid, ohne Mode, zeitlos alt und mit einem verkniffen schmallippigen Mund. Martha ist das inszenierte Fotografendrama sichtlich zu viel. Um ihren Mund spielt ein Mona-Lisa-Lächeln, das eine ihrer dunklen Augen fixiert die Kamera, der Blick des anderen gleitet vagant in die Ferne. Seitlich steht sie hinter der Mutter, ein 14-jähriges Mädchen, die zum Verschwinden gebrachten Zöpfe ziehen das gescheitelte Haar straff in den Nacken. Ihrem frischen Gesicht fehlt das Herbe der Geschwister, der Mutter. Nein, das Gesicht hat sie nicht von der Mutter, auch die Züge des Vaters finde ich darin nicht, aber seine Freundlichkeit und Milde. Fast noch kindbackig schaut sie offen in Richtung Kamera. Sie, die jüngste, hält einen Papierrosenstrauß, den hat ihr der Laggai in die Hand gedrückt. „Rosen, aufblühende Jugend und Leidenschaft“, denkt der, „das passt doch.“ Das papierene Objekt, ein bisschen fremd am Arm, zieht diesen schwer nach unten. Der andere, ihr rechter Arm, liegt auf der Stuhllehne der Mutter, das kommt der nicht ungelegen: Die Junge, die die Alte angedeutet schützend umhegt, so muss es sein.
Die ältere Schwester Marie steht auf der anderen Seite, mit undurchdringlicher Miene, streng gescheiteltem Haar, das zwar unsichtbar, aber sicherlich in einem Knoten zusammengefasst war, fotografengewollt kess die Rechte in die Hüfte und diese ins Bild drehend, die andere Hand auf die Stuhllehne des Vaters gestützt, der auf dem einzigen Armlehnstuhl sitzt. Der Vater, jetzt fünfundfünfzig, mit einem freundlichen Gesicht, das bestimmt wird von den wasserhellen Augen. Der Mann ist weich in den Stuhl gebeugt und seine Hand auf der Lehne abgelegt wie ein abgenutztes Werkzeug. Die Schwestern zwillingshaft im gleichen Kleid, hüftversetzt, kein Busen, keine Taille, die weiblichen Attribute versteckt im sackartigen, etwas weit ausfallenden Gewand, androgyn und durchaus zeitmodisch. Wären da nicht die Zöpfe, das Nest, was das Zeitgemäße wieder zu Nichte machte.
Im Zentrum, eingerahmt von den beiden Schwestern und Scheitelpunkt der vom Fotografen symmetrisch aufgestellten Gruppe, der junge Herr, der Bruder, bedeutend älter als Martha, im Anzug, mit weißem Kragen und Krawatte und legerer Herrenattitüde: Mittelpunkt, Höhepunkt der Familienaufstellung. Die Schwestern die umschmückenden Blätter der Blüte, in deren Zentrum Otto: Zukunft, Dynamik, Kraft, stolzer Stammhalter. Das hat der Fotograf intuitiv schon ganz richtig erfasst. Und die Eltern noch weiter draußen, fast schon am Abfallen, die Hüllblätter. Ein kurzer Zustand familiärer Blüte auf dem Höhepunkt ihrer Entfaltung. Bevor eine Unruhe hineinkommen würde, ein Welken, ein Auseinanderfallen.
So schauen sie in die Kamera. Für wen? Vielleicht zuallererst für sich selber. In einen auf Dauer gestellten Spiegel. Jetzt lächeln, den Atem anhalten, die Zeit für einen Moment. Was sehen sie, wenn sie ins Kameraauge schauen und hindurch, in die Ferne und zurück: „So weit sind wir gekommen. Bis hierher hat uns Gott gebracht“, denkt Daniel, Sophies Mann, der Vater der erwachsenen Kinder, und diese träumen voraus zu ihren zukünftigen Betrachtern, mit Hoffnungen und Sehnsüchten. Wenn sie bloß wüssten, wen sie da sehen, wer sie in diesem für immer festgehaltenen Moment einmal sehen würde, für wen sie sich aufgestellt haben.
Hinter der Gruppe dekorativ aufdampfendes Bühnenbildgewölk, aus dem sie alle kommen, und links und rechts Vorhänge, wie auf dem Proszenium des Theaters: Hinaus in die offene Zukunft! Das Stück kann beginnen...
Ein Familienfoto, das es von uns so nie geben wird, weil wir nie zum Fotografen gingen, weil immer einer fehlte, weil entweder, im Zeitalter der Kleinbildkamera, ein Mitglied der Familie der Fotograf war, oder im Krankenhaus, oder verstorben. Aber immer noch waren wir in unserer Kindheit und Jugend aufgestellt vor der Kamera, wartend auf das Auslösende, wonach kurz darauf das momenthaft für die Ewigkeit Stillgestellte wieder zerfiel, im Fluss der Zeit, wie ein Stück Würfelzucker unterm warmen Guss aus der Kanne. Kein Vergleich zu den Instant-Bilderfluten von heute. Jetzt getätigt und jetzt schon spurlos gelöscht, von den Speichermedien kaum wirklich gespeichert, im Augenblick für den Augenblick. Fotos, bei denen man kaum noch bei der Sache war, nein, nur noch bei der Sache und selber kaum bewusst anwesend. Ein Wimpernzucken, ein virtuelles Auslösen und Auflösen. Und hier betrachtete ich das Stück Papier, neunzig Jahre lang war der Moment festgehalten worden. Bis jetzt schauten sie die Nachkommenden an.
Was in den auf Schulabschluss und Konfirmation folgenden Jahren geschah, ließ sich nur vermuten. Martha wird wohl erst einmal zuhause unter der Obhut der Mutter geblieben sein, um dort in Haushalt und Landwirtschaft mitzuhelfen. So war das auf dem Land noch lang, im vorbereitenden Wartestand, um einmal die Eltern zu versorgen oder einen Ehemann, das war das Schicksal, das Gott für sie als Frau vorgesehen hatte. So sah man das.
In den Unterlagen meiner Schwester fand sich noch ein Schreibheft der Martha mit Musterbriefen. Demnach hatte sie als Vierzehn-, Fünfzehnjährige jeweils im Winterquartal die Fortbildungsschule am Ort besucht, die wohl Pflicht für die jungen Mädchen war, wie ich historischen Dokumenten im Dorfarchiv entnahm, damit sie ‚nicht unvorbereitet in die Ehe glitten‘ und dort womöglich ‚den sittlichen Verfall beschleunigten‘. Wöchentlich in vier Abendstunden lernten die jungen Schulabgängerinnen das Abfassen von Bewerbungs- und Empfehlungsschreiben für Hausangestellte und weibliches Dienstpersonal, das Formulieren von Reklamationen und Beurteilungen und Rechnen. Der Haushalt sollte kein blindes Werkeln sein, sondern als kleiner Betrieb aufgefasst werden und die Hausfrau als Managerin, die eine rudimentäre Kalkulation und Buchhaltung und den anfallenden Schriftverkehr beherrschte. Ob auch Hygiene, Kochen, Säuglingspflege zu den Fächern gehörte, war aus den Unterlagen nicht ersichtlich.
Dann fanden sich keine Einträge mehr im Musterheft. Vielleicht nahm Martha in der folgenden Zeit noch an Näh- und Kochkursen teil, die im Ort angeboten wurden, ansonsten schien sie im elterlichen Haushalt und in der Landwirtschaft mitzuhelfen, wie ihre ältere Schwester auch - und zu warten.
3.
‚Before they disappear‘ war der Titel der Ausstellung, für die derzeit ein Plakat in der Stadt warb, mit großformatigen Farbfotografien von Eingeborenen aus Papua, Kenia, der Mongolei, in bizarrem Putz, drapiert vor exotischen Welten einer scheinbar unberührten Natur ohne Strommasten, Autos, Hochhäuser.
Auch die Stondenwelt war dem Untergang geweiht und die Stondenleute ein aussterbender Stamm. Sie hätten zweifellos in die Fotoserie gepasst. Und plötzlich war wieder der Geruch da von Stall und alten Büchern und die Namen fielen mir ein, von den Cousinen, die in die Stond mussten: Esther, Christiane, von den Schulkameraden des Bruders, die in der Nachbarstadt wohnten und mit ihm auf dem Gymnasium waren. Manchmal kamen sie in Begleitung ihrer Väter in die Stond auf Besuch, Gerhard, Albrecht, oder auch Hans Wöhrle, einer der jüngsten Stondenbrüder damals, in Begleitung seiner Frau und Tochter Karin.
Ich suchte – war es spaßeshalber, der Zerstreuung wegen? - im Internet nach ‚Michael Hahn‘. Demnach gab es noch Hahnische Gemeinschaften in Böblingen, Altdorf, Stuttgart, Birkach. In einem privaten Blog berichtete jemand von seinen Erfahrungen mit den Stondenleuten, erinnerte sich an die Abgesonderten in seinem Dorf nur mit Abneigung, weil sie sich für etwas Besseres hielten, verglich sie mit den Amish oder nannte sie Sektierer. Dann stieß ich auf eine Abhandlung zu Hahns Lehre, von ‚Vision‘ war die Rede, von ‚Tinktur‘, ‚Wiedergeburt‘, ‚Geistleib‘, ‚Fleischleib‘, vom ‚Alten Adam‘ und der ‚Wiederbringung‘. Alle diese Begriffe waren plötzlich wieder da, verbanden sich mit Bildern von ernsten, dunkel gekleideten alten Frauen und Männern, die steif zusammensaßen und in Monatsstonden an Milchbroten kauten. Alle diese Erinnerungen, fremd-vertraut, unangenehm und heimelig, schossen auf wie Pflänzchen in der Wüste, die Jahre, Jahrzehnte lang auf den Tropfen Wasser gewartet hatten.
Ich erinnerte mich wieder an die ‚Schatzkästlein‘, eine Liedersammlung des Michael Hahn, aufbereitet für jeden Tag im Jahr, schaute nach, ob sie womöglich im Internet noch angeboten würden. Tatsächlich, die ‚kurzen‘ und die ‚langen‘ - richtig, es gab ja beides: Die kurzen waren quadratisch, die langen im üblichen Buchformat. – Beide waren antiquarisch noch zu finden und ich bestellte die kurzen ‚Schatzkästlein‘ bei einer Hanna Maria Adam. Wer so hieß, dachte ich, musste doch etwas mit der Stond zu tun haben. Aber warum verkaufte sie die Liederbüchlein? Und nun schickte sie per E-Mail parallel zur Sendung ein Begleitschreiben. An den Büchern hänge auch eine Geschichte, schrieb sie, als Kind habe sie immer in die Hahnische Gemeinschaftsstond mit müssen. Längst habe sie sich davon getrennt. Der Bruder allerdings führe ein Stondenhaus und halte es ‚mit der anderen Seite‘. Niemand von diesen ‚Superfrommen‘ halte zu ihr. Das Schreiben mündete in eine lange Klage, in der es um die andere Seite und diese Seite, Diese und Jene, Gut und Böse ging. Und sie selber schien entgegen ihrer Ansicht in dem schwarz-weißen Spinnennetz gefangen und fand keinen Ausweg.
Die zwei ‚Schatzkästlein‘ trafen ein paar Tage später ein. Beim Abendessen am Küchentisch, während das Radio in den Nachrichten von der Krimkrise plapperte und vom rätselhaften Verschwinden eines Flugzeugs, schlug ich neugierig das eine der Bücher auf. Die Lieder befassten sich thematisch, wie konnte es anders sein, mit dem Glaubensleben, sie wollten anspornen auf dem nicht immer einfachen Glaubenspfad und mahnten, nur ja darauf zu bleiben durch ein rechtschaffenes Leben, durch Wachen und Beten. Ich las Bibelvers und Lied zum heutigen Tag: ‚Gott du bist mein Gott. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen dürren Lande, da kein Wasser ist.‘ Und nach der Melodie: ‚O Jerusalem du schöne‘ - sofort erstand sie in meinem Gedächtnis – konnten dann die folgenden Liedstrophen gesungen werden.
Alles war in mir wieder da, der Text schwang in der Melodie und die Wörter wurden zu alten Bekannten, Rädchen und Zahnrädchen setzten sich zusammen wie zu einem Uhrwerk, eine patinierte Wärme stieg in mir auf: ‚Du bist‘s, den mein Geist begehret, Kreatur ist mir nichts nütz‘, ja, da war es wieder: das sich Abwenden von dieser Welt und ihrem lärmenden, nichtig-flüchtigen Getriebe. Eigentlich war es mehr als die Mechanik eines Räderwerks: ein Organismus, etwas Lebendiges fing an, als ein Fremd-Vertrautes in mir zu wuchern.
4.
Seit einigen Wochen transkribierte ich das Tagebuch der Martha Müller. Die Einträge waren mit einem blauen Tintenstift erfolgt, dessen Pigmente, über die Jahre haltlos geworden, sich langsam in die Papieroberfläche hinein auflösten und der Schrift die Aura der Vergänglichkeit verliehen. Allzu oft konnten die Seiten nicht mehr geöffnet werden, wollte man nicht Gefahr laufen, dass die Aufzeichnungen gänzlich ins Unleserliche zerflossen.
Mit jedem Satz tauchte ich tiefer in die Welt einer pietistischen Stondenschwester ein, die versucht hatte, ihr Leben im Licht ihrer Religion zu sehen und zu begreifen und den Vorschriften Gehorsam zu leisten.
In Mußestunden blätterte ich in Büchern mit Aufnahmen vom Dorf aus den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts. Wege wie ausgetrocknete Flussbetten, fantastische Dachlandschaften wie Schuppenhäute vorgeschichtlicher Fabelwesen, altersschiefe Gebäude, abgeblätterte, feuchte, überwachsene Fassaden, ein paar Drähte an Telegrafenmasten wie Spinnennetze an der Dorfstraße entlang, an ihrem Rand ungeheuer Verwinkeltes, Schiefes, Höhlenartiges, davor archaisch anmutende landwirtschaftliche Geräte, Wagen aus Holz wie bizarre Skulpturen, hie und da ein Kuhgespann, symbiotische Mensch-Tier-Wesen. Unvorstellbar primitiv, naturnah wie ein Eingeborenendorf auf Borneo oder im Amazonas-Becken. Längst versunkene Welten, die sich über die Jahre, die auch noch meine waren, wegschlichen, wie die Nacht aus dem Tag. Bereits beim Einschlafen oder noch beim Aufwachen tauchten sie wieder auf, darunter das alte Haus als weißer Berg, als steil aufragende Fläche, die sich dann in die Waagerechte neigte, zum schwimmenden Eisberg wurde, der schnell abschmolz und schwand, während ich mich darauf befand, in einem weiten, kalten Meer.
Ich würde dort hinfahren, sobald ich nicht mehr arbeiten musste. Bald war ich in Rente und zeitlich ungebunden. Ich würde zurückreisen und Orte aufsuchen, die in Marthas Leben und in meinem eigenen einmal von Bedeutung waren, Orte, die heute wenigstens noch den Namen von damals trugen, ansonsten aber, wie könnte es auch anders sein, sich verändert hatten. Und trotzdem: Vielleicht fanden sich tief in den verbreiterten, begradigten Straßen und den rudimentär aus jener Zeit noch vorhandenen Häusern, auf Hügeln und an Flüssen, in alten Ortskernresten und in den dort lebenden Nachkommen Marthas Spuren, von ihrer und meiner Zeit.
Schließlich, über ein Jahr war inzwischen vergangen, seit ich wieder eine erste Berührung mit jener Welt hatte, war es soweit. Ich fuhr in die alte Heimat.
Nach einer langen Bahnfahrt endlich auf dem Fußweg vom Bahnhof zum Zielort der berühmte Postkartenblick von der Flussbrücke aus, zahllose Maler und Fotografen hatten sich von ihm fesseln lassen. Mit der Zeit war das Panorama völlig zugewachsen. Die alte Steinbrücke, nach ihrem Erbauer Herzog Ulrich benannt (eben dem Ulrich, der in Marthas Schulheftchen zusammen mit seiner verschwenderischen Frau Sabina von Bayern erwähnt wurde), teilte wie vor Zeiten nach der flussaufwärts liegenden Seite mit ihren Flutbrechern, mächtigen Schiffsbugen gleich, das Flusswasser und nach der andern ragte über der steinernen Brüstung der Obelisk wie eine Lanze auf, die schützend vor den Ort in der Ferne gepflanzt war. Seine Inschrift informierte, dass die Brücke von Schickhard, einem der bekanntesten Architekten im Württemberg des 16. Jahrhunderts, stammte. Dahinter säumten mächtige Silberpappeln das Flussufer. Ihr Laub flirrte in Sonne und Wind wie ein mit unzähligen Pailletten besetzter Vorhang, in dem sich die Landschaft impressionistisch auflöste. Begradigt trieb der Fluss in einem nun auch schon nicht mehr neuen Bett dem Wehr zu, das jetzt nur mehr eine simple Wasserwalze war. Die einst vom Wasser angetriebene Mühle stand wegen der Flussumleitung seitab und war längst schon keine Mühle mehr, sondern ein griechisches Restaurant, das sich das Mühlenambiente nostalgisch zunutze gemacht hatte. Hundehalter führten ihre Tiere aus, ein sportlicher Geher war auf dem Wanderweg, der entlang des Ufers ausgeschildert war, mit seinen Stöcken unterwegs. Müßiggang, Freizeit, Wohlstand lagen in der Luft. Noch war der alte Friedhof, seit langem zum Park umgewidmet, mit der ursprünglichen Hausteinmauer umgeben. Innerhalb der Umfriedung hingen ein paar Jugendliche auf Parkbänken herum und spielten mit ihren Handys. In Vorgärten züngelten Schwertlilien blau im Wind, rostige Metallherzen waren in Blumenbeete gespießt, ganz offensichtlich eine gerade herrschende Gartenmode. Pfingstrosen leuchteten dunkelrot, nach dem Regen sich blätternd, wie blutende Wunden. Im Dorf standen noch etliche Bauernhäuser aus meiner Kindheit, mit den großen Scheunentoren und den Stalltüren unter Kammerfenstern. Neben den neuen, größeren, mit glänzenden Materialien armierten Wohngebäuden wirkten sie wie hinfällige Zeugen aus einer anderen Zeit. Sie starrten aus blinden Fensteraugen, manchmal waren die Läden geschlossen, von denen verblasstes Grün in Fetzen abblätterte. Wie oft war Martha da entlang gegangen, gefahren, gestolpert, von der Flussaue die steile Bergstraße hinauf, an ihrem Saum Häuser wie eh und je hingewürfelt und im Hintergrund die Schwäbische Alb, die über der Straßenschlucht hochstieg und den Horizont als blaue Wand umschloss. Früher, als Schulkind, ging es tagaus, tagein diese Straße hinunter in die Schule, am „Zwillingshaus“, einem Doppelhaus, vorbei, an der langen Stützmauer vorbei, beim Bäcker vorbei, bei der Tante vorbei und am Mittag wieder zurück. Zu dritt gingen wir jetzt: Martha, die zu meiner Mutter wurde, ich und ich als Kind.
II. Pfannkuchen
März 2013
Plötzlich spricht jemand, berührt mich mit seiner Stimme, die aus dem Jenseits einer vergangenen Zeit zu mir dringt. Ich halte inne, drehe mich um. Ein fremdes und gleichzeitig vertrautes Wesen begegnet mir in diesem Tagebuch, ein junges Mädchen, das später zu meiner Mutter wird. Ein paar knappe Äußerungen sind es nur, aber immerhin: Jetzt redet sie zu mir, den sie damals noch nicht kannte, ein auch ihr fremdes Wesen und doch Teil ihrer selbst, ein zeitläufteverstricktes, generationenversetztes Alter Ego: Du.
Warum und für wen machst du diese Aufzeichnungen? Ein junges Mädchen aus einfachsten Verhältnissen, in denen das Schreiben doch keine zentrale Rolle gespielt hat, schreibt ein Tagebuch. „Es ist eine Mode gewesen“, sagt mir jeder, dem ich von meiner Verwunderung berichte, „vor allem jedes Mädchen hat damals solche Aufschriebe angefertigt.“
Hast du Tagebücher gelesen? Haben Freundinnen dich darauf gebracht? Hier und da gab es Frauen, die sich in der Stond Notizen machten, das als wichtig Erachtete ergeben in kleine Heftchen notierten, um es zuhause noch einmal nachlesen zu können. Manche hatten sogar Kurzschrift gelernt und schrieben ganze Beiträge im Wortlaut mit. So entstanden die zu Büchern zusammengetragenen und im Verlag der Hahnischen Gemeinschaft veröffentlichten ‚Betrachtungen‘ des David Kuder von Nürtingen, des Ernst Klenk von Göppingen, des Karl Kraus von Böblingen. Mit Datum versehene, eigene Gedanken oder private Notizen hatten aber, weil zu unbedeutend, vielleicht auch als zu Ich-süchtig erachtet, auf diesen Seiten keinen Platz. Manchmal soll es auch vorgekommen sein, dass Stondenbrüder ihre „Geschwister im Geiste“, zur kritischen Seelenerforschung und zur Buchhaltung des Glaubensfortschritts, anhielten, Notizen anzufertigen.
Ist es Zufall, dass du dein erstes Tagebuch in einem Schulheft beginnst, auf dessen ersten Seiten die Daten deutscher und schwäbischer Regenten aufgelistet sind? Willst du dich vielleicht ganz unbewusst einreihen in den großen Strom der Geschichte mit deinem einfachen, oder soll ich sagen: unbedeutenden Leben?
Was sind die äußeren Umstände deines Schreibens? Wo setzt du dich zum ungestörten Tagebuchführen hin in der kleinen bäuerlichen Wohnung?
In einer der beiden Kammern hinter der Küche Richtung Grasgarten standen dein und deiner Schwester Betten. Nach dem Tod der Ahne vor zwei Jahren gab es ein Um- und Ausräumen und ein Möbelrücken von hier nach da und seit Neuestem hast du die kleine Kammer mit den zwei Fenstern nach Osten für dich allein.
Sobald du diesen, jetzt deinen Raum betrittst, schließt du die Tür hinter dir, erinnerst dich, wie du als kleines Kind darauf bestanden hast, dass diese Kammertür noch offen blieb, wenn du als die viel Jüngere immer früher als die andern ins Bett musstest und allein im Finstern lagst, so dass eine Art Nabelschnur aus Licht hinüberreichte, wo das Leben spielte und die Verbindung hielt zum Geschehen in der Küche, zu den andern, die noch um den Tisch saßen und den Tag mit Unterhaltungen fortsetzten. Jetzt schließt du die Tür und bist ganz bei dir selbst.
Wenn du die Holzläden öffnest, siehst du ostwärts in dem kleinen Ausschnitt, den dir die Nachbarhäuser gewähren, bis zur Schwäbischen Alb, wo an sonnigen Tagen in ihrer blauen Ferne der ebenmäßige Kegel des Aichelberg in den Himmel steigt. Du hörst aus dem Tal die Eisenbahn als ein Rauschen in unregelmäßigen Abständen. Morgens siehst du in den klaren Wintermonaten die Sonne aufgehen, dann scheint sie bis in den hintersten Winkel deiner kleinen Stube. Zwischen den beiden Fenstern steht ein weißes Tischchen mit Schublade. Du lässt dich daran nieder, ziehst das Heftchen aus der Lade, schlägst es auf und bist nun ungestört ganz dir selbst zugewandt, noch einmal sammelst du dich, um die wichtigen Ereignisse des Tages und der vergangenen Woche zu bedenken.
Meistens wird es der Abend sein und meistens der Sonntag, wenn die Eltern und Geschwister die Küche nebenan verlassen haben oder wenn sie ins Bett gegangen sind und Ruhe ins Haus einkehrt. Dann öffnest du das Privatissimum der leeren Seiten, in denen du Herrin deiner selbst bist, Regieführerin deines Lebens, das du in Worte fassend und in Schrift fixierend vor dir ausbreitest und auslegst und auslegend dir erschaffst.
15. Juli 1929
Heute will ich anfangen ein Tagebuch zu führen und so meine wichtigsten Erlebnisse und Gedanken von Zeit zu Zeit einzutragen. Mit diesen Worten beginnst du dein Tagebuch. Die Einträge versiehst du mit Jahr und Tag, Zeitmarken, die ein Vorher und ein Nachher deines Lebens kennzeichnen, die deine Person im gleichförmigen Fortgang der Zeit positionieren. 17 ¾ Jahre alt bist du. In drei Monaten wirst du von Zuhause fortgehen, „in Stellung“, wie es damals hieß. Du stößt die Tür deiner Kinderstube auf und tust einen Schritt hinaus in eine neue, in deine eigene Welt, heraus aus der Obhut deiner Eltern und Geschwister, dem in warmer Geborgenheit dahinfließenden Alltag.
Das Tagebuch bleibt nicht nur die schwärmerische Episode eines jungen Mädchens, sondern es wird dich durch dein Leben begleiten. Du vertraust diesen Zeilen nicht rückhaltlos alles an. Dein Innerstes bricht nicht unkontrolliert aus dir heraus, du legst einen Filter davor und formulierst entlang der Grenze von „gehört sich“ und „gehört sich nicht“, das Schickliche und davon nur wieder das Wichtigste. Vielleicht legt die Furcht des Entdecktwerdens den Riegel vor eine rückhaltlose Selbstoffenbarung, vielleicht ist es auch nur eine unerklärliche Scheu, denn es ist etwas anderes, ob man einen Gedanken nur denkt oder ihn im Hinschreiben fixiert. Aber sich in Gefühlen zu verlieren ist in euren Kreisen auch verpönt und dir ungewohnt und auch dein Jesus sagt es warnend, dass man Vorsicht walten lassen solle in dem, was den Mund verlässt, denn es könne den Menschen verunreinigen. Deine Einträge bleiben buchhalterisch knapp. Was dir wichtig erscheint ist nicht viel, Fragen, Zweifel und Kritik sind darin kaum zu finden. Das sind nicht die Erkenntnisinstrumente der braven Tochter.
Über alles das denkst du nicht nach, es dürfte dir nicht einmal bewusst sein. Du hast den Impuls, auf dem leeren Blatt dein Tagesgeschehen zu registrieren, festzuhalten, was dir wert ist an Eindrücken und Gedanken, vor allem die der anderen, dir wichtigen Personen. Sie sollen dich weiter bilden und, ja, so würdest du dich wohl ausdrücken, deinen „Geistleib nähren“. Und werden die wichtigen Ereignisse, die du schriftlich festhältst, nicht auch zu einem Dokument der Gottesführung, zum Beleg, dass dein Gott dich geleitet hat, hier und da und bis jetzt? Sie können dir, hoffst du vielleicht, in schwierigen Zeiten, wenn du dir seiner und deiner selbst nicht mehr sicher bist, beim lesenden Vergegenwärtigen wieder einen festen Halt geben. Vielleicht willst du dir mit den Einträgen auch Rechenschaft über den vergangenen Tag, die vergangene Zeit, über dein gottgefällig geführtes Leben geben, in dem nichts Unnützes, Eitles einen Platz haben sollte. Rechenschaft über ein Leben, das im Idealfall die Bilanz eines Heiligenlebens wäre.
Keine weit ausholenden Erinnerungen, keine Rückblicke auf Geschehnisse, die vor dem ersten Eintrag liegen, nicht der Krieg, der deine Kindheit prägte, nicht der Tod der Großmutter, der noch gar nicht so lange her ist, finden Platz in deinen ersten Zeilen, gleich bist du in der Gegenwart und schreibst von dem dir Wichtigen, dem innersten Sinn und Angelpunkt deines Lebens: deinem Jesus oder auch deinem Heiland, wie du ihn nennst. „Bist du seine Magd, sein Kind, seine Freundin? Liebt er dich, der Herrscher, der Vater, der Freund? Musst du um seine Liebe buhlen?“, fragt der Pfarrer heute von der Kanzel herunter die anwesende Gemeinde, fragt dich naives Mädchen. „Nein“, sagt er, „du musst sie nur erwidern, musst einfach nur ‚Ja‘ sagen.“ Voller Ernst schreibst du das auf, willst es zu Herzen nehmen, das dir Wichtige, willst es festhalten, um es wieder und wieder zu lesen. Dir würde es nicht einfallen, das von der Kanzel herunter Gesagte in Frage zu stellen. Das Wort gilt dir. Es soll dir eine Lehre sein, soll sich dir einprägen um dir künftig Orientierung, Halt und Trost zu geben. Dieses „Ja“, mit dem du, den Worten des Pfarrers Folge leistend, die Liebe deines Heilands erwidern sollst, ist nicht nur ein Wort, sondern umfasst dein ganzes Leben.
Du legst den Blaustift in den Seitenfalz, schließt das Heftchen und verwahrst es in der Schublade. Dann kniest du dich, schon im Nachthemd und bevor du zu Bett gehst, hin zum Abendgebet, weil du es nicht nur in Gedanken, sondern auch mit deinem Körper ganz ernst meinst, du hebst die gefalteten Hände dort hin, wo du die Inbrunst zu spüren meinst, als sanften Widerstand in Herznähe, ein warmer Klumpen, mal fest, mal weich, größer oder kleiner, ein Etwas, das sich verwandelt und als aufgelöste Substanz bis in den Kopf steigt, dort zur Stimme sich verwandelt, tröstend und mahnend, auch als strafend sich verhärtendes Wort zur Peitsche wird, zum quälenden Stachel, hinabsteigt, hineinfließt in die Adern in das Nervengeflecht als Gefühl, wärmend und angstauslösend, in deinen Leib hineinwächst und deinen Körper, deine Gedankenwelt durchzieht, als eine Energie, eine Substanz, ein Organismus wie ein Pilzgeflecht, ein Wesen liebendstrafend. „Ja, lieber Heiland, ich liebe dich. Amen.“
Mai 2015
Mit der S-Bahn fahre ich nach Ötlingen. Immer stelle ich den Vergleich an: Damals gab es die nicht, aber doch die Bahn, mit der du gefahren bist. Zuerst machst du dich, wie ich jetzt, zu Fuß zum Bahnhof auf, der jenseits des Flusses und weit außerhalb des Dorfs liegt. Heute gibt es für diese Wegstrecke alternativ einen Linienbus, aber ich gehe in altgewohnter Weise zu Fuß. In fünfzehn Minuten fährst du nach Ötlingen und dort geht es wieder zu Fuß ans Ende des Dorfs Richtung Kirchheim, wo die Sägemühle an einem Flüsschen liegt, dessen Wasserkraft sie für ihren Betrieb braucht. Dort habe ich eine Verabredung mit den Nachfahren deiner „Herrschaft“.
Im knirschenden Kies nähere ich mich dem Anwesen, das jetzt mitten in einem Industriegebiet liegt, passiere ein paar abgestellte Autos, herumliegendes Kinderspielzeug, Holzbretterstapel, die in Regalen säuberlich gelagert sind. Das stellte ich mir urtümlicher, gewaltiger vor, ein Hantieren mit mächtigen Baumstämmen, Kräfte gezielt gebändigt, Motorensägen, „der Hochgang“, wie du einmal sagst, wenn das ganze Haus wackelte und dröhnte unter dem Sägewerk. Aber davon ist weit und breit nichts zu vernehmen.
Das Haus deiner Herrschaft, das ich auch aus meiner Kindheit kenne, es steht noch, entpuppt sich aber als schlichtes Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert, dem man noch seine bäuerliche Vergangenheit ansieht. In meiner Erinnerung war es repräsentativer. Jetzt steht es da altersgrau, heruntergekommen, die Haustür achtlos offen. Sechs steinerne Stufen führen zu ihr und innen im Dämmer steigt eine Holztreppe gleich weiter nach oben in den ersten Stock. Wie oft du die gegangen sein magst? Auf und ab und auf und ab und noch einmal. „Maria bring dies! Räum das dort hin! Ach, ich hab noch was vergessen, Maria, sei so gut!“ So die Stimme der Frau aus dem oberen Stock werk. Um das Gebäude herum zahlreiche Anbau- und Veränderungsspuren. Zu unpraktisch war es über die Jahre geworden, zu klein. Da noch ein Balkon, dort eine Hütte angesetzt, auf seiner Rückseite das Dach angehoben von einer doppelfenstrigen Gaube, da könntest du dein Zimmer gehabt haben, hinter dem linken oder rechten Fenster, mit Blick auf das Flüsschen oder die Baumwipfel davor. Und auch die jetzt abgeschossen blaugrauen Holzläden könntest du morgens und abends bewegt haben. Damals noch frisch in der Farbe.
Wo ist das Blechdach, auf dem deine Mutter hockte? Hinter welchem Laden ist der Sägemüller gestorben? Wo hast du gekocht, wo gewaschen? Alles das hat hinter dieser jetzt mürben Hülle stattgefunden. Tja, alles viel bescheidener als ich mir ausmalte.
Am Eingang steht eine junge Frau. Die Tochter, die Enkelin oder die Urenkelin? Sie sei Gerda, die Enkelin der Lydia Hartmann, wird aufgeklärt. Dann geht es die sechs Steinstufen hoch ins Haus hinein und die breite Holztreppe hinauf, Gerda vorneweg, oben im ersten Stock über den knarrenden Holzdielenboden den Flur entlang. Die niedrigen Raumdecken fallen auf. An der Wand ein frommer Spruch, vielleicht die Jahreslosung, über der alten Kommode, die könnte noch von damals sein, links die Küche, wie wohl schon zu deiner Zeit, mit Blick auf den Fluss. Eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine rattert. „Die haben dich längst ersetzt“, schießt es mir durch den Kopf, „dein Waschtag ist inzwischen geschrumpft auf diesen weißen Kasten und einen lächerlichen Knopfdruck.“ Dann rechts in die Wohnstube. Alles wirkt praktisch auf den Kinderalltag der jungen Familie ausgerichtet. Auf dem großen Tisch liegen Fotoalben. Ich nehme Platz, etwa da, wo du laut Foto mit der Familie singend am Harmonium gestanden hast. Blindgewordene Bilder, die ich Gerda nun erhellen kann: Das Mädchen, die junge Frau, von der sie nicht wusste, wer sie war, das seist also du, die Martha, inmitten der Familie mit den schulpflichtigen, fast schon halb erwachsenen Kindern der Herrschaft, vor dem Haus, auf der Treppe, auf Baumstämmen. Von dir existierten also tatsächlich noch ein paar Fotos im Familienalbum der Sägwerksfamilie - einzige Erinnerungsspur an dich in diesem Haus, jetzt kurz im Tageslicht sichtbar und bald wieder zwischen zugeschlagenen Seiten verschwunden. Ich lese Gerda deinen Tagebucheintrag zum Tod ihres Großvaters vor. Mir kommen fast die Tränen vor Rührung. An ihr, die mir gegenüber sitzt und schweigend zuhört, merke ich keine weitere Reaktion.
Dann führt mich Gerda durchs Haus: die ehemalige Waschküche im Souterrain muffig, dunkel, an der Wand Rankenmuster, Spuren von einem Gummiwalzendruck, eine damals preisgünstige Verschönerung deines Arbeitsplatzes, das alte, abgestoßene Emaille-Waschbecken in der Ecke könnte vielleicht noch aus deiner Zeit stammen. In der Kammer unmittelbar dahinter klafft ein tiefes Loch, in dem ein Mühlrad früher die Energie des fließenden Wassers ins Haus geschaufelt hat: rauschende Urkraft, gezähmt, an langer Welle quer durchs Haus übertragen, eine Arterie der Energie, daran über Transmissionsriemen hängend und ihr mechanisches Leben daraus saugend verschiedene Maschinen, ursprünglich die einer Werkzeugschleiferei, sagt Gerda, die der Urgroßvater im 19. Jahrhundert in dem Bauernhaus aufgebaut hatte. Dann erst erfolgte die Umrüstung auf ein Sägewerk durch den Großvater Friedrich. Die mächtigen Sägegatter, tonnenschwere Gusseisenungetüme, urtümliche Monstren, kraftstrotzend und seit Jahrzehnten stillgelegt, wie unter einem Zauberbann stehen sie noch da, unter Staub und Spinnweben. Das Gebälk des Hauses aus dem neunzehnten Jahrhundert, man merkt es ihm an, hat schon immer unter den Lasten gestöhnt. Es lohne sich nicht, daran etwas zu richten, es sei von Grund auf morsch, sagt Gerda.
Ihren Onkel Traugott, dem Hochbetagten, der da hinten in dem Haus lebe - ja, immer noch lebt er, den du auf den Armen hattest, der einzige, der dich aus jenen, deinen Mädchentagen noch kennt - sei vor kurzem die Frau gestorben. Deshalb sei ein Zusammentreffen mit ihm nicht möglich. Eine halbe Stunde früher hätte ich ihn, Traugott, vielleicht noch vor dem Haus dort sitzen sehen können. So ist das mit der Zeit. Es gibt ein Zuspät, die Stondenbrüder sagten es ja immer.
Die Stuttgarter Straße hinauf, obwohl da kaum eine Steigung zu spüren ist, geht es, am Krankenhaus links, an der Papierfabrik Ficker rechts vorbei in die Innenstadt von Kirchheim. Zu Fuß ein weiter Weg, obwohl das Sägewerk gleich am Ortsrand von Ötlingen an der Stadtgrenze liegt. Wie oft machst du ihn? Zu welchen Anlässen? Meistens wirst du aber in die Stadt das Fahrrad nehmen, stelle ich mir vor.
In der Marktstraße, wo die wie in den blauen Himmel gesägten Fachwerkgiebel am weitesten auseinander stehen, sitze ich in einem Café. Am Maibaum, auf dem Platz ein paar Schritte weiter, flattern bunte Bänder und in der sommerlich-angenehmen Brise flanieren die Leute in Flipflops, T-Shirts, Babydolls und mit bunten oder gegelten Frisuren, Türkisch mischt sich mit Schwäbisch. Man riecht die adrette Sauberkeit, die Seife, das Deo, das süße Parfum in den bunten Kleidern. Ein langsames Hin und Her, Verweilen, Genießen und Konsumieren. Es ist dir alles ein oberflächliches Einerlei, berührt dich nicht. Du willst nur deinen Auftrag erfüllen, stelle ich mir vor, wie du da hindurch eilst, um eine Erledigung zu machen, mit dem Knoten im Haar, im dunklen Kleid bis zum Wadenansatz, leicht schwingend der schwere Stoff, zielstrebig wendest du dich nicht nach links noch rechts in dem weltlichen Spaß- und Amüsiergetriebe. Hier, diese giebelgezackte Straße entlang, bist du auch zur Apotheke geeilt, in die Stond gegangen.
4. August 1929
Etwas lernen, eine Ausbildung machen. Davon ist nie die Rede. Wozu auch? Sieben Jahre Volksschule, das muss reichen. Aber wenigstens als Dienstmädchen in Stellung gehen, das kostet nichts und bringt vielleicht sogar ein bisschen Geld. Als Dienstmagd wurden die Mädchen aus kinderreichen und sonst armen Familien immer schon regelrecht verkauft, das bedeutete eine Esserin weniger und immerhin etwas Geld auf die Hand. Einer kinderreichen Familie entstammst du nicht und bitter arm seid ihr auch nicht, aber jetzt, wo du den Kinderkleidern entwachsen bist, kann man dich ruhig zum Arbeiten schicken. Du könntest auch in die Fabrik, in die mechanische Leinenweberei im Nachbarort zum Beispiel. Andere Mädchen machen das. „Warum wurdest du Dienstmagd und nicht Arbeiterin?“, frage ich mich. War die an Maschinen stehende Frau eine zu fremde Vorstellung, diese Rolle zu sehr den Männern vorbehalten, womöglich die Arbeiterin als Teil des Proletariats zu politisch aufgeladen, womöglich kommunistisch? Dienstmädchen war dann vielleicht für ein Mädchen noch die bravere, traditionellere Alternative und die ausgeübte Tätigkeit gleich eine Einübung in die spätere Rolle zur gehorsam untergebenen Hausfrau, Ehefrau und Mutter. Mit der dienend erworbenen Kenntnis konntest du heiraten, Kinder erziehen, als Bäuerin arbeiten und den Haushalt führen und womöglich noch die Eltern pflegend versorgen. Magd war die weiblichste der in Frage kommenden Tätigkeiten, neben Krankenpflege, aber die wurde in deinen Kreisen eher von Diakonissen ausgeübt und erforderte eine langwierige Ausbildung bei gleichzeitiger Abwesenheit von zuhause, und damit wärst du ein Verlust der elterlichen Investition, ein Totalausfall der Arbeitskraft in Haushalt und Landwirtschaft. Als Magd war jederzeit über dich zu verfügen, konnte man dich problemlos aus deinem Dienst zurückholen und du bliebst so für zuhause als potentielle Stütze erhalten, und in fernerer Zukunft stand dir immer noch der Weg in eine Ehe offen oder die Rolle der ledigen Haushälterin, der „Stondenbas‘“ in einem Stondenhaus, das von einem unverheirateten Stondenbruder geleitet wurde.
Du darfst Dienstmädchen werden, sagst du, eine generöse Geste deiner Eltern, so siehst du das. Es war dein ureigenster Wunsch, dem sich die Eltern fügten. Andererseits hättest du dich auch nicht über den Elternwillen hinweggesetzt, wenn er deinem Ansinnen entgegengestanden hätte.
Es ist drei Jahre her, dass du in der Fortbildungsschule ein „Anerbietungsschreiben“ abfasstest: „Geehrte Fr. Renz! Durch den ‚Christenboten‘ habe ich erfahren, daß Sie den 15. Jan. ein Dienstmädchen brauchen. Da ich zuhause entbehrlich bin, u. ich mich in allen häuslichen Arbeiten ausbilden möchte, bin ich gerne bereit, Ihnen meine Dienste anzubieten. Letztes Frühjahr wurde ich konfirmiert u. bin seither im elterlichen Hause. Falls Sie es wünschen, bin ich gerne bereit, mich persönlich vorzustellen. Mit vorzüglicher Hochachtung verbleibe ich Ihre Martha Müller.“ Alles in einer wie gestochenen Schrift, versehen mit ein paar kleineren Korrekturzeichen des Lehrers und einem „gt.“. Ob sich hinter den Formulierungen damals schon ein eigener Wunsch verbarg, bleibt unklar. Um von zuhause wegzukommen musste man, wie das Schreiben erhellt, also „entbehrlich“ sein, was man auch als „überflüssig“ oder sogar als „nutzlos“ lesen konnte und beides bedeutete: aus der Sicht der sich zuhause eingesperrt fühlenden Tochter, endlich frei zu kommen, weil die anfallende Arbeit anderweitig geleistet wurde, oder aber, aus der Sicht der Eltern mit Blick auf die knappen Ressourcen, endlich eine unnütze Kostgängerin loszuwerden.
Das „sich in häuslichen Arbeiten ausbilden lassen“ war ehrfahrungsgemäß ein Euphemismus, unter dem sich häufig ernüchternd eine bittere Schule des Lebens verbarg und weniger ein systematisches Lehren und Einweisen in die Haushaltsführung, ganz abhängig von Lust und Laune der Hausfrau, die das unwissende junge Ding unter ihre Obhut nahm. Die Not oder die Neugierde trieb die Mädchen immer wieder dazu, sich in die Dienste fremder Haushalte zu stellen. Horizonterweiternd war das Experiment auf jeden Fall und, wenn man das Glück hatte und alles gut ging, boten sich sogar Chancen und Perspektiven.
„Ich will mich als Dienstmädchen verdingen“, bringst du eines Abends beim Vesper deinen Wunsch den Eltern vor (Wie verräterisch und brutal der Ausdruck ist, fällt mir jetzt erst auf: „sich verdingen“, sich zu einem Ding machen also, mit dem nach Belieben verfahren werden kann, mir verschlägt es fast die Sprache.), „will ein bisschen Geld verdienen und euch nicht auf der Tasche liegen. Einmal Anderes sehen und dabei etwas im Haushalt lernen, das kann ja nur ein Gewinn sein.“ Deine Eltern zögern: „Bist du nicht noch zu jung, kaum achtzehn?“, und wollen deinen Wunsch überdenken, überschlafen. „Ist unsere Jüngste jetzt schon so weit?“, fragen sie sich überrascht. „Ja, aber wir brauchen dich doch hier für die Landwirtschaft“, so ihr Einwand. „Aber nach der Ernte, im Herbst könntet ihr mich doch entbehren“, erwiderst du und denkst: „Und bin ich erst einmal weg, sieht man weiter.“ „Jetzt endlich, wo wir dich soweit haben und du erwachsen bist und mit anpacken kannst“, meint die Mutter, „wer weiß, wie lang die Marie und der Otto noch im Haus sind.“ „Aber noch ist die Marie ja ganz zu Hause und der Otto kann abends, wenn er von der Lehre kommt, auch noch einspringen“, sagst du. Und die Geschwister, die mit am Tisch sitzen, unterstützen dich. „Ja, also“, wird nach einigem Bedenken der Vater weich, „wir lassen dich gehen, wenn du unbedingt willst und du meinst, dass es Gottes Wille ist.“ „Wenn wir dich brauchen, bist du zurück, man weiß ja nie“, bestimmt die Mutter. „Und auch nicht in jeden Haushalt, man hört ja so Geschichten, was da alles passieren kann“, sagt der sich um sein jüngstes Töchterlein sorgende Vater. „Es muss schon ein christlich geprägter Haushalt sein, auf geistlichem Boden!“ schiebt er nach. „Und“, mahnt die Mutter nochmal, „zum Ernteeinsatz im nächsten Jahr bist du wieder hier. Unbedingt!“
Du sehnst dich danach, den Fängen der Mutter zu entkommen. Es ist der unter den gegebenen Umständen größtmögliche Aufstand gegen sie und das Dienen, so stellst du dir vor, ein Schritt in die Freiheit. Um den Abschied vom Vater ist dir eher bang, aber du spürst die Verlockung, die bitzelnde Lust auf ein neues Erlebnis, schlägst den ‚Christenboten‘ auf und suchst nach einer passenden Stellenanzeige. Du bist jung, unerfahren, naiv. Von der Welt weißt du gar nichts und denkst an ‚die besseren Leut‘: Unternehmer, Pfarrer, Lehrer, Ärzte, Beamte und an ihr anderes Leben, das du, neugierig, offen für fremde Sitten und Ansichten, kennenlernen willst. Die Stadt, die feinen Leute: das sind neue Perspektiven auf andere Horizonte. Das alles lockt dich. Und womöglich sogar über den Stand hinaus eine gute Partie oder eine unerwartete Karriere zu machen. Nein, daran denkst du eher nicht.
Jetzt holst du das Heft mit den Musterschreiben hervor und entwirfst deine Bewerbung, nimmst Bezug auf die Anzeige im ‚Christenboten‘, schreibst, dass du zuhause entbehrlich bist. „Mit vorzüglicher Hochachtung, Martha Müller“ und hoffst auf einen guten Bescheid.
15. September 1929
Vom Bauernhaus mit Kuhstall also in das Haus des Unternehmers mit der Sägemühle. Deine Schwester Marie hat es sich nicht nehmen lassen und dich zum Zug begleitet, den Koffer schiebt sie auf dem Fahrrad nebenher. Wenn du in deinem Aufschrieb betonst, dass die Familie auf geistlichem Boden steht, ist das für dich eine erwähnenswerte, wohl zu deiner Erleichterung gewonnene Erkenntnis aus einem Vorstellungsgespräch, und dich bewegt auf dem Weg dorthin die Frage, als was sich die Leute im Lauf der Zeit entpuppen werden, und Hoffnungen und Ängste kreuzen deine Erwartungen. Du denkst noch einmal an den Abschied von der Mutter, vom Vater: „Behüt‘ dich Gott“, sagte er. Keine Umarmung, die kennst du nicht, die hat es bei euch zu Begrüßungen, zum Abschied nie gegeben. (Und bei uns später auch nicht.) Jetzt also dein Vater mit einem festen Händedruck. Ihr seht euch in die Augen, die freie Hand legt er auf deine Schulter. In der Morgenandacht hat er dich ins Gebet eingeschlossen: „Und sei mit unserer Martha, lieber Heiland, wenn sie jetzt in die Fremde zieht. Behüte du sie. Und dass sie die ihr gestellten Aufgaben und Prüfungen erfüllt. Amen.“ Und im Segen, den er jeden Morgen spricht, setzt er dieses Mal deinen Namen ein: „Martha, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, der Herr behüte deinen Eingang und Ausgang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.“ Dein Vater weiß, wie dir zumute sein muss. Er hat ja auch sein Elternhaus verlassen. „Das kleine Mädchen“, denkt er, „noch nicht einmal achtzehn, jetzt noch formbar und biegbar und anfällig für wer weiß nicht was.“
Das liegt jetzt alles hinter dir. Vor dem Zugfenster verwischt die Geschwindigkeit die Landschaft und eine Frische breitet sich in dir aus, den Zug vernimmst du in einem grundlos weiten Rauschen, seine Bewegung fast wie in Trance, offen liegt alles vor dir. So muss es gewesen sein, das kurz herangeflogene Gefühl.
Sofort beim Betreten des Sägewerkgeländes fällt dir der Geruch des frisch gesägten Holzes auf, statt Stall und Dung. Dass Holz so duften kann, Holz, das hier überall in mächtigen Stämmen herumliegt, und dazu die anderen Geräusche: Sägegetöse statt Kuh-Muhen und Kettengeklirr, die anderen Stimmen, die Frau, der Herr, die Herrschaft, fein schreibst du, feiner in der Kleidung, der Herr, ein feines Gesicht, fein und freundlich, mit Jackett, die Frau mit ihrem dunkleren Teint, den schwarzen, kräftigen, im Scheitel gebändigten Haaren, den schmalen, schräg stehenden Augen. Beinahe fremdartig, indianisch, denke ich, als ich sie auf dem Foto wiedersehe, aber das sagt dir wohl nichts. Und so ein sauberes Gewand ohne Schürze, feiner im Gehabe, im Ton. Ein Geschäftshaus, die Frau anders als die Mutter, korrekter im Umgang, feiner eben, ein Begriff, der sich dir über alles hier legt, eine freundlich-offene Begrüßung, das lachende Gesicht im Widerspruch zu ihrer brüchig-herben Stimme, ein paar nette Worte, ein Handschlag, alles nicht so spröde, so derb wie die Mutter, und eine nicht von harter Arbeit aufgeraute Hand. Die Frau zeigt dir im ersten Überblick Küche, Waschküche, Wohnzimmer. „Hier kommt die Maria, so nennen wir dich jetzt, damit es keine Verwechslung gibt, denn das da ist die Martha, meine Tochter. Sag‘ Grüß Gott, Martha!“ Die steht gerade etwas unbeholfen, pubertär und eigentlich gar nicht viel jünger als du, neugierig schauend dabei, mit großen Zopfmaschen im dick geflochtenen, dunklen Haar, das sie von der Mutter geerbt hat. Der andere Name - du schlüpfst ab jetzt ein bisschen auch in die Rolle deiner Schwester, die, das ist dir dann doch komisch, auch fast so heißt. Jetzt bist du also die Maria, wie die Mutter Gottes, nein, nicht die katholisch thronende, sondern die aus der Weihnachtsgeschichte, die dienende Magd des Herrn. - „Und dort ist der Daniel, mein Ältester, und da als Jüngster der Traugott“, stellt die Frau die andere Nachkommenschaft noch vor. Die Kinder sind schon recht groß, konstatierst du, die älteste, der du deinen Namen überlassen musstest, Martha, gerade fünf Jahre jünger als du, Daniel vielleicht noch zwei weitere Jahre und Traugott, ein Nesthäkchen, jetzt auch schon fast im schulpflichtigen Alter. Sie sind wohlerzogen, schauen dich etwas unsicher und befremdet an, denn sie wissen nicht, welchem deiner schielenden Augen ihr Blick gelten soll, geben dir, artig sind sie zur Begrüßung aufgereiht, die Hand, führen dich auf Geheiß ihrer Mutter in ihr eigenes Zimmer und zeigen dir: „Da ist dein Zimmer.“ Das ist ein anderer Blick aus dem Fenster, auf den Mühlbach, auf das gefällte Holz, den Himmel. Im Zimmer ein Tisch, ein Bett, ein Schrank und ein Ständer mit Waschgeschirr. Das ist also Fremde.
Und schon bist du gefangen in deinem Dienstverhältnis und der unerbittlich festgelegten Rangordnung. Die Frau nennst du sie, ohne Namen, eine Herrschaftsbezeichnung, und folglich der Herr und die Herrschaft und du die Untergebene, Dienerin, Magd.





























