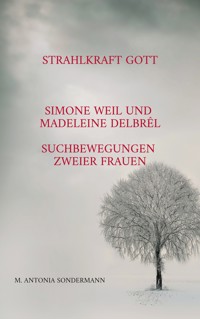
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Simone Weil und Madeleine Delbrêl haben sich in ihrem Leben leidenschaftlich und existenziell der Frage nach der Wirklichkeit Gottes gestellt. Ihr beider Denken, ihre ganze Person, wurden von der Strahlkraft Gottes berührt und angezogen und spiegeln auf vielfältige, sprachlich brillante Weise die innere Suchbewegung dieser beiden großen Frauengestalten des 20. Jahrhunderts, die in ihrer Biografie und in ihrem Werk aufscheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Simon Weil, Der Schlüssel zu den geistigen Dingen – Gedanken zur dunklen Nacht
1. Biografische Verortung des Themas
1.1 Auseinandersetzung mit dem Christentum
1.2 Literarische Zeugnisse der Hinwendung Simone Weils zur Mystik
2. Der Schlüssel zu den geistigen Dingen – Sanjuanistischer Denkhorizont
3. Simone Weils Verständnis der dunklen Nacht
3.1 Biblische Vorbilder
3.2 Simone Weils Interpretation der Dunklen Nacht bei Juan de la Cruz
3.3 Erscheinungsformen der Nacht
4. Dunkle Nacht als Prozess
4.1 „Dunkle Nacht – Anwendung in allen Bereichen.“
4.2 Der Weg der Entleerung und das Nicht-Lesen
4.3 Läuterung der geistigen Vermögen im Prozess der Entleerung
4.4 Die Dunkle Nacht des Glaubens und ihre Entsprechung im Atheismus
4.5 Simone Weils Verständnis des Glaubens
4.6 Gottesverständnis und das rechte Verhältnis des Menschen zu Gott
5. Das Ziel der Dunklen Nacht und die Bestimmung des Menschen
6. Literaturverzeichnis
6.1 Quellen
6.2 Sekundärliteratur
Glaube in Begegnung mit dem Unglauben nach Madeleine Delbrêl
A Biographische Notizen
1. Atheistisch-nihilistische Grundeinstellung
2. Perspektivwechsel und Entdeckung Gottes
3. Wegweisende Begebenheiten
3.1. Gespräch mit einer Kommunistin
3.2. Lektüre von Lenin
B Facetten des Unglaubens
1. Reflexionen der Grenzen ihrer Beobachtungen und Methode
2. Formen des Atheismus in Begegnung und seine Folgen
2.1 Deskriptive, phänomenologische Charakterisierung des Atheismus
2.2 Facetten des atheistischen Erscheinungsbildes
2.3 Die Wahrnehmung des Atheismus aus christlicher Perspektive
C Madeleine Delbrêls Antwort auf den Atheismus und seine Herausforderungen für den Glauben
1. Madeleine Delbrêls Leitinteresse
2. Madeleines Antwort im Umgang mit dem Atheismus
3. Die Herausforderung für das Glaubensleben
4. Anforderungen für den Glauben
5. Bilder für den Glauben
6. Das Gewand der christlichen Lebensart heute – Elemente der Glaubenspraxis für heute
7. Literaturangaben
7.1 Schriften Madeleine Delbrêls
7.2 Weiterführende Literatur über Madeleine Delbrêl
I
Vorwort
Simone Weil und Madeleine Delbrêl haben in ihrem Leben leidenschaftlich nach Gott und der Wahrheit gesucht. Ihr Denken und intellektuelles Ringen wurde von der Strahlkraft Gottes berührt und angezogen. Dies führte jedoch zu völlig verschiedenen Konsequenzen in ihren Lebensentscheidungen. Während Simone Weil sich trotz persönlicher Christuserfahrungen berufen glaubte, auf der Schwelle zum Christ-Sein und zur Taufe zu bleiben, wählte Madeleine Delbrêl nach ihrer Bekehrung den Weg persönlicher Christusnachfolge als eine Intensivierung ihrer Taufberufung. Das Ringen darum, wie man das Phänomen des Atheismus verstehen kann und wie man sich als Christ den Herausforderungen, die dieses für den eigenen Glauben und die Glaubenspraxis bedeutet, stellt, prägten ihr weiteres Leben und denken.
So ist es reizvoll, diese beiden unterschiedlichen Denkansätze in einem Buch gegenüberzustellen, obgleich die Beiträge als separate Aufsätze entstanden sind. Es wird deutlich, wie sehr das Ergri!enwerden von der Faszination Gottes die Überlegungen beider Autorinnen prägt und zu einer ganz eigenen originellen sprachlichen Ausdrucksgestalt führt., die von einer prophetischen Kraft zeugt, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat.
Antonia Sondermann
Simon Weil, Der Schlüssel zu den geistigen Dingen – Gedanken zur dunklen Nacht
1. Biografische Verortung des Themas
1.1 Auseinandersetzung mit dem Christentum
Auf einer Italienreise im Frühjahr 1937 beginn Simon Weil zum ersten Mal sich existenziellpersönlich, nicht nur intellektuell mit dem Christentum auseinanderzusetzen. Ausgelöst wird diese Beschäftigung durch geistliche Erfahrungen, die sie auf die Knie zwingen und ihr eine reine und vollkommene Freude vermitteln. Sie schildert verschiedene Transzendenzerfahrungen und mystische Phänomene, die im Erlebnis einer wirklichen Gottesberührung im Gebet von Person zu Person gipfeln. Dieses Ereignis findet in der Benediktinerabtei Solèsmes statt, in der sie auf das Gedicht Love von G. Herbert stößt und beginnt, dies trotz extremer Kopfschmerzen mit besonderer Aufmerksamkeit zu rezitieren.
„Ich glaubte nur ein schönes Gedicht zu sprechen, aber dieses Sprechen hatte, ohne dass ich es wusste, die Kraft eines Gebetes. Einmal, während ich es sprach, ist, … Christus selbst herniedergestiegen und hat mich ergriffen. In meinen Überlegungen über die Unlösbarkeit des Gottesproblems hatte ich diese Möglichkeit nicht vorausgesehen: die einer wirklichen Berührung, von Person zu Person, hienieden, zwischen dem menschlichen Wesen und Gott."1
Nach dieser éxperiences spirituelles ändert sich der Schreibstil Simone Weils. Im Juni 1941 macht sie die Bekanntschaft mit dem Dominikaner-Superior Pater Jean Marie Perrin, der ihr geistlicher Freund, Gesprächspartner und Berater wird. Er ist es auch, der Simone Weil mit den Lehren der katholischen Kirche vertraut macht und sie ersucht, sich mit der Möglichkeit einer Taufe auseinanderzusetzen.
Nach, wie man annehmen darf, gründlicher Prüfung kommt sie jedoch zu der Überzeugung, dass ein Eintritt in die Katholische Kirche nicht ihrer vocation entspricht.
„Ich habe es nicht unterlassen können, ihnen die größte Enttäuschung zu bereiten, die Ihnen zu bereiten in meiner Macht stand. Aber bis zu diesem Augenblick, obwohl ich mir die Frage oftmals während des Gebetes, während der Messe vorgelegt habe, oder im Lichte jenes inneren Glanzes, der nach der Messe in der Seele zurückbleibt, so habe ich doch niemals auch nur ein einziges Mal, … das Gefühl gehabt, dass Gott mich in der Kirche will. Ich habe nie auch nur ein einziges Mal ein Gefühl der Ungewissheit gehabt. Ich glaube, dass man nun daraus schließen darf, dass Gott mich nicht in der Kirche will.“2
1.2 Literarische Zeugnisse der Hinwendung Simone Weils zur Mystik
Erst in dieser Zeit, also relativ spät - 1941/42 beginnt sie mit der Niederschrift der Cahiers, ihrer Tagebuchnotizen, die sie zwischen November 1941 und Januar 1942 schriftlich fixiert. Diese stellen einen Spiegel ihres Geistes und ihrer intellektuellen Beschäftigung dar, sind sie doch eine unsystematische Darlegung ihrer Gedanken, die aus der konkreten geistig - geistlichen Auseinandersetzung und ihrer aktuellen Lektüre erwachsen und gleichsam synkretistisch, aphoristisch, in brillanter sprachlicher Dichte, zum Teil ausdrucksscharfer Härte und logischer Präzision sprachlicher Gestalt verleihen, was Ausdruck einer geradezu verbissenen Suche nach der Wahrheit ist. Um diese Suche nicht zu gefährden, hatte sich Simone Weil ausdrücklich gegen jede Form der Suggestion gewehrt und übernatürlichen Erfahrungen zunächst mit kritisch-skeptischer Distanz gegenüber gestanden. Aus diesem Grunde hatte sie zunächst sowohl das Gebet als auch die Lektüre der Mystiker vermieden. Simone Weils Verhältnis zum Gebet änderte sich erst während ihres Aufenthaltes bei Thibon. Dort lernte sie das Vater-unser auf Griechisch und wiederholte es tagelang bei der Weinlese.
„Die Kraft dieser Übung ist außerordentlich und überrascht mich jedes Mal, denn, obgleich ich sie jeden Tag erfahre, übertrifft sie jedes Mal meine Erwartung. Mitunter reißen schon die ersten Worte meinen Geist aus meinem Leib und versetzen ihn an einen Ort außerhalb des Raumes, wo es weder eine Perspektive noch einen Blickpunkt gibt.“3
Nach ihren eigenen mystischen Erlebnissen, von denen sie in ihrer "geistlichen Autobiographie" und im Prolog mit großer Zurückhaltung spricht, änderte sich ihre diesbezügliche Einstellung.4
„Im Übrigen waren an dieser meiner plötzlichen Übermächtigung durch Christus weder Sinne noch Einbildungskraft im Geringsten beteiligt; ich empfand nur durch das Leiden hindurch die Gegenwart einer Liebe gleich jener, die man in dem Lächeln eines geliebten Antlitzes liest. Ich hatte nie irgendwelche Mystiker gelesen, weil ich niemals etwas gespürt hatte, das mir sie zu lesen befahl. Auch bei meiner Lektüre habe ich mich stets bemüht, den Gehorsam zu üben. Nichts ist dem geistlichen Fortschritt förderlicher; denn ich lese so weit wie möglich nur das, wonach mich hungert, und dann lese ich nicht, ich esse. Gott in seiner Barmherzigkeit hatte mich gehindert, die Mystiker zu lesen, damit mir unwiderleglich klar würde, dass ich diese völlig unerwartete Berührung nicht aus eigenem erdichtet hatte.“5
Ihre Lektüre und Beschäftigung mit dem heiligen Johannes vom Kreuz entspringt zum einen dem Bedürfnis nach einem geistigen Korrektiv ihrer geistlichen Erfahrungen, über die sie mit keinem Vertrauten direkt zu sprechen wagte, zum anderen aber den Affinitäten, die in seiner Biografie und forme de pensee





























