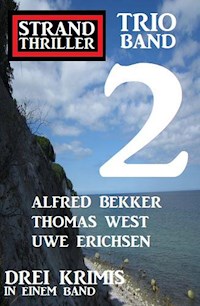
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Strand Thriller Trio Band 2 – Drei Krimis in einem Band von Uwe Erichsen & Alfred Bekker & Thomas West Der Umfang dieses Buchs entspricht 500 Taschenbuchseiten. Dieses Buch enthält folgende Krimis: Thomas West: Jesse Trevellian und der rote Diamant Uwe Erichsen: Travers und das Dynamit-Komplott Alfred Bekker (Henry Rohmer): East Harlem Killer Kriminalromane der Sonderklasse: hart, überraschend und actionreich. Henry Rohmer ist das Pseudonym des bekannten Fantasy- und Jugendbuchautors Alfred Bekker, der darüber hinaus an zahlreichen Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton Reloaded, John Sinclair und Kommissar X mitschrieb.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Strand Thriller Trio Band 2 – Drei Krimis in einem Band
Alfred Bekker et al.
Published by Alfred Bekker präsentiert, 2021.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Strand Thriller Trio Band 2 – Drei Krimis in einem Band
Copyright
Jesse Trevellian und der rote Diamant
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Travers und das Dynamit-Komplott
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
East Harlem Killer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Further Reading: 10 ausgewählte Thriller - Ein 1204 Seiten Krimi Koffer
Also By Alfred Bekker
Also By Thomas West
Also By Uwe Erichsen
About the Author
About the Publisher
Strand Thriller Trio Band 2 – Drei Krimis in einem Band
von Uwe Erichsen & Alfred Bekker & Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 500 Taschenbuchseiten.
Dieses Buch enthält folgende Krimis:
Thomas West: Jesse Trevellian und der rote Diamant
Uwe Erichsen: Travers und das Dynamit-Komplott
Alfred Bekker (Henry Rohmer): East Harlem Killer
Kriminalromane der Sonderklasse: hart, überraschend und actionreich.
Henry Rohmer ist das Pseudonym des bekannten Fantasy- und Jugendbuchautors Alfred Bekker, der darüber hinaus an zahlreichen Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton Reloaded, John Sinclair und Kommissar X mitschrieb.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Authors
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Jesse Trevellian und der rote Diamant
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 118 Taschenbuchseiten.
Die britische Königin wird in New York erwartet, und für ihre Sicherheit sind die FBI-Agenten Trevellian und Tucker zuständig. Ihre Kollegen bearbeiten derweil die Ermordung des Diamantenschleifers Amoz Koslowski in SoHo, die wahrscheinlich von einer Jugendgang verübt wurde. Währenddessen plant Leonard Wilberforce, der als „Mann für alle Fälle“ von der Unterwelt gern beauftragt wird, den größten Deal seines Lebens. Für den Diamantenhändler Henry Sharington soll er den „Williamson“ – den weltweit größten roten Diamanten – stehlen und dafür einhunderttausend Dollar erhalten. Doch der Scheich, der den einzigartigen Stein besitzen will, zahlt fünfzehn Millionen Dollar dafür – da kommt es auf ein paar Leichen mehr oder weniger nicht an ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker.
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Der fette Kater schnurrte wollüstig und rieb seine haarige Kehle an Koslowskis ausgewaschener Cordhose. "Du bist ein gieriges Miststück, Emma", bellte der knochige, weit über siebzigjährige Mann in die Sprechmuschel seines altmodischen Telefons. "Wenn du Geld brauchst, fällt dir ein, dass du in SoHo noch einen alten Vater sitzen hast!"
Seine lang gliedrigen, kräftigen Hände vergruben sich im gelb schmutzigen Fell des Katers. "Ansonsten bin ich Luft für dich!" Das Tier räkelte sich unter seinen Liebkosungen.
"Du bist ungerecht, Dad!" Die Frauenstimme am anderen Ende der Leitung klang beleidigt. "Wer putzt dir denn jeden Monat deine Dreckbude?! Außerdem studier' ich noch - du musst mich unterstützen ...!"
"Ich hör' wohl nicht recht!" Wie von der Tarantel gestochen, schoss der Mann aus seinem Ohrensessel. Der Kater rettete sich mit einem Satz auf das Sofa. "Gar nichts muss ich! Sterben muss ich ...!"
Irgendwo im Haus klirrte eine Scheibe. Koslowski riss den Hörer vom Ohr und lauschte. "Dad?", quäkte die Frauenstimme aus dem Telefon. "Bist du noch dran, Dad?"
Der Kater belauerte die Tür, sein Rückenfell sträubte sich. Koslowski ließ den klobigen Hörer auf die Gabel fallen. "Hast du auch was gehört, Rudi?" Der Alte näherte sich langsam der Tür. Die Stehlampe neben dem Sofa erlosch.
"Verflucht!", zischte Koslowski. "Spinn' ich oder hat da jemand die Sicherungen ausgeschaltet?" Durch die Dunkelheit tastete er sich zu einem schmalen Eichenschrank neben dem Fenster. Dort hatte er eine der zahllosen Taschenlampen deponiert, die überall im Haus verteilt auf einen Stromausfall warteten.
Knarrend öffnete sich die Schranktür. Koslowski griff nach der Lampe und knipste sie an. Ihr Lichtstrahl fiel auf den Kater. Mit seinen senkrecht abstehenden Fellhaaren sah er aus wie ein riesiger Igel. Zur Tür hin fauchend stand er auf steifen Beinen vor der Couch.
Unten, im ersten Geschoss der Maisonette-Wohnung, knirschte das ungeölte Schloss einer Tür. Jemand schien eine Klinke herunterzudrücken. Ein kalter Schauer rieselte Koslowski über die Rückenhaut.
Er richtete den Strahl der Lampe in den Schrank. Im mittleren Fach zwischen Fotokartons und einem Stapel Briefmarkenalben schimmerte das schwarze Metall eines Armeerevolvers auf. Koslowski holte den .45er heraus und ließ die Trommel herauskippen. Hastig wühlte er im Schrank herum, fand endlich die Munition, steckte mit zitternden Fingern sechs Patronen in die Trommel und spannte den Hahn.
"Verkriech dich lieber, Rudi", flüsterte er, "ein Einbrecher scheint es auf meine Werkstatt abgesehen zu haben."
Er glaubte selbst nicht, was er seinem Kater erzählte. Ein Einbrecher würde abends um zehn kaum in eine Wohnung einsteigen, in der Licht brannte. Jedenfalls nicht hier in der Dominick Street. Und wenn doch - aus welchem Grund schaltete er dann die Sicherung aus?
Koslowski schob die beunruhigende Frage so weit weg von sich wie möglich. Auf Zehenspitzen schlich er zum Telefon, die Waffe auf die Tür seines Wohnzimmers gerichtet. Er nahm den Hörer ab - die Leitung war tot. Hinter seinem Brustbein schien innerhalb von Sekunden eine Eisschicht zu wachsen.
Fester umklammerte er die Waffe und schluckte. "Okay, Rudi", flüsterte er. "Wir sind uns einig - da ist jemand. Und ich sage dir: Dieser Jemand führt nichts Gutes im Schilde." Waffe und Lichtstrahl auf die Klinke gerichtet näherte er sich der Tür. "Scheißegal, Rudi - schauen wir uns den Typen an ..."
Er legte das Ohr ans Schlüsselloch und lauschte. Nichts zu hören. Vorsichtig drückte er die Klinke herunter und leuchtete durch den Türspalt in seinen mit schweren Möbeln überladenen Flur. Niemand zu sehen.
Zwischen seinen Beinen huschte der Kater aus dem Zimmer. Koslowski wagte sich hinaus auf den Flur und leuchtete nach beiden Seiten. Nichts. Die Tür seiner Werkstatt war geschlossen.
Der Kater stand am Treppenabsatz und lauschte mit steil aufgerichteten Ohren hinab. Sein schräg nach unten gerichteter Schwanz erschien buschiger als sonst.
Leise schlich Koslowski zu dem Tier. Der Lichtkegel seiner Lampe durchdrang den unteren Flur. Die Tür zu seinem Schlafzimmer stand offen. Er hätte schwören können, dass er sie geschlossen hatte, bevor er hoch ins Wohnzimmer gegangen war. Von seinem Schlafzimmer aus ging ein Fenster in den Hinterhof. Ein Fenster, von dem aus man die Feuerleiter erreichen konnte ...
"Ist da jemand?" Seine heisere Stimme kam ihm fremd vor. Er betrat die oberste Treppenstufe. Das alte Holz knarrte unter seinen Schuhsohlen. "Wer zum Teufel ist da unten?!"
Rechts hinter ihm wurde die Toilettentür aufgerissen. Koslowski fuhr herum - ein dunkler Schatten, ein erhobener Arm, eine Faust, die einen länglichen Gegenstand umklammerte. Etwas prallte auf seinem Schädel auf. Eine Welle von Übelkeit schoss aus seinem Magen in seine Kehle - Koslowski konnte nicht einmal mehr schreien.
Ein zweiter Schlag traf ihn, jemand hielt seine Rechte umklammert und entwand ihm den Revolver. Seine Knie gaben nach, kopfüber stürzte er auf die Treppe, schlidderte die siebzehn Stufen hinunter und kniff geblendet die Augen zusammen, als ein Lichtstrahl sein Gesicht traf.
Wie durch einen Nebel hörte er Rudi fauchen. Für Sekundenbruchteile spürte er sein Fell auf seinem Gesicht. Jemand schrie: "Autsch! Verdammtes Mistvieh!"
"Stech' ihn ab!", eine zweite Stimme.
"Es ist zum Schlafzimmerfenster hinaus ..."
Es waren mindestens drei oder vier Männer die ihn festhielten. Junge Männer - das hörte er an ihren Stimmen. Er konnte ihre Gesichter nicht sehen, sie leuchteten ihm direkt in die Augen.
"Den Code von deiner Werkstattür, Opa!", zischte einer von ihnen. Koslowski reagierte nicht. Ein Handrücken klatschte in sein Gesicht. "Schwerhörig, oder was?! Den Code! Den Code!" Sie schüttelten ihn durch.
Er spürte warmen Atem nah an seinem Gesicht. Atem, der nach Zigarettenrauch stank. "Den Code, verdammt noch mal!" Koslowski saugte den Schleim aus seinem Rachen nach oben und spuckte aus.
Der Lichtkegel wich von seinem Gesicht. "Scheißkerl!", fauchte jemand. Für einen Moment sah Koslowski ein dunkles, jugendliches Gesicht. Etwas krachte hart auf seinen Schädel. Sein Bewusstsein schnurrte zusammen, wie ein angestochener Luftballon und taumelte in eine Tiefe, aus der es kein Zurück mehr gab ...
2
Milo legte drei Streichhölzer vor sich auf die Theke. "Okay, losen wir." Mit einer einladenden Geste wies er auf Jay Kronburg. "Brich einem den Kopf ab, Jay."
Jay stellte sein Bierglas auf die Theke. Mit spitzen Fingern nahm er das mittlere der drei Hölzer und zwickte ihm den Zündkopf ab. Das um seinen Schwefelkopf gekürzte Holz schob er zwischen die anderen beiden.
Es war spät am Abend. Ein Montagabend, wenn ich mich recht erinnere. Wir hockten im >North Star Pub<, einer munteren irischen Kneipe in Seaport an der South Street.
Zu sechst: Jay und Leslie, Clive und Medina, Milo und ich. Unser Chef hatte uns einen Auftrag serviert, der keinem von uns schmecken wollte. Personenschutz für einen Staatsbesuch - die englische Königin wollte New York City besuchen. Zwei Wochen lang. Eigentlich nur um eines ihrer Rennpferde auf dem Aqueduct Race Track zu bewundern. Und nicht zu vergessen die mildtätige Stiftung für Aidskranke, die sie ins Leben rufen wollte.
Doch irgendeinem ihrer Protokollheinis hatte das nicht gereicht. Eine Rede vor der UNO war aufs Programm gesetzt worden und ein Plausch mit unserem fotogenen Bürgermeister. Und schon hatten wir einen Staatsbesuch. Und für dessen Schutz war nun mal das FBI zuständig. Wir.
Der Zufall wollte es, dass jedes unserer drei Teams in den letzten Tagen einen Fall abgeschlossen hatte und jeder von uns theoretisch für den atemberaubenden Einsatz infrage gekommen wäre. Unser Chef war ein menschenfreundlicher Mann und wollte niemanden zu dem Einsatz verdonnern. "Einigen Sie sich, Gentlemen", hatte er gesagt.
Und das taten wir jetzt. Mit einer bewährten Methode - mit Streichhölzern. Auf lange Diskussionen hatten wir uns gar nicht erst eingelassen.
"Hast du mal'n Augenblick Zeit, Woody?!" Milo nahm die drei Streichhölzer und streckte sie dem Barkeeper entgegen.
"Was gibt's denn?" Woody war ein kahlköpfiger Kleiderschrank mit schwarzen Bartstoppeln und einem ansehnlichen Bauch. Angeblich studierte er Philosophie an der Columbia University. Seit ungefähr zwanzig Jahren. Niemand von uns war taktlos genug sich ihm gegenüber darüber zu wundern. Er war ein guter Barkeeper, und fertig.
"Eine Entscheidung steht an." Milo legte ihm die Streichhölzer in die ausgestreckte Hand.
"Ihr wollt losen?" Woody - eigentlich hieß er Andrew Blackwood aber alle Gäste im >North Star Pub< nannten ihn Woody - nahm sie meinem Partner ab und wandte uns den Rücken zu, um die Hölzer zwischen seinen Fingern zu ordnen. "Geht's um eine Frau?"
"Kann man so sagen", brummte Jay.
"Wie heißt sie?"
"Elizabeth", sagte ich, "mach schon."
Er drehte sich um und streckte uns seine rechte Faust entgegen. Drei Hölzer ragten zwischen Daumen und Zeigefinger hervor. "Wer das kürzere zieht, scheidet aus und die anderen beiden teilen sich Betty, oder wie?", grinste er.
"Umgekehrt", knurrte Jay, "außerdem geht's hier um drei Zweier-Teams."
"Also vier Leute teilen sich Betty", staunte Woody.
"Umgekehrt hab' ich gesagt." Jay fixierte die Hölzer in der Faust des Barkeepers. "Zwei teilen sich Betty. Das Team, das den Kürzeren zieht." Woody machte ein grüblerisches Gesicht, was ziemlich albern aussah. Irgendwas schien er falsch zu verstehen.
"Wer greift zu?", fragte Milo.
"Ich", sagte ich, "bevor wir hier noch hundert Jahre sitzen." Risikofreudig, wie ich nun mal bin, griff ich zu - und zog das Zündholz mit dem abgebrochenen Kopf.
Jay und Leslie atmeten auf, Orry und Clive bestellten erleichtert eine Runde Bier, und Milo vergrub sein bekümmertes Gesicht seufzend in beiden Händen.
"Scheint ja nicht gerade der Hit zu sein, eure Betty." Woody blinzelte irritiert von einem zu anderen. "Hat sie die Krätze? Ist sie fett? Oder bist du mit ihr verheiratet?" Er meinte Milo.
"Sie ist eine Königin", erklärte Orry.
Woodys Gesicht wurde um keine Spur intelligenter. "Hä?"
"Vergiss es", Milo winkte ab und schaute mich schicksalsergeben an. "Also gut, Partner - du hast ausnahmsweise mal das große Los gezogen. Und was willst du in den nächsten zwei Wochen zu meiner Unterhaltung beitragen?"
Betreten betrachtete ich den Bierschaum am Grund meines Glases. "Sieh's doch mal positiv, Milo - Pferderennen, kalte Büfetts auf Wohltätigkeitsveranstaltungen, Konzerte in der Avery Fisher Hall, Theaterbesuche, müßige Stunden im Guggenheim Museum, Stadtrundfahrten: Kann ein Urlaub schöner sein?"
"Ja", knurrte Milo. Ich sprach es nicht aus, aber ich gab ihm recht.
3
Der silbergraue Lincoln rollte den Broadway hinunter. In nördliche Richtung. Noch etwa eine halbe Meile bis zur Kreuzung Fifth Avenue. Und zum Madison Square Garden.
Henry Sharington klappte den Aktenkoffer noch einmal auf. Er entnahm das schwarze Lederetui und öffnete es. Der rosafarbene Stein lag auf dem schwarzen Samt, wie ein überdimensionaler, von der Sonne ausgebleichter Blutstropfen. Pflaumengroß, oval, und unglaublich schön. Und eingefasst in den Weißgoldrahmen einer Brosche.
Sharington nahm den Stein aus dem Etui und hielt ihn in Augenhöhe gegen das Seitenfenster. Die nächtlichen Lichter Manhattans brachen sich in den hundertfältigen Schliffflächen des Diamanten.
"Wo soll ich Sie absetzten, Sir?" Der Chauffeur hielt vor der Ampel und setzte den Blinker nach rechts.
"Am Haupteingang, Jefferson." Sharington steckte den Stein zurück in das schwarze Samtkissen des Etuis. Mit klopfendem Herzen betrachtete er das Kunstwerk. Der >Williamson< - der größte Diamant dieser Farbe. Dreiundzwanzig Komma sechs Karat. Lupenrein, von Briefel & Lemer in London geschliffen. Mindestens anderthalb Millionen Dollar wert. Ein Scheich aus Saudi-Arabien hatte ihm das Zehnfache geboten.
Der einzige Makel des Steines: Er war ein Duplikat. Sharington klappte das Etui zu und verstaute es in seinem Aktenkoffer.
"Der Madison Square Garden, Sir", sagte Jefferson, "wir sind da."
"Gut." Sharington hob den Boden seines Koffers an. Zeichen und Farben wurden sichtbar, die er im Schlaf erkennen würde: Hundertdollarnoten. In zwanzig Bündeln mit je fünfundzwanzig Scheinen. Fünfzigtausend Dollar. Er ließ die Schlösser seines Aktenkoffers einrasten.
"Ich brauche nicht länger als eine halbe Stunde, höchstens eine. Gehen Sie was trinken, Jefferson. Ich ruf Sie an, wenn ich so weit bin."
Der Chauffeur bog in den Madison Square Park ein und hielt vor dem Haupteingang der Halle. Sharington stieg aus und mischte sich unter die vielen Menschen.
Er drängte sich durch die Massen und legte den beiden Freaks an der Kasse seine Eintrittskarte vor. Sie musterten ihn mit schrägen Blicken. Es kam wohl nicht alle Tage vor, dass silberhaarige Männer mit Aktenkoffern ein Rockkonzert besuchten. Schließlich nickten sie und winkten ihn in die Konzerthalle hinein.
Sharington hatte sich ein Hugo-Boss-Jackett angezogen und in ein paar Jeans gezwängt, die ihm Jefferson gestern besorgt und gewaschen hatte. Trotzdem sah er zwischen all den Exoten aus wie ein Beamter von der Sittenpolizei.
Unzählige Menschen drängten sich in der Halle. REM hieß die Gruppe, die vorn auf der Bühne unter einem Lichtgewitter Tasten und Saiten bearbeitete. Der Sänger bog sich über sein Mikro wie ein Verdurstender über eine Quelle. Das Lichtstakkato ließ sein kurzes blondes Haar in allen Farben des Regenbogens aufblitzen. Seine Stimme orakelte dunkel und heiser: >First we take Manhattan, then we take Berlin ...<
"Und danach den Buckingham Palace", dachte Sharington. Er schob sich durch die Menge. An der rechten Seite der Halle nahm er das Neonschild wahr, das den Notausgang beleuchtete. Daneben wies ein großes Symbol auf die Toiletten hin.
Sharington sah auf seine Armbanduhr: Viertel nach zehn. Um halb elf auf der mittleren Herrentoilette.
Leonard Wilberforce würde pünktlich sein. Der Zuhälter aus Little Italy, der ihn empfohlen hatte, war ein guter Menschenkenner - Sharington hatte Wilberforce einmal gesehen, und sofort begriffen, dass er einen Mann vor sich hatte, der seine Arbeit erledigte, als stünde sein Leben auf dem Spiel. Dabei ging es für ihn nur um hunderttausend Dollar.
Das Publikum tobte, der Bandleader moderierte mit wenigen Worten, die Musiker bewegten sich auf der Bühne, wie Leute, die wussten, dass die Champions waren.
Sharington bekam kaum etwas mit von der fiebrigen Atmosphäre. Meter um Meter bewegte er sich auf die rechte Saalseite zu. Gegen halb elf huschte er in den Gang, der zur Nottür und zu den Toiletten führte.
>Die mittlere Herrentoilette< - er presste den Koffer unter seinen Arm und schritt die Türen ab. Es war halb elf.
Drei blau lackierte Metalltüren - >Gentlemen<, warnten die Emailleschilder auf den Türblättern. Er drückte die mittlere Tür auf und betrat den gelblich gekachelten Raum. Ein säuerlicher Gestank schlug ihm entgegen.
Über eines der beiden Waschbecken beugte sich ein kleiner Mann - glupschäugig, blondes Kurzhaar, enge schwarze Lederhosen, graues Jackett. Unter dem Waschbecken ein Aktenkoffer. Dem, den Sharington an sich drückte, zum Verwechseln ähnlich.
Ihre Blicke begegneten sich kurz. Wilberforce' wässrig blaue Augen weiteten sich. Seine blonden Brauen zuckten fragend nach oben. Sharington nickte und stellte seinen Koffer neben der Tür ab. Ohne ein Wort zu verlieren stellte er sich an eines der Pissoirs und öffnete seinen Hosenschlitz.
Hinter sich hörte er den kleinen Blonden die Tür aufziehen und den Raum verlassen. Als er sich umdrehte und zu den Waschbecken ging, war sein Koffer verschwunden. Der von Wilberforce stand immer noch unter dem Waschbecken.
Sharington wusch sich die Hände, griff nach dem Koffer und öffnete ihn. Er enthielt weiter nichts als zwei Briefbögen. Auf dem ersten war in großen Druckbuchstaben eine Adresse notiert: Canal Street Flea Market, 335 Canal Street. Auf diesem Flohmarkt also wollte Wilberforce ihm den echten Diamanten übergeben.
Auf dem zweiten Blatt eine Handynummer und die Nummer des Kontos, auf die Sharington nach erledigtem Auftrag die zweite Hälfte des Honorars einzahlen sollte.
Er klappte den Koffer zu und verließ die Herrentoilette. In der Konzerthalle mischte er sich unter das Publikum. Aber nur um sich nach und nach in Richtung Ausgang zu bewegen.
Als er über den Hauptweg des Madison Square Parks schlenderte, zog er sein Handy aus der Tasche. Er tippte die Nummer seines Chauffeurs ein. "Ecke Fith Avenue, Madison Square Plaza, Jefferson. In fünf Minuten."
Der erste Schritt zur Rettung seiner Firma war getan.
4
Emma Koslowski hockte wie teilnahmslos auf der untersten Stufe der Treppe. Sie rauchte und starrte auf die weißen Kreidelinien vor sich auf dem Flurparkett. Sie umrissen die Konturen des Körpers, den die Bullen eben in einem Plastiksack zur Wohnungstür hinaustrugen.
Ohne Leben war dieser Körper in dem grauen Leichensack - erschlagen, tot. So tot wie ihre Beziehung zu seinem ermordeten Besitzer. Ihr Vater war ein Arschloch gewesen. Daran gab es nichts zu rütteln. Aber er war ihr Vater gewesen.
Zum Teufel - und man hatte nur einen Vater! Und selbst wenn man ihn hasste, selbst wenn man ihn für den bescheuertsten Giftzwerg im ganzen Staate New York gehalten hatte - seine Stimme, sein misstrauisches Gesicht, seine zackige Art zu gehen und sich zu bewegen: All das würde man genauso wenig aus seinem Hirn herausbekommen, wie das Bild von Neil Alden Armstrong, wie er im Juli '69 vor der Mondfähre von Apollo 11 die amerikanische Flagge gehisst hatte.
Tränen liefen über Emmas ausdrucksloses Gesicht. Sie wischte sie weg und drückte ihre Kippe in dem kleinen Teller aus, der neben ihr auf der Treppe stand.
Sie rieb die feuchten Hände an der schwarzen Lederhose trocken und fummelte eine zerknitterte Schachtel Camel ohne Filter aus der Brusttasche ihrer ausgebleichten Jeansjacke. Ihre Finger zitterten, als sie sich die nächste Zigarette zwischen die Lippen steckte.
Einer der Männer, die den Hausflur der Maisonette-Wohnung nach Spuren absuchten, streckte ihr ein Feuerzeug hin und schnippte die Flamme an.
"Tut mir leid, Miss Koslowski, aber glauben Sie mir - wir kriegen die Mistkerle." Der zivile Sergeant der City Police hieß Ron Landley und sprach mit gepresster Stimme.
"Klar doch." Emma Koslowski schniefte in den Ärmel ihrer Jacke. "Klar ..." Schwarze Haarsträhnen hatten sich aus dem Knoten auf ihrem Hinterkopf gelöst und hingen ihr wirr ins schmale, sommersprossige Gesicht. Sie mochte Ende zwanzig bis Anfang dreißig sein.
Ein Mann in weißem, kurzärmeligem Hemd und mit gelöstem Krawattenknoten trat zu ihnen. "Er ist mit einem harten Gegenstand erschlagen worden, vermutlich mit einem Totschläger."
Der Sergeant nickte grimmig. "Wann ungefähr?"
Der Polizeiarzt zuckte mit den Schultern. "Höchstens eine Stunde her."
"Danke, Doc." Der Arzt bedachte Emma mit einem routinierten Nicken und verließ die Wohnung.
"Ich sag' Ihnen doch, ich hab sie noch gehört", schluchzte die Frau.
"Und Sie sind sicher, dass es mehrere waren, die Sie da gehört haben?" Landley ließ sich neben ihr auf der Treppe nieder.
"Ganz sicher." Emma sprach mit einer rauen, monotonen Stimme. Der Sergeant hatte sie längst als Kettenraucherin eingestuft, vermutlich nahm sie auch noch Drogen. "Ich habe Stimmen gehört. Und vom Schlafzimmerfenster aus hab' ich sie über den Hof rennen sehen. Mindestens drei."
"Klingt ganz nach einer dieser verdammten Jugendgangs", mischte Landleys Assistent sich ein. Hinter Emma stieg Bill Cranfield die Treppe herunter. Kaugummi kauend und beide Hände unter seinem Sakko in den Hosentaschen vergraben. Er war ungefähr in Emmas Alter. "Dort oben haben die Jungs Fingerabdrücke und Blutspuren gefunden."
"Eine richtige Seuche mit diesen Gangs", murmelte der Sergeant. "Wir werden Sie bitten müssen, sich genau in der Wohnung Ihres Vaters umzusehen. Wir wollen wissen, was diese Kerle geraubt haben."
Emma winkte müde ab. "Ich hab' doch keine Ahnung, was für Wertsachen mein Vater wo versteckt hat. Ich weiß ja nicht mal, auf welcher Bank er seine Kohle deponiert."
"Es müssen keine Wertsachen sein, die fehlen, Miss Koslowski", sagte der Polizist hinter ihr auf der Treppe. "Diese Burschen klauen alles, was sich irgendwie zu Geld machen lässt."
"Sie werden doch über den Besitz ihres Vaters im Bilde sein?", wunderte sich der Sergeant.
Sie schüttelte müde den Kopf. "Ich hab' nur ein-, zweimal im Monat vorbeigeschaut. Um ein bisschen sauber zu machen. Ich hätt's mir auch sparen können. Ins Schlafzimmer und in seine Werkstatt ließ er mich erst gar nicht rein. Aber ich brauchte Geld."
"Hey, Miss Koslowski." Cranfield hinter ihr lehnte sich ans Treppengeländer. "Das klingt nicht nach Harmonie und Freude."
Emma zog den linken Mundwinkel hoch. Ein bitterer Zug trat in ihr Gesicht. "Wir hatten eine Scheißbeziehung. Ich war froh, wenn ich seine Tür wieder hinter mir zu machen konnte."
"Werkstatt?" Der Sergeant hob fragend die Brauen. "Haben Sie eben was von Werkstatt gesagt? Was für'ne Werkstatt?"
Aus der offenen Schlafzimmertür huschte der Kater. Sein schmutzig rotes Fell wirkte zerzaust und matt. Mauzend strich er um die Kreideskizze auf dem Parkett.
"Hey, Miss!" Landley beugte sich zu Emma hinüber. Sie schien ganz in den Anblick des Katers versunken zu sein. "Ich hab' sie was gefragt. Was für eine Werkstatt?"
Emma deutete mit Daumen über die Schulter nach hinten. "Oben. Letzte Tür links. Eine Diamantenschleiferei." Cranfield hinter ihr stieß sich vom Geländer ab, nahm die Hände aus den Taschen und lief wieder die Treppe hinauf.
"Diamantenschleiferei? Er ist doch ... Moment", Landley zückte seinen Notizblock und ging seine Aufzeichnungen durch. "Er ist doch schon sechsundsiebzig. War er in seinem Alter denn noch berufstätig?"
Emma nickte. "Dad ist ..." Sie unterbrach sich. "Dad war ein ziemlich guter Diamantenschleifer. Weit über die Staaten hinaus bekannt. Hat bis vor Kurzem häufig Aufträge angenommen. Auch von seinem letzten Arbeitgeber." Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. "Auf die letzte Arbeit war er so stolz gewesen, dass er sie mir sogar gezeigt hat. Ich musste eine Flasche Sekt mit ihm trinken und hinterher gab's einen Hundertdollerschein bar auf die Pfote."
"So ganz Funkstille war also doch nicht zwischen Ihnen?" Emma bemerkte nicht den skeptischen Blick des Sergeants. Sie rauchte schweigend und betrachtete Rudi.
Der Kater saß auf der Stelle, wo die Kreidezeichnung den Kopf des alten Koslowski skizzierte. Immer wieder stieß er ein jämmerliches Miauen aus.
"Gehörte sie ihrem Vater?" Zum ersten Mal hörte Emma so etwas wie Anteilnahme aus der Stimme des Sergeants heraus.
"Es ist ein Kater", sagte Emma müde. "Rudi. Er gehört niemandem, wie die meisten Katzen. Vor zwei Jahren ist er unten auf der Straße vom Müllwagen zusammengefahren worden. Dad hat ihn gesund gepflegt. Seitdem folgt ihm Rudi auf Schritt und Tritt."
"Armer Kerl." Er sprach heiser vor Rührung. Einer von den Unzähligen, die eine Leiche kalt lässt und denen der Anblick von Viehzeug das Herz schmelzen lässt, dachte Emma. "Ich habe auch Katzen zu Hause ..."
"Eine Metalltür!", kam es von oben. "Jemand hat sie mit dem Stemmeisen bearbeitet." Cranfield tauchte an der obersten Treppenstufe auf. "Sie ist durch ein elektronisches Codeschloss gesichert!"
Emmas dunkle Augen wurden schmal. "Das klingt ganz so, als hätten die Kerle gewusst, was sich hinter der Tür befindet ..." Ihre Stimme klang plötzlich lauernd und misstrauisch.
"Was denn?"
"Rohdiamanten, nehme ich an. Und vermutlich das eine oder andere Duplikat." Emma drückte die Zigarette aus. "Wie gesagt, er hat mich nicht in die Werkstatt gelassen."
"Komisch, Sarge." Der Kaugummikauer stand oben auf der Treppe. Er hatte zugehört. Emma drehte sich zu ihm um. "Die Gangs schlagen normalerweise spontan und wahllos zu", sagte er. "Die hier scheinen sich ihr Opfer sorgfältig ausgesucht zu haben."
"Ja, wirklich komisch", murmelte der Sergeant.
5
Die englische Königin hatte sich einen guten Reisetermin herausgesucht - seit zwei Tagen lag ein mildes Oktoberlicht über Manhattan, die Temperaturen erreichten Frühlingswerte und die Wetterfrösche aller Nachrichtensender waren sich einig: Das warme Herbstwetter sollte noch bis zum kommenden Wochenende anhalten.
Es war ein Mittwochvormittag, an dem Milo und ich uns ein genaues Bild vom Aqueduct Race Track in Queens machten. Und vor allem von den Sicherheitsvorkehrungen auf der Pferderennbahn. Täglich, außer dienstags, fanden hier von Oktober bis Mai Pferderennen statt. Die Sommersaison wurde dann auf Long Island ausgetragen, im Belmont Park Race Track.
"Ich denke, hier kommen wir mit vierzig Leuten aus", sagte ich nach einem Rundgang über die Tribünen zu dem uniformierten Captain zwischen Milo und mir. Richard Bluster vom NYCPD war technischer Leiter des Einsatzes, den wir zum Schutz der Queen gemeinsam organisieren mussten. Am Sonntag würde sie die Rennbahn besuchen.
"Sehe ich auch so, Trevellian." Bluster nahm die Dienstmütze von seinem kahlen Schädel und wischte sich mit dem Ärmel seines Uniformhemdes den Schweiß von der Stirn.
Bluster war ein Mann von den Körperausmaßen eines Gewichtshebers. Obwohl er ein ziemlich grobschlächtiges Gesicht hatte, war er mir auf Anhieb sympathisch.
"Ich würde fünfundzwanzig Mann in Uniform antreten lassen", sagte er. "Um Polizeipräsenz zu demonstrieren. Und den Rest postieren wir in Zivil an den neuralgischen Punkten."
"Okay - Sie sorgen für die zusätzlichen Videokameras und die mobile Einsatzstation?"
"Klar", nickte Bluster. "Unsere Techniker bringen den Van auf Vordermann. Bis Samstag ist das Fahrzeug einsatzbereit." Bluster und einer von uns beiden würde den Einsatz von einem Van aus leiten, der mit technischem Gerät vollgestopft war.
"Gut", Milo reichte dem Uniformierten die Hand. "Wir hören voneinander."
"Wird schon schiefgehen, was?" Der massige Cop grinste mich an, als er seine kraftvolle Pranke um meine Hand schloss.
"Wenn ihr wachsames Auge über dem Spektakel schwebt, kann eigentlich nichts schiefgehen", lachte ich. Er schlug mir auf die Schulter, und ich wusste, dass ich bei dem Captain einen Stein im Brett hatte.
Wir verließen das Areal der Pferderennbahn. Der Parkplatz davor war fast leer. Die Vormittagssonne spiegelte sich im grauen Lack unseres Dienstwagens - ein Mercury. "Netter Kerl, was?" Ich setzte mich hinter das Steuer.
"Ein ziemlich ungehobelter Bursche, aber nett", pflichtete Milo bei. Er ließ sich auf dem Beifahrersitz nieder und zog ein zusammengelegtes Stück Papier aus dem Jackett. "Also - gehen wir das königliche Programm noch einmal durch." Er entfaltete das Papier mit dem Besuchsprogramm. "Morgen Abend zwanzig nach sechs holen wir die blaublütige Oma vom Kennedy Airport ..."
"Etwas mehr Respekt vor der englischen Königin, Special Agent Tucker." Ich mimte den Empörten.
"... eskortieren wir Ihre Majestät, Elizabeth die Zweite, vom Flughafen zu ihrem Hotel."
"Na, also." Ich bog nach links in den Rockaway Boulevard ein. Der Aqueduct Race Track lag vor dem westlichen Zipfel des John F. Kennedy International Airports, keine Meile von dem Flughafen entfernt. Der Van Wyck Expressway war eigentlich die Hauptverbindung zur Interstate 495 und damit nach Manhattan. Doch der war um die Mittagszeit meistens verstopft. Also nahm ich den Woodhaven Boulevard.
"Übermorgen, am Freitag, Mittagessen mit unserem Bürgermeister in der City-Hall," fuhr Milo fort. "Nachmittags Besuch des Guggenheim-Museums. Am Samstagvormittag Einkaufsbummel in der Fith Avenue ..."
"Famoser Job - wir kommen sogar ein bisschen an die frische Luft ..."
"... Samstagnachmittag: Flatbush - Diana-Stiftung für ein Sterbehospiz für Aidskranke. Am Sonntag dann das Pferderennen, und am Montag bringen wir die Lady bis zum Eingangsportal der UNO. Dort übernimmt der hauseigene Sicherheitsdienst."
"Mit der City-Hall beschäftigen wir uns morgen", sagte ich. "Lass uns als nächstes das Hotel unter die Lupe nehmen."
Über die 495 und den Queens-Midtown Tunnel fuhren wir nach Manhattan hinein. Dann ging es nach rechts in die Park Avenue und hinauf in die Upper East Side. Im Carlyle Hotel hatte die Queen eine Luxussuite gebucht.
Die Rezeption war vollgestopft mit Antiquitäten. Ich kam mir vor, wie in einem englischen Barockschloss. Die Empfangsdame meldete uns bei einem der Hotelmanager - einem gewissen Randolph Hong. Wir mussten nicht einmal drei Minuten warten, bis er sich aus dem Lift stürzte und mit ausgestreckter Hand auf uns zueilte: klein, Schlitzaugen, pomadig zurückgekämmtes Haar, unablässig grinsend. Seine Vorfahren waren Chinesen oder Koreaner, tippte ich.
"Willkommen, Gentlemen - Hong ist mein Name, Randolph Hong." Wir stellten uns vor. "Bitte folgen Sie mir." Er ließ uns vor sich in den Lift steigen und drückte den Knopf für das achtzehnte Stockwerk. "Wenn die Windsors nach Manhattan kommen steigen sie immer bei uns ab", erzählte der Mann. Ich suchte sein Gesicht nach dem Schalter ab, mit dem man sein Plastikgrinsen abstellen konnte. "Und Sie wohnen immer in der Fünfzimmer-Suite im achtzehnten Stock."
Mit vor Stolz und Zufriedenheit geschwellter Brust wieselte er uns voran durch eine mit antiquarischen Möbeln ausgestattete Zimmerflucht. Ganz am Ende des Ganges blieb er vor Zimmer 1812 stehen.
Er machte ein Gesicht, als wollte er uns seine Nobelpreisurkunde präsentieren und öffnete die gepolsterte Doppeltür der Suite. Durch einen kleinen Flur gelangten wir in einen riesigen, pompös ausgestatteten Salon.
Milo pfiff anerkennend durch die Zähne: Brokatbezogene Sessel, eine mächtige Couch mit grünem, goldbesticktem Polster, ein ovaler Tisch mit kunstvoll gedrechselten Beinen und einer schimmernden Platte aus rotem Marmor, und in der Mitte des Raumes ein wuchtiger schwarzer Flügel.
Die offenen Lederportale gaben den Blick in die anderen Zimmer frei, die mit ähnlichem Schnickschnack ausgestattet waren. Hong rieb sich die Hände, lächelte und schien darauf zu warten, dass wir ein Loblied anstimmten.
Ich konnte mich nicht beherrschen - ich ging zur großen Fensterfront und blickte über den Central Park, und die dahinter angrenzenden Apartmenthäuser der West Side. "Wissen Sie, was ich am schönsten finde an diesem Raum?" Er neigte andächtig lauschend den Kopf. "Den Anblick unserer einzigartigen Stadt."
Hong deutete eine holzig wirkende Verbeugung an und eilte uns voraus in die nächsten Zimmer. Milo grinste mich an. Wir folgten ihm.
"Vielen Dank, Mr. Hong", sagte Milo nach der Besichtigung. "Unser Team wird morgen Vormittag die Suite nach Wanzen und ähnlichem untersuchen."
Hong wollte etwas entgegnen, wurde aber abgelenkt, weil die Eingangstür sich öffnete. Eine Frau betrat die Suite. Sie trug einen Rosenstrauß aus mindestens fünfzig Rosen vor sich her. Hongs Gesicht hellte sich auf. Deutlich sah ich das gierige Funkeln in seinen Schlitzaugen. "Ah, Miss Browling!" Er wies auf uns. "Mr. Trevellian und Mr. Tucker sind vom FBI. Sie organisieren den Personenschutz für Ihre Majestät."
Die Frau stellte den Strauß auf dem Flügel ab und lächelte uns zu. Sie war von ähnlich eleganter Schönheit wie die Rosen: blondes, streng zurückgekämmtes Haar, schmales Gesicht mit ausgeprägter Augen- und Stirnpartie, lange Beine und schlanke Gestalt, die in einem blauen Hosenanzug aus Seide steckten. Ihr Mienenspiel hatte etwas Katzenhaftes, Hellwaches. Ich sah sofort, dass sie eine kluge Frau war.
"Miss Browling ist die Chefin des Zimmerservices. Die Betreuung der Windsors liegt in ihrer persönlichen Verantwortung." Der Kerl konnte kaum seine Augen in Zaum halten. Unruhig wanderten sie über ihren Körper. An dem mäßig gewagten Dekolleté ihrer weißen Bluse kamen sie ins Stolpern.
Ich war sicher, dass sie es merkte - sie ließ sich aber nichts anmerken. "Freut mich, Gentlemen." Sie reichte uns die Hand. "Wenn ich Sie irgendwie unterstützen kann, lassen sie es mich wissen. Aber ehrlich gesagt: Ich wüsste gar nicht, wer einer alten Ikone, wie der englischen Queen etwas antun sollte."
"Ihr Wort in Gottes Ohren, Ma'am", sagte Milo, "aber in unserer Branche sieht man so manches Pferd kotzen."
Sie lächelte süffisant. "Vermutlich wollen Sie damit sagen, dass Ihre Berufserfahrung Sie gelehrt hat auf jede Überraschung gefasst zu sein." Sie nickte grüßend und schwebte aus der Suite.
"Genau das wollte ich sagen", brummte Milo. Verblüfft sah er mich an. "Wollt' ich doch, oder?"
"Sie müssen wissen, dass Miss Browling nur in den sogenannten besseren Kreisen arbeitet. Ein paar Jahre lang hat sie sogar das Schloss und das zwanzigköpfige Personal eines französischen Edelmanns gemanagt." Wieder dieses antrainierte Lächeln. "Der gute Ton ist ihr sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen."
"Ich nehm ihr nichts übel." Milo machte ein unschuldiges Gesicht. "Außerdem hat sie mich doch verstanden."
Als wir den Eingangsbereich des Hotels verließen und die sechsundsiebzigste Straße betraten, atmeten wir erst einmal tief durch. "Irgendwie stickige Luft in dem Laden, oder was meinst du?" Milo öffnete den obersten Knopf seines Hemdes und lockerte den Krawattenknoten.
"Wenn ich täglich von solchen schweren Teppichen und wuchtigen Möbeln umstellt wäre, würde ich irgendwann einen Asthmaanfall kriegen. Und diesem Hong darf man kein Wort glauben."
"Und die Frau?", wollte Milo wissen.
"Rechne ich zu den Positivposten dieses langweiligen Jobs. Und du?"
"Hast doch gesehen, wie gut wir uns verstanden haben. Tolle Frau."
Wir überquerten die Straße und stiegen in unseren Mercury. "Das heißt also: Wir würden uns in die Quere kommen", sagte ich während wir einstiegen.
"Sag' bloß, du willst es auch bei ihr versuchen!?" Milo spielte den Erstaunten. "Übernimm dich nicht, Partner - du weißt, wie schmerzhaft Enttäuschungen auf diesem Gebiet sein können."
Es war mir klar, dass er mich provozieren wollte. Aber es reizte mich. "Gut - probieren wir es beide und schließen eine Wette ab."
"Einverstanden. Wie viel?" Er streckte mir die Hand hin.
"Wen sie abblitzten lässt, zahlt das nächste Essen im >Mezzogiorno< ..."
6
Der weißblonde Mann bewegte sich mit einer Selbstverständlichkeit durch die Lobby des Carlyle Hotels, als hätte er zwischen Biedermeiertischen, Rokkokosesseln und barocken Ölgemälden das Laufen gelernt.
Das war nicht der Fall. Leonard Wilberforce hatte als kleiner Junge seine ersten Schritte in einem Waisenhaus getan. An einem Ort, an dem man lernt, dass man schneller essen muss als die andern, wenn man satt werden will.
Und danach hatte er viele andere Dinge gelernt, die ein Normalsterblicher nur vom Hörensagen kennt: In den Gesichtern der anderen Angst und Lüge zu lesen auf den Straßen von Bedford Stuyvesant, die Funktion von Alarmanlagen zu verstehen während seiner Elektrikerlehre, Farmern und kleinen Beamten minderwertige Staubsauger zu verkaufen als Vertreter in Minnesota, töten und Nahkampf bei der Navy, Erpressung und den Aufbau einer Untergrundorganisation während einer vierjährigen Haftstrafe wegen Einbruchs, strategische Kriegsführung in seiner Zeit als Söldner der sudanesischen Rebellenarmee und manches mehr.
Vor allem aber hatte er gelernt, dass die Welt mit ihren Städten, Fabriken, Highways und Regierungsprogrammen ein ganz normaler Dschungel ist. Trotz des vielen Glases, Asphalts, Stahls und Papiers weiter nichts als ein Dschungel: Sei schneller als der andere, gerissener, stärker und hemmungsloser - und du überlebst.
Die Empfangsdame an der Rezeption warf einen flüchtigen Blick auf die engen Lederhosen, die Wilberforce unter seinem teuren Jackett trug. Aber nur einen flüchtigen. Es kam immer wieder vor, dass irgendwelche Exoten im Carlyle abstiegen: Rockstars, Modedesigner, Schauspieler - Leute jedenfalls, die über genug Geld und gesellschaftliche Anerkennung verfügten, um die konventionelle Kleiderordnung ignorieren zu können.
Wilberforce legte seinen Aktenkoffer auf den Tresen und stützte sich darauf ab. "Ich werde einen Tag früher abreisen, als vorgesehen", sagte er. "Geschäfte." Die Frau an der Rezeption nickte unterwürfig. "Machen Sie mir für morgen früh die Rechnung fertig."
"Selbstverständlich, Mr. Wilberforce."
Er lächelte freundlich und zog seinen Aktenkoffer vom Tresen. "Einen schönen Nachmittag noch", rief er, während er die Aufzüge ansteuerte.
"Danke gleichfalls, Mr. Wilberforce", rief die Empfangsdame ihm nach. Eine leichte Röte überflog ihre Gesichtshaut. Der Gast aus Zimmer 1713 war allgemein beliebt beim Hotelpersonal. Nicht nur, weil er üppige Trinkgelder gab. Ihm ging auch jene kühle Unnahbarkeit ab, die in den arroganten Gesichtern der Mehrzahl der Leute geschrieben stand, die im Carlyle abstieg.
Wilberforce fuhr hinauf in den siebzehnten Stock. Er hatte ein Zimmer durchschnittlicher Preisklasse gewählt - auf Sauna, Terrasse und Esszimmer konnte er verzichten. Das Carlyle bot auch so genug Komfort: Große, geschmackvoll eingerichtete Zimmer, Kochnische, Videogerät, Stereoanlage, drahtloses Telefon- und Faxanschluss.
Es tat ihm fast leid, das Hotel morgen verlassen und sich mit dem wesentlich spartanischer eingerichteten Räumen des Plazas begnügen zu müssen, wo er schon seit einer Woche eine Art Zweitwohnsitz hatte. Aber er durfte auf keinen Fall mehr hier sein, wenn der hohe Besuch aus Old England einlief.
Wilberforce schloss die Tür seines Zimmers hinter sich und sah auf die Uhr. Kurz nach fünf. Er war gut in der Zeit. In einer knappen Stunde erst würde er das Hotel wieder verlassen müssen, um das vereinbarte Timing einhalten zu können.
Er öffnete den Aktenkoffer und entnahm ihm das schwarze Etui. Eingerahmt in das weiße Blattgold einer Brosche funkelte der große Diamant. Wilberforce hatte keine Ahnung von Diamanten. Doch selbst einen Laien wie ihn fesselte die Schönheit des roten Steins.
Hunderttausend Dollar würde ihnen der Coup einbringen. Fünfzigtausend für jeden. Fünfzigtausend waren kein Pappenstiel, und Wilberforce gehörte zu den Leuten, die nach dem Prinzip arbeiteten: Ein gut und gründlich erledigter Auftrag für einen Kunden brachte zwei neue Kunden. Aber wenn man den echten Diamanten selbst verkaufen würde, brauchte man vermutlich keine Kunden mehr ...
Er schloss den Koffer und ging mit dem Etui ins Bad. Dort versenkte er die Brosche in seinem Porzellan-Zahnbecher.
Zurück in seinem Zimmer kramte er einen Zettel aus seinem Jackett. Er warf sich aufs Bett und überflog zum x-ten Mal die handschriftlich hingekritzelten Zeilen auf dem Papier: >Ankunft - Donnerstag, 18.20 Uhr: Empfang beim Bürgermeister - Freitag, 12.45 Uhr: Besuch des Guggenheim-Museums - Freitag, 15.00 Uhr: Diana-Stiftung in Flatbush - Samstag, 16.00 Uhr ...<
Er kannte das Programm inzwischen auswendig. Aber es verlieh ihm ein Gefühl der Sicherheit, von Zeit zu Zeit noch einmal einen Blick darauf zu werfen.
Zwanzig Minuten nahm er sich Zeit für eine Entspannungsübung. Danach holte er ein paar bunte Lederbälle aus seinem Nachttisch - tennisballgroß und weich. Zuerst jonglierte er rechtshändig mit zwei, dann linkshändig mit zwei. Als er schließlich beidhändig mit vier jonglierte, lief ihm der Schweiß über die Stirn.
Wie so vieles hatte Wilberforce auch das Jonglieren im Gefängnis gelernt. Und benutzte es, um seine beiden Hirnhälften zu koordinieren und seine Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. Beides würde er in den nächsten fünf Tagen dringend brauchen.
Anschließend ging er unter die Dusche, warf sich danach in Schale und verließ Punkt sechs das Hotel. Während er in einem Restaurant im Theatre District beim einem viergängigen thailändischen Menü saß, lief ohne sein Zutun die vorletzte Stufe des Planes an ...
7
"Haben Sie die Sache im Griff?" Der Blick unseres Chefs streifte Milo und mich.
"Kein Problem, Sir", versicherte Milo.
"Gut." Mehr sagte Jonathan McKee nicht. Ich hatte den Eindruck, als flöge ein Ausdruck des Bedauerns über sein Aristokratengesicht. Personenschutz für einen Staatsgast war nicht unbedingt das, wovon ein G-Man träumte - das wusste auch er.
Er wandte sich an Orry und Clive. "Das NYCPD hat sich offiziell an uns gewandt." Er nahm eines der unzähligen Papiere auf, die vor ihm auf seinem Schreibtisch lagen. "Hier hab' ich einen Brief des Chief of Department. Es geht um das Bandenwesen, das auch in unserer Stadt in letzter Zeit mehr und mehr um sich greift."
"Jugendgangs?", fragte Medina.
"Ja. Die City Police ist der Ansicht, dass sich diese Art der Kriminalität dem Stichwort >Organisiertes Verbrechen< zuordnen lässt. Unser Hauptquartier in Washington neigt zu der gleichen Auffassung. In manchen Großstädten der Vereinigten Staaten wird das Bandenwesen unter Jugendlichen ja schon ausschließlich unter der Verantwortung des FBI bekämpft."
Clive Caravaggio lehnte sich in seinen Sessel zurück. "Und in New York City?" Er machte keinen besonders glücklichen Eindruck. Ermittlungen gegen Jugendgangs war ein bisschen wie gegen Windmühlenflügel kämpfen: Man fischte im trübsten Milieu - und wenn man jemanden wegen Körperverletzung ins Gefängnis brachte, war klar, dass man ihm eine Art Spezialausbildung verschaffte. Ein paar Jahre später würde man den gleichen Mann wegen Bankraubs, Kidnapping oder Mordes ins Gefängnis bringen.
"Ich hab deswegen schon wiederholt mit dem Hauptquartier telefoniert", sagte unser Chef. "Die zurzeit gültige Order: Wenn ein Antrag der City Police vorliegt, sollen wir die aktuellen Fälle übernehmen." Er reichte Clive den Brief. "Der Antrag ist nun formal korrekt eingegangen. Nehmen Sie sich mal der letzten Fälle an und berichten Sie mir."
"In Ordnung, Sir." Ein wenig neidisch blickten Milo und ich auf unsere Kollegen. Sie strichen die Unterlagen zu ihrem neuen Auftrag ein und standen auf. "Liegt ein aktueller Fall an?", wollte Orry wissen.
"Ja. Ein Mord an einem Diamantenschleifer in SoHo."
"Jugendliche?"
"Sieht ganz so aus." Der Chef zuckte mit den Schultern. " Ein paar Fakten fallen etwas aus dem Rahmen. Schauen Sie mal." Er wandte sich noch einmal an Milo und mich. "Und Ihnen viel Vergnügen mit der Queen, Jesse und Milo." Ein Lächeln flog über sein Gesicht. "Passen Sie gut auf die Lady auf."
Später fuhren Milo und ich hinauf in die Upper East Side. Die letzten Vorbereitungen im Carlyle Hotel mussten getroffen werden. Unsere Sicherheitsleute einweisen, das Personal informieren, das königliche Besuchsprogramm noch einmal mit dem Hotelmanager durchsprechen.
Das Team, das die Suite nach Wanzen abgesucht hatte, gab einen kurzen Bericht ab. Er bestand nur aus zwei Worten: Nichts gefunden.
Etwas anderes war auch nicht zu erwarten gewesen. Alles, was wir hier im Carlyle anstellten, war reine Routine, die eben abgespult wurde: Suche nach Wanzen, Postierung von Sicherheitsbeamten, Durchsicht der Personalakten von Leuten, die mit dem Staatsgast direkt zu tun haben würden, und so weiter.
Niemand von uns hatte erwartet irgendeinen Hinweis auf eine Gefährdung der Queen zu finden. Und auch für die kommenden vier Tage erwarteten wir weiter nichts als Routine.
Milo und ich hatten uns getrennt. Während er noch einmal mit Hong die neuralgischen Punkte des Hotels abschritt, setzte ich mich mit dem Chef der >Bemelmans Bar< und der Leiterin des >Café Carlyles< zusammen.
Beide Lokale gehörten zum Hotel. Ich stellte ihnen unsere Sicherheitsbeamten vor, suchte Stellen für die Montage zusätzlicher Videokameras aus und bestimmte zwei Tische, die von unserem Standpunkt aus am günstigsten für einen Besuch der Queen zu sein schienen. Man würde mindestens einen von beiden für den Rest der Woche reservieren.
Anschließend fuhr ich hinauf in den achtzehnten Stock. Die Doppeltür zur Suite stand auf. Milo und Hong standen mit ein paar Sicherheitsbeamten davor und sprachen letzte Einzelheiten ab.
Ich warf einen Blick in die Suite. Mary-Lou Browling ordnete ein Herbstblumengesteck auf dem Kamin. Unsere Wette fiel mir ein und ich schlenderte auf den Kamin zu. Durch die offene Tür ins nächste Zimmer sah ich ein Zimmermädchen einen Wandtresor auswischen.
"Schön haben Sie die Räume dekoriert", sprach ich Mary-Lou Browling an, "wunderschön. "So etwas lernt man doch nicht durch ein Literaturstudium?"
"Sie haben meine Personalakte gelesen?", fragte sie verwundert.
"Das gehört nun mal leider zu unserem Job." Aus ihrer Akte wusste ich, dass sie englische Literatur studiert hatte und fließend Französisch, Deutsch und Italienisch sprach. "Haben alle Chefinnen des Zimmerservice eine Universitätsausbildung?"
"Nicht unbedingt." Sie ordnete die weißen Chrysanthemen auf dem Kamin. "Das ist nur ein Einstiegsjob. Ich bin so eine Art rechte Hand von Mr. Hong und werde wohl mittelfristig seine Position besetzen. Sie wissen ja, dass ich erst letzten Monat hier angefangen habe."
"Ihre Familie besitzt ein paar Hotels in der Schweiz und in Südfrankreich, habe ich gelesen."
"Ähnliche Luxushäuser wie dieses hier." Sie senkte die Stimme. "Sie werden es nicht glauben, aber die Leitung des Carlyle verlangt für meine Position tatsächlich ein Hochschulstudium." Sie wandte sich dem Rosenstrauß auf dem Flügel zu und sprach in normaler Lautstärke weiter. "Eines davon werde ich in den nächsten Jahren übernehmen. Aber bevor ich mich von meiner Verwandtschaft beschlagnahmen lasse, wollte ich erst einmal die Welt kennenlernen und ein bisschen Erfahrung sammeln."
Durch die offene Tür sah ich, wie das Zimmermädchen, den Tresor zuklappte und ein rollbares Bücherregal davorschob. "Wie wäre es, wenn ich Ihnen ein bisschen dabei helfe zumindest Manhattan näher kennenzulernen?"
Sie setzte ein undurchsichtiges Lächeln auf. Ein verheißungsvolles Lächeln - also setzte ich nach. "Wir könnten in diesen Tagen mit einer privaten Stadtführung beginnen", sagte ich. "Ich lade sie in die älteste Bar Manhattans ein."
"Das ist sehr nett von Ihnen, Mr. Trevellian. Aber bis die Queen wieder abreist, habe ich hier einen Vierundzwanzigstunden-Job."
"Dann eben danach, sagen wir am Dienstagabend oder am Mittwoch nächster Woche."
"Tut mir wirklich leid, Mr. Trevellian, aber da bin ich schon belegt." Sie machte eine bedauernde Geste. "Vielleicht ein anderes Mal ..." Sie lächelte und rauschte ab ins Nebenzimmer.
Es schien nicht mein Tag zu sein. Ich stornierte meinen Plan für einen weiteren Vorstoß und zog ab. Meine Stimmung war merklich gedämpft.
"Was liegt jetzt noch an?", fragte Milo.
"Hier scheint alles erledigt zu sein", knurrte ich.
Milo sah auf die Uhr. "Dann nehmen wir uns zwei Stunden Auszeit und gehen zum Mittagessen."
Ich folgte ihm zum Aufzug. "Wohin?"
Die Türen schoben sich auseinander, und wir traten ein. Mein Magen hob sich, als der Lift nach unten fiel. "Ins >Mezzogiorno<", sagte Milo, "und so wie du aussiehst, zahlst du."
"Was soll das heißen?" Ich machte ein verständnisloses Gesicht.
Milo grinste. "Du bist abgeblitzt - gib's doch zu. Mit halbem Ohr hab ich's mitgekriegt."
Ein furchtbarer Verdacht trieb mir die Zornesröte ins Gesicht. "Sag' bloß ...!"
Die Lifttür öffnete sich. Milo stieß sich von der Innenwand ab und betrat die Lobby. Er strahlte über das ganze Gesicht. "Heute gegen Mitternacht treffen wir uns in der Hotelbar", verkündete er bestens gelaunt. "Morgen oder übermorgen werden wir zusammen essen gehen, und wenn die Show hier vorbei ist, so ab nächsten Dienstag, wird sie an meiner Seite Manhattan kennenlernen ..."
8
Am späten Vormittag ließ Wilberforce sich noch einen Café au lait kommen. Völlig entspannt rührte er in der milchig braunen Brühe herum. Er war der letzte Frühstücksgast im Café Carlyle.
Die Kellnerin in der altrosa Brokatbluse servierte ihm die bestellten Zigaretten auf einem Silbertablett – Benson & Hedges. In guten Zeiten pflegte Wilberforce guten Tabak zu rauchen. In weniger guten konnte er sich auch mit trockenem Ausschuss oder Schwarztee begnügen. Im Gefängnis wird man flexibel.
Während die Rauchkringel sich dem sechsarmigen Leuchter über seinem Tisch entgegenschraubten, dachte er keineswegs an die Zeiten, in denen er Schwarztee geraucht hatte. Er stellte sich seine Zukunft eher mit Benson & Hedges, mit einem Lincoln unter dem Hintern und einer Menge Champagner im Keller einer Villa in Florida vor.
Die Hunderttausend von Sharington würden dafür natürlich nicht reichen. Der Williamson aber war mehr als nur eine gute Rentenversicherung. Mit dem roten Stein würde er sich eine goldene Festung im Dschungel des Lebens errichten können.
Sicher - sein guter Ruf als Spezialist für alle erdenkbaren Fälle, die jenseits des Gesetzes geregelt werden mussten, beruhte zum größten Teil darauf, dass er als hundertprozentig zuverlässig galt.
>Leonard Wilberforce macht seine Arbeit zweihundertprozentig<, hieß es in der Unterwelt zwischen Frisco, Chicago und dem Big Apple. >Leonard Wilberforce hält sich bis aufs i-Tüpfelchen an Vereinbarungen<, wurde über ihn kolportiert. Und >Hundert Riesen bei einem Deal mit Leonard Wilberforce investiert, werfen mehr ab, als noch so viele Aktien von Chrysler und Benz.<
Genüsslich schlürfte er seinen Kaffee. Er drückte die halb gerauchte Zigarette aus und zündete sich die nächste an.
Viele Jahre harter Arbeit steckten hinter diesem guten Ruf. Spektakuläre Coups in fast allen Staaten der USA: Banküberfälle, Entführungen, Überfälle auf Geldtransporte, Schiffe und Züge, und der eine oder andere Auftragsmord.
Jetzt war Wilberforce weit über vierzig. Obwohl kein Mensch ihm das ansah. Und es stellte sich die Frage, ob harte Arbeit nicht langsam der Vergangenheit angehören sollte. Ohne die Notwendigkeit von Arbeit war er auf keinen guten Ruf mehr angewiesen. Warum also nicht mal eine Ausnahme machen? Warum also nicht den Williamson auf eigene Faust zu Geld machen? Sharington würde sich hüten die Polizei einzuschalten ...
Der Gedanke brachte Wilberforce zum Lachen. Er drückte die Zigarette aus und verließ das Café Carlyle.
An der Rezeption schob er seine Kreditkarte über den Tresen, um sein Zimmer zu bezahlen. Oben in seinem Zimmer dann, bevor er begann seine Sachen zu packen, ging er ins Bad. Er nahm die Zahnbürste aus dem Zahnbecher und stülpte das Porzellangefäß auf seiner flachen Hand um. Nichts. Die Brosche mit dem Diamantenduplikat war verschwunden.
Wilberforce grinste still in sich hinein. Die letzte Phase seines Planes hatte begonnen. Der wichtigste Teil seines Jobs war getan. Sicher - sein Part im letzten Teil war unentbehrlich. Und heikel genug. Aber eigentlich ging es nur noch darum Feuerschutz zu geben.
9
Die Nachmittagssonne lag freundlich und warm über dem East River. Es war windstill, kaum Wellengang auf dem Fluss, und das Hausboot lag still am Ufer.
Auf Deck lagen lang hingestreckt acht Jungen, kaum älter als siebzehn. Durchweg Farbige. Sie hatten ihre Matratzen aus dem Aufbau des Hausbootes geholt und ließen sich die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres auf den Pelz brennen.
Vom Franklin D. Roosevelt Drive her rauschte der Verkehr der beginnenden Rushhour, und am Ufer, im nördlichsten Zipfel des East River Parks, füllten sich die Wege mit Spaziergängern und die Rasenflächen mit Menschengruppen.
Am Heck des Bootes ein kleiner Gartentisch aus verrostetem Metall. Vier Gestalten saßen auf Klapphockern drumherum und pokerten. Der Älteste war etwa zwanzig - ein bulliger Bursche mit rotem, im Nacken zusammengeknotetem Kopftuch. Er trug einen abgewetzten Trenchcoat, der früher einmal schwarz oder dunkelblau gewesen sein muss. Das Porträt eines zähnebleckenden Pittbulls zierte das schwarze T-Shirt unter dem Mantel.
Über die rechte Wange seines schwarzen, aufgedunsen wirkenden Gesichts zogen sich entzündete Kratzspuren.
Winston Laromy legte Wert darauf, dass sein Mantel immer aufgeknöpft und das Hundegesicht gut sichtbar war. Auch die anderen drei Jungens um den Kartentisch trugen an irgendeiner Stelle ihrer Kleidung ein Hundesymbol - auf dem Rücken der Lederweste, auf dem Schulterstück der alten Armeejacke oder eben auf dem T-Shirt.
Winston war der Kopf der >Sweatdogs< - der >Rudelführer<, wie er manchmal sagte. Seit nicht ganz einem Jahr. Seitdem sein älterer Bruder wegen Körperverletzung mit Todesfolge auf >Rikers Island< hinter Gittern saß.
Winston hatte drei Könige auf der Hand. Und da er gegeben hatte, wusste er ziemlich genau, dass keiner der anderen mehr zu bieten hatte. Er griff in seine Manteltasche und holte ein kleines Döschen aus durchsichtigem Kunststoff heraus. Es enthielt drei Cracksteine.
Er betrachtete sie nachdenklich und schob das Döschen dann zu dem Münzhaufen in der Mitte des Tisches. "Sagen wir fünfzig Dollar."
"Du spinnst." Der knapp vierzehnjährige Kahlkopf neben ihm warf seine Karten hin. "Bin weg."
"Und du, Billyboy?" Winston musterte den Hänfling ihm gegenüber. Der beachtete weder seine Karten noch die die fünfzig Dollar in Crack neben dem Pot. Starr sah er geradeaus an Winston vorbei auf den Fluss hinaus. "Hey, Billyboy - Flashback, oder was? Ich will wissen ob du fünfzig in der Hand hast?"
"Ich glaub, wir kriegen Besuch", flüsterte Billyboy.
Winston fuhr herum. "Bullshit!" Drei Patrouillenboote der Hafenpolizei durchpflügten das Wasser und näherten sich dem Hausboot.
Sie ließen die Karten fallen, Geld und Crack in den Taschen verschwinden und sprangen auf. "Die anderen wecken!", schrie Winston. "Stoff und Waffen in die Plastikbeutel und versenken!"
Sie liefen zu den dösenden Gangmitgliedern. "Die Bullen! Wir müssen ...!" Billyboy unterbrach sich mitten im Satz. Wie die anderen starrte er auf den Anlegesteg: Ein gutes Dutzend Männer kamen über die Dielen gestiefelt, die Hälfte davon in Polizeiuniformen. Einige hielten Maschinenpistolen in den Händen.
"Verfluchter Mist!", fauchte Billyboy. "Wenn wir übers Wasser abhauen, fischen uns die Bullen mit ihren Booten auf! Verfluchter Mist!"
"Shut up!", zischte Winston. "Schlimmstenfalls kommen wir wegen den Steinen und den Waffen dran. Schleich dich in die Kajüte und sieh zu, dass du möglichst viel von dem Stoff versenkt kriegst." Er drückte ihm das Döschen mit den Cracksteinen in die Hand. Billyboy zog sich Richtung Bootsaufbau zurück.
"Hübsches Hausbötchen habt ihr hier!" Die ersten beiden Cops sprangen an Bord. Der vordere zückte seine Kupfermarke. "Sergeant Landley, das ist Detective Cranfield." Er wies auf seinen Partner. "Und die beiden Gentlemen sind vom FBI." Er grinste. "Sagt euch sicher was."
Nach und nach kamen die Cops auf das Hausboot. Einer der beiden FBI-Leute hatte einen dunklen Teint und blauschwarzes Haar. Er sah aus wie ein Indianer. "Medina, FBI." Er hielt Winston seine Dienstmarke unter die Nase. "Du scheinst hier so 'ne Art Captain zu sein. Krach mit deinem Mädchen gehabt?" Medina zeigte auf die Kratzspuren in Winstons Gesicht.
"Kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben", giftete er.
"Das ist so eine Schwäche von uns", grinste Cranfield, "wir kommen meistens uneingeladen."
Durch die Tür des Bootsaufbaus zerrten zwei Cops den wild um sich schlagenden Billyboy. "Seht mal her, was der Bursche hier aus dem Fenster im East River versenken wollte!" Einer der Cops hob ein Plastikbündel.
Clive Caravaggio nahm es ihm ab und öffnete es auf den Bordplanken. "Ganz schön schwer." Eine Plastiktüte war in die andere gesteckt. Auf diese Weise fünffach gesichert kamen Totschläger, Messer, zwei Revolver, Schlagringe und kleine Behälter mit Cracksteinen zum Vorschein.
"Ich denke, das reicht für eine vorläufige Festnahme", sagte Sergeant Landley.
"Ihr seid wohl übergeschnappt!" Winston riss sich von den Cops los, die ihm Handschellen anlegen wollten. "Ein bisschen Spielzeug, ein bisschen Stoff - deswegen könnt ihr uns doch nicht in den Knast sperren!"
Blitzschnell packte Medina von hinten zu und bog ihm den Arm in den Nacken hinauf. "Das entscheidet der Haftrichter."
Als die Burschen sahen, dass ihr Anführer in Handschellen von Bord geführt wurde, ließen sie sich widerstandslos festnehmen.
"Das ist jetzt die dritte Horde, die wir einbuchten", knurrte Clive. "Und morgen müssen wir sie wahrscheinlich wieder laufen lassen."
"Ich wär da nicht so sicher." Landley lehnte über die morsche Reling und beobachtete, wie die Cops die Gang in einen Gefangenenwagen verlud.
"Dein berüchtigter Bulleninstinkt?" Cranfield grinste verächtlich.
"Die Kratzer auf dem Gesicht des Burschen, habt ihr die gesehen?" Sie nickten. "Die stammen nicht von seiner Freundin." Er sagte das an Medina gewandt. "Vier eng nebeneinander verlaufende Kratzer, stark entzündet ..." Der Sergeant schüttelte nachdenklich den Kopf. "Die stammen überhaupt nicht von Menschen."
"Worauf wollen Sie hinaus, Landley?" Orry wurde ungeduldig.
"Wenn Sie wie ich Katzen zu Hause hätten, G-Man, dann wüssten Sie worauf ich hinaus will."
"Ich versteh' kein Wort", sagte Clive.
Landley wandte sich an seinen Assistenten. "Wo hast du Penner zuletzt eine Katze gesehen?"
"Heute Morgen im Treppenhaus vor der Tür des Nachbarn." Cranfield machte ein begriffsstutziges Gesicht.
"Und davor?"
"Vorgestern in der Wohnung dieses Diamantenschleifers mit dem polnischen Namen ..." Er unterbrach sich verblüfft. "Moment mal - willst du etwa sagen, dass ..."
"Ich denke nur laut. Denken ist mein Job. Aber gibt dir keine Mühe, du wirst das nie lernen ..."
10
Die Dämmerung senkte sich langsam auf den Park. Fahrradfahrer, Inlineskater, Spaziergänger - die Transverse Road zwischen Upper East Side und West Side machte ganz den Eindruck, als sei halb Manhattan im Central Park unterwegs. Der laue Spätherbstabend lockte die Leute scharenweise ins Freie.
Immer wieder musste der Chauffeur auf die Hupe drücken um dem dunkelblauen Rolls Royce den Weg frei zu machen.
"Fahr ruhig etwas langsamer, Jefferson." Sharington beugte sich aus der Rückbank zu dem Mikrofon, das in der Glasscheibe zwischen ihm und dem Fahrer eingelassen war. "Cleopatra hat's heute nicht so eilig."
Er drehte sich um und blickte durch die Heckscheibe zurück auf den Rand der 65th Straße, die als Transverse Road quer durch den Central Park Ost- und Westhälfte Manhattans verband.
Er sah Cleopatra an einer Parkbank herumschnüffeln. "Langsamer, Jefferson! Cleopatra kommt nicht mehr hinterher." Die riesige schwarze Dogge pinkelte den Papierkorb neben der Bank an.
Fast jeden Abend führte der Juwelier auf diese Weise seinen Hund aus. Von der Upper East Side, 67th Straße war es nur ein Sprung in den Central Park. Da konnte man seinem Hund schon mal einen kleinen Spaziergang gönnen.
Das Autotelefon auf der Mittelkonsole der Rückbank läutete. "Sharington?"
Es war Hastings, sein Sekretär. "Riad am Apparat, Sir - ich verbinde."
Eine tiefe Männerstimme meldete sich. Der Scheich, der an dem Williamson interessiert war. Ob Sharington den Stein inzwischen erwerben konnte, und wann man sich zum endgültigen Geschäftsabschluss treffen würde.
"Noch ein paar Formalitäten, Eure Exzellenz", sagte Sharington. "Ich melde mich, sobald das Projekt abschlussreif ist. Ich gehe mal davon aus, dass es Anfang nächster Woche so weit sein wird."
Der Scheich zeigte sich erfreut und wollte wissen, ob sie sich zur Übergabe der Ware beziehungsweise des Geldes in Zürich oder lieber in Luxemburg treffen wollten. Sharington schlug Zürich vor, weil er dort noch ein paar Geschäfte zu erledigen hatte. "Apropos, Euer Exzellenz - es bleibt doch bei der vereinbarten Summe?"
Der Saudi am anderen Ende der Satellitenleitung versicherte wortreich, dass es selbstverständlich dabei bleiben würde. Sie tauschten noch ein paar Höflichkeiten aus und verabschiedeten sich.
Zufrieden legte Sharington auf. "Fünfzehn Millionen", murmelte er. "Jesus - fünfzehn Millionen ..." Das Diamantenhaus, das er von seinem Vater übernommen hatte, würde in der Familie bleiben. Wenn alles nach Plan lief.
Er wandte sich zur Heckscheibe um. Cleopatra bohrte ihre Nase gerade unter den Schwanz eines deutschen Schäferhundes. "Um Gottes Willen, Jefferson - halt an!" Der Chauffeur stoppte, und Sharington sprang aus dem Wagen. "Cleopatra!", rief er. "Cleopatra! Bei Fuß!"
Die Hündin hatte ihre gute Stube vergessen. Hechelnd schob sie dem Schäferhund ihr Hinterteil entgegen. "Ja, ist das denn die Möglichkeit!" Sharington beugte sich zurück in den Wagen und griff sich das Hundehalsband. Im Laufschritt eilte er auf die Parkbank zu, wo der Schäferhund sich soeben anschickte seine reinrassige Dogge zu bespringen.
"Cleopatra, pfui!", keuchte Sharington. Fahrradfahrer wichen ihm aus, eine Gruppe Skateboardfahrer spritzte auseinander, um ihn durchzulassen.
Der Besitzer des Schäferhundes, ein alter Latino, stand vor den Tieren und grinste genüsslich. "Können Sie nicht auf ihren Köter aufpassen?!", schimpfte Sharington. Er nahm seinen Hund an die Leine und zerrte ihn mit sich zum wartenden Rolls Royce.
"Keine Sorge, Sir", rief ihm der Alte hinterher. "Mein Hund macht nur Spaß, er ist doch kastriert ..."
Sharington hörte es nicht mehr. Er hatte Cleopatra in den Font seines Wagens gescheucht, sich neben sie in den Sitz fallen lassen und die Tür zugeschlagen. "Zurück nach Hause, Jefferson!"
Er blickte auf seine diamantenbesetzte Rolex: acht Uhr. Es wurde allmählich dunkel. "Die Nachrichten, Jefferson!"
Der Chauffeur schaltete das Autoradio ein. Die Meldungen von Naturkatastrophen, Internationalen Konferenzen, Kriegsgefahren und Verbrechen rauschten an dem Diamantenhändler vorbei. Endlich die Meldung des Ereignisses, auf das er seit Wochen zufieberte.
>Heute Abend landete Elizabeth die Zweite auf dem John F. Kennedy International Airport. Der Vizepräsident empfing sie mit militärischen Ehren. Morgen wird die englische Königin in der City Hall erwartet ...<
Sharington spürte seine Hände feucht werden. Die fiebrige Erregung, die schon seit Tagen in seinen Gedärmen kribbelte, erschwerte ihm für Sekunden das Atmen. "Sie ist gelandet ..., es geht los ..."
Er griff zum Telefon und rief seinen Anwalt an. "Ich habe gute Nachrichten", sagte er, "ein lukratives Geschäft steht kurz vor dem Abschluss. Setzten Sie sich mit der Züricher Bank wegen eines Kredites in Verbindung. Und teilen sie dem Aufsichtsrat meiner Firma mit, dass ich unter keinen Umständen einem Verkauf zustimmen werde. Sagen Sie den Gentlemen, ich hätte einen soliden Weg gefunden, den Bankrott abzuwenden ..."
11
"Ist Ihre Katze zu Hause





























