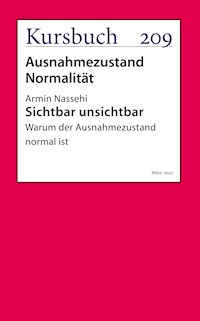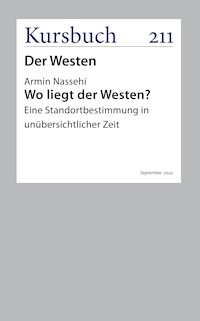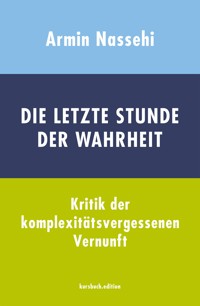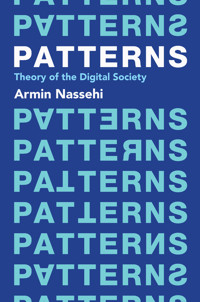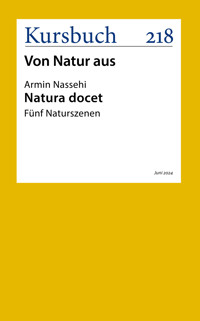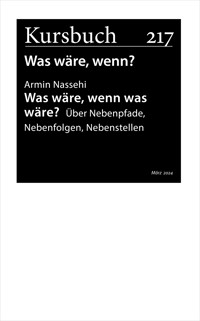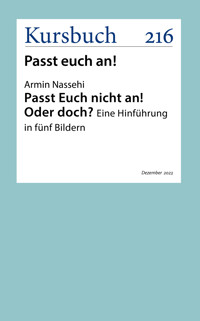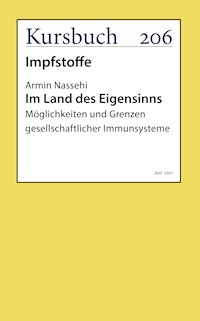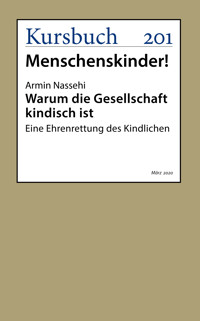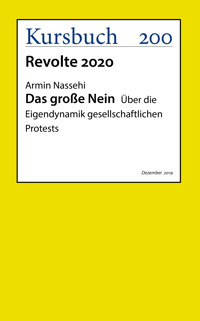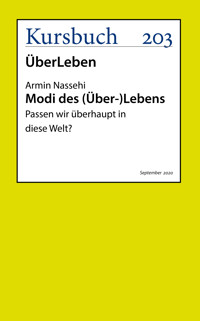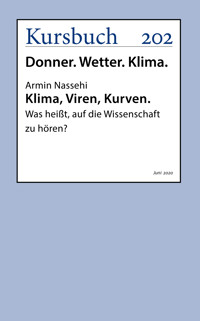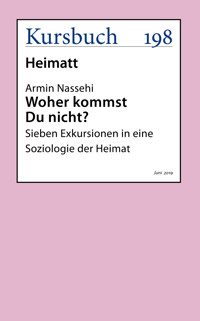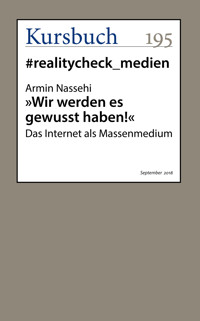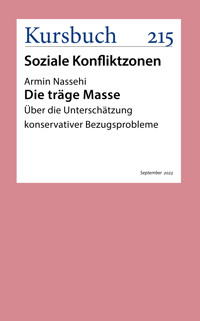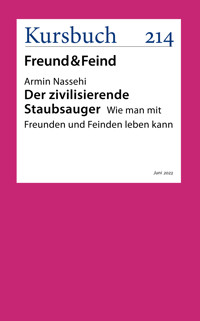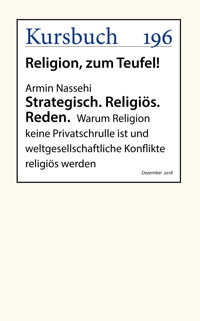
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In seinem Beitrag nimmt der Soziologe und Kursbuch-Herausgeber Armin Nassehi das Verhältnis von Religion und Politik in den Blick: Einerseits werde das Religiöse als privates Personenstandsmerkmal aufgefasst, andererseits verbinde sich zumal heute religiöses Reden mit politischen, kollektiv wirksamen Geltungsansprüchen. Nassehi versucht, die Politisierbarkeit des Religiösen in weltgesellschaftlichen Konfliktlagen mit einer Teilanalogie der Funktionen von Politik und Religion zu erklären.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Armin NassehiStrategisch. Religiös. Reden.Warum Religion keine Privatschrulle ist und weltgesellschaftliche Konflikte religiös werden
Der Autor
Impressum
Armin NassehiStrategisch. Religiös. Reden.Warum Religion keine Privatschrulle ist und weltgesellschaftliche Konflikte religiös werden
Wir haben uns daran gewöhnt, das Religiöse als eine Art privates Personenstandsmerkmal aufzufassen. Wer religiös redet, tut das gerne im Modus der authentischen, der persönlichen, der innerlichen Rede. Der Modus der Rede kapriziert sich auf die individuelle Entscheidung und vor allem darauf, dass der Geltungsraum jenes »Ganzen«, auf das Religion stets rekurriert, das eigene Leben sei.1 Man bezieht dann Kraft fürs eigene Leben aus der religiösen Erfahrung, bezieht den Sinn des innerweltlichen Tuns daraus oder begründet moralische Standards des eigenen Lebens mit religiösen Chiffren. Und doch verbindet sich derzeit religiöses Reden durchaus mit geradezu politischen, besser: kollektiv wirksamen Geltungsansprüchen. Viele Konflikte der Welt nehmen religiöse Inklusions- und Exklusionsformen in Anspruch. Weltgesellschaftliche Konflikte sehen inzwischen bisweilen aus wie Konflikte zwischen religiös/konfessionell codierten Akteuren und überlagern, kolonialisieren geradezu politische Codierungen weltgesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Vieles sieht aus wie ein Kampf der islamischen Welt gegen den christlich imprägnierten Westen. Bei der einzigen existierenden Demokratie im sogenannten Nahen Osten sind sich ihre Feinde nicht ganz sicher, was sie mehr verachten: den westlich orientierten Liberalismus ihres demokratischen Systems oder dass es der Staat der Juden ist. In Asien, Afrika und Südamerika finden sich ebenfalls neue konfessionelle und religiöse Konfliktlinien – und die Identitätsdiskurse in unserer Hemisphäre entdecken das Christliche, oft verbrämt als das »Christlich-Jüdische«, als Identitätsfaktor gegen die Anwürfe der Weltgesellschaft. Das ist ein widersprüchlicher Befund – und doch sind es zwei Seiten einer Medaille, die etwas mit der besonderen Potenz religiöser Rede zu tun haben. Das gilt für ihre Individualisierbarkeit ebenso wie für ihre Politisierbarkeit.
Zwischen Emanzipation und »Privatschrulle«
In der Religionsgeschichte moderner westlicher Gesellschaften kann man einen Trend der Entdramatisierung religiöser Zugehörigkeit im Hinblick auf andere Mitgliedschaften beobachten. Die Konfessionalität einer Person begann für andere Mitgliedschaften und Zugangsvoraussetzungen immer weniger Informationswert zu haben. Ob Katholik oder Protestant, ob überhaupt religiös oder nicht, wird wohl als irrelevant für die Frage angesehen, ob man Mitglied einer Firma, eines Sportvereins, einer Universität oder einer politischen Partei sein kann. Abweichungen von diesem Prinzip sind entweder skandalisierungsfähig oder bedürfen besonderer Begründungen und sogar Rechtsfiguren, wenn man etwa an das kirchliche Arbeitsrecht denkt. Und selbst wenn hier Fälle zu registrieren sind, die so gar nicht modern wirken wollen, ja wie eine gewisse Rückständigkeit aussehen, so ist doch klar, dass man es hier mit Ausnahmen, mit Abweichungen von einem Normalfall zu tun hat.
Am längsten haben solche Formen wohl in der Familie überlebt – noch vor einer bis eineinhalb Generationen war die Konfessionalität des künftigen Ehepartners beziehungsweise der künftigen Ehepartnerin durchaus eine Information – in einer Welt, in der das in den anderen Institutionen, mit denen man typischerweise zu tun hatte, längst obsolet war. In meiner eigenen Familie – meine Mutter stammte aus einem sehr konservativ-bürgerlichen katholischen Elternhaus, mein Vater war bei Eheschließung meiner Eltern ein persischer Student – wurde aus der mütterlichen Familie der Spaß kolportiert, es sei schon schlimm genug, dass nun ein Moslem in die Familie einheiratet, einen Protestanten hätte man niemals akzeptiert. Vor diesem Hintergrund ist es übrigens für viele und sehr oft bei der Vorstellung meiner Person eine Information, dass ich mich im nicht mehr ganz zarten Alter von 18 Jahren habe taufen lassen, katholisch auch noch. Seit das einmal in einem elektronischen Lexikon publiziert wurde, scheint es irgendwie eine Information zu sein. Es lebt aber letztlich von der Attraktivität der Abweichung.
Dass es eine Entdramatisierung der Konfessionsspaltung gibt und kirchliche Mitgliedschaften zur Privatsache degradiert wurden, reiht sich also in den Trend einer Entkoppelung von Inklusionen ein. Obwohl auch Gegenwartsgesellschaften sehr stark von Milieus geprägt sind, scheinen die Milieus selbst viel gröberen Unterscheidungsmustern zu folgen als noch vor zwei Generationen. Das urban-liberale Milieu, geübt im Umgang mit Diversität, ebenso wie das eher kleinstädtisch und agrarisch strukturierte Milieu bezeichnen heute keine geschlossenen sozialen Gruppen mehr, sondern eher Cluster von allgemeinen Merkmalen. Man kann sie an Wahlergebnissen festmachen, die immer deutlicher machen, dass die Unterschiede sich mit den Milieugrenzen kreuzen. Man kann sich dem eher linken Spektrum zugehörig fühlen und dabei sowohl dem einen als auch dem anderen Cluster angehören – und konservativ zu sein, heißt heute keineswegs, nicht mit urbaner Diversität und Liberalität umgehen zu können. Diese grundlegende Konfliktlinie des öffentlichen Diskurses, oftmals verspottet als die »Offenen« gegen die »Ver- oder Geschlossenen« – übrigens zumeist von den »Offenen« – ist vielleicht abstrakt identitätsstiftend, aber nicht im Sinne konkreter Lebensformen, die in sich diverser und pluraler sind als die klassischen Milieus der ebenso klassischen Arbeits- und Industriegesellschaft.