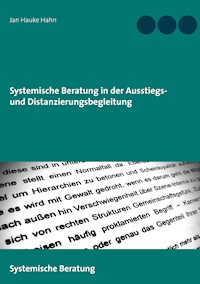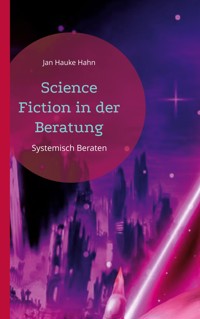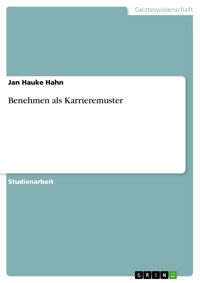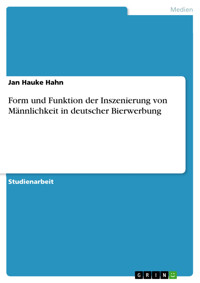Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Stress lass nach! richtet sich an alle, die in den Bereichen Gesundheitsförderung, Resilienzförderung oder im betrieblichen Gesundheitsmanagement beratend tätig sind, sich mit Resilienz und Stresskompetenz beschäftigen oder selbst an einer gesunden Stresskompetenz arbeiten wollen. In kurzen Kapiteln bietet es einen Überblick über die systemische Sichtweise auf Resilienz und Burn-Out sowie umfassende Methoden für die praktische Arbeit mit Menschen. Zudem können die Übungen auch selbst durchgeführt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Jan Hauke Hahn (M.A.), Jahrgang 1985, studierte Pädagogik, Europäische Ethnologie, Neuere Deutsche Literatur & Medien und Skandinavistik in Kiel und in Göteborg.
Er arbeitet in den Bereichen Jugendhilfe, Schule und in der Ausstiegs-und Distanzierungsbegleitung. Zudem ist er freiberuflich als systemischer Berater, Supervisor und Dozent tätig.
Stress lass nach! richtet sich an alle, die in den Bereichen Gesundheitsförderung, Resilienzförderung oder im betrieblichen Gesundheitsmanagement beratend tätig sind, sich mit diesen Themen beschäftigen oder selbst an einer gesunden Stresskompetenz arbeiten wollen.
In kurzen Kapiteln bietet es einen Überblick über die systemische Sichtweise auf Resilienz und Burn-Out sowie umfassende Methoden für die praktische Arbeit mit Menschen. Zudem können die Übungen auch selbst durchgeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Zielsetzung dieses Buches
THEORETISCHE GRUNDLAGEN
3 Was ist Stress? - Neurologische Grundlagen
4 Was passiert bei Stress? - Lazarus´ Stressmodell
5 Krank und gesund - Das Salutogenese-Modell nach Antonowsky
6 Was ist Resilienz?
7 Zwischenstand
METHODEN und ÜBUNGEN
8.1 Übungen Akzeptanz
Innere Antreiber – innere Motivatoren
Das innere Team
Die zweitbeste Lösung
8.2 Übungen Bindung
Rollenklärung – Systemaufstellung
Rollenklärung – Stellenausschreibung
8.3 Übungen Lösungsorientierung
Die Zeitmaschine
8.4 Übungen Gesunder Optimismus
Reframing
Die Zeitkapsel
8.5 Übungen Selbstwahrnehmung
Positionierung
Selbsttest - Wie resilient bin ich?
Was stresst mich wie sehr?
Ressourcen-Check
Warmer Regen
Den Gefühlen Namen geben
Fühlen, was da ist
Wer sind Ihre VIPs?
8.6 Übungen Selbstreflexion
Interview mit dem Stress
Energiebilanz regulieren, Kraftquellen (wieder) entdecken
Beziehung zur Arbeit erkunden
Starke Worte
8.7 Übungen Selbstwirksamkeit
Quellen der Kraft
Rucksack leeren
Fass leeren
Prioritäten setzen mit der 3-Körbe-Methode
Zeitplanung nach dem Kiesel-Prinzip
Abgrenzung
Literaturquellen
Internetquellen
Podcasts
1 Einleitung
In der Supervision sowie in der Beratung von Teams und Einzelpersonen ist ein Thema wiederkehrend präsent – die (Arbeits-)Gesundheit. Bei genauerem Nachfragen landen wir bei Psychohygiene, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, bei Belastungen im Alltag, Herausforderungen oder den Umgang mit Krisen. Müsste man eine gemeinsame Überschrift für dieses Themenfeld finden, könnte man es mit Resilienz beschreiben.
Die Arbeitsbelastung bei Team aus psychosozialen Kontexten ist besonders hoch. Wer als Sozialarbeiter*in schon einmal versucht hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, wird sicher über die hohen Beiträge erstaunt gewesen sein. Dies liegt in der vergleichsweise höheren Burn-Out-Wahrscheinlichkeit bei den Ausübenden der sozialen Berufe. Aber nicht nur in diesem Berufsfeld ist die Arbeitsbelastung hoch. Der Anteil der durch psychische Erkrankungen entstandenen Arbeitsunfähigkeitstage hat sich seit 1997 verdreifacht, seit 1976 in etwa verfünffacht.1
Eine generelle Eigenschaft von Arbeit ist die immer höhere Verdichtung von Tätigkeiten in beruflichen Kontexten. Dies bezieht sich nicht allein auf den Berufsalltag. Auch im Privatleben, der Zeit neben der Arbeit sind wir permanent erreichbar, verpassen keine Nachricht in social media und können erst abschalten, wenn wir den Knopf auf dem Smartphone gedrückt haben.
Belastungen des Alltages oder Krisen können überfordernd sein, wenn das landläufige Nervenkostüm bereits sehr dünn ist. Wir benutzen dann Beschreibungen wie „man ist dünnhäutig“, wir brauchen ein „dickes Fell“ oder „man lässt die Sachen zu nah an sich heran“. Am liebsten würden wir die Belastung demnach gerne weg von uns oder außerhalb von uns wissen, die Dinge von uns fernhalten.
Doch was bedeutet es überhaupt Stress zu haben? Wie kann man ihn wieder loswerden? Kann man ihn überhaupt loswerden?
Zunächst müssen wir herausfinden, was Stress für uns bedeutet, wie er auf uns wirkt und welche unterschiedlichen Dinge uns stressen können. Was passiert bei Stress im neurologischen System? Wie können wir präventiv wirksam werden, um zukünftig nicht aus der Bahn zu fliegen und was können wir tun, wenn es doch einmal passiert ist? Kurzum: Wie können wir Widerstandsfähigkeit für die Anforderungen des (Arbeits-)Alltages trainieren. Wie können wir resilienter werden?
Bevor es losgeht, ist mir wichtig zu erwähnen, dass der Bereich der Gesundheitsförderung sowie die Entstehung von Krankheit und Gesundheit sehr komplex ist. In diesem Buch werden Übungen vorgestellt, die auf der Reflexions- und Verhaltensebene des Individuums stattfinden. Keineswegs soll damit postuliert werden, Gesundheit liege allein in der Verantwortung der Arbeitnehmenden. Gesundheitsförderung ist kontextbedingt und muss von Unternehmen gewollt werden. Der Fokus dieses Buches liegt hauptsächlich auf den Dingen, die im Einflussbereich des Individuums liegen und aktiv verändert werden können.
1 Schubert, 2016, S. 241 (in: Kontext. Ausgabe 3, 2016)
2 Zielsetzung dieses Buches
Dieses Buch ist im Zusammenhang mit einer Workshop-Reihe zur Resilienzförderung entstanden und versteht sich in erster Linie als praxisorientiert mithilfe überwiegend systemisch-konstruktivistischer Methoden. Der Fokus liegt somit weniger auf theoretischer Ebene, sondern auf der Ebene von Durchführung und praktisches Arbeiten.
Ziele dieses Buches sind es die Anzeichen von Stress und Belastung frühzeitig zu erkennen, die Intensität einordnen zu können und im Zuge dessen wirksame Strategien zu entwickeln, um angemessen mit Belastungssituationen oder -zeiträumen umgehen zu können.
Um eine nachhaltige Stärkung der persönlichen Widerstandsfähigkeit oder Stresskompetenz zu erlangen, werden Methoden zur Sensibilisierung der Selbstwahrnehmung vermittelt.
3 Was ist Stress? - Neurologische Grundlagen
Um dem Phänomen Stress näher zu kommen, müssen wir das neurologische System betrachten. So können wir bestimmte Abläufe nachvollziehen und die Reaktionen unseres Körpers verstehen.
Die Reaktionen, die wir in Stresssituationen oder bei Gefahren zeigen sind vergleichbar mit den Reaktionen traumatisierter Menschen in Triggermomenten. In diesem reagieren wir blitzschnell und ohne Nachdenken. Doch auch ohne Traumatisierung können wir ähnlich reagieren. Anders als eine traumatisierte Person kommen wir unbelastet wieder schneller zurück in den Normalzustand.
Unter Stress oder bei Gefahren reagieren wir oft auf unsere Instinkte zurückgeworfen und schalten unser Denkhirn, den Neokortex aus, sodass unser Hirn auf den Modus Autopilot.
Instinktgesteuertes Verhalten ist dem reflexartigen Verhalten von Tieren ähnlich, in welchem Reaktionen ohne langes Nachdenken passieren.2 Wir reagieren somit auf einer eher tierischen Entwicklungsstufe. Ist dieser Modus aktiviert, ist das Großhirn, welches in der Entwicklung des Menschen der Teil des Hirns ist, der sich erst spät entwickelte, weniger aktiv. Es übernehmen Areale des Hirns, die für instinktgesteuertes Verhalten zuständig sind. Umgangssprachlich kann man hier vom Reptilienhirn sprechen.
Das Reptiliengehirn ist der älteste Teil des menschlichen Gehirns.
Es ist im Stammhirn angesiedelt, zu welchen das limbische System sowie der Hirnstamm gehören.
Diese alten Hirnstrukturen des sogenannten Reptiliengehirns haben Vorrang vor den später ausgebildeten Arealen des Menschen. Das bedeutet, bei Alarm übernehmen sie reflexartig die Kontrolle, während das Bewusstsein längere Zeit benötigt.
So übertrumpft unser reptilisches Erbe aus früheren Zeiten das jüngere, menschliche Bewusstsein.