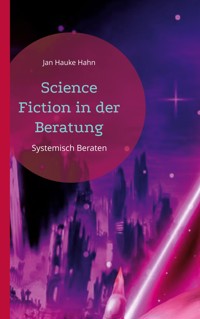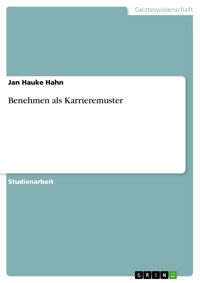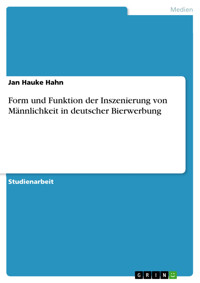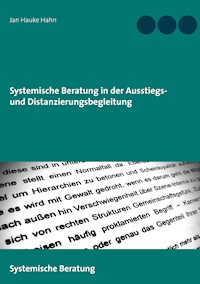
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Möglichkeit, der Thematik Rechtsextremismus zu begegnen ist die Beratung von Menschen, die sich entschieden haben einen Weg heraus aus rechten Strukturen zu suchen oder deren rechtes Weltbild ins Schwanken geraten ist. Eine mögliche Herangehensweise bietet die Systemische Beratung. Dieses Buch beleuchtet Ausstiegs- und Distanzierungsbegleitung mithilfe der Systemischen Beratung. Im Fokus steht die Frage: Welche Möglichkeiten bietet Systemische Beratung in der Ausstiegs- und Distanzierungsbegleitung? Es wird erläutert, welche Potentiale in spezifischen Methoden der Systemischen Beratung in Bezug auf die Arbeit mit ausstiegswilligen Menschen, die sich aus rechten Strukturen lösen, stecken. Zum Einen werden spezifische Methoden die in der Systemischen Beratung Verwendung finden auf ihre Potentiale hin beleuchtet; zum Anderen wird geschaut, inwiefern eine systemisch-konstruktivistische Haltung hilfreich in der Arbeit mit Beratungsnehmenden mit rechtsextremen Hintergrund sein kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Jan Hauke Hahn (M.A.), Jahrgang 1985, studierte Pädagogik, Europäische Ethnologie, Neuere Deutsche Literatur & Medien und Skandinavistik in Kiel und in Göteborg.
Er arbeitet als Sozialpädagoge und ist freiberuflich als Systemischer Berater tätig.
Ein großes Dankeschön für weitere Perspektiven, Korrekturen und spannende Gespräche richte ich an Nils Stühmer, Janosik Herder und Tobias Prelwitz.
Abkürzungen
SB
Systemische Beratung
GMF
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
LLL
life long learning
Inhalt
1.
Einleitung
I.
Rechtsextremismus
2.
Rechtsextremismus und G
ruppenbezogene Menschenfeindlichkeit....
2.1. Ausstiegsbegleitung und Prävention
2.2. Was ist Ausstiegsbegleitung?
2.3. Ausstieg als Prozess
2.4. Rechte Realitäten – rechte Strukturen – rechte Kulturen
2.5. Gründe für einen Ausstieg
II.
Systemische Beratung
3.
Theoretische Grundlagen der systemischen Beratung
3.1. Konstruktivismus
3.2. Systemtheorie
III.
Zusammenführung
4.
"Mit Nazis rede ich nicht!"
- Arbeiten mit Menschen aus rechten Strukturen
4.1. Methoden der systemischen Beratung
4.2.
"So kann man´s auch sehen..."
Reframing als konstruktivistische Methode in der Systemischen Beratung
4.3.
"Was würde deine Mutter dazu sagen?"
- Zirkuläre Fragen als systemische Methode in der Systemischen Beratung
4.4. Grenzen der Systemischen Beratung
4.5. Zusammenfassung
Anhang
5.
Literaturverzeichnis
5.1. Internetquellen
5.2. Weitere Quellen
1. Einleitung
Seit 2014 verzeichnet das Bundesamt für Verfassungsschutz einen stetigen Anstieg rechtsextremistisch motivierter Taten. Während in den Jahren zwischen 2010 und 2014 jährlich etwa 16.000 – 17.000 Straf- und Gewalttaten verübt wurden, kam es 2015 zu einem sprunghaften Anstieg von etwa 22.000 Delikten und zu einem vorläufigen Höhepunkt im Jahre 2016 von etwa 22.500 Taten mit rechtem Hintergrund.1 Die Ausschreitungen während der Aufmärsche von AFD, Pegida, dem Bündnis "Pro Chemnitz" und dem rechten Zusammenschluss "Der III. Weg"2 in Chemnitz 2018, in denen tausende von Menschen im Beisein Rechter und Hooligans demonstrierten, spiegeln einerseits die hohe Präsenz und Mobilisierungsfähigkeit des rechten Randes wider als auch rechte Gewaltpotentiale. Auf der Frankfurter Buchmesse 2018 gibt es mit Manuscriptum und Junge Freiheit Verlage – im Vorjahr kam es bereits zu Protesten mit dem Antaios-Verlag – welche sich rechtsintellektuell gerieren und ihren jeweiligen Beitrag leisten, rechtsideologische Inhalte salonfähig zu machen. Bei der Landtagswahl 2018 in Bayern wurde die AFD3 zum ersten Mal in den Landtag gewählt.4 Die Auflistung rechter Präsenz könnte noch viel weiter gehen. Die oben genannten Beispiele aus Presse und Behörden betonen die Aktualität verfassungs-, meinungs- und menschenfeindlicher Ideologien in der Bundesrepublik. Rechte Ideologien scheinen in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Auch durch die Anschläge des NSU wird deutlich, Rechtsextremismus ist ein Thema höchster Brisanz und Relevanz. Rechtsextreme Strukturen sind nicht immer sichtbar und scheinen im Verborgenen zu existieren und zu operieren. Handlungsbedarfe in unterschiedlichen Feldern sind unabdingbar.
Eine Möglichkeit, der Thematik Rechtsextremismus zu begegnen ist die Beratung von Menschen, die sich entschieden haben einen Weg heraus aus rechten Strukturen zu suchen oder deren rechtes Weltbild ins Schwanken geraten ist. Eine mögliche Herangehensweise bietet die Systemische Beratung.
Systemische Beratung oder systemische Methoden sind mittlerweile zu einem festen Bestandteil in der sozialen Arbeit geworden (vgl. Döcker/Georg/Kühling in: Becker/Schmitt 2019: 231). Sucht man im Internet nach systemischer Literatur, stößt man auf ein facettenreiches Angebot von Veröffentlichungen.5 Auch im Bereich von Fort- und Weiterbildungsangeboten scheint Systemische Beratung besonders im Trend zu liegen, sodass ein ebenfalls breites Angebot vorhanden ist. So wird etwa durch das Demokratiezentrum Hessen eine Weiterbildungsreihe zu "Systemischer Beratung im Kontext Rechtsextremismus" angeboten, die sich unter anderem an Berater_innen der Distanzierungsarbeit richtet.6
Dieser Text beleuchtet Ausstiegs- und Distanzierungsbegleitung mithilfe der Systemischen Beratung. Im Fokus steht die Frage: Welche Möglichkeiten bietet Systemische Beratung in der Ausstiegs- und Distanzierungsbegleitung? Es wird erläutert, welche Potentiale in spezifischen Methoden der Systemischen Beratung in Bezug auf die Arbeit mit ausstiegswilligen Menschen, die sich aus rechten Strukturen lösen – oder nicht weiter annähern wollen – stecken. Zum Einen werden spezifische Methoden die in der Systemischen Beratung Verwendung finden auf ihre Potentiale hin beleuchtet; zum Anderen wird geschaut, inwiefern eine systemisch-konstruktivistische Haltung hilfreich in der Arbeit mit Klient_innen mit rechtsextremen Hintergrund sein kann.
Als Grundlage dieser Ausarbeitung dient die aktuelle systemischkonstruktivistische Literatur. Nicht alle großen Namen, die mit Systemischer Beratung in Verbindung gebracht werden, finden Erwähnung. Dies ist für das Ziel dieser Arbeit nicht entscheidend. Die innerhalb der Bücher beschriebenen theoretischen Grundlagen und Methoden werden herangezogen und ausgewertet. Teilweise ältere Literatur kann aus dem Grunde verwendet werden, weil es trotz einiger Weiterentwicklungen in der Systemischen Beratung keinen Paradigmenwechsel seit Mitte der 1990er-Jahre gegeben hat. Ferner dient einschlägige Literatur zum Themenfeld Ausstiegsarbeit als Analysegrundlage.
Dieses Buch ist in drei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt befasst sich mit dem Themenfeld Rechtsextremismus, innerhalb dessen zunächst für diese Arbeit relevante Themen aufgegriffen werden, die inhaltliche Berührungspunkte mit dem Kontext Rechtsextremismus aufweisen. Im zweiten Teil wird die Systemische Beratung mit ihren Grundpfeilern erläutert. Im dritten Teil, Zusammenführung, werden die beiden vorangestellten Bereiche miteinander verbunden, indem systemische Methoden auf den Kontext der Ausstiegsarbeit bezogen und erörtert werden. Im Folgenden werden die Inhalte dieser Arbeit erläutert:
Zunächst wird eine Annäherung an die Begriffe Rechtsextremismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) vorgenommen, die den aktuellen Stand der Forschung und das Verständnis des Begriffes wiedergibt (zum Beispiel von Heitmeyer, Jaschke, Schulze/Schuhmacher, usw.). Ob sich Adressat_innen der freiwilligen Ausstiegsbegleitungen als (ehemalige) Rechtsextremist_innen angesprochen fühlen, ist dabei jedoch nicht maßgeblich. Zu Grunde gelegt sei ein breiteres Verständnis von rechts und schließt somit rechten Extremismus mit ein. Menschen, die sich in eine Ausstiegsberatung begeben, definieren für sich selbst, ob oder dass sie sich rechten Strukturen oder Kulturen zugehörig fühl(t)en. Damit reicht das Adressat_innenspektrum von Mitläufer_innen, die sich distanzieren wollen bis hin zum Kader rechter Organisationen, die einen sensibel geplanten Ausstieg vollziehen möchten. Dennoch ist die Definition des Rechtsextremismus-Begriffes unumgänglich, um sich dem Thema anzunähern.
Im nächsten Schritt werden die Begriffe Ausstiegsbegleitung und Distanzierungsbegleitung, die häufig analog verwendet werden, erläutert. Was ist darunter zu verstehen? Wer sind die Adressat_innen? Wie kann man sich einen Ausstiegsprozess in etwa vorstellen? Welche Phasen beinhaltet dieser?
Im Kapitel Rechte Realitäten – rechte Strukturen – rechte Kulturen wird in die Lebenswelten der Klient_innen eingeführt. Das Augenmerk wird hierbei auf Jugendliche und junge Menschen gerichtet. Das Kapitel ermöglicht Leser_innen einen Einblick in die Erlebniswelt Rechtsextremismus, welche Gründe Menschen haben können, sich in rechten Strukturen zu bewegen. Was bieten rechte Strukturen jungen Menschen an? Worin besteht die Attraktivität der rechten Szene?
Zum Abschluss des Themenfeldes Rechtsextremismus werden mögliche Gründe und Motivationen von Klient_innen beleuchtet, die sich entscheiden, ein Angebot der Ausstiegsbegleitung aufzusuchen.
Der zweite Teil beginnt mit einem Überblick über das Grundgerüst der Systemischen Beratung (SB). Die Entwicklung der SB hat in ihrer Geschichte etliche Stadien durchlaufen, bis sie zu dem wurde, was sie heute, bzw. etwa seit Mitte der 90er-Jahre, ist. Da diese Genese bücherfüllend ist, konzentriert sich die Darstellung auf die Verknüpfung von Systemtheorie und Konstruktivismus.
Im dritten Teil werden die Themenblocks Rechtsextremismus und Systemische Beratung zusammengeführt. Im Unterpunkt "Mit Nazis rede ich nicht!" - Arbeiten mit Menschen aus rechten Strukturen, in welchem es um die Haltung der Fachkraft in der Arbeit mit Klient_innen geht, tritt die humanistische Komponente der SB zutage. Im weiteren Verlauf werden für die Systemische Beratung und Therapie spezifische Methoden vorgestellt und auf den speziellen Kontext der Ausstiegsarbeit bezogen erörtert.
1 Bundesamt für Verfassungsschutz. (2018) Zahlen und Fakten Rechtsextremismus. Vgl. online unter: https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-rechtsextremismus/rechtsextremistische-straf-und-gewalttaten-2016 (Abruf: 17.10. 2018)
2 Mitteldeutscher Rundfunk (2018) Demonstrationen in Chemnitz und Plauen.. Vgl. online unter: https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/demonstration-chemnitz-plauen-wochenende100.html (Abruf: 17.10. 2018)
3 Es soll keineswegs behauptet werden, die AFD sei eine rechte Partei. Es muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass eine hohe Korrelation zwischen AFD-Wähler_innen und Menschen, die eine Nähe zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) zeigen besteht. So stimmen, laut Studie 88% der AFD-Wähler_innen einer Abwertung asylsuchender Menschen zu. (Vgl. Zick/Krause/Berghan/Küpper in: Melzer, 2016, S. 64) . Die AFD positioniert sich im Gender-Diskurs eindeutig abwertend gegenüber Trans*Menschen (Vgl. Kemper in Henningsen/Tuider/Timmermanns, 2016, S. 142), was ebenfalls im signifikanten Zusammenhang mit GMF steht.. Ferner existieren personelle Überschneidungen der AFD mit eindeutig rechts orientierten Gruppen, wie etwa PEGIDA. (Vgl. Kemper in: Henningsen/Tuider/Timmermanns, 2016, S. 144)
4 Spiegel Online (2018) Höhenflug der AFD gestoppt. Vgl. online unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bayern-wahl-hoehenflug-der-afd-gestoppt-a-1233229.html (Abruf: 17.10. 2018)
5 Sonja Radatz bemerkt die inflationäre Nutzung des Begriffes "systemisch". Häufig werde dies unter anderem auch im Zusammenhang mit NLP, Gruppendynamik oder Transaktionsanalyse genannt. Sie betont die klare Verbindung zum Konstruktivismus. (Vgl. Radatz, 2000, S. 56)
6 Beratungsnetzwerk Hessen (2018) Fortbildungsangebote 2018. Vgl. online unter: http://beratungsnetzwerk-hessen.de/fortbildungsangebote-2018 (Abruf: 21.09.2018)
Teil I Rechtsextremismus
I Rechtsextremismus
2. Rechtsextremismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF)
Um dem Begriff des Rechtsextremismus näher zu kommen und etwaige Strukturen zu verstehen, die ihm innewohnen, wird der Begriff in diesem Kapitel erläutert, beziehungsweise in den Terminus der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) überführt.
Nach Heitmeyer existieren zwei wesentliche Grundelemente einer rechtsextremistischen Orientierung. Zum einen spricht er von einer Ideologie der Ungleichwertigkeit (Abwertung anderer). Darin enthalten ist die Dimension von Ausgrenzungsforderungen in Form sozialer, ökonomischer, kultureller, rechtlicher und politischer Ungleichbehandlung von Fremden und Anderen. (Vgl. Lobermeier 2006: 10).
Das zweite Grundelement ist, nach Heitmeyer, die Akzeptanz von Gewalt.
Heitmeyer ist dazu übergegangen den Begriff Rechtsextremismus durch den Begriff des Syndroms gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu ersetzen. Dieser berücksichtigt,