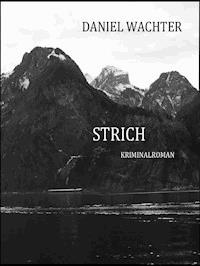
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar Meyer
- Sprache: Deutsch
Was haben eine Prostituierte, ein Junkie und ein Politiker gemeinsam? Sie alle sind einem Serienmörder, der in Zürich sein Unwesen treibt, zum Opfer gefallen. Kommissar Gian Meyer muss gezwungenermassen mit einem jungen Kollegen namens Ramon Steiner ermitteln, dabei gelangen die beiden in einen Fall von internationalem Menschenhandel. Viel Lokalkolorit aus diversen Metropolen und Regionen Europas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Wachter
Strich
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Danksagung
Informationen zum Autor
Weitere verfügbare Werke:
Als E-Book erschienen:
Impressum neobooks
Titel
DANIEL WACHTER
STRICH
KRIMINALROMAN
Texte: © Copyright by Daniel WachterUmschlaggestaltung: © Copyright by Daniel Wachter
Verlag Taschenbuchausgabe:Daniel Wachter
CH-6036 Dierikon
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Eine E-Book-Version dieses Werkes wurde publiziert von neobooks – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Prolog
Montag, 17. Januar 2011, 10:30
Ein schwarzhaariger Mann mit nach hinten gegeltem Haar sass, mit Handschellen gefesselt, einer grossen Flügeltür gegenüber auf einem Stuhl im Flur des Zürcher Kantonsgerichtes. Sowohl zu seiner Linken, als auch zu seiner Rechten stand je ein bewaffneter Kantonspolizist, die Hände vor dem Bauch gefaltet, und warfen ein wachsames Auge auf den Mann.
Immer und immer wieder fragte er sich, was er hier verloren hatte. Jahrelang konnten sie ihm nichts nachweisen und jetzt plötzlich hatte ihm dieser uralte grässliche Bulle einen Knastaufenthalt verpasst.
Er drehte den Kopf nach links und verzog das Gesicht. Wer da heranstolziert kam, konnte der Mann bis aufs Blut nicht leiden. Innerlich schäumte der Schwarzhaarige vor Wut.
„Na, Herr Calvaro! Alles klar?“, fragte der andere ruhig.
„Tja, Commissario Meyer, haben Sie mich erwischt!“, knurrte Mario Calvaro und legte ein falsches Grinsen zu Tage.
‚Selbstherrlicher Hurensohn!’, dachte er.
„Da hätten Sie besser aufpassen sollen und nicht gegen das Gesetz verstossen!“, grinste der Kriminalkommissar der Kantonspolizei Zürich, Gian Meyer, schelmisch.
Calvaro und Meyer waren sich nicht ganz unbekannt. Der Sizilianer Calvaro war ein stadtbekannter Zuhälter. Die Kantons- und auch die Stadtpolizei hatten ihn seit langem unter Verdacht wegen Menschenhandels und Körperverletzung. Doch Calvaro schaffte es stets, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die polizeilichen Beweismittel – blau geschlagene Huren mit gebrochenen Kiefern – reichten dank Calvaros rhetorischen Fähigkeiten unter der gigantischen Nase des Kantonalrichters nicht aus, um den Italiener hinter Gitter zu bringen. Meyer hatte es als Ziel oberster Priorität vor der Pensionierung gesetzt, diesen Italiener in den Knast zu bringen. Endlich schien das lang ersehnte Ziel zum Greifen nah. Des einen Freud, des anderen Leid.
Meyer gab den bewachenden Beamten ein knappes Zeichen, worauf diese den laut auf Italienisch fluchenden Calvaro hoch zerrten. Die drei gingen an Meyer vorbei, welcher sich auf den Stuhl im Flur setzte und tief durchatmete. Die ganze Geschichte hatte erheblich an ihm gezerrt, langsam machte er sich Gedanken, sich in den Ruhestand versetzen zu lassen.
Die beiden Beamten öffneten die Flügeltür und beförderten Calvaro in das gleissende Licht des Gerichtssaals…
Etwa zur selben Zeit beobachtete der SBB-Dispoleiter Franz Odermatt im Zentralstellwerk beim Zürcher Hauptbahnhof die Monitore der Videoüberwachung des Bahnhofs Altstetten.
Eine junge Frau, kaum 25, stand am Bahnsteig Gleis 3 und rauchte. Sie kam Odermatt irgendwie bekannt vor. Er warf einen Blick zum überdimensionalen, mit Linien durchzogenen Gleisplan, der auf einem in der Wand des Büros eingelassenen Monitor auftauchte. Er zeigte analog wie die Flugbewegungen bei Skyguide die Zugbewegungen auf jedem einzelnen Schienenstrang in der Umgebung von Zürich an.
Odermatt drehte sich um und schaute aufs Gleisfeld. Es hatte wieder zu schneien begonnen. Jeder Arbeitsplatz war mit dem Rücken zum Gleisfeld des Vorbahnhofs gewandt.
Endlich realisierte der Dispoleiter, wer diese Frau war: Die Mairiakis, eine Halbgriechin oder so; er hatte mal im selben Block wie sie an der Nebelbachstrasse im Seefeld beim Bahnhof Tiefenbrunnen gewohnt. Ihr Anblick liess das Blut in seinen Adern gefrieren. Unfreiwillig wurde er von den schwärzesten Stunden seines Lebens eingeholt, obwohl er bei unzähligen Kirchenbesuchen gewünscht hatte, nicht mehr daran erinnert zu werden.
Seit ihrem Einzug hatte er sie begehrt, doch sie wollte ihm nicht einmal ihren Vornamen verraten. Die Sehnsucht nach ihr begleitete ihn bis in den Schlaf. Wie oft hatte er in seinen Träumen ihren Namen gerufen, so oft, dass ihn seine Frau verlassen hatte und jetzt den Briefträger des Quartiers bumste. In jedem seiner Träume war sie ihm erschienen, die Bewegung ihrer Unterarmmuskeln, wenn sie die Einkaufstüten in ihre Wohnung schleppte, die gespannte Bluse über ihren üppig geformten Brüsten, ihr Lächeln, einfach alles.
Als Odermatt mit dem Zentralschlüssel – er war zu jener Zeit nebenberuflich Hausmeister des Gebäudes gewesen – einmal in Mairiakis’ Wohnung eingedrungen war, hatte sie ihn erwischt und im Handumdrehen wegen Stalking verklagt. Odermatt hatte gedacht, dass sie einkaufen war – sie hatte auf sein Klingeln hin nicht geöffnet – und wollte herausfinden, welche Vorlieben die Mairiakis hatte und ihr mit einer solchen beschenken wollte, um ihr Herz zu erobern. Doch – sie war nicht einkaufen gegangen, sondern war unter der Dusche gewesen und hatte ihn – nur mit einem Handtuch um die Hüfte – beim Durchsuchen ihrer DVD-Sammlung ertappt. Nur dank einer grosszügigen Vergleichszahlung abseits des Gerichtes und dem Versprechen, sich von nun an nicht mehr auf weniger als 100 Meter zu nähern, war er einem Gerichtsverfahren entgangen. Odermatt musste ausziehen und übersiedelte in eine Wohnung im Hardau-Hochhaus. Das war vor einem knappen Jahr gewesen. Seitdem hatten sie nie mehr etwas voneinander gewusst. Jede Woche ging er seitdem in die St. Antoniuskirche beim Kreuzplatz und leistete Abbitte. Zunächst im Beichtstuhl, wo er vom Pfarrer jeweils zu unendlich vielen Vater unser oder Ave Marias verdonnert wurde, danach in der sonntäglichen Messe. Odermatt, ursprünglich aus dem Kanton Nidwalden stammend, war katholisch getauft worden und hegte eine gewisse Sympathie für Opus Dei. Jede bei der Kommunion eingenommene Hostie liess das Schuldgefühl ein wenig sinken. Aber wenn es nicht reichte, zog er sich jeweils vor dem Zubettgehen vor einem von Kerzen gesäumten Altar aus und geisselte sich mit einer selbstgebauten Peitsche selbst. Die Schmerzen der Narben und Wunden, auch durch die Reibung des Rückens am Stoff der Kleidung, verfolgten ihn bis in den Arbeitsalltag.
Die Frau warf ihre Zigarette achtlos auf den Bahnsteig, ging schnurstracks auf die Geleise zu und sprang von der Bahnsteigkante mitten aufs Gleis. Passanten näherten sich und schrieen.
Odermatt traute seinen Augen kaum. Er schaute zum Gleisplan. Ein blinkender roter Punkt signalisierte die Einfahrt eines Zuges in den Bahnhof Altstetten.
Geistesgegenwärtig griff Odermatt zum Telefon.
“Leitet den IC aus Brig in Altstetten auf die 4!“, bellte er in den Hörer.
„Was?“, schrie er nach einer kurzen Pause, die jedoch wie eine Ewigkeit schien. „Der hat die Weiche schon passiert?!“
Wütend schlug der den Hörer auf die Gabel und verdeckte wie in Trance mit der rechten Hand seine Augen, als könnte er so dem fatalen Ereignis ausweichen, das sich gleich auf den Monitoren abspielen wird.
Mairiakis stand immer noch auf den Gleisen. Sie hatte die Arme ausgebreitet und den Kopf in den Nacken gelegt. Wie eine Christusstatue sah sie aus, als der IC-Doppelstockzug mit nahezu 125 Kilometern pro Stunde in den Bahnhof Altstetten brauste und die Frau innert Sekundenbruchteile erfasste. Nach 10 Sekunden hatte der Zug den Bahnhof passiert und das Gleisbett war leer. Wenig später setzte der Lokomotivführer des Zuges eine Schnellbremsung, um den Zug zum Stillstand zu bringen und der Gleisplan meldete mit einem durchdringenden Piepsen eine Störung beim Bahnhof Altstetten.
Sie hätte sich mit der Situation in den vergangenen Wochen nicht erfolgreich auseinandersetzen können und habe diesen Schritt aus Liebe zu ihrem verstorbenen Freund getan, um sich mit ihm im Jenseits zu vereinigen. Diese Begründung für den wohl mutigsten Schritt ihres Lebens fanden die Angehörigen der streng gläubigen Toten im Abschiedsbrief vor, den sie am Abend beim Betreten der Wohnung auf dem Tisch ausgebreitet vorfanden. Franz Odermatt hatte keine Erwähnung gefunden.
Kapitel 1
Sonntag, 12. Dezember 2010, 15:00
Gian Meyer stand etwas abseits einer grossen Traube von Polizeibeamten auf dem Rasen eines Grundstückes an der Römerstrasse östlich des Winterthurer Stadtzentrums. Das heisst, der Rasen lag unter einer knapp fünf Zentimeter hohen Schneedecke. Er hatte den Kopf gesenkt. Ein Aussenstehender hätte diese Haltung vermutlich als Denkpose interpretiert, aber in Wirklichkeit musste Meyer durchatmen. Dieser Einsatz machte ihm mehr zu schaffen als jeder vorangegangene. Der Kommissar studierte seine Fussabdrücke, die den Schnee durchgedrückt haben und das Gras zum Vorschein brachten. Er machte einige Schritte. Mit einem Platschen wurde der Schneematsch zusammengedrückt und Wasser bildete sich. Wasser, das durch seine angeblich wasserfesten Winterstiefeln rann und seine Socken nässte.
Es hatte wieder zu schneien begonnen. Grosse dicke Schneeflocken, die von Matsch zeugten, fielen von der tief hängenden Wolkendecke.
Vor knapp zwei Minuten waren vier Streifenwagen der Polizei durch Winterthur gerast und hatten mit quietschenden Reifen den Rasen des Grundstücks platt gewalzt. Die vom Schnee befreite matschige braune Erde gab das gezackte Reifenprofil der Wagen exakt wieder. Als die Beamten sich Zutritt zu dem zweistöckigen Einfamilienhaus direkt an der Einfahrt verschaffen wollten, trat ein Ehepaar mittleren Alters aus der Tür.
„Wir möchten mit ihrem Sohn sprechen!“, hatte Meyer gesagt. Es schien ihm eine Ewigkeit her. Alles war wie ein Routineeinsatz.
Doch er stiess auf Widerstand.
„Wieso?“, hatte ihn die Frau skeptisch gefragt.
„Wir haben die Auffassung, dass er seine Freundin ermordet hatte“
Trotz dieser Indiskretion hatte der Kommissar keine Chance. Im Gegenteil, sie hatte die Konfrontation sogar noch verschärft.
Meyer sah auf und wischte sich Schnee, der ihm fortwährend auf die Augenpartie fiel, weg.
Die restlichen Polizisten hatten sich um das Ehepaar geschart. Es schien sehr aufgebracht zu sein.
„Was unterstellen Sie nur meinem Sohn!“, hörte Meyer die Frau keifen. Meyer glaubte, sie würde jeden Moment ein grosses Messer hinter dem Rücken hervorziehen und die Beamten abschlachten.
„He, Meyer!“ Jemand riss ihn aus seinen Gedanken.
Der Kommissar sah auf und sah, wie ein junger Mann intensiv zu ihm winkte. Es war sein designierter Nachfolger Ramon Steiner, ein aufstrebender 25-jähriger Neuabsolvent der Polizeischule aus Bülach. Steiner hatte das dunkelblonde Haar seitlich gekämmt.
Meyer ging auf ihn zu.
Es war bisher ein strenges Wochenende gewesen für den Kommissar, bis sie endlich auf die Spur des Mörders einer schwangeren 17-jährigen in Winterthur-Wülflingen gekommen waren. Als Vorsitzender der kantonalen Kripo reichte das Einzugsgebiet von Meyers Fällen, durchschnittlich vier pro Monat, über den gesamten Kanton Zürich, meistens beziehen sie sich doch auf die Stadt Zürich, wo der Kommissar im Schnitt zwei Fälle pro Monat zu lösen hatte. Der dritte monatliche Fall ereignete sich generell in der Agglomeration Winterthur, ansonsten kamen die restlichen Notrufe wegen Mordes oder Vergewaltigung, die den vierten Fall ausmachen, mehr oder weniger aus dem Ober- oder dem Unterland, seltener aus dem Weinland, das mit knapp einem Verbrechen pro Jahr die klar niedrigste Quote aufwies.. In der Weihnachtszeit ereigneten sich statistisch gesehen mehr Kapitalverbrechen als in den übrigen elf Monaten des Jahres.
Die 17-jährige wurde offensichtlich von ihrem 19-jährigen Freund erdrosselt, nachdem sie ihm die Schwangerschaft gebeichtet hatte – sie war nämlich von ihrem Vater, der sie regelmässig vergewaltigt hatte, geschwängert worden. Meyer kriegte die Bilder des Mädchens, die feuerroten Abdrücke des als Tatwaffe genutzten Taus an ihrem Hals, der starre Blick, die geweiteten Pupillen, das Erbrochene in ihrem Rachen, kaum aus dem Kopf. Ihr Freund, der in einem Seuzacher Kindergarten seinen Zivildienst absolvierte, hatte den Tau von einem Klettergerüst des Kindergartenspielplatzes abgeschnitten. Er hatte auf Meyer nie den Eindruck eines eiskalten Mörders verübt, so wie er weinend in seinem Zimmer dasass, als er zum ersten Mal befragt wurde. Weinend, so dachte Meyer damals, aus Trauer um den herben Verlust seiner Freundin. Dass es einfach nur Verzweiflung hätte sein können, wäre dem Kommissar nicht im Geringsten in den Sinn gekommen. Das weit über den Horizont reichende Denken, das dem ehemaligen Interpol-Agenten den Weg zum Kripochef des Kantons Zürich geebnet hatte, war mit zunehmendem Alter immer mehr in den Hintergrund gerückt, bis es nun gar nicht mehr zum Vorschein zu kommen scheint.
Und nun standen sie abermals vor dem Haus.
„Komm Gian! Wir müssen rein!“, sagte Steiner.
Meyer warf einen Seitenblick auf das Ehepaar. Die Ehefrau konnte sich nicht beruhigen, obwohl fünf Beamte auf sie einredeten. Tränen flossen wie Sturzbäche über ihre Wangen.
„Er hat nichts gemacht! Lassen Sie ihn doch in Ruhe, suchen Sie doch alle Fehler bei sich selbst!“, schrie sie wild gestikulierend. Ihre Stimme überschlug sich fast.
Meyer sah Steiner zweifelnd an.
„Nun sei kein Angsthase! Es ist schrecklich, ich weiss, aber wir haben keine andere Wahl!“, rief Steiner.
„Ramon, ich glaub, ich habe genug von allem!“
Steiner kicherte leise und klopfte Meyer auf die Schulter.
„Hör mal Gian! Du bist der alte Hase im Geschäft! Du hast alle Fälle gelöst! Klar geht das an die Substanz, aber du bist nicht nur mein Vorbild, du bist der Grandseigneur! Das Symbol des Kampfes gegen alle Verbrechen im Kanton! Also reiss dich zusammen!“
Steiner stapfte mit schweren Schritten zur offen stehenden Wohnungstür.
Meyer war über Steiners emotional geführten Vortrag sichtlich überrascht und schaute seinem Kollegen nach, wie er auf den Hauseingang zuging. Erst als Steiner wild winkte und ihm mit einer geschwungenen Handbewegung zum Eingang bewegen wollte, setzte er sich in Bewegung.
„Wenn du meinst“, sagte er und folgte seinem Kollegen. Als sich die Eltern des Tatverdächtigen den beiden Ermittlern in den Weg stellen wollten, wurden sie von den Beamten gewaltsam zurückgehalten. Meyer glaubte gar einen schwingenden Gummiknüppel gesehen zu haben.
Sie betraten das Haus. Der Eingang war geschmacksvoll eingerichtet. Eine Holzbank im englischen Stil bildete das Entree. Eine grosse Topfpflanze war als Schutz vor der Kälte in den Eingangsbereich getragen worden. Meyer konnte trotz eines kleinen botanischen Wissens den genauen Namen der Pflanze nicht eruieren. Eine geschwungene Holztreppe führte ins Obergeschoss, an eine vom Eingangsbereich abgehende Tür war ein hellbraunes Holztäfelchen angenagelt, auf dem dunkelbraun Keller eingebrannt wurde. Auf einem zweiten stand Garage und auf einem dritten Wachküche. Meyer fragte sich, ob das fehlende s den Bewohnern schon aufgefallen war.
Meyer und Steiner gingen ins Obergeschoss. Hier gingen rechterhand mehrere Türen ab. Auch sie waren mit den eingebrannten Holztäfelchen bestückt: Küche, Toilette, Schlafzimmer, Leandra, Raphael, Büro. An der Decke waren die Umrisse der herauszuziehenden Dachstockleiter zu sehen. Auf der linken Seite der beiden Ermittler lag ein mittelgrosses Wohnzimmer, das einzige Zimmer, das von der Diele aus nicht durch eine Tür versperrt war. Ein doppelter Deckenstrahler hing fest an einem der Dachbalken aus Holz, ein Flachbildfernseher hing an der Wand, direkt unter der abfallenden Schräge des Daches. Auch hier befanden sich wieder einige Pflanzen, die Familie schien ein Faible zu haben, gar den grünen Daumen zu besitzen. Der um die Ecke dem Fernseher gegenüber stehende Kamin schien seit Jahren nicht benutzt worden zu sein. Nur zwei Holzscheite lagen in einem Kupfertopf und die Rückwand des Kamins war stark verrusst. Auf dem Tisch auf halben Weg zwischen Kamin und Fernseher stand ein grüner Adventskranz, auf dem drei der vier roten Kerzen brannten. Irgendwo dudelte ein Radio gerade die neusten Hits der Weihnachtshitparade auf und ab.
Steiner schaute Meyer fragend an und wies auf die Tür mit dem Raphael-Schild. Meyer nickte.
Die beiden Ermittler gingen auf die Tür zu Raphaels Zimmer zu. Raphael Ferkovic, das war der Name des Hauptverdächtigen.
Meyer setzte die Faust zum Klopfen an, atmete tief durch und prasselte mit der Faust ein paar Mal gegen das Holz der Tür.
„Aufmachen!“, schrie der Kommissar.
Nichts geschah.
Meyer trommelte stärker gegen die Tür, bis sie nachgab und sich öffnete.
Das Zimmer war wie jedes gewöhnliche eines Jungen in seinem Alter eingerichtet. Martin hatte seins in Gertruds Haus in Oerlikon ähnlich gestaltet, das letzte Mal, dass er es gesehen hatte, war letztes Jahr gewesen.
Wie im Wohnzimmer war auch hier die Schräge des Daches deutlich zu erkennen, zwischen den Dachbalken hingen Bilder, die vermutlich aus Raphaels Kinderzeit stammten. An der Rückseite der Tür wurde diagonal ein Schal des lokalen Challenge League-Klubs FC Winterthur aufgehängt, mit Nadeln war er am Holz der Tür befestigt worden. Ein Bett, ein Tisch mit einem modernen Computer, eines dieser angesagten iPhones samt den berühmten Apple-Kopfhörern auf dem Tisch und ein Schrank. An der Wand hingen ein Poster des englischen Spitzenvereins Manchester United, aufgenommen bei der Siegesfeier des bisher letzten Champions League-Triumphes 2008 in Moskau sowie ein zweites der Simpsons. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie grinsten, auf ihrem braunen Sofa sitzend, von der Wand hinunter. Auf einem offenen Regal neben dem Bett stand ein Foto. Es zeigte ein hübsches Mädchengesicht, das lachte: Vanessa, das Opfer. Niemals wird sie auf dieser Erde je wieder lachen. Meyer beschlich ein trauriges Gefühl.
Raphael Ferkovic sass vor dem Computer und spielte ein Game, dessen offene Hülle neben dem Jungen auf dem Boden lag. Counterstrike. Diesem Egoshooter war Martin zu Zeiten der Scheidung zwischen ihm und Gertrud auch verfallen gewesen. Bei Martin diente es als Ablenkmanöver während eines Durchhängers an der Schule – er war im August 2008 im dritten Schuljahr des Gymnasiums sitzen geblieben, bei Raphael diente Counterstrike zum Ablenken vom Tod der Freundin – oder von seiner grauenhafte Tat selbst – zur Überdeckung von Schuldgefühlen etwa.
„Verdammt!“, fluchte der Junge und schlug mit beiden Händen auf die Tastatur, nachdem seine Spielfigur vom Feind erwischt worden war.
‚You have no bullets!’, stand in hellgrünen Lettern über der Waffe, die aus der Sicht des Betrachters in den Hintergrund der dreidimensionalen Grafik zielte. Raphael hatte den Besuch der beiden Beamten noch nicht bemerkt.
Meyer räusperte sich.
Raphael fuhr panisch herum. Das längere schwarze Haar war ihm ins Gesicht gefallen. Er erkannte Meyer und Steiner vom gestrigen Besuch, als sie ihm die Nachricht von Vanessas Tod überbracht hatten.
„Was machen Sie hier?“, fragte er sichtlich erschrocken.
„Gib es zu, Raphael. Das was du mit Vanessa gemacht hast!“, erwiderte Meyer ruhig.
„I-Ich hab nichts gemacht!“ Er schüttelte energisch den Kopf. Meyer sah, dass der Junge mehrmals geweint hatte. Die Gegend um die Augen war stark gerötet.
„Wir wissen es. Haben Beweise. Du hast sie erdrosselt, weil sie von einem anderen schwanger war!“
„Es war ihr Vater, verdammt noch mal!“, schrie Raphael auf, schleuderte die Tastatur an die Wand und begann zu schluchzen. „Dieser perverse Sack!“
Das Schluchzen wurde immer stärker, zwischendurch japste der Junge um Luft zu schnappen.
„Immer hat sie geheult, immer ging es ihr schlecht, weil er sie wieder mal gefickt hatte. Sie hatte keine Chance. Mit Gürteln hatte er sie am Bett festgezurrt und sie dann vergewaltigt, anal und vaginal. Manchmal kam noch ein Freund von ihm vorbei und sie taten es gleichzeitig. Ich wollte ihr nur helfen und sie von ihren Qualen befreien“, fügte er hinzu, nachdem er sich ein wenig beruhigt hatte.
„Hat Sie Ihnen…dir etwas davon erzählt?“, fragte Meyer leise. Er ekelte sich schon ab der Vorstellung, was Vanessa zu Lebzeiten widerfahren war.
„Nein!“, schluchzte Raphael. „Sie war immer scheisse drauf, aber einmal, als ich mit ihr ein Date hatte, war ich zu früh dran.“ Er rang nach Worten. „Ihr Zimmer ist…war ebenerdig. Man konnte von der Einfahrt direkt hineinsehen. Und da sah ich, wie ihr Vater…sie…“ Er heulte drauflos. „Ich wollte ihr wirklich nur helfen! Glauben Sie mir, es war das Beste für sie!“
„Aber gleich mit Mord?“, wollte Meyer wissen, der den Jungen für weniger zurechnungsfähiger hielt als es zunächst den Anschein gemacht hatte.
„Ihre Seele war beschädigt, ihr Leben verschmutzt. Jeden Tag hätte sie an diese scheusslichen Sachen denken müssen, jeden Tag! Wer will da noch leben!“
„Es tut uns leid, Raphael, aber wir müssen dich mitnehmen!“
Da brach der Junge erneut in Tränen aus und fiel vom Stuhl. Keuchend schnappte er nach Luft. Der Brustkorb senkte sich rasend schnell.“
Meyer kniete zu ihm nieder und versuchte, ihn zu beruhigen.
„Ganz ruhig! Du hast das getan, was du für richtig hieltst!“
„Ich wollte ihr doch nur helfen!“, jammerte Raphael.
Der Junge war vermutlich mit der Situation überfordert gewesen und sah in Mord den einzigen Ausweg. Jedoch lag das nicht dem Mangel an Erfahrung bei Streitlösungen zugrunde, auch Rentner morden noch. Meyer schien dem Täter tatsächlich zu glauben, dass der Junge vielleicht das Mädchen vor den Qualen des Vaters schützen wollte. Estermann war fuchsteufelswild geworden und hatte Meyer als Perversling bezeichnet.
„Wann begreift es diese Welt endlich, dass Worte die beste Lösung von Konflikten sind?“, pflegt Meyers Chef, der Polizeipräsident Philipp Estermann, stets zu sagen.
Dieses Zitat war Meyer während des Wochenendes mehrmals durch den Kopf gegangen.
Aber auch für die Ermittler waren die Untersuchungen ein Grauen gewesen, allen voran der Vater der Toten, welcher zu allem Übel noch mit dem Inzest geprahlt hatte. Meyer hätte am liebsten gekotzt, als dieses Arschloch vor ihm stand und nur so vor Testosteron geprotzt hatte.
Zur selben Zeit betrat Lilijana Perkovic die Skymetro am Terminal E in Kloten und setzte sich auf einen der freien Plätze. Vor etwa einer halben Stunde war sie aus Pristina gelandet. Vor zwei Monaten war ein Mann an ihr Gymnasium gekommen, der ihr gesagt hatte, dass ihre naturwissenschaftlichen Talente massiv beeindruckten und die Eidgenössisch-Technische Hochschule in Zürich massives Interesse hätte, sie in ihren Studiengängen zu begrüssen. Sie würde es auch in Kauf nehmen, ausnahmsweise eine Studentin unter den Semestern zuzulassen. Sie hatte sofort zugesagt – eine Chance wie diese sollte man packen. Sie wollte das Studium absolvieren, um ihre Eltern finanziell im Kosovo zu unterstützen. Immerhin hatte sich das Land von Serbien loseisen können, doch die fehlende Infrastruktur und der Mangel an Rohstoffen liessen das Land verarmen.
Der Zug setzte sich in Bewegung und brauste unter dem Rollfeld des Flughafens hindurch. Wenig später ertönte die Begrüssung in der Schweiz, samt Kuhglocken und Jodelklängen und die Skymetro hielt an ihrer Endstation im Airport Center.
Sie erhob sich und passierte sowohl die Zoll-, als auch die Passkontrolle. An der Gepäckausgabe holte sie sich ihren uralten Schalenkoffer und begab sich zur Ankunftshalle. Die Menschen hier waren gut gekleidet, hasteten aber für ihre Verhältnisse ein bisschen zu viel durch die Gegend. Morgen beginnt ihr Studiengang als Bauingenieurin und die Schweiz würde für mindestens fünf Jahre ihre neue Heimat sein. Sie wird sich dran gewöhnen.
In der Ankunftshalle erblickte sie einen dunkelhaarigen Mann, der in seinen Händen ein Pappschild mit ihrem Namen trug. Der Mann an der Schule hatte ihr versprochen, dass ihr in der Schweiz ein Mann zur Betreuung zur Seite gestellt würde. Das also war er, ein bisschen zu alt für ihren Geschmack, aber das konnte man sich ja nicht aussuchen. Lilijana wippte mit dem Kopf und ging auf ihn zu.
„Guten Tag, ich bin Lilijana Perkovic!“, radebrechte sie auf Deutsch. Diese Sprache hatte sie in den letzten zwei Monaten wie besessen gebüffelt.
Freundlich lächelnd schaute sie ihn an und war sich sicher, dass sie ihm vertrauen konnte.
Sie streckte ihm die Hand entgegen, und er klatschte mit seiner behaarten Pranke auf ihren Handteller.
Die Gedanken an den Inzest und an Raphael gingen Meyer durch den Kopf, als er im Winterthurer Stadtzentrum in seinen Audi RS6 stieg. Er hoffte, dass der morgige Arbeitstag ein klein wenig ruhiger verlief. Die gesamten Ermittlungen waren für alle Beamten sehr belastend gewesen, je mehr Details des Verbrechens ans Licht gerückt waren. Obwohl Vanessas Vater ihr seelischen Schaden angerichtet hatte und Raphael seiner Meinung nach sie nur von all der Schande befreien wollte, musste der Junge mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit für längere Zeit hinter Gitter als ihr Vater, da das Schweizer Gesetz nun mal Kapitalverbrechen mehr bestraft als Sexualverbrechen. Gerade in diesem Augenblick hätte Meyer die vor kurzer Zeit von rechtsextremen Anhängern ins Spiel gebrachte Einführung der Todesstrafe bei Sexualverbrechen unterstützt, obwohl seine politischen Vorstellungen überhaupt nicht mit denen der Rechtspopulisten übereinstimmten.
Nach der Verhaftung Raphaels wegen Mordes waren sie nach Wülflingen gefahren, wo sie endlich den Widerstand von Vanessas Vater überwinden konnten und die Staatsanwältin Dr. Elisabeth Göhner sofort Anklage gegen ihn wegen Blutschande erhoben hatte.
Raphael wurde danach ins Präsidium nach Zürich gefahren und von Meyer und Steiner ausgiebig befragt. Er hatte weiterhin bekräftigt, ihr nur geholfen zu haben. Die beiden Ermittler haben den Fall danach in die Hände der Jugendrichterin übergeben und kriegten dann von Estermann den Rest des Tages frei.
Die Bilder der Verhaftung gingen immer noch durch Meyers Kopf, als er gegen sechs Uhr abends auf der Westumfahrung Zürich im Stop-and-Go-Verkehr das Autobahndreieck Zürich West bei Wettswil passiert hatte. Er war in Wülflingen direkt auf die A1 gefahren und wollte direkt nach Horgen. Bereits bei der Aubrugg und am Limmattaler Kreuz war die Autofahrt zu einer Geduldsprobe geworden. Aber immerhin, sie liess Meyer wilde Gedankengänge zu. Das Leben, das Raphael Ferkovic mit der angeblichen Schutztat an Vanessa dieses Wochenende zerstört hatte, beschäftigte der Kommissar. Er hatte Angst, dass Martin auch eine solche Tat vollbringen würde. Zwar war Martin, ganz im Gegensatz zu Raphael, wie es den Anschein machte, ein rationell denkender Mensch und liess sich nicht allzu viel von Gefühlen leiten, aber ein, nur einer, emotionaler Ausbruch kann einen Menschen in ein ganz anderes Wesen verwandeln.
12. Dezember, 22:57 Uhr
Die Haupthalle des Zürcher Hauptbahnhofes war trotz der späten Stunde immer noch voller Leben.
Eine Unmenge an Menschen hastete durch die leere Haupthalle des Hauptbahnhofes in Richtung des Ausganges beim Alfred-Escher-Denkmal hin zur Bahnhofstrasse. Die rot leuchtende Neonspirale am Ausgang zur Quaibrücke erhellte das Gebäude. Gegenüber hing ein weiteres, mit Tieren und neonroten Spiralen versehenes, Kunstwerk an der Wand. Auf ihm prangten kleine Zahlen, die nach dem gleichnamigen italienischen Mathematiker benannte Fibonacci-Folge, bei der die zwei vorangegangen Zahlen addiert die aktuelle ergibt: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 und so weiter. Doch sie wurde von niemandem richtig wahrgenommen.
Auch der bunte, mit goldenen Flügeln versehene Engel der inzwischen verstorbenen Niki de Saint Phalle, ihres Zeichens geniale Künstlerin und Ex-Frau von Jean Tinguely, der am Dach hing und den Reisenden der SBB Gottes Segen gab, schien friedlich zu schlafen. Nur wenige Beobachter reckten den Blick auf den Engel, zu viele sind sich an ihn gewöhnt, sie liessen sich durch die Farbenfröhlichkeit nicht mehr vom Hocker reissen.
Immer wieder hallte das kurze, zischende Geräusch, eines von einem von der Fahrleitung abgekoppelten Stromabnehmers einer Lokomotive durch die Gleishalle.
Die Ansagerin kündigte gerade einen InterCity nach Basel SBB an, wenig später rumpelten die von einer Lokomotive gestossenen Wagen rückwärts in den Bahnhof.
Jedoch fanden sich nur wenige Leute am Bahnsteig ein.
Menschen hasteten, um dann am Bahnsteig die roten Rücklichter ihres Zuges zu sehen, wenn er die Halle in Richtung Zielort verlässt. Ihre Flüche waren gelegentlich zu vernehmen.
Auch ein Reisender, der den Zug nach Basel knapp verpasste, war ein solcher Fall.
Die Taxifahrer bei der Zollbrücke am Bahnsteig Gleis 18 hatten Hochbetrieb.
Der Bahnhofsseelsorger schloss seine Kirche und machte sich wohlverdient an den Heimweg. Heute musste er sich um ein kleines gestrandetes Mädchen aus Italien kümmern, das in Mailand vor den Augen seiner Mutter in den Zug nach Zürich gestiegen war – obwohl die Mutter Fahrkarten nach Bern gekauft hatte. Er hatte es seiner angenommen und hatte es schliesslich auf den nächsten Zug nach Bern begleitet, wo sich die Mutter sicherlich über das Auftauchen ihres Töchterchens freute. Ansonsten hatte er nicht viel zu tun gehabt, nur ein Araber, der grosse Flugangst hatte und sich grässlich vor dem Heimflug nach Dubai gefürchtet hatte.
An der Ecke, beim halbrunden SBB-Informationsschalter, hockte ein Penner am Boden, den Hund neben sich, um sich Plastiktaschen aus verschiedenen Discountern wie Denner, Aldi oder Lidl um sich geschart. Der Kopf war ihm auf die Brust gefallen, und leise liess er schnarchende Laute von sich geben. Auch der Hund schien zu schnarchen. In der Nacht war der HB vielfach die einzige Anlaufstation für Landstreicher. Zwei patrouillierende Bahnpolizisten liessen ihn gewähren und setzten ihren Rundgang auf den Bahnsteig beim Gleis 18 fort.
Das Band, über das tagsüber digital in weissen Punkten Werbeslogans der SBB flimmerten, war gänzlich schwarz und in der Dunkelheit nur schwer auszumachen.
Niemand nahm den mit schwarzer Wollmütze und schwarzem Schal vermummten Mann wahr, der um zwei Minuten vor elf mit einer grossen, dunklen Sporttasche auf den Schultern gemächlich die Treppe von der Gleishalle zum Untergeschoss mit der Einkaufspassage und dem Zugang zum Bahnhof Museumstrasse hinunterschlenderte.
Er machte den Eindruck, dass er von ausserhalb des Bahnhofs käme, denn die Temperaturen lagen, für diese Jahreszeit typisch, tief unter dem Gefrierpunkt.
Als der Mann vor dem abgesperrten Bereich einer Baustelle war, drehte er den Kopf nach links und nach rechts, und als gerade niemand die Unterführung zum Shopville entlang gehastet kam, überschritt die nur aus einem Plastikband bestehende Absperrung, die eine kleine Fläche vor der eigentlichen Baustelle absicherte. Diese Fläche wurde, jetzt in der Nacht, als Abstellplatz für kleinere Baugeräte benutzt. Einer der Bauarbeiter hatte sogar seinen Helm auf den Platz geworfen, als er Feierabend gehabt hatte. Lose lag er auf dem Deckel, die Bänderteile hingen lose über den Rand.
Achtlos wurde er vom Eindringling an eine Wand getreten. Leises Scheppern hallte durch die Unterführung, als der Helm zurück auf den Boden fiel.
Der Mann nahm mit einer schwungvollen Bewegung die Tasche vom Rücken. Sie war schwer. Behutsam liess er sie auf den Boden gleiten und zerrte den Reissverschluss auf.
Dann griff er hinein. Der mit Leintüchern umwickelte Gegenstand war schwer. Er verspürte grosse Mühe, ihn herauszuziehen.
Kapitel 2
Montag, 13. Dezember 2010, 07:08
Kommissar Gian Meyer stand in seinem Badezimmer vor dem Spiegel und rasierte sich seinen graumelierten Dreitagebart ab. Das dunkle Haar hatte bereits vor dem Alter kapituliert und hatte den Rückzug in einen schmalen Haarkranz am Hinterkopf angetreten, einen Haarkranz, den Meyer jeweils rigoros abrasieren lässt. Hinter vorgehaltener Hand wird Meyer oftmals als Zürcher Version von Bruce Willis bezeichnet, obwohl Meyer niemals auf die Idee kommen könnte, wie John McClane in „Stirb langsam“ im weissen Unterhemd herumzurennen. Manche Kollegen liessen es sich unter Alkoholeinfluss nicht verkneifen, diesen Vergleich am Stammtisch zu ziehen – selbstverständlich bei Anwesenheit Meyers. Doch Meyer ist dies egal, es erfüllte ihn gar mit Stolz, mit Bruce Willis verglichen zu werden, denn seiner Meinung nach stimme der Vergleich überhaupt nicht. Es hätte auch schlechter kommen können: Der Chefpathologe des Forensischen Dienstes, Dr. Furrer, war laut den Stammtischkollegen angeblich Osama Bin Laden wie aus dem Gesicht geschnitten. Ob wahr oder nicht, darüber liesse sich streiten und Meyer hielt sich am liebsten aus solchen seiner Ansicht nach unter der Gürtellinie befindenden Diskussionen heraus.
Meyers Badezimmerfenster bot einen fantastischen Blick über den Zürichsee. In den rechten Augenwinkeln konnte man die Glarner Alpen ausmachen, und auch, dass sich der Himmel über den Bergwipfeln leuchtend feuerrotorange über den ziemlich genau im Osten von Meyer ausgesehenen gelegenen Gipfeln aufgehenden Sonne gefärbt hat. Meyer hatte sich vor knapp vier Jahren nach seiner Scheidung von Gertrud mit dem Ersparten von knapp 20 Dienstjahren bei der Zürcher Kripo und Interpol diese Wohnung in Hanglage ob dem Zürichsee in Horgen gekauft. Früher hatte er eine Mansardenwohnung in Gertruds Elternhaus mitten in Oerlikon bewohnt. Hier in Horgen schätzte er vor allem eins: Ruhe und Abgeschiedenheit, und trotzdem lebte er nicht am Ende der Welt.
Das Badezimmer selbst war für Schweizer Verhältnisse normal eingerichtet. Hinter einer milchigen Plexiglaswand befand sich eine Dusche mit – wie Meyer immer stolz erzählte, einer Chromstahlbrause, zudem eine perfekt in die Plättchenwand eingelassene Badewanne, eine Toilette und zwei Spülbecken. Meyer nutzte generell nur eines. Auch zwei der drei Badezimmerschränke, die allesamt mit einem Spiegel versehen wurden, waren leer. Das einzige, was den Kommissar störte, war dass die sanitären Einrichtungen wie die WC-Schüssel oder die Badewanne in feurigem Rot gehalten wurden, während der Rest des Zimmers weiss war.
Meyer sah sich im Spiegel an, dann pustete er die kurzen Härchen in den Ausguss und liess den Wasserhahn laufen. Durch das Rauschen hindurch überhörte er beinahe das Klingeln seines Telefons.
Barfuss tappte er über die Fliesen zur Tür und dann auf dem Parkettboden zum Wohnzimmer, wo das schnurlose Telefon auf einem hohen, kreisrunden Tisch lag. Die Station war sonst irgendwo im Haus, verborgen unter einem gigantischen Haufen Altpapier, aber solange das Signal noch funktionierte, war kein Aufräumen angesagt. Auf der mittleren Ebene des Tischchens, unter der Platte, leuchtete das hellgrüne Lämpchen des WLAN-Routers, welcher Meyers Wohnung samt Wintergarten gänzlich mit Internet versorgte. Dadurch musste der Kommissar nicht immer aufpassen, dass er nicht gerade die Telefonbuchsen mit Möbeln zusperrte. In der alten Wohnung in Oerlikon war genau das immer zum Problem geworden, zumal Gertrud gegen die Einrichtung eines drahtlosen Netzwerks war, da sie allfällige Schäden durch die Strahlungen befürchtete.
Meyer nahm das Telefon in die linke Hand und hielt es ans Ohr.
„Ja? Meyer am Apparat?“
„Hey Gian!“, Meyer erkannte die Stimme sofort. Es war Steiner, der die Ermittlungsarbeiten in Winterthur besser zu verdauen schien als der alte Hase Meyer, „du hast was zu tun. Eine Leiche am Sihlquai. Estermann hat den Fall uns gegeben!“
„Eine Nutte?“, erkundigte sich Meyer.
„Erraten! An der Kasernenstrasse kannste die Unterlagen abholen. Estermann hat uns die Ermittlungen übertragen und der Hausdrache leitet die Voruntersuchung!“ Mit ‚Hausdrache’ war Staatsanwältin Dr. Elisabeth Göhner gemeint.
„Ich komme sofort!“, rief Meyer und beendete den Anruf.
Meyer hatte im Zuge seines Umzugs nach Horgen mit seinem Büro vereinbart, dass er per sofort den Weg zum Polizeipräsidium nur noch im Ermittlungsfalle per Wagen antreten wird. Dieses ewige und lästige Im-Stau-stehen schlug an seine Substanz, so dass er bereits gestresst bei der Arbeit eintraf. Mit zunehmendem Alter genoss er es vielmehr, das Generalabonnement zu erstehen und damit per S-Bahn nach Zürich zu ruckeln und sich mit den Schlagzeilen der Pendlerzeitung vertraut zu machen, ohne auch nur einen Schweisstropfen zu verlieren. Wenn es unbedingt notwendig – laut Meyer „unausweichlich“ – war, dass er per Auto kam, so wurde er am frühen Morgen jeweils per Telefon informiert.
Er nahm wohl den Mantel etwas zu eilig vom Haken, denn der hölzerne Hutständer schwankte bedrohlich, verlor schliesslich das Gleichgewicht und landete genau auf einer alten chinesischen Ming-Vase, die ein Antiquar vor drei Wochen unten in Oberrieden abgelehnt hatte. Blau/Weiss, die Farben von GC, dem FC Zürich und dem FC Luzern, gehörten bei ihm als leidenschaftlicher FC Basel-Fan nicht in den Laden. Meyer, der seit seinem Kreuzbandriss und dem Karrierenende bei der U15-Juniorenmannschaft des Churer Fussballvereins nicht gerade gut auf Fussball zu sprechen war und seit dem Auftreten des Basler Goldhühnchens Gigi Oeri dem Schweizer Klubfussball nicht einen feuchten Kehricht mehr abgewinnen konnte, war wieder abgerauscht.
Nun lag diese Vase in unzähligen Einzelsplittern auf dem Teppichboden. Meyer fluchte, drehte um und zerrte den Staubsauger aus dem Besenschrank. Als er den Stecker eingestöpselt hatte und den Sauger laufen lassen wollte, merkte er, dass die Steckdose Wackelkontakt hatte.
„Wie viel geht heute denn noch schief?“, knurrte er und steckte den Strecker um. Endlich!
Knirschend flogen die Porzellansplitter die metallene Röhre des Staubsauger-Ansatzes hoch.
Als Meyer merkte, dass er schon genug Zeit verloren hatte, liess er den Staubsauger Staubsauger sein und verliess die Wohnung.
Meyer stieg in seinen Audi RS6 – ebenfalls ein Zeugnis seines guten Einkommens und nebst der Wohnung der einzige geleistete Luxus – und startete den Motor.
Dreissig Minuten später – davon mindestens 18 im Stau – verliess Meyer in Wiedikon den Autobahnzubringer A3W und rollte an der Sihl entlang zum Kantonalen Polizeigebäude an der Kasernenstrasse. Er parkte den Wagen unmittelbar vor dem Eingang und trat ein. An der Kreuzung Manessestrasse/Schimmelstrasse, als Meyer vor einem Rotlicht warten musste, ging eine Gruppe von sechs Jugendlichen, kaum älter als 16, vom Trottoir auf die Strasse, um Meyers Wagen zu bestaunen.
Einer der Jugendlichen klopfte auf der Beifahrerseite an die Scheibe. Als Meyer den Kopf umdrehte, vollführte der Junge mit der rechten Hand eine Kurbelbewegung.
Meyer verstand, lehnte über den Beifahrersitz und liess per Knopfdruck die Scheibe herunter.
„Starke Karre, Mann!“, sagte der Junge und lächelte. „Oh Mann, sogar Ledersitze!“
„Danke!“, erwiderte Meyer, liess die Scheibe wieder hochfahren, blickte nach vorne und als er gesehen hatte, dass das Lichtsignal auf Grün gesprungen war, gab er Gas. Langsam bremste er und hielt er direkt vor dem Eingang des Polizeipräsidiums an der Kasernenstrasse 29, unweit vom Hauptbahnhof gelegen. Die Fassade war vergangene Freitagnacht von FCZ-Anhängern bei ihrem Streifzug durchs Langstrassenquartier mit blauen Schriftzügen versprayt worden.
Fräulein Roggenmoser, die ledig gebliebene, aber in die Jahre gekommene Empfangsfrau der Kapo Zürich winkte ihm von weitem entgegen.
„Kommissar Meyer, Kommissar Meyer! Kommen Sie! Kommen Sie“, keifte sie mit so lauter Stimme, dass alle im Foyer aufhaltenden Personen den Kopf in Richtung ihres Tresens drehten.
Als Meyer an den Empfangsschalter trat, übergab sie ihm feierlich ein mit Papier vollgestopftes Mäppchen.
„Alles klar, Herr Kommissar?“, fragte sie. Dieses Zitat des von ihr verehrten österreichischen Sängers Falco war ihr Markenzeichen. Eine im Präsidium kursierende Legende besagt, dass sich Fräulein Roggenmoser nach Falcos Unfalltod in der Dominikanischen Republik 1998 gleich für eine Woche krankschreiben liess.
Meyer lehnte sich lässig an den Tresen, packte das Mäppchen und blätterte rasch durch die Akten.
„Läck Bobby“, entfuhr es ihm, „so einen Papierkram. Wann wurde die Leiche gefunden?“
„Laut Ramon vor einer dreiviertel Stunde. Sie sind spät dran heute! Der Forensische Dienst ist bereits vor Ort!“
„Bereits so viel Altpapier nach 45 Minuten?“
„Naja, Ramon sagt, die beiden Beamten der alarmierten Stadtpolizei hätten einen genauen Beschrieb des Tatortes abgegeben!“
Meyer blätterte durch die Unterlagen. „Einen sehr genauen“, berichtigte er.
„Kaffee?“
Meyer hatte keine Gelegenheit, abzulehnen, denn Roggenmoser hatte, während die die Frage gestellt hatte, eine Tasse der dampfenden Moccabrühe auf den Tresen gestellt. Dankend nahm er einen Schluck und verbrühte sich fast die Zunge.
„Verdammt!“, fluchte er.
Fräulein Roggenmoser lachte.
Schweigend stellte er die noch halbvolle Tasse zurück und nickte zum Abschied.
Meyer entschied, den kurzen Weg zum Tatort zu Fuss zu absolvieren. Mit dem Wagen hätte er den Hauptbahnhof umrunden müssen, als Fussgänger konnte er diesen queren.
Während dem Spaziergang blätterte er den Bericht vom Fundort durch. Opfer ist eine junge Prostituierte, zwischen 18 und 25 Jahre alt. Aufgefunden in einem Wohnwagen. Ohne Papiere. Tod durch Messerstich – jedoch keine Spur von der Tatwaffe. Der Satz „Die Leiche wurde vom Vorgesetzten der Toten entdeckt“, liess Meyer zu einem Grinsen hinreissen.
„Zu verklemmt, um „Zuhälter“ zu schreiben, oder was?“, murmelte er leise.
Weiters enthielt der Bericht, dass beim ersten Überblick des Fundortes keine Papiere und sonstige Hinweise auf die Identität des Opfers gefunden wurden. Die Leiche ist mindestens seit ein Uhr in der Früh tot, so eine erste Blutanalyse.
Der Kommissar trat auf den Bahnhof Sihlpost zu. Linkerhand ragten rund zehn rote und gelbe Baukräne in die Höhe, welche Tag für Tag die Grossüberbauung Europaallee in den Stadtzürcher Himmel hochzogen. Zur Stunde waren die Arbeiten wieder voll im Gange, hunderte Bauarbeiter in ihren orangefarbenen Leuchtwesten kletterten über die Gerüste.
Meyer liess sich per Rolltreppe zur Passage Sihlquai hinunterbefördern, der westlichen Hauptunterführung des HB’s. Gähnend liess er hastende Reisende links überholen. Inmitten der Hauptverkehrszeiten herrscht hier stets ein grosses Gedränge, so auch an diesem Tag. Der Kommissar verzichtete auf ein Weiterlesen und konzentrierte sich stattdessen darauf, der hastigen Meute auszuweichen. Gelegentlich spürte er den Zusammenprall mit ausgefahrenen Ellenbogen und wäre beinahe über einen Barbie-Minirollkoffer eines kleinen Mädchens gestolpert. Bei jedem Aufgang zu einem Bahnsteig zeigten zwei blaue Zugzielanzeiger die Destination an. Man merkte, dass Zürich nicht nur national, sondern auch international ein Verkehrsknoten war, denn zwischen den Dialekten aus Bern, Wallis, St. Gallen oder Graubünden waren auch Brocken von Fremdsprachen zu verstehen. So fragte zum Beispiel ein Geschäftsmann auf Französisch nach den Abfahrtszeiten des nächsten TGV nach Paris. Sobald Meyer an einem Aufgang vorbeiging, drangen Wortfetzen zu ihm durch. „Nach Konstanz Gleis 7, nach Sargans–Landquart–Chur, Gleis 6, nach Stuttgart, Gleis 18“, und so weiter und so fort. Am Aufgang zum Bahnsteig mit dem abfahrbereiten InterCity nach St. Gallen stand ein hagerer Mann mit seitlich gekämmtem gräulichen Haar im weissen Hemd und einer weinroten Weste mit einem Glas Milch in der Hand und liess in seinem St. Galler Dialekt seine Umwelt wissen, dass er seine Mutter suche, die doch nur ein zweites Glas Milch für ihn holen wollte. Ein paar Reisenden drehten den Kopf zu ihm um, aber Meyer war sich sicher, sobald sie den Aufstieg zum Bahnsteig hinaufhasteten oder gar sich ins Gedränge um einen Sitzplatz stürzten, hatten sie den St. Galler und sein angeblich bemitleidenswertes Schicksal bereits wieder vergessen.
Erleichtert atmete Meyer auf, als er am Nordende des Bahnhofs vor der Rolltreppe auf Erdniveau stand. Er atmete zweimal durch, ehe er auf die Rolltreppe trat, die ihn nach oben brachte. Oben verliess er den Bahnhof am Kiosk beim Seitenbahnsteig Gleis 18 und grüsste zwei Beamte der Stadtpolizei, welche mit ihrem Schäferhund patrouillierten und vermutlich nach der Tatwaffe suchten. Meyer überquerte die Museumstrasse am westlichen Brückenkopf der die Sihl überspannenden Zollbrücke und bog dann rechterhand auf den Sihlquai ab, wo Polizeisperren, Streifenwagen und die zunehmende Anzahl Stadt- und Kantonspolizisten den Tatort bereits von weitem ankündigten.
Der Sihlquai ist schweizweit als Strassenstrich bekannt. Sobald die Dunkelheit über Zürich eingebrochen ist, erwecken die geparkten Wohnwagen zum Leben und Prostituierte versammeln sich über die gesamte Strasse. Die Stadt Zürich sucht seit Jahren nach einer Lösung, zumal sich die Anwohner zunehmend unwohl fühlen. Denn die Prostituierten gingen ihrem Geschäft immer seltener in den Wohnwagen oder in den Wohnungen der Freier nach, immer mehr treiben es in den Vorgärten der Anwohner. Meyer hatte das von Steiner erfahren, der selber vor kurzem am Sihlquai eine Wohnung bezogen hatte. Ironischerweise lag genau am gegenüberliegenden Sihlufer der berühmt-berüchtigte Platzspitz am Zusammenfluss von Sihl und Limmat. Dieser wiederum war in den Siebziger- und Achtzigerjahre DER Treffpunkt für Drogensüchtige. Als sich dann diese Welle sich bis zum Shopville im Hauptbahnhof verbreitet hatte, wurde kurzer Prozess gemacht und mit der Schliessung für die Öffentlichkeit der Platzspitz 1992 drogenfrei gemacht, woraufhin der ganze Tross an den Bahnhof Letten an der seit der Hirschengrabentunnel-Eröffnung 1989 stillgelegten SBB-Strecke HB–Stadelhofen umzog, wo die ganze Krise wieder von vorne begann. Meyer erinnerte sich an die finale der Polizeiaktionen 1995, bei der sich die damalige Vorsteherin des städtischen Sozialdepartements, Emilie Lieberherr, vor die schwer bewaffneten Beamten gestellt hatte und der Polizei unmissverständlich weisgemacht hatte, dass diese Aktion sinnlos sei und die Drogensüchtigen in die Wohnquartiere treibe. Meyer, der diese Aktion in einer Nachrichtensendung des damaligen Fernsehens DRS verfolgt hatte, erinnerte sich wie er damals unweigerlich schmunzeln musste. Auf Lieberherr ging bis heute die kontrollierte Heroinabgabe zur Prävention zurück. Bei seiner Vereidigung als Kripochef 2000 war sie auch zugegen gewesen und hatte ihm einen Wunsch auf den Weg gegeben: Behandeln Sie alle gleich, Herr Meyer. An dieses Credo versuchte sich der Kommissar bis heute zu halten, auch wenn er sich bisher nicht mit Drogendramen wie anno dazumal auseinandersetzen musste. Denn bis vor wenigen Jahren jedenfalls war Ruhe eingekehrt – damals hatte sich wieder eine Szene in diesem Park vor dem Landesmuseum aufgebaut, jedoch viel kleiner als zuvor – und sie erhitzte auch nicht die Gemüter und löste schon gar nicht Grosseinsätze der Polizei aus.
Meyer überstieg die Polizeisperre aus Plastik und ging auf die kleine Menschengruppe, bestehend aus drei Männern, zu. Einer dieser Männer war Ramon. Er ging auf ihn zu und begrüsste ihn mit Handschlag. Steiner antwortete mit einem Niesen.
„Nette Begrüssung!“, bemerkte Meyer.
Steiner sah ihn entschuldigend an. „Nur ein Schnupfen. Ist ja schliesslich auch Winter!“
Der Kommissar grinste.
Meyer – mit 59 bald im Alter der Altersreduktion angelangt – soll in seinen letzten Dienstjahren die Kriminalfälle im Gebiet der Stadt Zürich und der nahen Umgebung gemeinsam mit Steiner lösen, damit dieser für die Zukunft ein stabiles Fundament als neuer Kriminalkommissar vorweisen kann. So wollte das Polizeipräsident Estermann mit tatkräftiger Unterstützung der Staatsanwältin Dr. Elisabeth Göhner. Der Mord an der Jugendlichen in Winterthur sollte sein letzter in anderen Gebieten des Kantons gewesen sein, trotz seiner Funktion als Kripochef. Nach anfänglichem Murren hatte Meyer zugesagt, nicht ohne sich jedoch eine gewaltige Gehaltserhöhung aufs Lohnkonto zuschreiben zu lassen – der Bonus für gelöste Fälle, wie er es zu pflegen nannte. Meyer höchstpersönlich hatte Steiner unter knapp sechzig Bewerbern als seine Nachfolge auserkoren.
„Gian, das sind Stadelmann und Hänzi von der Stapo. Haben mit mir die Polizeischule gemacht“, stellte Steiner die beiden anderen Uniformierten vor. Steiner war, genauso wie Meyer, in Zivil. Dicke Handschuhe, eine Wollmütze und ein grauer Baumwollschal schützten den Jungpolizisten vor der eisigen Kälte.
„Und das ist“, Steiners Schauspielkunst erreichte feierliche Höchstwerte, „der berühmte Zürcher Kriminalkommissar Gian Meyer!“
Doch Hänzi und Stadelmann schienen von der Koryphäe Meyer sichtlich unbeeindruckt.
„Ich hoffe, dass Sie mit den Fakten vertraut sind, welche wir Ihnen zukommen liessen, Herr Kommissar“, bemerkte Hänzi leicht säuerlich. Meyer erinnerte sich, dass sich der Beamte ebenfalls als neuer Kriminalbeamter beworben hatte. Nach Steiners Wahl ging in Zürcher Polizeikreisen das Gerücht um, Meyer hätte nur Steiners Akte gelesen und die anderen übergangen. Was nicht der Wahrheit entspricht, denn Meyer konnte sich jederzeit an jedes Detail jedes Bewerbenden erinnern. So auch daran, dass der Chefdozent der Polizeischule unter der Überschrift „Bemerkungen“ auf Hänzis Bewerbungsformular die Worte „Konsumiert gerne Internetpornografie über das iPhone während der Vorlesung“ hinzugefügt hatte. Von Steiner hatte Meyer erfahren, dass dieses Hobby aufgeflogen war, nachdem Hänzi versäumt hatte, die Lautsprecher seines Smartphones auszuschalten. Am Sihlquai verzichtete er jedoch auf eine Bemerkung in Bezug auf diese Angelegenheit.
„Ja, habe ich“, sagte er stattdessen. „Die Leiche wurde vom Vorgesetzten der Toten, Mario Calvaro, entdeckt, haben Sie im Bericht festgehalten“. Auf Gänsefüsschen mit den Fingern bei „Vorgesetzten“ verzichtete Meyer ebenfalls, obwohl er brennende Lust verspürt hatte.
„Ja“, antwortete Hänzi, der offenbar das Sprechen auch für Stadelmann übernommen hatte. Er wies auf den stämmigen Mann mit gegeltem Haar, welcher rund 10 Meter von den Beamten entfernt auf einer leeren Harasse sass, eine Zigarette rauchte und der Spurensicherung zusah, welche um den Wohnwagen herumschwirrten.
„Das ist…“
„Mario Calvaro, kennen wir“, unterbrach Meyer den (zu) übereifrigen Hänzi.
„Möchten Sie die Leiche sehen?“ Endlich hatte sich auch Stadelmann zu Wort gemeldet. Hänzi schwieg beleidigt.
Meyer nickte.
„Gerne“
Die Vierergruppe setzte sich langsam in Bewegung und gesellte sich zu den Beamten der Spurensicherung, welche in ihrem weissen Ganzkörperanzug gerade die Tür des Wohnwagens unter die Lupe genommen haben und das Schloss auf Kratz- oder sonstige Einbruchspuren untersuchten. Einer pinselte gerade schwarzes Pulver auf das Schloss und trat zur Seite.
„Was gefunden?“, wollte Hänzi wissen.
„Nein, noch nicht“, antwortete der Beamte und wandte sich wieder dem grossen Pinsel zu. Der Wohnwagen – der äusserlich wie ein Sanierungsfall aussah – stammte aus den Siebzigern und hatte die für damals typische Eierform. Die Räder der beiden Achsen wurden abmontiert, stattdessen stand das Vehikel auf zwei kräftigen Holzpfeilern, die an den ehemaligen Achsenstellen den Wohnwagen aufstützten. Zum Eingang führte eine rostige Eisentreppe. Meyer, Steiner, Hänzi und Stadelmann betraten den Wohnwagen durch die offene Tür. Das Innere des Wohnwagens war total umgebaut. Statt der kompletten Einrichtung mit Küche, Toilette und Wohnzimmer bestand der gesamte Raum aus einem grossen Bett. Die beiden kleinen quadratischen Fenster des Wohnwagens waren mit weinroten Vorhängen vollständig bedeckt, so dass das Tageslicht nur gedämpft in den Raum drang. An der Wand hingen zwei Bilder, eines zeigte eine rote Kutsche in einer grünen, vermutlich aus Weinreben bestehenden Landschaft, gezogen von zwei Schimmelpferden, das andere war eine billige Reproduktion von Van Goghs Gemälde über die gelbe Brücke im französischen Arles.
Links vom Bett ging eine Tür ab. Steiner öffnete sie und hielt danach unter Prusten die Nase zu. Beissender Gestank erfüllte den Raum. Eilig zog sich der Beamte Gummihandschuhe über.
„Diese Toilette stinkt zum Himmel!“
Das Innere der Toilette war extrem unhygienisch. Die Schüssel selbst war mit schmutzigbraunen Flecken versehen. Der letzte Benutzer hatte jedenfalls nicht heruntergespült, lange Kotwürste schwammen im Wasser. Ein angeekelter Steiner drückte mit dem Finger auf die Spüle, wich aber angeekelt zurück. Selbst dort hatte sich Schmutz angesiedelt. Eine Dusche oder eine Badewanne suchte man hier vergebens, dafür befand sich am Waschbecken eine Zahnbürste, aber keine Zahnpasta. Als Steiner versuchte, Wasser aus dem Hahn zu lassen, kam nur ein saugendes Geräusch. Daraufhin führte Steiner den Finger in den Hahn, und als er ihn wieder herauszog, war der Gummihandschuh mit Kalkbrocken übersät.
„Mein Gott, da ist Analfingering ja noch angenehmer!“, bemerkte er.
„He, Meyer! Sieh dir das mal an!“, rief er wenig später durch die halb offene Toilettentür.
Als Meyer nicht reagierte, rief er dessen Namen noch einmal.
Nachdem wieder keine Reaktion eingetreten war, ging Steiner aus der Toilette und schlug die Türe zu.
Meyer starrte hochkonzentriert auf das mit samtroten Kissen bedeckte Bett. Steiner erstarrte, als sein Blick demjenigen von Meyer folgte.
Die Tote war knapp bekleidet. Zu Lebzeiten war sie ein sehr schönes Mädchen gewesen. Ihre Gesichtszüge waren mit einer fast unnatürlichen Symmetrie gesegnet. Ihr hellbraunes Haar sowie die reine Haut auf den langen Beinen, dem flachen Bauch und dem schönen Gesicht schimmerten kupferfarben in der durch das Wohnwagenfenster eindringenden Sonne. Sie lag auf dem Bett, den Kopf zu den Beamten gedreht. Ihre Augen waren weit geöffnet. Auf dem Boden hatte sich eine Pfütze aus Blut gebildet, welche beinahe eingetrocknet war und mit dem Staub des Bodens hässliche dunkelrote, fast schwarze Klumpen bildete.
Unter ihrer rechten Brust war deutlich die Stichstelle des Messers zu sehen – der einzige Schandfleck an ihrem sonst so perfekten Körper. Unsanft wurden die Haut und das Fleisch abrupt auseinander gerissen. Doch was Meyer erstarren liess, waren zwei senkrechte Schnitte auf ihrer Stirn.
Kapitel 3
13. Dezember, 08:45
Emmanuel Menevoie hüpfte von einem Fuss auf den anderen als er vor der markanten Glaspyramide im Hof des Pariser Louvre wartete. Da die vom ehemaligen französischen Staatspräsidenten François Mitterand in Auftrag gegebene Pyramide den Eingang des Kunstmuseums markierte, huschten stets unzählige Touristen mit ihren Fotoapparaten an ihm vorbei, welche die horrenden Preise nur bezahlten, in der Hoffnung, einen Blick auf Kunstwerke wie die Mona Lisa oder die Venus von Milo erhaschen zu können. Menevoie ertappte sich immer wieder beim Versuch, den Kontaktmann in der Menschenmenge zu erkennen. Nervös starrte er im Zehnsekundentakt auf die Uhr. Um halb neun sollte er hier auf seinen Kontaktmann warten, doch der liess sich nicht blicken.
Erschrocken wich er einen Schritt zurück, als plötzlich sein Mobiltelefon zu klingeln begann.
Mit zittrigen Fingern holte er das Telefon aus der Hosentasche.
„Ja, bitte?“, meldete er sich.
„Emmanuel Menevoie?“, fragte eine unbekannte Stimme mit russischem Akzent.
„Ja?“, entgegnete Menevoie verblüfft.
„Haben Sie die Information?“, fügte er an.
„Wollen Sie sie?“
„Natürlich!“
„Ausgezeichnet! Gehen Sie bitte zur Place de la Concorde!“
„Aber…“
Der Anrufer am anderen Ende der Leitung legte auf. Menevoie zuckte mit den Schultern.
Sein Herz klopfte bis zum Hals, als er losging.
Hätte er nein gesagt, wäre er binnen wenigen Minuten tot gewesen.
Unter dem Arc de Triomphe du Carousel atmete er tief durch. Der aus rotem Stein erbaute Triumphbogen stand in einer Geraden mit seinem weitaus berühmteren Pendant auf der Place de l’Etoile und mit dem in den späten Achtzigerjahren erbauten Grand Arche im Büroviertel La Défense. Dann nahm er seinen gesamten Mut zusammen und schritt durch die Tuilerien. Trotz der frühen Uhrzeit und des winterlichen Wetters begegnete er doch einigen Spaziergängern. Der Winter hatte Nordfrankreich und insbesondere die Pariser Metropolregion Ile de la France fest im Griff. Am Flughafen Roissy-Charles de Gaulle müssen täglich knapp die Hälfte aller Flüge gestrichen werden, eine Besserung bis zu den Weihnachtsfeiertagen sei nicht in Sicht, heisst es in Mitteilungen der französischen Verkehrsbehören.
Auf der Place de la Concorde schaute er sich um, um hinter den Monumenten einen allfällig verdächtig aussehenden Mann zu erkennen. Vor sich startete die achtspurige Champs-Elysées ihren schnurgeraden Weg zur Place de l’Etoile, der Arc de Triomphe war im Schneetreiben gerade noch zu erkennen.
Menevoie war nervös und atmete hastig. Immer mehr bereute er seine Taten. Eigentlich war er im Sozialministerium Frankreichs engagiert, um sich vor allem für die Bevölkerung der Banlieues von Paris, Lyon und Marseille zu engagieren, hatte aber mit leichten Gesetzesverstössen sein doch eher spärliches Gehalt aufgebessert. Doch er konnte die Folgen nicht absehen: Immer tiefer war er in den Strudel des Pariser Bandenlebens geraten, bis seine Tätigkeiten von der Polizei aufgedeckt wurden und er seinen Job im Ministerium loswurde. Jetzt war er vollzeitlich als Vebrecher tätig und schleuste für ein russisches Firmenkonglomerat regelmässig illegal Personen und Waren ins Hexagon ein. Er war bei diesem Konzern auch offiziell angestellt und gilt deshalb nicht als arbeitslos.
Langsam wanderte Menevoies Blick über die Champs-Elysées, als er plötzlich den heissen Atem eines anderen Menschen im Nacken spürte. Panisch drehte er sich um. Hinter ihm stand ein Mann, fest in Winterjacke, Schal, Mütze und Handschuhe verhüllt. Die Gesichtspartie war kaum zu erkennen. Der Mann reichte ihm wortlos einen Briefumschlag.
„Was ist das?“, fragte Menevoie, als er nach dem Couvert griff.
Er bekam keine Antwort, stattdessen machte der Kontaktmann auf dem Absatz kehrt und verschwand in Richtung der Rue Royale, die in Richtung Norden führte.
Verloren fühlte sich Menevoie, als er mitten auf der Place de la Concorde stand und den Briefumschlag in seinen Händen drehte. Schliesslich riss der Geduldsfaden und er riss ihn mit blossen Händen auf. Langsam zog er ein gefaltetes Papier hervor und las stumm die aufgetragenen Zeilen.
Menevoie, heute um 18 Uhr am CDG, AF aus Kiew, 5 Stück
R
Der Franzose wusste sofort, was die Botschaft zu übermitteln versuchte. Heute um 18 Uhr würden am Charles de Gaulle in Roissy 5 junge aus Kiew eingeflogene Frauen mit der Air France landen, die dann von Menevoie als Zwischenhändler an Zuhälter in ganz Frankreich zu verkaufen seien. R. war der Kopf des Menschenhändlerrings, er war auch der Chef des Firmenkonglomerats, für das Menevoie tätig war. Sie waren sich noch nie begegnet, er wusste auch nicht R’s vollen Namen.
„Was ist das für eine Wunde auf der Stirn?“, fragte Meyer in Richtung der Spurensicherung, welche sich über das Mordopfer im Wohnwagen kniete.
„Eine Schnittwunde, welche allerdings nicht geblutet hat“, entgegnete einer der Spurensicherungsbeamten ohne zu Meyer aufzusehen. „Sie wurde dem Opfer vermutlich posthum zugefügt“.
„Sind Sie sich sicher?“
„Zu neunzig Prozent, ja. Aber wir werden die Leiche anschliessend an Dr. Furrer übergeben!“ Dr. Furrer ist der Chefpathologe des Forensischen Dienstes der Kantonspolizei Zürich, wie die Spurensicherung im Fachjargon heisst.
„Gut. Haben Sie Fingerabdrücke feststellen können?“
Der Beamte verneinte. Er fügte hinzu, dass die Tatwaffe nicht sichergestellt werden konnte und die Tote keine Papiere aufweisen konnte, weder bei sich, noch im Wohnwagen.
Meyer winkte Steiner nach draussen.
„Das bringt nichts“, knurrte er. „Lass uns den Calvaro unter die Lupe nehmen“
Die beiden gingen auf den Zuhälter zu. „Herr Calvaro?“
Calvaro drehte sich um. Sein Gesicht erhellte sich schlagartig.
„Commissario Meyer!“ Er sprach mit starkem italienischem Akzent. „Schön, Sie wieder zu sehen!“
„Können wir Ihnen ein paar Fragen stellen?“, fragte Steiner ruhig.
„Nur zu, Signore!“ Calvaro lachte und bleckte die vom Rauchen gelblich gefärbten Zähne.
„Sie haben die Tote also gefunden. Wann genau?“, wollte Meyer wissen.
„Als ich heute Morgen den Wohnwagen reinigen wollte, habe ich sie gefunden. Auf dem Bett!“
„Wie sah sie aus?“
„Tot! Sie haben Sie ja selbst gesehen, nicht?“
„Wie war der Name der Toten?“, erkundigte sich Steiner.
„Ich weiss es nicht.“
„Was?“, entfuhr es Meyer
„Sie war nicht meine Nutte.“
„Das erklären Sie mir jetzt aber mal, Calvaro!“
„Ganz klar. Sie hat nicht für mich gearbeitet!“
„Und was zum Henker macht sie dann in Ihrem Wohnwagen?“ Meyer musste auf die Zähne beissen, um nicht laut loszubrüllen.
Calvaro zuckte mit den Schultern.
„Haben Sie sie jemals zuvor gesehen?“, fragte Steiner. Er hatte Meyer zurückgedrängt und mit einer beschwichtigenden Geste zur Beruhigung aufgefordert.
„Nein, naja, doch.“
„Was heisst das jetzt?“, Steiners Stimme war sehr ruhig, was Meyer in Erstaunen versetzte.
„Sie wollte bei mir einen Job. Aber ich habe abgelehnt.“
„Wann war das?“
„Vor etwa zwei Wochen.“
„Wie war sie?“
„Ich habe sie nicht gevögelt!“ Calvaro grinste und bleckte abermals seine gelben Zähne. Meyer sah sich versucht, nach einem Postauto umzusehen, welche sich in Calvaros Zähne spiegelte.
„Ich meine, Ihr Auftreten!“, grummelte Steiner ungeduldig.
„Ich weiss, was Sie meinen“, grinste Calvaro, „ein kleiner Witz kann doch niemandem schaden, oder?“
„Doch“, sagte Meyer knapp.
„Wie Sie meinen“, seufzte der Zuhälter, „sie hat gebrochen Deutsch gesprochen, mit einem slawischen Akzent. So etwa: Sie haben Arbeit fur mich!“
Calvaro lachte schallend. Die Polizisten verzogen keine Miene.
‚Du redest ja akzentfrei Deutsch, du selbstherrliches Arschloch’, schoss es Meyer durch den Kopf.
„Gut. Sie haben Sie also abgelehnt. Wem gehörte dann der Wohnwagen?“, sagte er stattdessen, ohne die Miene zu verziehen.
„Na mir!“
„Du dummes Arschloch“, geriet Steiner in Rage, „welche Nutte hat sich darin in den Arsch ficken lassen?“
„Is’ ja gut. Maria Petrova. Aus Bulgarien. Sie ist aber gestern einfach abgehauen, ohne was zu sagen!“
Meyer biss sich auf die Lippen. Beinahe wäre ihm der Satz ‚ist ihr ja auch nicht zu verübeln’ ausgerutscht. Stattdessen beliess er es bei einem: „Haben Sie ein Foto von ihr?“
Calvaro wühlte in seiner Tasche und entnahm dieser ein Buch, welches er durchblätterte. Er öffnete eine Doppelseite, welche mit ‚MARIA PETROVA’ in krakeliger Handschrift beschriftet war und löste das Foto heraus. Er übergab es den beiden Polizisten, welche zum Dank knapp nickten.
„Kommst du mit rauf?“, fragte Steiner, als die beiden Ermittler vor dessen Haustür am Sihlquai just wenige Meter neben dem Tatort, standen.
„Besprechung, meinst du?“
Steiner nickte.
„Okay. Von mir aus!“, sagte Meyer und ging an Steiner vorbei zur Tür. Er klopfte sich den noch spärlich vorhandenen Schnee von den Schuhen.
„Nanana, nicht so eilig!“, grinste Steiner und drückte sich am Kripochef vorbei. Er fingerte den Schlüsselbund aus der Westerntasche und schloss die Tür auf.
Wenig später sassen sie in Steiners Küche. Durchs Fenster, das in Richtung Landesmuseum wies, konnte Meyer die immer noch arbeitenden Polizisten sehen. Plötzlich wurde ein dunkler Wagen durch die Absperrung gelassen. Bei näherem Hinsehen erkannte Meyer den Mann mit dem langen Spitzbart, der ausstieg: Es war Dr. Furrer, der Pathologe, der sofort Richtung Tatort eilte.
„Bin Laden, nicht?“, wollte Steiner wissen, der gerade vor der Kaffeemaschine stand und ebenfalls aus dem Fenster sah.
„Meinst du?“, Meyer sah seinen Kollegen zweifelnd an.
Steiner zuckte mit den Schultern.
Die Maschine hatte gerade unter lautem Getöse ihre Pflicht vollbracht und Steiner servierte Meyer die eine Tasse, die andere schob er zu seinem Stuhl, auf den er sich sogleich setzte.
„Gut machst du das. Hättest vielleicht besser Kellner als Polizist werden sollen!“, flachste Meyer.
Steiner schaute ihn entgeistert an, musste aber, als Meyer sich ein Lachen nicht verkeifen konnte, losprusten.
„Du und dein Schabernack!“, sagte er kopfschüttelnd.
„Mein lieber Ramon. Alles musst du ja auch nicht ernst nehmen?“ Meyer trank.
„Das sagt gerade der, der schon einen Puls von 200 bekommt, wenn der Drucker gerade wieder kein Papier hat?“, entgegnete Steiner und schaute Meyer forsch an. Der zog eine Grimasse.
„Spass beiseite, wir müssen arbeiten!“, sagte Meyer, als er sich geräuspert und den Stuhl zum Tisch gezogen hatte. Auf der Tischplatte hatte er Marias Foto und dasjenige der Toten gelegt.
„Definitiv nicht dieselben!“, sagte Steiner, nachdem er die beiden Bilder gemustert hatte.
„Sie sahen sich sehr ähnlich!“, nuschelte Meyer. „Vielleicht gibt es eine Verbindung?“
„Wie meinst du das?“
„Hör mal, Ramon! Die Tote wurde in Maria Petrovas, ich sags mal jetzt so, Stammwohnwagen tot aufgefunden und Maria ist weg!“
Steiner sah auf. „Wie? Du meinst, Maria ist weggelaufen und hat, um das zu vertuschen…“
„…eine Doppelgängerin engagiert! Genau!“ Meyer nickte heftig und nahm einen Schluck vom Kaffee. „Doch Calvaro ist ein Fuchs und hat’s natürlich rausgekriegt!“
„Maria hat wohl nicht daran gedacht, dass ihr Leberfleck“ Steiner wies auf den dunklen Fleck ob Marias Oberlippe, „ein so auffälliges Merkmal sei!“
Meyer seufzte. „Der Typ ist doch schlauer, als ich dachte!“
„Was machen wir jetzt?“
„Wir warten auf Dr. Furrers Ergebnisse, die treffen frühestens morgen früh ein. Dann können wir ja noch was über die Petrova herausfinden!“
„Wieso nicht jetzt?“
„Das hat keinen Sinn. Die ist eh über alle Berge! Da kommt’s auf einen Tag mehr oder weniger kaum drauf an!“ Der Kommissar schob die leere Tasse in die Tischmitte und stand auf.
„Wenn du meinst?“, jetzt war es Steiner, der zweifelte.
„Machen wir uns einen schönen Nachmittag!“, sagte Meyer fröhlich und klatschte laut in die Hände.
Kurz darauf standen Steiner und Meyer vor Steiners Privatwagen der Marke VW Tiguan, der vor dessen Haustür geparkt war.
„Soll ich dich beim HB vorne absetzen?“, fragte Steiner.
„W-Was? Spinnst du? Du willst mich von hier zum HB fahren?“, fragte Meyer irritiert. „Das ist gleich dort drüben. Man ist zu Fuss schneller!“
„Nein, nein!“, lachte Steiner. „Ich geh noch rüber zu Melinda!“
„Ach so!“
„Also, willst jetzt mitfahren?“
Meyer schüttelte den Kopf. „Danke, aber ich muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Für die Kinder.“
„Dann kannst ja trotzdem mitfahren. Das ist keine Ausrede.“
Steiner öffnete per Fernbedienung die Fahrertür seines Wagens und kletterte hinein,
„Nein, danke! Diese paar Meter kann ich trotz meines Alters noch gehen! Dann musst du auch nicht einen Umweg machen!“





























