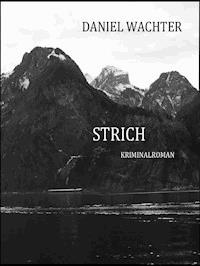Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissar Ehrat
- Sprache: Deutsch
Ein Münchner Playboy stürzt auf Mallorca vom Balkon. Offizielle Todesursache: Suizid. Doch ist das auch die Wahrheit? Wurden am Ende alle getäuscht? Der Münchner Kriminalkommissar Wolfgang Ehrat und der mallorquinische Polizeibeamte Francesc Bonet rollen den Fall neu auf. Derweil versucht sich der junge Journalist Patrick Schneider undercover im Drogenmilieu. Mit fatalen Folgen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Wachter
Getäuscht
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Getäuscht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Epilog
Über den Autor
Impressum neobooks
Getäuscht
Daniel Wachter
GETÄUSCHT
Kriminalroman
Prolog
August 2012
Ein heisser Sommertag brach an, mitten in der touristischen Hochsaison.
Keine Wolke war am Himmel zu sehen, als im Osten die Sonne aufging.
Die Gischt des Mittelmeers schäumte den Sandstrand auf, ein paar Einheimische waren da, teilweise plantschten Hunde in den Fluten.
Die Platja de Palma auf Mallorca war bis auf diese wenigen Ausnahmen jedoch menschenleer. Jedenfalls im Vergleich zu anderen Tages- oder eher Nachtzeiten. Nichts erinnerte an das bunte Treiben, welches bis früh in die Morgenstunden andauerte und ab dem Nachmittag wohl auch wieder über die knapp sechs Kilometer lange Strandpromenade vom Flughafen bis S’Arenal hereinbrechen würde.
Nur eine Reinigungsequipe arbeitete mit Hochdruck daran, die Spuren der Nacht in die Kanalisation zu treiben.
Der Ballermann – Inbegriff des Massentourismus.
Bierkönig, ParadiesBeach, MegaPark und Oberbayern – diese Namen bedeuteten Kult für manch jungen Menschen. Ein Fressen für Boulevardmedien und nachmittägliche Reportagen von privaten Fernsehsendern.
Grölen, Saufen, Prügeln, Flirten.
Endlich mal die Sau rauslassen.
Den Menschen werden, den man in der Heimat nicht zu sein traut. Über die Stränge schlagen, buchstäblich feiern, bis der Arzt kommt.
Umstrittene Shows in den Diskotheken. Freude hier, Kopfschütteln in der fernen Heimat.
Damit ist nicht Jürgen Drews samt Gefolge gemeint.
Drei solcher junger Menschen traten nach einer durchzechten Nacht, bereit zum Schlafen nun auf den Balkon ihres Hotelzimmers, die Oberkörper der Wärme und der Freiheit wegen frei. Hier darf man noch so durch die Strassen laufen, wie man von Gott erschaffen wurde.
Alle drei liessen sich auf die Plastikstühle fallen, zwei steckten sich sogleich eine Zigarette an.
Der Tag begann.
Aller dreier Schädel brummten vom Vorabend. Die Getränke waren auch einladend billig.
Plötzlich warfen sie einen Blick durch das Geländer auf das sich unter ihnen ausbreitende Vordach des Speisesaals.
Den dreien stockte der Atem.
Nichts mehr wird so sein, wie es bis anhin war.
Ein Mann, rund zehn Jahre älter als sie, lag in Rückenlage auf dem Vordach. Mann, hatte der wohl einen Rausch gehabt.
Keine Reaktion auf lautes Zurufen. Die Bauchdecke bewegte sich nicht.
Wahrlich kein gutes Zeichen.
Die Wirklichkeit flog an den dreien vorbei.
Schnell zogen sie sich eines der in den Lokalen bei genügend Getränken verschenkten Billig-T-Shirts über und rannten an die Rezeption. Dort ernteten sie zuerst ungläubige Blicke, dann wurde auch dem Personal der Ernst der Lage klar. Telefone auf alle Zimmer, ob jemand fehlte. Erste Verdächtigungen kamen auf, die aber wieder verstoben. Sirenen erklangen in der Ferne.
Tage später würde es in den Medien heissen, dass der Mann von Mitarbeitern gefunden wurde. Ehrlicher Schutz für die Urlauber.
Wenig später war klar – der Mann war tot.
Lebenserhaltende Massnahmen brachten nicht den gewünschten Erfolg.
Vermutlich ein Sturz vom Balkon.
Lange Zeit verging, bis er identifiziert wurde.
Die Policía National der Ajuntament de Palma de Mallorca nahm ihre Ermittlungen auf. Der Fall schien äusserst mysteriös. Gemäss Gerichtsmediziner erfolgte der Sturz vom Balkon mit unmittelbarer Todesfolge gegen drei Uhr in der Früh.
Die Leiche war nach der Identifikation ein Fressen für die bayrischen Boulevardmedien. Der Tote – ein stadtbekannter Playboy in München, berüchtigt für seine Partys, welche er im Sommer stets an den Ballermann verlegte.
Zuhause in Grünwald und in Manacor, war er ein gern gesehener Gast an Szenepartys im P1, aber auch auf Banketts des FC Bayern, liess sich alle Jahre auch nicht die Wies’n entgehen, ja war jeweils auf Einladung der CSU auch auf dem Nockherberg zugegen.
Kapitel 1
Januar 2013
Tja.
Ein neuer Tag war angebrochen.
Ich, immer noch schlaftrunken, fuhr mir durch das chaotisch abstehende Haar und liess mich am Küchentisch auf einen Stuhl fallen.
Wie hatte ich es nur bis hierhin geschafft. Am liebsten würde ich gleich wieder einschlafen.
Weniger als eine Minute war vergangen, als mich – wieder einmal – mein absolut nerviger Wecker mit seinem mindestens ebenso nervigen durchdringenden gleichmässigen Piepsen aus meinem Schlaf und aus meinen Träumen geholt hatte, um mir gleich die graue Realität auf dem Silbertablett zu präsentieren.
Ich, Vorname Patrick, Nachname Schneider, Alter 23, Dienstgrad unbekannt, pulte mir den Sand aus meinen Augen und starre auf die dampfende Tasse Tee vor meinen Augen. Ein Wunder, dass ich dies trotz meiner Müdigkeit vollbringen konnte. Manch einer würde mir jetzt zu einem Kaffee raten, doch ich verabscheute diese bittere Moccabrühe, die schmeckte, als hätte man einen zerstampften Karton in heissem Wasser aufgelöst. Sollte mir einer Kaffee auftischen, würde ich diesen aufs Geratewohl gegen die nächstgelegene Wand schmeissen und die servierende Person für immer mit Hass, Verachtung und bösen Blicken bedenken.
Tja, auch meine Eltern mussten diese Erfahrungen machen!
Wie konnte man das eigene Kind nicht kennen?
War halt die Quintessenz daraus, dass man nur auf seinen Beruf und das Ansehen in der Gesellschaft fixiert war. Für meine Eltern war es wichtiger, den teuersten Esstisch im ganzen Quartier zu haben, statt sich um ihren Sohn zu kümmern.
Ich sollte sie mal wieder anrufen.
Oder auch nicht.
Ich hatte bestimmt ihre Telefonnummer vergessen.
Da fragte sich noch einer, wieso ich ein solcher Zyniker geworden bin.
„Verdammt! Die Zeitungen!”, murmelte ich zu mir selbst und stand auf, um zum Briefkasten zu geben.
Dummerweise hatte mein Hintern jetzt entschieden, zu jucken, was ich unbedingt mit einem Kratzen quittieren musste. Zu viele Informationen? Korrekt.
Immer noch schlaftrunken versuchte ich, meinen Briefkastenschlüssel in das zugehörige Schloss zu stecken. Da ich eine Erdgeschosswohnung besass und somit die Briefkasten gleich gegenüber hatte, machte es mir nichts aus, meine Post schnell nur in Boxershorts zu holen. Sah mich ja eh keiner.
„Guten Morgen Patrick!”
Bis heute.
Ich schaute auf. Vor mir stand Angelika, die Bewohnerin des oberen Stockwerks, die Schönheit in Person. Lange blonde Haare und eine angemessene Figur samt einer Oberweite, die keinen Mann enttäuschte. Ihr perfektes Lächeln entblösste eine weisse Zahnreihe, welche es in ihrem Glanz ohne Probleme mit der Milchstrasse aufnehmen kann.
Zudem war auch ihr Wesen nicht von schlechten Eltern – kurzum, sie war ein Engel und nicht selten auch eine meiner Masturbationsfantasien.
Der einzige Makel, der ja bekanntlich den Rest noch schöner wirken liess, war ihr altmodischer Vorname, ihren Nachnamen hatte ich bereits wieder vergessen oder sie hatte ihn mir nie gesagt, kann auch sein, ich wusste es nicht.
Mist.
Hätte ich doch nur eine Jeans übergezogen.
Natürliche Reaktionen halt.
Hoffentlich sah sie es nicht.
„Morgen!”, nuschelte ich, grub die Zeitungen aus meinen Briefkasten, schloss ihn ab und verschwand schleunigst in meiner Wohnung.
Verdammt wie peinlich!
Ein Ständer am Morgen sorgt für Kummer und Sorgen!
Haha, der war gut!
Nicht lustig, aber zutreffend!
Wahrscheinlich hatte sie es eh nicht wahrgenommen, tat sie ja auch beim Gesamtpaket nicht.
Trotzdem hatte sie meinen Namen gewusst.
Mochte sie mich also doch?
Eh nicht.
Wahrscheinlich würde sie sich gleich mit ihrer besten Freundin zum Kaffeeklatsch treffen sich mit ihr wahrscheinlich den gesamten Tag auf meine Kosten amüsieren, in dem die beiden über die Standhaftigkeit des kleinen Patrick lachten.
Kapitel 2
Wütend schmiss ich die Zeitungen auf den Tisch und entschied mich für die Süddeutsche. Niveau am Morgen muss auch sein.
Auf der Frontseite war irgend so ein Bericht eines Professorchens, welcher sich der Frage nach dem Ich und dem Sinn des Lebens angenommen hat und nun dort irgendwelche angeblich bahnbrechende Ergebnisse erzielt hatte.
Nun gut.
Wer war ich?
Meinen Namen – den weiss ich noch.
Glück gehabt!
Eigentlich war ich Schweizer, stammte aus einem Kaff, dass nicht mehr als ein Fliegenschiss auf der Landkarte war. Den Namen erwähnte ich dem geneigten Leser mal nicht, ich bin sicher, drei Zeilen später hätte er ihn längst wieder vergessen.
Leider lebte ich dort nur kurz. Meine Eltern liessen sich noch vor meiner Geburt scheiden und meine Mutter fand bald einen Ersatz, den sie jedoch nicht heiratete. Mein Stiefvater in spe war Polizist und wurde kurz nach meiner Geburt zu Interpol nach Lyon abberufen, was bedeutete, dass ich meine Kindheit und die ersten Jahre meiner Jugend in Frankreich verbracht hatte. Scheusslich. Vor allem diese Sprache! Immerhin war ich in einem besseren Viertel aufgewachsen, als die armen Jungs in der Banlieue. Meine Mutter heiratete dann in Lyon ihren Polizisten, doch ich behielt den Namen meines Vaters. Der Kontakt zu diesem war schon seit Jahren abgebrochen, wahrscheinlich auch auf Initiative meiner Mutter. Deshalb wollte ich noch eine Erinnerung an ihn.
Ich wurde auf eine angemessene Schule geschickt, doch hatte ich an diesem ewigen Gelaber keinen Spass und mogelte mich mehr oder weniger durch. Erst an der Journalistenschule erkannte ich bei mir Freude am Lernen. Anfangs war ich über diesen Sinneswandel noch ganz erschrocken, danach wurde mir aber bewusst, dass es damit zu tun hat, dass ich endlich mal was zu tun habe, deren Tätigkeit ich mich erfreuen kann.
Als ich 16 war, entschied sich mein Steifvater dann, einen Posten bei der Münchner Kriminalpolizei anzutreten. Wieder ein Kulturschock. Vom Coq au vin nun zu Weisswurscht mit Brez’n.
Nicht schlecht, denn immerhin musste ich nicht den ganzen Tag in Lederhosen rumhopsen, wie das bajuwarische Klischee wohl besagt. Später entdeckte ich dann auch das köstliche bayrische Weissbier für mich.
Zudem konnte ich jetzt wieder Deutsch sprechen, vor allem seit ich diesen Schweizer Akzent mehr oder weniger abgelegt hatte. Immerhin sprach ich kein Emil-Hochdeutsch mehr, sondern so vielmehr eines, was mich irgendwie in der Region südlich des Limes ansiedeln liess, was ja auch der nackten Wahrheit entsprach. Auch wenn mein Schnabel noch südlich des Hochrheins, aber nördlicher des Gotthardmassivs gewachsen war.
Seit sieben Jahren also lebte ich in München, seit zwei Jahren in einer eigenen Wohnung in einer Retortensiedlung namens Arabellapark, dem Stadtbezirk Bogenhausen zugehörig. Meine Brötchen verdiente ich als Journalist bei einer lokalen Zeitung, die eher ein Käseblatt war. Darum auch die Süddeutsche am Morgen – immerhin meine Traumdestination, für die ich mich immer zu empfehlen versuchte.
Gesättigt von tagesaktuellen Informationen kletterte ich unter die Dusche.
Als ich das Wasser laufen liess, fiel mir dann der Brief des Hausmeisters wieder ein, welcher besagte, dass am heutigen Tage der Boiler wegen irgendwelchen angeblich notwendigen Wartungsarbeiten abgeschaltet war.
Bibber!
Das kalte Wasser startete einen Versuch, meine Lebensgeister zu erwecken.
Es blieb beim Versuch. Ein jämmerlicher Versuch.
Auch als ich in meine Kleider geschlüpft war, sah ich kaum durch meine Augenlider hindurch.
Gähnend holte ich meine Jacke vom Haken und schloss die Tür. Draussen war es kalt, typische Dezemberluft.
Nach drei Tagen Schnee schien immerhin die Sonne. Ich setzte mir meine Sonnenbrille auf und machte mich auf den Weg zur nahegelegenen U-Bahn-Station. Ein Auto besass ich keines; der Sinn, in einer Grossstadt wie München im eigenen Wagen zu sitzen, erschloss sich mir nicht.
Nachdem ich mich durch den Menschenstrom gequält hatte, trat ich auf den Bahnsteig, der bereits proppenvoll von Pendlern war, welche in etwa dieselbe Lebensenergie ausstrahlten wie ich. Wenn man diese Energie nutzen könnte, wäre vielleicht die Versorgung eines jämmerlichen einsturzgefährdeten Strebergartenhäuschens oder dessen Überresten zu gewährleisten.
Mit einem lauten Grummeln signalisierte mein Zug sein Ankommen, wenig später erblickte ich im Tunnel die Frontlichter der Bahn, ehe sie dann mit einem lauten Tosen in den Bahnhof einfuhr und mit quietschenden Bremsen hielt.
U4 forever! Was mache ich nur ohne dich?
Ich quetschte mich in die bereits volle U-Bahn. Wie durch ein Wunder hatte der gesamte Bahnsteig Platz in dieser Kiste erhalten, wenn auch mit der Konsequenz, dass sie jetzt die Steigerungsform einer Sardinenbüchse ist.
Dummerweise hatte mein Nachbar wohl heute bei seiner Katzenwäsche sein Deodorant vergessen, und seine Achselhöhe befand sich ebenso dummerweise auf meiner Nasenhöhe. Meine Schleimhäute lösen sich bei dem Geruch ja freiwillig auf. Das Gute daran: In nächster Zeit werde ich wohl keinen Schnupfen haben, diesem Stinktier sei Dank!
Am Stachus stieg oder besser zwängte ich mich aus der U-Bahn und liess mich mit einer der Rolltreppen ans Tageslicht befördern.
Gierig streckte ich meine Arme nach den Sonnenstrahlen aus, woraufhin ich verwirrte Blicke von Passanten erntete.
Freudloses Volk!
Kapitel 3
Die Redaktion befand sich in einer Querstrasse der Neuhauser Strasse, welche um diese Uhrzeit glücklicherweise noch ausgestorben war. Den Feierabend musste man sich täglich nicht durch die Arbeit verdienen, sondern durch den Spiessrutenlauf durch all diese taschenbepackten Mademoiselles in ihren hochhackigen Schuhen, wo sich bereits bei deren Anblick Blasen an meinen Füssen bildeten.
Ich betrat das Gebäude, nur um dann festzustellen, dass der Aufzug defekt war. Fünf Stockwerke zu Fuss! Der Tag war ja bereits jetzt im Eimer!
Ein Ständer beim Anblick Angelikas.
Eine proppenvolle U-Bahn
Mein stinkender Mitreisender
Defekter Aufzug in der Redaktion
Was denn noch?
Fehlte nur noch, dass die Speisekarte der Kantine heute Innereien ankündigt.
Was ein Scherz sein sollte, entpuppte sich fünf atemlose Stockwerke später als bittere Wahrheit. Der Fresszettel am Anschlagbrett versicherte mir, dass ich nicht träume.
Hat sich die ganze Welt gegen mich verschworen?
Missmutig stiess ich die breite Glastür auf, um mich dann im Empfangsgebäude wiederzufinden.
„Guten Morgen Patrick!”, strahlte mir die Sekretärin entgegen.
Ja, sie hat sich gegen mich verschworen.
Die gute Dame war 24 und stand offensichtlich auf mich.
So weit so gut.
Nur war sie etwa 170 Zentimeter gross und gefühlte 200 Kilogramm schwer. Zudem schien sie anscheinend nur jeden zweiten Zahn zu besitzen. Ihre Haarfarbe wechselte im wöchentlichen Rhythmus. Heute war giftgrün angesagt. Steht ihr irgendwie...nicht! Was stand ihr überhaupt? Am ehesten noch eine Glatze.
Als Krönchen ihrer Erscheinung besass sie noch eine Brille, welche wohl stärker war als ein Präzisionsfernglas bei der Bundeswehr.
Die gute Dame war halb blind. Wahrscheinlich wäre sie gerne total blind, vor allem in den Momenten, in denen sie sich im Spiegel anblicken muss.
Ich nuschelte ihr ein genervtes „Morgen!” entgegen und suchte dann meinen Arbeitsplatz. In diesem Labyrinth von Grossraumbüro einfacher gesagt als getan.
Als ich meinen Schreibtisch der Erlösung endlich gefunden hatte und diese schäbige Kiste namens Computer hochfuhr, schob sich plötzlich ein breiter Bauch vor mein Gesichtsfeld.
Ich blickte hoch.
Vor mir stand mein Chef, das perfekte Yang zur Sekretärin. Gefühlte drei Meter gross, gewogene 150 Kilogramm, puterrotes Gesicht ähnlich dem eines Schweins, schwitzend, und einen zerzausten Schnurrbart.
Eine einflussreiche Gestalt mit Gewicht – im wahrsten Sinne des Wortes.
Haha, Wortwitz!
Patrick, du solltest Kabarettist werden.
Mein Chef, Franz Ebermann war sein Name – passend zum Gesicht – hatte das Aussehen eines Ottfried Fischer gemischt mit den rhetorischen Fähigkeiten eines Edmund Stoiber. Trotzdem war er ein hohes Tier in der Münchner Verlagsszene, weil er unser Blatt in kürzester Zeit so umstrukturierte, dass man gar die Auflage steigern konnte. Dass damit die Abnahme der Qualität der Artikel verbunden war, schien ihn im geringsten nicht zu interessieren. Ebenso, dass ihm seine Kollegen von seriöseren Medien keinen Respekt entgegenbrachten.
Für ihn zählte nur seine Meinung, denn selbstverständlich tut nur er das Richtige!
Die halbe Redaktion rauszuschmeissen war für ihn der beste Entscheid. Oder eher für sein Portemonnaie. Der Ertrag blieb derselbe, dafür konnte der Aufwand verringert werden.
„Schneider!” Trotz des Aussehens hatte er nichts von einem knuddeligen Erzählopa. Seine Stimme war etwa so weich wie ein frisch geschliffenes Messer.
Ohne eine Antwort zu geben, schaute ich ihn an.
„Ich habe einen Auftrag für Sie!”
Er schmetterte eine fleckige alte braune Aktenmappe auf meinen Schreibtisch, machte wortlos auf dem Absatz kehrt und verschwand aus meinem Blickfeld.
Neugierig nahm ich die Mappe unter die Lupe.
Auf der ersten Seite war in Computerschrift meine Anweisung abgetippt. Auf der Redaktion war es Usus, das Ebermann einem den Wisch auf den Tisch donnerte, ohne ein Wort zu sagen, und der Auftrag stattdessen schriftlich formuliert war.
Bei der Erfüllung war man auf sich alleine gestellt. Schutzschilder in Form von Vorgesetzten suchte man bei unserer Zeitung vergeblich.
Ich musste die Zeilen mehrmals lesen, um zu verstehen, was meine Aufgabe war.
Ich sollte einem Drogenring beitreten, um danach undercover eine Reportage für meine Zeitung abliefern zu können.
Ich schüttelte den Kopf.
Das konnte doch nicht wahr sein.
Das durfte doch nicht wahr sein!
Kapitel 4
Zuhause angekommen, stellte ich mich unter die Dusche, um meine Gedanken zu sortieren. Ebermanns Auftrag hatte diese vollends in Beschlag genommen. Wie sollte ich nur den Weg in diese Drogenszene finden?
Ein grosses Laster hatte ich in dieser Hinsicht, nur war meine Droge legal:
Der Alkohol.
Ich war das Paradebeispiel, wie man durch Alkohol zum Arschloch wird. Ich wusste es, wollte mich ändern, aber konnte es nicht.
Meine Selbstzweifel schlugen dann stets in Arroganz um.
Ich schämte mich jede Woche für mein Verhalten, gelobte mir Besserung, doch ändern konnte – oder vielleicht doch wollte? – ich nichts.
War ich auch nüchtern ein solches Riesenarschloch?
Oder nur ein gottverdammter Zyniker?
Ich wusste es nicht.
Die wichtigste Frage: Wie stellte ich Ebermann mit meinem Auftrag zufrieden?
Wie komme ich nach dem Ende wieder aus dem Drogensumpf raus?
Würde ich selbst zum Junkie?
Den ganzen restlichen Tag hatte ich mit ersten Recherchen über die Münchner Drogenszene verbracht. Bei der Polizei biss ich auf Granit, diese Pfostenköpfe wollten mir selbstverständlich keine Informationen weiterreichen, da ich ja nur für Sensationsjournalismus stände und ihre Arbeit nur behindern würde. Tief in meinem Innern musste ich ihnen trotz allem Geschimpfe Recht geben, mein Arbeitgeber war wohl der falsche Partner, um die Polizei- und Sozialarbeit in der Öffentlichkeit positiv darstellen zu lassen. Wer las denn unser Papier? Wahrscheinlich nur die Arbeitslosen, welche mit ihrem 99-Cent-Bier den ganzen Tag auf Brunnenmauern hockten und über alles schimpften.
Ich fragte mich, wozu Ebermann überhaupt einen solchen Artikel in der Zeitung haben will? München sei ja schliesslich die sicherste Grossstadt Europas, solche Texte würden die Leser nur verunsichern.
Mir war es egal.
Erste Ergebnisse konnte ich bereits erzielen, Schwerpunkte in der Innenstadt wären der Hauptbahnhof und das Sendlinger Tor. Die Stadt hatte bereits irgendwelche Sozialarbeiter dorthin geschickt, um die Obdachlosen vom Sumpf loszueisen. Ich wünschte mal gutes Gelingen!
Ich wollte mich morgen mal am Hauptbahnhof umsehen und dann über mein weiteres Vergehen nachdenken.
Ich bekam eine Woche Zeit, den Artikel zu schreiben. Eine gottverdammte Woche im Sumpf.
Entschied ich mich für einen Rückzieher, würde mir Ebermann gewiss nicht den Arsch versohlen!
Nein, er würde mir eine Kartonschachtel an den Kopf werfen und mich feuern!
Schon mehrere Male gesehen oder gehört, die Schreie dringen jeweils durchs ganze Gebäude.
Er verlangte, dass wir unser Leben für seine Auflage riskieren und rastete aus, wenn wir Angst um uns haben.
Das nächste Mal sollte er meines Erachtens selbst an die Front.
Mit den gedanklichen Ermordungen meines Chefs schaltete ich das Wasser ab, schob den Duschvorhang zur Seite und griff nach meinem Handtuch.
Wieso machte ich das überhaupt?
Was wollte ich?
Frau und Kinder.
Woher kriegte ich sie?
Angelika?
Sie würde ich auf der Stelle heiraten.
Sie mich auch?
Wohl kaum.
Was mache ich bloss?
Fragen und Antworten auf diese Fragen und wieder neue Fragen und wieder deren Antworten schwirrten in meinem Kopf herum. Die Dusche hatte ihren Zweck kräftig verfehlt.
Wütend schlüpfte ich in meine Kleider und hastete, nachdem mein beschissener Magen geknurrt hatte, zielstrebig in die Küche, öffnete den Kühlschrank und – fluchte wie ein Rohrspatz.
Er war leer. Leer bis auf eine uralte schrumpelige Möhre, welche ich gleich aus dem Fenster schmiss. Scheiss auf den Pechvogel, der unten auf der Strasse von ihr bombardiert wurde. Schlechten Tag erwischt? Geht mir übrigens an meinem fetten Elefantenarsch vorbei!
Ich hatte doch glatt das Einkaufen vergessen! Wütend trat ich gegen die Kühlschranktür, nur um danach noch wütender werden, denn mein rechter Fuss tat höllisch weh. Wieso musste diese Scheiss-Kücheneinrichtung auch aus Metall sein?
„Der Tag wird wahrlich immer besser!”, schimpfte ich. Was würde noch folgen?
Ein Ständer am Morgen.
Sardinenbüchsenartiges Gequetsche in der U-Bahn.
Das Stinktier ohne Deo.
Der Aufzug in der Redaktion hatte seinen Geist aufgegeben.
Dessen Mechaniker machten auf Streik
Innereien in der Kantine.
Der Kantinenchef hatte eine akute Erkältung, die Hälfte seines Rotzes landete sicherlich im Essen.
Die „gute” Laune meines Chefs.
Eine Woche im Drogensumpf – hoffentlich darf ich mal high werden?
Ein leerer Kühlschrank!
Verdammt! ich muss zu Aldi!
Kapitel 5
Wütend nahm ich meine Jacke vom Haken, knallte die Tür lautstark zu, so dass es auch der schwerhörigste meiner Nachbarn mitbekommen hatte. Wenn ich Glück hatte, statteten mir die Bullen einen Besuch wegen Ruhestörung ab!
Zum Glück hatte ich Strohrum im Hause, dann würden die abgefüllt und kämen hoffentlich in eine Kontrolle ihrer Kollegen.
Über diesen Gedankengang grinsend betrat ich die Aldi-Filiale nebenan. Der einzige Vorteil dieser Kaninchenfarm ist, dass sie sich unmittelbar neben meiner Wohnung befand und auch lange geöffnet hatte, sollte ich nach einer durchzechten Nacht noch Hunger bekommen, wären die Spaghetti oder das Schnitzel nicht mehr weit.
Auch wenn ich die Spaghetti in nüchternem Zustand wohl kaum verspeisen würde und im Schnitzel garantiert alles andere drin war – ausser Fleisch.
Am Eingang warf ich einen missbilligenden Blick ich auf das Werbeplakat, wo irgendwelche Computer für 99 Euro verkauft werden – wahrscheinlich hatte Ebermann mal bei so einem Angebot zugegriffen, seine Kisten sind wahrlich für nichts zu gebrauchen. Textverarbeitung und Internetbrowser offen, schon ist der Arbeitsspeicher überlastet.
Ich ging durch die Regale oder besser gesagt, durch die auf den Paletten aufgestapelten Türme von Artikeln. Egal ob Toilettenpapier oder die gefühlte eintausend Kilometer lange Tierfutterallee, alles wurde aufgetürmt, man mag sich in den tiefen Strassenschluchten Manhattans fühlen.
Das Streben nach Höherem macht auch vor Aldi nicht halt.
Das nervigste im Laden waren allerdings diese Hausfrauen, welche möglichst billig einkaufen wollen, dafür aber alles in der Tiefgarage in ihren Porsche Cayenne würgen – Hauptsache, der fahrbare Untersatz hat Stil.
Wie dumm und einfältig unsere Gesellschaft geworden ist.
Ich schnappte mir eine Packung Nudeln und eine undefinierte Sauce, deren Bild auf der Etikette sich mit grosser Wahrscheinlichkeit heftig vom Inhalt unterscheiden wird. Erinnert mich irgendwie an Mc Donald’s, dort schauen die Burger im Karton auch nie aus wie auf den Plakaten.
Nach dem Bezahlen hastete ich wieder in meine Wohnung. Draussen hatte die Dämmerung eingesetzt, der Feierabendverkehr quälte sich in Richtung Leuchtenbergring. Einige arbeiteten im Arabellapark, andere wie ich wohnten dort. Aber solche, welche hier wohnten und ihre Brötchen verdienten, sucht man vergebens. Lieber tagtäglich in einer Blechlawine die Luft verpesten oder in der U-Bahn den Weltrekord aufzustellen, möglichst viele Menschen in einen Waggon zu quetschen.
In meinem bescheidenen Heime angekommen schmiss ich meine Schuhe in die Ecke und machte mich sogleich auf in die Küche. Die Polizei war nicht da und hat auch keinen Zettel hinterlassen, da hatte wohl der Herr Nachbar das Hörgerät abgeschaltet.
Mir kann’s nur recht sein.
Mein Magen hatte sich nun einige Male gemeldet und mir weisgemacht, dass er Inhalt bräuchte.
Gesagt, getan.
Wasser für die Nudeln aufgesetzt? Abhaken.
Und jetzt heisst es warten.
Ich setzte mich an den Küchentisch und schweifte über die Seiten des Spiegels, den ich auf dem Nachhauseweg noch im Kiosk am Stachus gekauft habe. Wie immer wird über irgendwelche politischen Angelegenheiten diskutiert. Immerhin was niveauvolles, während ich eine solch abgehalfterte Reportage über Drogenabhängige liefern muss, die ohnehin niemand liest, weil ich sie im Stil einer Seifenopfer schreiben muss. So etwa: Kind (8) wächst mit Kokain statt Puderzucker auf, Mutter (13) obdachlos. Die Bilder auf Seite 9-99. Fast schon so, wie das Seite 1-Girl der Bild, wenn es 200 Kilogramm schwer wäre.
So ein Witz.
Ich unterdrückte ein Gähnen, die Müdigkeit holte mich ein.
Ich schrak erst hoch, als ich das laute Sieden meines Wassertopfs hörte. War ich jetzt echt eingepennt?
Schnell senkte ich die Temperatur meines Kochherds und warf die Nudeln in den Topf. Jetzt dürfen sie noch ein wenig vor sich hin köcheln.
Immer bedacht, nicht wieder einzunicken, konzentrierte ich mich wieder auf das Magazin vor mir. Doch die Buchstaben flitzten irgendwie an mir vorbei, zu gross war der Bammel auf das Ungewisse, auf das, was mich erwartet.
Ich habe mir vorgenommen, morgen mal zum Hauptbahnhof zu fahren, und sich dort umzusehen. Obdachlose scheint es in der Haupthalle und bei den Zugängen zur U- und S-Bahn genügend zu haben.
Anschliessend sollte ich mir wohl eine neue Identität suchen, irgend eine Lügengeschichte über meine nicht vorhandene Kindheit auftischen – wobei, würde es einen Unterschied ausmachen, wenn ich nicht lügen würde?
Keine Ahnung.
Wer würde mir eine neue Frisur verpassen? So giftgrüne, weit abstehende Strähnen, eine Frisur wie Johnny Rotten besass?
Auf Stahlstifte, die mein Gesicht entstellen, verzichtete ich. Man wollte ja noch schliesslich attraktiv auf die Frauenwelt wirken.
Meine Gedanken trieften wieder mal voller Ironie.
Ich? Attraktiv?
Eher würde ein stinkender Misthaufen als sexy bezeichnet als der Milchbubi in Person - meine bescheidene Wenigkeit.
Ich wusste, dass Angelika Friseuse war, doch hatte ich den Mut, sie zu fragen?
Noch eine Nacht darüber schlafen.
Endlich waren die Nudeln fertig. Ich gab die Sauce bei, rührte alles ordentlich durcheinander, kümmerte mich einen Scheissdreck um die herumspritzenden Tropfen, lud die gesamte Riesenportion auf den bereitgestellten Teller und machte mich mit Heisshunger über die Teigwaren her.
Sollte ich Angelika fragen?
Wie würde sie reagieren?
Es ist ja kein Date, sondern nur die Frage, ob sie mir eine neue Frisur verpassen soll.
Diese Gedanken beschäftigten mich auch spätabends, als ich mich in meiner Decke wälzte.
Kapitel 6
Wie geplant, machte ich mich am nächsten Morgen auf den Weg zum Hauptbahnhof. Ebermann hatte mir verboten, während der Bearbeitungszeit des Artikels, auch nur einmal die Redaktion zu betreten. Er wolle nicht, dass Rückschlüsse gezogen werden.
Da ich zwei Stunden später als normal aus dem Haus gegangen war, hielt sich auch das Benutzeraufkommen der U-Bahn in Grenzen. Ich erhaschte zwar keinen Sitzplatz, erlebte aber auch nicht die Konfrontation mit einer ungepflegten Achselhöhle. Sage mir einer den Zweck, warum der Mensch dort stinkt.
Einen Plan habe ich mir bereits zurechtgelegt. Zunächst würde ich mich mal am Hauptbahnhof umsehen, anschliessend hatte ich einen Termin bei der Stadt vereinbart, um mich über die Arbeit dieser Streetworker zu informieren. Zuständig für die Angelegenheit war das Kreisverwaltungsreferat an der Rupperstrasse.
Am Nachmittag wollte ich mal bei Angelika vorbeischauen, vielleicht kann sie mir als Gegenleistung zu einem Kaffee eine neue Frisur verpassen.
Aber das ist ja noch weit weg.
Am Hauptbahnhof entstieg ich der U-Bahn und hielt mich an den Wänden dieser Verbindungstunnels. Überall sassen Bettler am Boden und hielten ihre selbstgebastelten Pappschilder hoch. Die Leier war immer dieselbe, entweder ist das Kind todkrank, man war im Krieg geschädigt oder die Frau hat ihn sitzen gelassen. Wem diese Schicksale widerfahren sind, gebührt ehrliches Mitleid, doch wer dies erfindet, nur um Geld zu holen, der sollte Schande über sich ergehen lassen.
Dummerweise lassen sich die Unterschiede nicht auf den ersten Blick erkennen. Da man als Passant wohl kaum auf die Drogengeschäfte aufmerksam wird, muss ich doch wohl oder übel als verdeckter Journalist in die Szene eintauchen.
In der Haupthalle dasselbe Bild. Abseits der hastenden Menge, begleitet vom Duft der zahlreichen Frittenbuden und dem Klang der Lautsprecherdurchsagen, wieder dasselbe Bild wie in der unteren Ebene.
Wollte ich hier einen Dealer ausmachen, hätte ich eher Polizist samt dieser Flughafenzoll-Gesichtsmerkmalerkennungsdingsbums-Ausbildung machen müssen. Da nützt mir mein tägliches Fingermalträtieren auf der Computertastatur einen feuchten Kehricht, um es mal abweichend von meinen Gewohnheiten nicht in primitiver und ebenso vulgärer Fäkaliensprache auszudrücken.
„Haste mal ’nen Euro, Bro?”, sprach mich einer der Obdachlosen an.
Ich überlegte mir, zunächst nein zu sagen, entschied mich dann angesichts eines möglichen Wiedererkennens während der Ausübung der mir von Ebermann übertragenen Tätigkeit um und drückte ihm die Münze in die mit löchrigen Handschuhen überzogenen Hände.
Das Gespräch beim KVR brachte mir kaum neue Erkenntnisse. Die nette Dame erzählte mir von den Streetworkern, welche mit diversen Projekten versuchten, einerseits den Drogensüchtigen einen Silberstreifen am Horizont zu ermöglichen, andererseits aber auch die Plätze von ihnen zu säubern.
Nach dreissig Sekunden ihrer in monotoner piepsiger Stimmlage gehaltenen Ausführung hörte ich nur noch mit halbem Ohr hin.