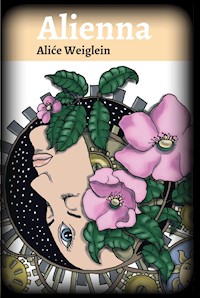4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Obscuritas
- Sprache: Deutsch
Nathalie entflieht ihrer dem Untergang geweihten Welt und gelangt in eine Welt voller Magie. Doch auch hier findet sie keinen Frieden: Die ewige Nacht droht von allem und jedem Besitz zu ergreifen. Das Ende der Zeit ist nahe. Immer tiefer wird Nathalie in den Konflikt dieser Welt hineingezogen, aber ihr wird bald klar, dass sie nicht für beide Welten kämpfen kann. Je länger sie bleibt, desto schwieriger wird es für sie zu entkommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Aliće Weiglein
Sturm ohne Wind
Obscuritas I
© 2019 Aliće Weiglein
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7497-8561-2
Hardcover:
978-3-7497-8562-9
e-Book:
978-3-7497-8563-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Prolog
Wir schreiben den 17. März 2097.
Meine geliebte Tochter, wenn Ihr diese Nachricht lest, werde ich längst tot sein. Ich hatte lange gehofft, die Gefahr betreffe mich nicht, doch nun muss ich mir eingestehen, dass diese Annahme ein Irrtum war, wie er größer nicht hätte sein können. Nie waren sie je so kurz davor es zu bekommen, nein! alles zu bekommen. Wenn auch noch dieses eine an sie fällt… noch können sie es nicht wissen – und doch, es ist ein Gegenstand von großem Wert.
Ach, wenn ich mir doch wenigstens sicher sein könnte, dass es eine Zukunft geben wird, sei es auch eine Schlechte! Ich weiß keine Antworten mehr und ich weiß keine letzte Frage mehr zu stellen. Eine grausame Leere schlägt in meiner Brust anstelle eines fühlenden Herzens. Wie kann ich mich unschuldig denken, der ich doch mit dem Einsatz meines Lebens an dem mitwirkte, was uns jetzt vernichtet? Für mich ist eine Strafe nur gerecht. Aber die Strafe wird alle treffen, alle Schuldigen, und auch alle Unbeteiligten, so wie Euch, meine einzige Tochter.
Wir haben unseren Fehler zu spät erkannt. Und nun ist es zu spät, jeder ist mein Feind, selbst ich bin mein eigener Feind geworden.
Sie sind vorm Haus. Ich höre sie an der Türe. Gleich werden sie vor mir stehen und ich werde kein Mitleid in ihren blanken Augen lesen können, kein Zucken in ihren Mienen, sondern nur die Berechnung wieder erkennen, die ich in ihr Handeln gelegt habe und mit der sie mich aufspürten. Ich bin zu schwach, um mich zu wehren…. und irgendwann ist auch der letzte Kampf zu lang gekämpft.
Euch gebe ich in die Hände derer, die mir nie feindlich gesinnt waren, die mir selbst dann noch Vertrauen schenkten, als ich es schon nicht mehr verdient hatte. Dabei wurden auch sie von mir verraten, so wie alle, die bis zuletzt an mich geglaubt hatten. Ihr werde nirgendwo sicher sein, aber vielleicht werdet Ihr noch leben, um diesen Brief zu lesen.
Das Schlimmste am Ende des Lebens ist nicht der Tod, mit ihm kann man rechnen, sondern dieses Bedauern. Ein Bedauern, das sich tief in mich hineingefressen hat und keine Grenzen kennt. Die Gewissheit, dass mein verschwendetes Leben kein gutes Ende haben kann und dass ich auch unzähligen anderen die Chance auf eine Zukunft genommen habe.
Ich kann nicht weiterschreiben und zu sagen gibt es ohnehin schon so lange nichts mehr. Sie kommen nach oben…
Möget Ihr am Ende eine Wahrheit finden, die heilt und nicht zerstört. Dort, wo meine Taten Euch nicht erreichen können. Geht dorthin, und blickt nicht hinter Euch. Die Zukunft endet hier.
Kapitel 1
-Silber und Stahl-
Den zusammengefalteten Brief in ihren Händen haltend, blickte Nathalie durch eines der Fenster nach draußen. Sofort musste sie blinzeln, so gleißend hell blendete die Sonne. Auf den Handflächen und ihren nackten Armen spürte sie die Hitze, die sich hinter der Scheibe aufgestaut hatte. Als sich ihre Augen an das grelle Licht gewöhnt hatten, konnte sie die Landschaft, die sich dahinter erstreckte, besser erkennen. Dasselbe wässrige Aquarell wie immer. Blasse Farben, verwaschener Horizont, der immer selbe Bildausschnitt aus einer unveränderten Perspektive.
Nie hatte sie etwas anderes zu sehen bekommen, denn außer im Haus durfte sie sich nur im kleinen Garten aufhalten. Ihr Ziehvater ging alle paar Wochen zum nächstgelegenen Tauschmarkt, aber begleiten durfte ihn niemand. Es sei zu gefährlich, erwiderte er immer, wenn sie ihn danach fragte. Nicht selten geschah es, dass selbst er, ein Mann von stattlicher Statur, überfallen und niedergeschlagen wurde. Jedes Mal schwiegen sie und hungerten, bis er soweit genesen war, um einen erneuten Versuch wagen zu können. Er war ihre einzige Versorgung und Nathalie wünschte sich oft genug, an seiner Statt gehen zu können. Die traurigen Blicke und das beharrliche Schweigen trieben sie schier in den Wahnsinn.
Nathalie seufzte und ließ den Blick wieder nach draußen schweifen. Sie wusste nicht, was hinter den Hügeln lag, die das Dorf, oder vielmehr die verlassene, verwahrloste Häusersiedlung umgaben. Ihre Sicht reichte nur bis zu den Windkrafträdern, die sich auf den Hügelkuppen gen Himmel streckten. Allerdings hatte es den Anschein, als ob ein Riese mit ihnen Mikado gespielt und anschließend alles wirr durcheinander liegen gelassen hätte. Viele waren zerbrochen und hatten keine Rotoren mehr. Nur noch Stümpfe von unterschiedlicher Höhe standen aufrecht. Rumpfstücke und Rotorblätter lagen ungeordnet in der Umgebung verteilt.
Nathalie ließ ihren Blick weiter wandern. Unten im Tal sollten laut Beschreibung ihres Ziehvaters in früheren Zeiten florierende Felder gewesen. Doch diese Zeiten mussten lang vorbei sein. Nathalies Erinnerungen nach lag das Land schon immer brach und wild wuchernde Pflanzen suchten sich ihren eigenen Weg. Der Bach, der sich durch das Tal geschlängelt hatte, war während der verheerenden Dürre der letzten Hitzeperiode restlos ausgetrocknet. Am Bachufer standen einige verwahrloste Häuserruinen, in denen schon lange niemand mehr wohnte.
Gedankenverloren wandte sich Nathalie vom Fenster ab. Die bunten Ringe und Flecken vor ihren Augen verblassten nach und nach. Ihre Aufmerksamkeit richtete sie nun wieder auf den Brief. Sie sehnte sich danach, seinen Inhalt zu verstehen, um einen Blick auf den Mann dahinter zu erhaschen, der ihr Vater gewesen sein sollte. Aber sie verstand bisweilen nicht einmal sich selbst. Wusste nicht, was sie fühlen sollte und scheiterte daran, die Welt zu begreifen, die ihr alles verbot, wovon sie träumte. Die sie zu einer Gefangenen in diesem Haus machte. Man sprach nicht von ihrem Vater, man erklärte ihr nicht, was er ihr in seinem Abschiedsbrief umständlich aufzudecken versuchte. Jeden Tag, so fand Nathalie, musste er ein weiteres Mal sterben, weil sie zum Vergessen gezwungen wurde und sein Abbild in ihren Erinnerungen zu einem formlosen Schleier der Vergangenheit verblasste.
Sie hämmerte mit geballten Fäusten gegen die Scheiben, wollte sie im Zorn einschlagen, hinaus brechen in die Freiheit und dem näher zu sein, was sie weder kennen durfte, noch jemals kennen würde. Als wartete ihr Vater dort irgendwo in der Trostlosigkeit, eine leuchtende Silhouette, die ihr den Weg wies, wie eine kleine Sonne, ohne sie jedoch zu verbrennen. Doch sie wusste, dass sie ihn weder drinnen noch draußen, noch sonst irgendwo finden würde. Er war fort, für immer, und hatte sie in einer kalten Welt zurückgelassen, in der alle schwiegen und im Verborgenen stumme Tränen vergossen.
„Warum ist es so schwer, zu sprechen, mit mir zu sprechen über ein totes Stück Papier?”, hatte sie ihre Zieheltern einmal angeklagt. „Alles was ich will, ist doch bloß verstehen. Ist es denn falsch, aus der Vergangenheit lernen zu wollen? Ist es falsch, erfahren zu wollen, wer ich bin?”
„Du begreifst das nicht”, hatte ihr Ziehvater erwidert und sie dabei so gleichgültig angesehen, wie einen der vielen Gegenstände, die er Tag ein Tag aus vergebens zu reparieren versuchte und schließlich mit einem Schulterzucken auf den Müll zurückwarf.
„Es kommt schon lange nicht mehr darauf an, die Welt zu begreifen oder auch nur sich selbst zu verstehen. Es kommt einzig darauf an, zu überleben. Überleben ist alles. Wenn du das schaffst, bist du wer. Aber nicht mehr als das. Du bist, weil du lebst, oder du stirbst und bist nichts. Eine andere Rolle ist nicht notwendig.”
„Du sagst mir nur das, was mir helfen soll”, hatte Nathalie ihm verzweifelt vorgeworfen. „Aber ich habe einen Brief, einen Brief von meinem Vater. Und er wollte mir etwas sagen, über sich, über mich, vielleicht noch mehr. Und du, ihr beide, ihr wisst es und doch schweigt ihr.”
Ihre Ziehmutter hatte sich mit glasigen Augen abgewandt und hatte es ihrem zornigen Gatten die Verteidigung überlassen.
„Ja, ganz recht, dein Vater war jemand. Damals war es noch entscheidend, wer man war. Das ist lange her und dieser Brief ist nichts als ein Nachhall einer anderen Zeit, ein Beweis, dass es nie mehr genauso sein wird. Wir leben wie die Tiere, das haben wir dir versucht beizubringen. Wie die Tiere. Darum leben wir noch. Instinkt, mein Kind, kein Verstand. Wenn du nach höherer Erkenntnis verlangst, dann lebst du in der falschen Zeit und unser Schutz kann dich nicht retten. Dabei war es das, was dein Vater wirklich wollte: Dich sicher zu wissen.”
Er stierte auf seinen wässrigen Nahrungsbrei. „Aber du, du wirst seine Mühen mit deiner rastlosen Unzufriedenheit zunichtemachen“, sagte er, ohne den Blick vom Essen zu wenden.
Gedemütigt von seiner Ignoranz und seinem Trotz, nahm Nathalie sich vor, das Thema nicht ein zweites Mal aufzubringen. In all den Jahren hatte sie sich bemüht, ihr Dasein nicht zu hinterfragen, aber sie konnte die Worte in dem Brief nicht vergessen. Konnte den Vater nicht vergessen, den sie nie gekannt hatte. Sie war nicht wie ihre gleichgültigen Zieheltern: sie empfand etwas. Sie wollte raus aus dem Gefängnis, das ihre einzige Heimat war, aber ihr wohl bewusst, dass sie sich draußen nicht lange alleine würde durchzuschlagen und versorgen können, wenn sie nicht einmal eine vage Vorstellung davon hatte, was hinter dem Hügel lag, auf den sie Tag um Tag blickte.
Wenn sie ihren Vater nur ein einziges Mal treffen könnte… Wenn es jemanden gäbe, der bereit wäre ihr das Leben zu erklären…, jemanden mit dem sie sich der Welt draußen stellen könnte ohne Angst haben zu müssen…
Je mehr sie sich danach verzehrte, desto unerträglicher wurde die Enge, die ihr den Atem raubte. Jedes Mal wenn sie am Morgen die Augen aufschlug, dachte sie darüber nach, ob ihr Dahinvegetieren eine Form von Leben war, die noch irgendetwas Lebenswertes beinhaltete. Vielleicht wollte sie ja gar nicht mehr aufwachen, nur um mit ausdruckslosen Augen aus dem immer gleichen Fenster starren zu müssen. Manchmal wollte sie, die Arme vor der Brust gekreuzt, wie die alten Pharaonen, von denen sie Abbildungen in alten Büchern gesehen hatte, einfach liegen bleiben und darauf warten, dass alle Lebenskraft entweichen würde. Lediglich das Nachsinnen über den Brief ihres Vaters war eine Sache, die ihren Kopf zu beschäftigt hielt, um diesen Gedanken weiterzuverfolgen.
Außer seinen letzten niedergeschriebenen Worten hatte Nathalie noch ein weiteres Indiz dafür, dass es einen liebenden Vater in ihrer Vergangenheit gegeben haben musste: Ein silbernes Amulett in Form eines Buchenblattes, das an einer feingliedrigen Silberkette hing. Diese Kette legte sie nie ab, weder zum Schlafen, noch auf Wunsch ihres Ziehvaters, der das Amulett aus irgendeinem Grund hasste. Es war ihr Glücksbringer, ihr Talisman, ihr ein und alles in gewisser Weise.
Langsam schloss sich ihre Hand um das Amulett und sie drückte es an ihre Brust. Wenn sie es dort einpflanzen könnte, genau an die Stelle, an der ihr kaltes, kränkliches Herz seine kraftlosen Verzweiflungsschläge tat. Das Amulett, so schien es ihr, war viel lebendiger als sie selbst, es strahlte eine beständige Anmut und Kraft aus, unangetastet von Schmerzen und der bedrückenden Nähe des Todes. Sie wünschte sich einen winzigen Splitter seiner Stärke. Aber diese Stärke schien an eine Wahrheit gebunden zu sein, die selbst ein tödliches Elixier war. Eine Wahrheit, von deren zerstörerischem Hauch ihr Vater sie nicht berührt sehen wollte. Zurücklassen sollte sie alles. Aber wohin wenden? Da war nichts.
„Nathalie!”, rief eine aufgeregte Stimme nach oben und riss sie aus ihren Gedanken. „Komm schnell, sie sind mir hierher gefolgt!”
Ohne auf weitere Aufforderung zu warten, lief sie so schnell wie möglich die hölzernen Treppenstufen nach unten. Sie wusste, was die knappen Worte ihres Ziehvaters bedeuteten. Plünderer! Sie machten bandenweise die Gegend unsicher. Wer sein Haus nicht abgeschlossen und verbarrikadiert hatte, mochte diese Nachlässigkeit mit dem Tod bezahlen. Die Überfälle waren unvorhersehbar und konnten jeden treffen
Wenn sie zuschlugen, nahmen die Banden alles mit, was sie für nützlich erachteten, hinterließen Verwüstung und verschonten in der Regel weder Frauen noch Kinder. Jeder Konkurrent weniger war in ihren Augen das einzige, was im Kampf ums Überleben von Bedeutung war. Wer ihre Angriffe rechtzeitig bemerkte und sich, solange ihre Plünderung andauerte, wohl verborgen hielt, hatte nichts zu befürchten, denn die Banden verschwanden jedes Mal so schnell wie sie gekommen waren. Allerdings führten sie eine Vielzahl von Waffen mit sich und scheuten sich auch nicht, davon Gebrauch zu machen, sollte sich auch nur ein leiser Atemzug vernehmen lassen. Manchmal verfolgten sie sogar ausgewählte Opfer, die ein besonders wertvolles Gut mit sich trugen.
Und jetzt waren sie hier. An der Schwelle zu Nathalies einzigem Zuhause.
„Hol dir ein Messer aus der Küche, schnell!”, forderte ihr Ziehvater sie auf. Er selbst hielt bereits ein Messer in der Hand und hatte sich mit voller Konzentration dem Geschehen an der Türe zugewandt. Eine steile Falte des Zornes zerteilte seine hohe Stirn und in seinen Augen blitzte der Kampfeswille. Nathalie hatte ihn noch nie so lebendig gesehen.
Ohne zu zögern öffnete Nathalie eine der Schubladen in der Küche auf und entnahm ihr ein Messer mit schwarzem Griff. Es ruhte dort schon so lange, wie ihre Erinnerungen an das Leben bei ihren Zieheltern zurückreichten. Die Klinge war etwas länger als Nathalies Hand, mit beidseitig scharf geschliffener Klinge und einer zierlichen Spitze. Wie angegossen lag das Messer in ihrer Hand, wie ein eigenes Körperteil. Der Lärm draußen wurde lauter. Eine blutige Vorahnung lag in der Luft.
Die Plünderer bemühten sich nicht, unauffällig zu bleiben. Nur todesmutige Narren wagten sich ihnen in den Weg zu stellen. So berüchtigt waren sie für ihre Taten, dass jeder kluge Mensch es nicht auf eine offene Konfrontation ankommen ließ.
Nathalies Finger schlossen sich noch fester um den Griff ihres Messers, bis ihre Knöchel weiß unter der Haut hervortraten. Sie zitterte am ganzen Körper, ihre Brust war eng vor Angst und ihr Herz raste vor Aufregung. Schweiß sammelte sich an ihren pulsierenden Schläfen, ihr wurde abwechselnd heiß und kalt. Wie sollte sie sich beherrschen, wenn sie wusste, dass ihr zu Hause, ihr Leben, oder zumindest ihr klägliches bisschen Dasein auf dem Spiel stand? Je mehr sie bei Vernunft zu bleiben versuchte, desto mehr störte sie sich an dem uneinheitlichen Rhythmus ihres Herzschlags und ihren schweren Atemzügen. War dieses Dasein überhaupt einen Kampf wert? Sie war eine Gefangene in ihrem eigenen Leben. Warum nicht einfach den Kampf anderen überlassen… Da wurde sie sich des Amuletts um ihren Hals bewusst, das mit einem Mal Tonnen zu wiegen schien. Ihr Vater hatte auch bis zum Ende gekämpft, dachte Nathalie. Um sie in Sicherheit zu wissen. Konnte sie einfach dastehen und abwarten, was geschah? Hatte ihr Vater sie dafür gerettet, dass sie sich willenlos in ihr Schicksal fügte? Warum war sie dann nicht schon früher aufgestanden und gegangen, um nach Wahrheiten zu suchen?
Weil das mein Zuhause ist, dachte Nathalie. Mein einziges Zuhause.
Den Stimmen nach zu urteilen, musste die Bande etwa ein halbes Dutzend Köpfe zählen. Damit war die Bande vielleicht verhältnismäßig schwach besetzt, aber trotzdem zu stark, um sie einfach in die Flucht schlagen zu können. Weder Nathalie, noch ihre Ziehmutter hatten sich je verteidigen müssen. Einzig und allein Nathalies Ziehvater verließ das Haus, um neue Güter heranzuschaffen. Woher kamen die Sachen, die er brachte? Was hatte er schon alles auf diesen unzähligen Trips erleben müssen? Manchmal war er verletzt nach Hause gekommen, hinkend, oder mit blutigen Schnitten an den Armen und dem Oberkörper. Aber er hatte immer beharrlich geschwiegen und seine Wunden versorgt. Nathalie war es gewohnt, keine Fragen zu stellen. Jetzt aber, wo sie der Gefahr gegenüberstand, schwirrten tausende von Fragen durch ihren Kopf und suchten nach Antworten, die sie nicht fanden. Ärgerlich versuchte Nathalie alle Fragen zu verdrängen und alle Unsicherheit bei Seite zu schieben. Alles was zählte, war das Hier und Jetzt. Ihr Zuhause.
Das halbe Dutzend Plünderer stand in der offenen Haustüre, die für sie kein Hindernis darstellt hatte, und maßen den Mann und die beiden Frauen mit abschätzenden Blicken. Sie waren zu einer schnellen Entscheidung gelangt und griffen Nathalies Ziehvater ohne zu zögern an.
Natürlich, dachte Nathalie, er stellt den einzigen ernst zu nehmenden Gegner dar. Die Plünderer wissen, dass sie mit den beiden Frauen, die sich unsicher im Hintergrund hielten, anschließend leichtes Spiel haben werden.
Warum zögerte Nathalies Ziehvater? Es war, als scheue er den Kampf. Aber den Moment, den er verstreichen ließ, nutzten die Angreifer sofort zu ihrem Vorteil aus. Sie waren es gewohnt, um ihr Leben und gegen andere zu kämpfen. Sie besaßen nichts, sie waren nicht mehr als eine Zweckgemeinschaft aus Männern, die nicht davor zurückschreckten, Gewalt anzuwenden, um tagtäglich ihr Überleben zu sichern. Aus ihrer Sicht waren ihre eigenen Gefährten nicht mehr als zweckmäßig, entweder waren sie da, um ihren Dienst zu tun, oder sie waren nicht mehr da und mussten ersetzt werden.
Der Moment des Zögerns brachte Nathalies Ziehvater eine lange Schnittwunde am Arm ein. Seine Frau schrie vor Entsetzten und wich zurück. Nathalie konnte alles in ihren Augen lesen: Ich kann sie nicht alleine beschützen. Sie werden sie finden. Alleine bin ich nichts. Du darfst nicht von uns gehen. Alleine sind wir verloren. Wir haben ein Versprechen gegeben. Du kannst mich damit nicht alleine lassen. Sie schafft es nicht ohne uns. Ohne dich.
Nathalies Gedanken kreisten umeinander, sie konnte keinen Entschluss fassen. Hässliche Fratzen der Zukunft verschleierten ihren Blick, der gerade jetzt so klar wie nie hätte sein sollen. Welche Wahrheit kannten ihre Zieheltern, die sie wohlweißlich vor ihr verborgen hielten? Was hatten sie ihrem Vater versprochen? Was wussten sie über ihren Vater? Konnte das Wissen über ihn zu gefährlich sein, um es mit ihr zu teilen? Warum vertrauten sie ihr nicht?
Was, wenn sie nicht überlebten? Nathalies Kehle war wie zugeschnürt bei dem Gedanken. Was, wenn sie nie mehr die Wahrheit erfahren würde? Was, wenn heute der letzte Tag war?
Ihre Zieheltern waren ihren Verletzungen erlegen, wie Ertrunkene in ihrem eigenen Blut reckten sich ihre nackten, geschändeten Leiber auf den Dielenfließen. Gelächter drang mal lauter, mal leiser an Nathalies Ohr, sie fühlte wie auch sie immer tiefer rutschte, roch den eisenartigen Geruch ihres eigenen Lebenssaftes. Ihre Hände, die sich umsonst abmühten, sie hoch zu stützen, waren rot wie nach dem Schlachten. Ihre Augenlider waren verklebt und feucht, und ließen sich nur einen kleinen Spalt weit öffnen. In dem winzigen Ausschnitt erkannte sie Feuer. Es schlug aus dem Holz der Möbel, leckte an den Gardinen, verzehrte die Leichen ihrerZieheltern in Zeitraffer zu schwarzen Kadavern. Einer der Plünderer beugte sich zu ihr, seine Fackel streifte heiß ihre Wange und versengte ihr Haar.
„Wir bringen das Feuer, kleine Nathalie, damit du die Wahrheit findest in der Dunkelheit …”
Sie brach zusammen, als er ihr die Arme wegtrat.
„Vater”, murmelte sie mit ersterbender, vom Rauch kratziger Stimme, „das ist nicht die Wahrheit, die du mir versprochen hast.”
„Oh doch, mein Kind”, hörte sie den Plünderer ganz nahe an ihrem Ohr und gleichzeitig doch schon wie aus weiter Ferne, dann schlugen ihr Flammen ins Gesicht und ihr wurde schwarz vor Augen…
Nathalie öffnete mühelos beide Augen, die zwar feucht vor Tränen waren, aber weder geschwollen noch verklebt. Wieder stand sie der Realität gegenüber, die sie nur in ihrer Vision weitergesponnen hatte, zu einer Brutalität die keine Grenzen kannte. Wut zog sich wie ein Geschwür in ihrem Herzen zusammen, als sie ihre schreiende Ziehmutter am Schrank kauern sah. Ihr Messer war ihr aus der Hand gerutscht und lag nutzlos am Boden. Ihr Ziehvater war durch die Plünderer von ihnen beiden abgeschnitten worden, er beugte sich qualvoll hustend vornüber. Inzwischen blutete er aus mehreren Schnitt- und Stichwunden, geschlagen von den Messern und dolchartigen Waffen seiner Gegner.
Kaum noch in der Lage, sich zu verteidigen, beschränkte er sich auf die notwendigsten Parierstreiche und nahm in Kauf, dass er immer öfter einstecken musste und seine Stärke gleichsam mit seinem gebrochenen Willen schwand.
Drei der Plünderer traktierten ihn von verschiedenen Seiten, während die anderen drei auf Nathalies Mutter zukamen. Sie hatten es nicht eilig. Nathalie selbst stand nur wenige Schritte entfernt. In ihr war nichts als Zorn. Sogar Trauer und Angst wurden davon weggewischt, wie Gefühle eines anderen, die sie nicht im Entferntesten betrafen.
„Ich werde euch die Wahrheit schon selbst zeigen!”, schrie Nathalie fast besinnungslos.
So fest wie es ihr möglich war warf sie ihr Messer nach dem nächststehenden Feind.
Der Getroffene brach mit dem tief in seiner Brust steckenden Messer zusammen und blieb vor Schmerzen gekrümmt liegen. Ein Häuflein Elend. Blut sickerte aus seiner Wunde und färbte sein schmutziges Hemd rot. Ein Tier, geschlachtet von Nathalie. Sie blickte in stummem Entsetzen auf ihre Hände herab, die sauber waren. Wenn man eine Sache stahl, besaß man sie, konnte sie fühlen, ansehen, in Händen halten… Warum war nichts Greifbares, nichts Erkennbares da, wenn man ein Leben gestohlen hatte? Wie konnte es weg sein, ohne dass selbst der Räuber einen Rest davon zurückbehielt? Schuld war unsichtbar. Aber für Nathalie fühlte es sich schmutzig an. Es war das einzige, woran sie in den erstarrten Sekunden denken konnte. In ihrer Phantasie sah sie den Schädel, dessen Haut in Zeitraffer fahl wurde und an den Knochen fest trocknete, die Kiefer zwischen denen es keine Zunge mehr gab, öffnete sich: „Gib mir dein Licht, dein Licht. Lass mich nicht in dieser garstigen Dunkelheit, wo sie alle sind. Gib es zurück! Sie warten ja doch auch auf dich eines Tages.“
Wie ein Mann hielten die anderen fünf Räuber inne, drehten sich zu ihrem gefallenen Kameraden um und blickten zu Nathalie. Ungläubigkeit und Verwirrung in ihren Augen, panische Furcht im Herzen, ihr Verstand begriff zum ersten Mal, das auch sie verlieren konnten, dass auch jeder von ihnen nur ein Leben besaß, das sie so leichtfertig aufs Spiel zu setzen gewohnt waren. Ihr Gefährte, hingerichtet von einer jungen Frau, die interessiert auf den Toten herabsah wie auf die Beute einer Jagd. Etwas an ihr war so kalt gegen das Leben, dass sie alle in den Bann zog und gleichzeitig ihr Innerstes zur Flucht wandte.
Behände bückte Nathalie sich nach jenem Messer, das den hilflosen Händen ihrer Ziehmutter entglitten war. Wären die Plünderer nicht schon aus dem Haus gehastet und hätten die Türe hinter sich zugezogen, so hätte vielleicht auch diese Klinge ihr Ziel gefunden.
Stille senkte sich über das Haus, in dem nunmehr nur noch seine eigentlichen Bewohner und der Tote zurückgeblieben waren. Niemand wusste etwas zu sagen. Ihr Ziehvater war der erste der das Schweigen brach, obwohl er es war, der am meisten an Stärke eingebüßt hatte:
„Nathalie, das war die gedankenloseste und zugleich kühnste Tat, die ich je gesehen habe. Ohne deinen Meisterwurf hätten wir das Schicksal dieses Barbaren erlitten. Geflohen sind sie… fragen wir nicht, warum. Aber sie hatten Angst vor dir, Nathalie, Angst. Ich habe noch nie so eine Angst bei ihnen gesehen.”
Was alles hätte schief gehen können erwähnte er besser nicht.
Nathalie lächelte schwach. Sie war sowohl müde vom Leben, als auch müde vom Verteidigen ihres Lebens. Eigentlich hätte sie sich über den Sieg freuen sollen, aber sie suchte vergebens nach einem solchen Triumphgefühl. Der Hass gegen die Feinde war verflogen und hatte eine unangenehme Leere hinterlassen. Sie starrte den Leichnam an, der wenige Schritte vor ihr lag, doch sie konnte den Anblick des von ihr niedergestreckten Mannes nicht ertragen und wandte sich ab. Egal wie böswillig er zu handeln bereit gewesen war, rechtfertigte das ihre Tat? Er hätte sie alle drei ohne zu zögern getötet, wenn es seinem Zweck dienlich gewesen wäre. Aber war das eine Entschuldigung für seinen Tod? Sie wünschte sich von ganzem Herzen, dass die Sonne aufhörte, sie spöttisch auszulachen. Ihr Vater hatte die Leiche inzwischen auf seine Arme geladen und trug sie langsam und mit hinkendem Bein aus dem Haus. Eine schiere Ewigkeit bewegte sich das Opfer ihres Blutrausches durch ihr Blickfeld, als wollte es für immer dort verharren und sie auf ewig an ihre Zornestat erinnern.
Du hast mir meinen Namen genommen und sieh! Ich werde der Namenlose sein, der dich verfolgt und deine Träume vergiftet!
Als Nathalies Ziehvater wieder hereinkam gingen sie alle gemeinsam, wie ein Trauerzug, ins Wohnzimmer, wo ihre Mutter in fast schon anmutiger Zeremonie alle Wunden notdürftig reinigte und verband. Der Überfall hatte ihnen allen viel abverlangt, so dass sie sich ohne weitere Worte schlafen legten. Nathalie war schon in ihrem Bett, als sie ein Pochen an ihrer Zimmertüre hörte.
„Komm herein”, murmelte sie etwas widerwillig.
Es war ihr Ziehvater, der ungewohnt bedächtig und mit merklichem Zögern eintrat.
„Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen, du hast heute völlig richtig gehandelt, und zwar richtiger und besser als ich es je gekonnt hätte. Dein Vater wäre stolz auf dich gewesen, das wollte ich dir sagen.”
Er sah ihr fest in die Augen, als wollte er sie dazu zwingen, genauer hinzusehen, das wahrzunehmen, was er nicht aussprach und nur dort irgendwo in seinen Gedanken existierte. Dann zog er das Messer mit dem schwarzen Griff hinter seinem Rücken hervor. Die Klinge war gesäubert und poliert und strahlte schöner als je zuvor.
„Ich denke, du solltest es behalten, es gehört zu dir, nachdem es dir so viel Glück gebracht hat. Du hast mir oft beim Messerwerfen üben im Garten zugesehen. Jetzt bist du viel begabter darin, als ich je werden könnte. Ich hoffe nicht, dass du noch einmal auf seinen Dienst angewiesen bist, aber es wird kein Schaden sein, wenn du es bei dir trägst.”
Er zuckte mit den Schultern und legte es eine Spur zu hastig auf ihrem Nachttisch ab, wie ein verwünschtes Artefakt, dem er nicht traute und welches er keine Sekunde länger in Händen halten wollte.
Nathalies Schlaf verlief unruhig und war durchzogen von wirren Alpträumen, die einander nachfolgten wie Krankheiten sich ewig fortsetzten, manchmal ineinander übergehend, manchmal überlagert. Mehrmals wachte Nathalie in dieser namenlosen Nacht auf, um kurz darauf wieder vor Erschöpfung einzunicken, egal wie stark ihr Vorsatz war, nicht wieder in die Grausamkeit ihrer Phantasiewelt hinab zu driften. Doch der Tagesanbruch ließ auf sich warten und so fühlte sie sich am Morgen schließlich so, als hätte sie nun noch das letzte bisschen Kraft aufgebraucht.
Nach einem kargen Frühstück stieg sie schlafwandlerisch die Treppe in den Keller hinab und verließ noch immer wie in Trance über eine der beiden Fenstertüren das Gebäude. Einmal wandte sie sich um, wie eine Verfolgte, aber es war niemand hinter ihr. Sie hatte sich nur eingebildet, ihren Ziehvater zu hören, der sie bat, im Schutz des Hauses zu bleiben. Doch ihr Ziehvater hätte sie niemals um etwas gebeten. Sein Wort war Befehl. Einen Befehl aber, das stand sicher fest, hatte sie diesmal nicht gehört, also setzte sie ihre ziellose Reise über die Terrasse fort. Splitter des rissigen Pflastersteins bohrten sich wie Dornen in ihre nackten Fußsohlen, doch sie lächelte nur über den unmerklichen Schmerz, der ihr so viel weniger real vorkam, als die Torturen in ihren Träumen.
Sie stellte sich vor, es wären die Stacheln von Rosenzweigen, die sich wie sterbende Schlangen über den Boden wanden, zuckend, Halt suchend an ihren zierlichen bleichhäutigen Beinen, sie warnend vor einer Welt, deren Opfer keinem Zweck dienten, sondern ihrer eigenen Sinnlosigkeit geopfert wurden. Gerade weil Nathalie sich vorstellte, nicht weiterlaufen zu dürfen, wurden ihre Schritte fester und zuversichtlicher.
Rosen waren damals ein Zeichen der Liebe. Noch mehr, sie waren auch Symbol für vielerlei Dinge. Schwarz für die Trauer, weiß für die Toten. Die roten Rosen aber, waren den Liebenden vorbehalten. Aber es gibt sie nicht mehr, das war damals…
Selten genug, dass ihre Ziehmutter Nathalie aus der Vergangenheit erzählte, umso dankbarer war sie über alle noch so winzigen Details, die sie erfahren konnte. Rosen, überall meinte sie ihnen seitdem zu begegnen, mit ihren bunten dicken Blütenköpfen – so wie sie sich Rosen aus den Erzählungen ihrer Ziehmutter vorstellte – aber mittlerweile gewöhnte sie sich an die Streiche, die ihre Augen ihr so oft spielten. Die ihr zeigten, was sie nicht hatte und wonach sie sich umso mehr sehnte.
Rings um den Steinpfad, der kaum noch als solcher auszumachen war, wucherten die Pflanzen durcheinander, die stark genug waren, um von nichts als Entbehrung satt zu werden. Ihre Zieheltern hatten ihr von dem Brauch berichtet, sich die Natur in dem abgegrenzten, zum Haus gehörenden Gebiet untertan zu machen und nach Wunsch zu gestalten. Eine Tradition, namens Gartens, die ihren Wert verloren hatte. Wer sollte einen bewundernden Blick darauf werfen, wenn man auf der Flucht oder in Verstecken seine Existenz zu retten versuchte? Alles was heute hier zu wachsen in der Lage war, wuchs wie es wollte. In der Mitte der Gartenfläche streckte sich ein großer Baum vergeblich nach Erlösung heischend gen Himmel. Vornüber geneigt stand er da, ein alter gebeugter Krüppel, ein Kriegsveteran, dem niemand seine Wunden zu versorgen kam, der in Verbitterung und Einsamkeit seine letzten Jahre trotzig fristete und doch noch alle zu überdauern gedachte. Nathalie setzte ihren Weg durch den Garten fort, bis sie an den rostigen Maschendrahtzaun gelangte, der das Grundstück abgrenzte. Gekonnt platzierte sie einen Fuß in eine der Maschen und schwang sich auf die andere Seite des Zauns. Vor ihr ragte ein schier undurchdringliches Gestrüpp aus dürren Sträuchern und vereinzelten gekrümmten Bäumen auf. Wenn sie allein sein wollte kam sie oft hierher, sodass sie mittlerweile eine Vielzahl von Wegen durch das enge Gewirr kannte. Das hier war die einzige Freiheit, die sie sich selbst und ihren Zieheltern gegenüber herausnahm: ein Versteck in den Armen der fast erstorbenen Natur. Die aber genauso überdauerte wie sie alle in dieser Welt, in der man niemand sein konnte oder durfte. Auch wenn die Pfade nicht weit führten und immer wieder dort endeten, wo sie begonnen hatten, waren diese Zirkel ein Weg, auf dem Nathalie sich allein und frei bewegen konnte. Ob ihre Zieheltern wirklich nichts von ihrem Geheimnis ahnten, oder sich mit diesem kleinen, überschaubaren Regelbruch abgefunden hatten, ohne je ein Wort darüber zu verlieren, wusste Nathalie nicht mit Gewissheit. Daher zog sie es vor, ihre geheimen Ausflüge nie zu lange auszudehnen und wieder ebenso unbemerkt ins Haus zu gelangen, wie sie sich davongestohlen hatte. Wie sonst schon so oft wollte sie sich auch jetzt aller Gesellschaft entziehen und auf andere Gedanken kommen, um die Ereignisse des Vortags zu vergessen, wenigstens für einen verschwindend kurzen Augenblick, in dem sie sich einbilden konnte, glücklich zu sein.
Statt einen der ihr bekannten Wege zu wählen, nahm sie das Messer, das sie von jetzt an immer bei sich tragen wollte, und bahnte sich einen Weg durch das dornige Gestrüpp. Trotzdem musste sie die Arme schützend vors Gesicht nehmen. Über ihr wurde das Geäst immer dichter und dichter, so dass Nathalie bald gezwungen war auf Knien weiter zu kriechen. An wenigen Stellen robbte sie sogar auf dem Boden voran, bis die Sträucher auf einmal weiter nach außen rückten und sie aufrecht stehen konnte, ohne ihr Messer zu Hilfe nehmen zu müssen. Sie überlegte angestrengt. Nein, sie war sich sicher, dass sie diesen abgeschiedenen Ort vorher noch nie zuvor betreten hatte. Neugierig sah sie sich nach allen Seiten um. Die Sträucher ließen eine kreisförmige Lichtung frei und schlossen sich knapp über Nathalies Kopf wie zu einem kuppelartigen Dach zusammen. Fasziniert blickte sie sich um und wunderte sich, dass sie diesen Ort nicht schon längst entdeckt hatte. Sie streckte die Arme aus, als wolle sie etwas direkt vor ihr in der Luft greifen. Mechanisch machte sie einen Schritt. Erschrocken taumelte sie rückwärts, als ihr Fuß an etwas stieß. Leise fluchend fokussierte sie den kränklichen, gräulichen Waldboden. Das Hindernis war nichts weiter als ein runder Kanaldeckel, so groß, dass er unter normalen Umständen nicht zu übersehen gewesen wäre. Als ihr Puls sich wieder normalisiert hatte, ging Nathalie neben dem Kanaldeckel in die Hocke und fuhr mit der flachen Hand darüber. Gedankenverloren zeichneten ihre Finger die Umrisse des Deckels nach, bewegten sich nach und nach ins Innere des Kreises und kamen in einer kleinen Vertiefung zum Ruhen. Einer Vertiefung in Form…
Ihr Herz setzte schier einen Schlag aus. Noch bevor sie hinsah, um sich zu überzeugen, war sie sich absolut sicher. Die Form die sie da erspürte, war so unverwechselbar und so klar und deutlich mit jedem Detail, jeder feinsten Rille und Hebung in ihr Gehirn eingebrannt, dass eine bloße Einbildung außer Frage stand. Es war das Negativ zu dem silbernen Buchenblattanhänger, den sie Tag und Nacht um den Hals hängen hatte. Ohne nachzudenken griff sich Nathalie an die Brust, wo sie die Kühle des Talismans spürte. Ihr Hals war ihr so eng geworden, als läge ein straff gezogener Strick darum. Wo war die Luft zum Atmen geblieben?
Wie konnte das überhaupt alles sein? Wo war sie und warum war sie hier? Wie konnte es sein, dass der Kanaldeckel eine Mulde passgenau für ihren Talisman aufwies? Träumte sie? Lebte sie noch? Nathalie fühlte sich, als wäre sie in ein Zeitloch gefallen. Als wäre sie irgendwo in Raum und Zeit, nur nicht da, wo sie vor ein paar Minuten, oder waren es schon Stunden, gewesen war. Und nun, dachte sie. Was nun? Wie geht es weiter?
Aufgeregt und mit zitternden Fingerspitzen öffnete sie den Verschluss der Silberkette und ließ das wohl bekannte Amulett in ihre Hand gleiten. Sie wog es ab, aber diesmal nicht, um seinen Wert oder seine verborgene Lebensenergie zu schätzen, sondern um die Bedeutung zu ermessen, die dem unschuldig glänzenden Schmuckstück tatsächlich innewohnte.
Noch einmal verglich sie es mit der in den Kanaldeckel eingelassenen Form, um nicht doch einem Trugbild zu erliegen, dem Wunsch etwa, dass sie etwas über ihren Vater lernte, oder einen winzigen Bruchteil der Welt verstand, die das viel zu enge Korsett ihres Lebens darstellte. Hier saß sie nun, wollte Antworten, aber wagte es nicht, die nötigen Fragen zu stellen. Zitternd sah sie auf das Amulett in ihrer Hand herab. Wie lange saß sie so da, unbeweglich, unentschlossen, unwohl? Sie wusste es nicht. Sie wusste, dass sie nichts wusste.
Irgendwann ertappte sie sich dabei, wie ihre Hand samt Amulett auf die Mulde zusteuerte. Jedes Mal, wenn sie hinsah, hielt sie in der Bewegung inne. Dann legte sie in einer fast schon hektischen Geste das Amulett in die Mulde. Vornüber gebeugt wartete Nathalie ungeduldig. Egal wie oft sie die Augen schloss und wieder öffnete, oder wie sachte, oder energisch sie am Amulett herumdrückte, alles blieb unverändert. Als wäre die Szene ein Bild für die Ewigkeit, das von nun an nicht wieder verändert werden sollte.
Bitter enttäuscht stand Nathalie schließlich auf, machte auf dem Absatz kehrt, ohne noch ein einziges Mal zurückzublicken und lief so lange aufrecht in nächst bester Richtung los, bis die Dornen so stark an ihr rissen und zerrten, dass sie gezwungen war, stehenzubleiben und Atem zu holen.
Sie hatte ihren Talisman willentlich abgelegt und zurückgelassen. Als der Zorn sich im Augenblick des Verharrens von selbst verflüchtigte, bereute sie ihr Verhalten, das ihr wie ein Verrat an ihrem Vater erschien. Schuldig und mit hängendem Kopf schlich sie auf demselben Wege, den sie gerade gegangen war, zurück zu der Stelle, wo gerade das Sonnenlicht gleißend hell auf den Kanaldeckel schien. Das Silber des Amuletts schimmerte im Licht. Ohne noch Augen für die Schönheit des Moments zu haben, riss Nathalie das Amulett aus der Mulde und legte es samt Kette wieder um ihren Hals. In diesem Moment glitt der Deckel zur Seite und offenbarte eine in tiefste Schwärze mündende Röhre.
Nicht sicher, was sie bei dem Anblick fühlen oder denken sollte, umrundete Nathalie den Schacht wie eine Wildkatze, die ihre Beute umkreist. Wie oft passiert etwas Ungewöhnliches in ihrem Leben? Wie sehr hatte sie ein solches Ereignis herbeigesehnt? Und jetzt zögerte sie, trat zurück, fürchtete sich vor der Erfüllung ihrer Wünsche.
„Hoffe lieber nicht, dass etwas Unvorhergesehenes geschieht“, hatten ihre Zieheltern sie einmal gewarnt, als sie sich als junges Mädchen wieder einmal in der Enge ihres Zimmers gelangweilt hatte, „Denn es könnte schneller wahr werden, als du ahnst. Aber wenn es soweit ist, könnte es dir nicht gefallen.“
Für einen kurzen Augenblick erwog Nathalie die Möglichkeit, zum Haus zurückzugehen und ihre Entdeckung zu vergessen, die ihr vielleicht nichts als Ärger einbrachte. Allerdings wäre sie wahrscheinlich wie eine Angeklagte zurückgetrottet und ihr Ziehvater wäre als Richter vor ihr aufgetreten und hätte ihr das Geheimnis letztendlich doch entlockt. Und die Verteidigerin, ihre Ziehmutter, hätte zugehört und weggesehen.
Nur allzu schnell entschied Nathalie sich gegen das Eingeständnis ihrer Niederlage und Schwäche. Das Geheimnis gehörte ihr allein und wenn sie es behalten und würdigen wollte, musste sie es auch nutzen. Ganz gleich wie eigensinnig und stolz ihre Haltung hierin war, blieb das Amulett einzig und allein ihr Talisman. Der Weg, den er ihr wies, war ihrer. Aber war sie auch bereit ihn zu gehen war das letzte, was sie sich fragte, bevor sie sich vorsichtig mit den Füßen voran in das Kanalrohr hinabließ. Stufen gab es keine, deshalb fiel sie zuerst senkrecht nach unten und schlitterte dann, an die kalte Röhrenwand gepresst, um mehrere Kurven. Die Rutschpartie kam zu einem plötzlichen Stopp, als das Rohr endete und Nathalie auf moosigen Waldboden ausspuckte.
Benommen rappelte sie sich auf und taumelte, als die farbigen Sinneseindrücke rund um sie herum alle auf einmal auf sie eindrangen. Eine Weile saß sie einfach nur da, eingerollt wie eine Kugel, viel zu durcheinander, um eine Entscheidung zu treffen. Würde die bunte Kulisse noch da sein, wenn sie den Blick hob? Wie konnte etwas existieren, das von solcher Intensität war, das aus sich heraus leuchtete und strahlte? Was sie da vor sich hatte war kein blasses, ausgeblichenes Aquarell, sondern ein schillerndes Farbenmeer.
Die weite Lichtung auf der sie sich befand war umsäumt von Bäumen verschiedenster Art. Kräftige lebenshungrige Bäume, wie Nathalie sie noch nie gesehen hatte. Manche wuchsen senkrecht nach oben, andere waren ineinander verschlungen oder verzweigten sich schon nahe am Boden. Aber nicht nur die Bäume waren bewundernswert, sondern auch der Boden selbst, der vollständig von etwas grünem, weichen bedeckt war. Überall zwischen den Bäumen und größeren Pflanzen blühten Blumen in vielfältigsten Farben und Formen. Da waren fingernagelkleine, aber auch handtellergroße Blüten. Manche hatten viele Blütenblätter, manche waren rund, wieder andere waren zackig und spitz. Kelche, Trichter, Rosetten… All das kannte sie nur aus Büchern, die eine Welt abbildeten, die es für Nathalie nie gegeben hatte. Bald hatte sie jedes Zeitgefühl verloren und hätte nicht sagen können, wie lange sie dasaß und die Eindrücke ihrer Umgebung in sich aufsog. Sie war fasziniert von dem Anblick, der sich ihr bot, denn sie kannte nur die allmählich absterbenden Bäume und das wuchernde Gestrüpp aus dem Garten ihrer Zieheltern. Alles dahinsiechendes Leben, das verzweifelt auf seine Erlösung wartete. Das hier unterschied sich so sehr von dem, was sie gewohnt war. Leben lag in der Luft. Und Nathalie inhalierte es regelrecht. Leben duftete gut, es war ein gutes Gefühl.
Am liebsten wollte Nathalie darin versinken, sich liebkosen, sich trösten lassen, aber sie fürchtete, dass sie dann nie mehr in der Lage sein würde, sich loszureißen, wenn sie erst einmal zu lange davon gekostet hatte. Letztendlich siegten ihr starker Wille und ihre Neugier. Vorsichtig, um nichts zu zertreten, lief sie weiter, bis der Wald sich nach einiger Zeit lichtete und die Baumriesen nicht mehr dicht gedrängt, sondern verstreuter standen. Stattdessen erstreckte sich jetzt so weit das Auge reichte eine Ebene vor Nathalie. Ein Fluss schlängelte sich in seinem Bett; seine Windungen zogen sich bis zum Horizont hin. Wo die Sonne die Wasseroberfläche berührte, schimmerte das Wasser wie ein flüssiger Diamant.
Nathalie schlenderte zum Ufer hin und fasste mit der hohlen Hand ins Wasser und kostete davon. Es war so kristallklar wie sie sich Wasser nie hätte vorstellen können. Und es schmeckte nach Leben. Düster erinnerte sie sich an den Bach, der im Tal unterhalb ihres Hauses verlaufen war, bevor ihn eine der letzten Hitzewellen schließlich völlig hatte eintrocknen lassen. Sein schmutziges Wasser und der fauligbittere Geruch waren Boten der Verwesung und des Todes gewesen.
Ehrfurchtsvoll nahm sie noch einen weiteren Schluck, dann erhob sie sich, um weiterzulaufen. Sollte sie ihren Zieheltern von dieser paradiesischen Gegend erzählen oder sie ihnen gar zeigen? Das Wissen um dieses unverdorbene Land war kostbar und ihr war bewusst, dass sie ehrfurchtsvoll und klug damit umzugehen hatte. Aber das Geheimnis war nicht nur für sie da, sie durfte es bestimmt nicht für sich allein behalten und in Kauf nehmen, dass andere kränklich dahinsiechten, bis das Sterben sie von ihrem nichtswürdigen, trostlosen Dasein erlöste. Das Geheimnis, so fasste Nathalie es auf, musste ein Geschenk sein. Ein Geschenk, von dem erwartet wurde, dass sie es gerecht und umsichtig teilte. Wer aber sollte darüber entscheiden, was gerecht war und was nicht? Ihr Gedankengang wurde jäh unterbrochen, als sie angesprochen wurde.
„Seid gegrüßt, Fremde in einem fremden Land. Man nennt mich Xenia.“
Nathalie schrak zusammen, zum einen, weil die plötzlich erschienene Frau nicht durch das leiseste Geräusch zu bemerken gewesen war, zum anderen, weil Nathalie instinktiv Furcht verspürte. Vorsichtshalber zückte sie ihr Messer. Auch wenn die Frau nicht den Anschein erweckte, als gehöre sie zu den Plünderern, war ihr Aussehen doch beängstigend und auf der anderen Seite faszinierend gleichermaßen.
Die Frau lächelte nur, ein Lächeln, das sich am besten als eine Mischung aus Herablassung und einem überlegenen Charme beschreiben ließ.
„Ihr dürft nicht glauben, ich gehöre zu den Schwarzen. Ich weiß… Äußerlichkeiten… Ich tarne mich auf meine Weise. Aber zu bedeuten hat das nichts für Euch. Ich bin Euer Freund, vertraut mir.”
Zum Beweis hatte sie ihre leeren Hände vor der Brust erhoben und wartete auf Nathalies Reaktion, ohne sich zu nähern, oder zu entfernen.
Langsam gewann Nathalie die Fassung wieder und steckte ein wenig beschämt ihre Waffe weg. Möglichst unauffällig musterte sie ihr regloses Gegenüber von oben bis unten. Die Frau schien höchstens um die Dreißig sein, hatte schwarze lange Haare und war ganz in schlichtem dunkelbraun gekleidet. Dazu trug sie einen schwarzen Umhang über den Schultern, der von einer goldenen Brosche zusammengehalten wurde. Ihre Beine steckten bis zu den Knien in schwarzen Stiefeln, die eisenbeschlagene Spitzen aufwiesen. Nichts aber war so spektakulär und absonderlich wie das Gesicht. Anstelle ihres rechten Auges war dort eine Apparatur, die einem Auge ähnelte, aber mit winzigen Zahlen und Maßstrichen versehen war. Nathalie fand, dass es nach Schmerz aussah, was künstlich dort angebracht worden sein musste.
„Seid auch mir gegrüßt”, brachte sie endlich hervor und fügte anstandshalber hinzu: „Ich werde Nathalie genannt.”
Die andere nickte, nicht wie bei der Kenntnisnahme einer Neuigkeit, sondern eher wie bei der Bestätigung einer schon bekannten Tatsache. Nathalie musste sich zusammen reißen, um sich ihr wiederkehrendes Misstrauen nicht anmerken zu lassen. Entweder war sie hier erwartet worden, oder die andere machte sich nicht viel aus ihr und ihrem Namen. Da die Frau sich ihr als Xenia vorgestellt hatte, wurde zumindest scheinbar nicht erwartet, dass Nathalie ihren Namen im Vorab kannte. Nachdem Xenia zum Schluss gekommen zu sein schien, dass genug Zeit des Kennenlernens verstrichen war, streckte sie zögernd die Hand nach Nathalies Amulett aus. Bevor sie es allerdings anrühren konnte, ließ sie den Arm auf halber Höhe sinken. Doch ihre Augen ruhten unentwegt darauf, während sie wieder das Wort ergriff:
„Ihr seid also von drüben”, bemerkte sie und schielte mit dem intakten Auge kurz zu Nathalie.
„Von drüben?”
„Ja, aus der Welt der Menschen. Ist es nicht so?“
Nathalie starrte Xenia ungläubig an. „Das hier soll also eine andere Welt sein? Aber ich bin doch einfach durch ein Rohr gerutscht! Ein Kanalrohr, nichts weiter.”
Schon wieder lächelte Xenia geheimnisvoll.
„Welche Tarnung könnte sich als Zugang zu einer Parallelwelt besser eignen als ein Kanalrohr?“ Sie deutete mit einer bezeichnenden Geste in Richtung Amulett. „Den Schlüssel scheint Ihr ja jedenfalls zu besitzen. Aber um seinen Wert wisst Ihr wohl erst seit kurzem. Trotzdem… Ob Zufall oder Wissen, Ihr habt den Weg in diese Welt gefunden. Wie ist im Grunde unwesentlich.“
Ihre Mundwinkel zuckten unmerklich. Nathalie hatte keine Ahnung, was sie fühlen oder denken sollte. Sie war sich nicht einmal sicher, ob sie verstand, was die fremde Frau ihr zu sagen versuchte. Bevor sie ihre Gedanken auch nur annähernd ordnen konnte, fuhr Xenia fort: „Wer fragt schon, welcher der vielen Wege, die er zu Lebzeiten gewandelt ist, ihn letztendlich ins Paradies gebracht hat, solange er nur dort ist. Am Ende zählt, ob man das Ziel erreicht hat oder nicht. Der Weg spielt nur für die Gegenwart eine Rolle, für die Zukunft ist er absolut unerheblich.”
Was wusste die fremde Frau über ihren Talisman und woher, dachte Nathalie. Wusste sie etwas über ihren Vater? Vor Aufregung begann ihr Herz fast schon schmerzhaft in ihrer Brust zu schlagen.
„Ihr meint, der Kanaldeckel hat sich durch das Amulett öffnen lassen? Es funktioniert wie… eine Art von Schlüssel?”
Mit gespielter Gleichgültigkeit zuckte Xenia die Schultern. „Ja, vermutlich.”
Dann hob sie den Kopf und ihre Miene wirkte plötzlich angespannt. „Lauft!”, rief sie noch, als der Boden unter ihren Füßen zu beben begann. Lianenartige Greifarme schossen aus der Erde und wickelten sich wie lebendig gewordene Stahlseile erst um Nathalies Knöchel, dann wurde sie mehr und mehr von ihnen umwickelt, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Sie drückten ihren Brustkorb zusammen und nahmen ihr die Luft.
Sie werden mich erwürgen, dachte Nathalie, während sich die Dämmerung in ihrem Gehirn ausbreitete. Ich werde meine Zieheltern und mein Zuhause nie wieder sehen! Ich werde gestorben sein, ohne den Versuch gemacht zu haben, zu helfen die Welt zu verbessern und jemand zu sein.
„Xenia!”, schrie sie gepresst. „Helft mir!”
Diese war bereits unaufgefordert an ihre Seite gekommen und versuchte Nathalie nach oben zu ziehen, merkte aber, dass dieses Unterfangen sinnlos war. Jede menschliche körperliche Kraft war gegen den Würgegriff der Schlingpflanze machtlos. Als nächstes versuchte sie die Lianen abzuwickeln, doch neue Schlingen krochen rasend schnell heran und ersetzten die alten, zahlreicher als zuvor. Als hätte sie den frustrierenden Kampf aufgegeben, wandte Xenia sich ab und entfernte sich mit langsamen Schritten und bedächtig gesenktem Kopf.
Mit letzter Kraft streckte Nathalie einen Arm nach der fremden Frau aus, der sie nach ihrer eigenen Aussage hatte Vertrauen sollen. Im Moment der schwersten Enttäuschung schloss sie die Augen und spürte wie ihr Körper vor Verzweiflung und Schwäche zitterte.
Als sie jedoch wieder aufsah, fixierte Xenias Blick sie. Kalt und ausdruckslos. Dann vollführte jene mit einer der behandschuhten Hände geschmeidig eine halbe wellenartige Drehung und richtete die Handfläche auf die Stelle über dem Boden, an der die Schlingen einem Knotenpunkt zu entspringen schienen. Ein blasser blauer Lichtstrahl zuckte aus der geöffneten Hand und traf die sich windende Masse aus Greifarmen. Es zischte und diese fuhren wie unter größten Schmerzen sofort zurück und ihre Ausleger ließen Nathalie frei als hätten sie sich an ihr soeben verbrannt. Alle übrigen Schlingen zogen sich unter die Erde zurück, während Erdklumpen bei dem hastigen Rückzug durch die Luft flogen. Ausschließlich das aufgewühlte Erdreich zeugte von den jüngsten Ereignissen. Ein Geruch nach verbranntem Fleisch lag in der Luft.
Mit unverändert ausdrucksloser Miene zerrte Xenia die stoßweise atmende Nathalie auf die Beine und nutzte die Gelegenheit, die Menschenfrau einer gründlicheren Musterung zu unterziehen. Sie schätzte sie einige Jahre jünger als sie selbst. Sie war sehr zierlich, trug Kleidung, die kaum mehr als solche zu erkennen war. Ihr Gesicht, eingerahmt von braunen schulterlangen Haaren, barg eine sonderbare Wildheit. Ihre Gesichtsfarbe wirkte dagegen krank, viel zu blass. Ansonsten gab es eigentlich nichts auffälliges, das sie von anderen jungen Frauen dieser Welt unterschieden hätte. Wäre da nicht der Talisman über ihrem Dekolleté, der sie sofort verriet.
Im Grunde hatte Xenia ihre Magie nicht offenbaren wollen, nicht so kurz nach der ersten Begegnung, nicht jetzt, vielleicht sogar nie, wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Doch der unpassende Zwischenfall hatte ihr keine andere Wahl gelassen, er hätte einen vorzeitigen Tod der Menschenfrau bedeutet, und das wäre noch wesentlich unpassender gewesen. Jetzt musste sie das Beste aus der Situation machen und Nathalies Vertrauen möglicherweise von neuem gewinnen.
„Wir sollten uns ein sicheres Lager suchen, solange die Sonne noch scheint und uns noch Zeit bis zum Einbruch der Dämmerung bleibt. Diese Gegend scheint auf den ersten Blick friedlich, aber auch hier existieren Lebewesen, die zu einer ernsthaften Gefahr werden können. Es hat Euch angegriffen, Menschenfrau, weil es spürt, dass Ihr fremd seid. Eure Ankunft ist nicht unbemerkt geblieben.“
Zunächst reagierte die Angesprochene nicht. Obwohl sich der erste Schock gelegt hatte, war Nathalie tief in Gedanken versunken. Xenias Worte waren wie aus weiter Ferne zu ihrem Bewusstsein durchgedrungen und hatten gleich die nächsten Fragen aufgeworfen. War sie tatsächlich angegriffen worden, weil sie aus einer anderen Welt stammte, oder vielmehr, weil sie etwas von großem Wert bei sich trug…?
Ohne eine Reaktion abgewartet zu haben, war Xenia bereits losgelaufen. Es schien für sie eine Selbstverständlichkeit, dass Nathalie ihr folgte. Mit vor der Brust verschränkten Armen stapfte Nathalie hinterher. Es ärgerte sie ein wenig, dass Xenia so offensichtlich nicht nach ihr umsah, aber ihr andererseits nichts anderes übrigblieb, als ihr trotzdem zu folgen. Ohne die fremde Frau war sie völlig allein in einer unbekannten, gefährlichen Welt. Obwohl sie sich nicht sicher war, ob sie vor Xenia weniger Angst haben sollte. Was genau war es, dass sie getan hatte, um sie aus dem Würgegriff der Schlingpflanze zu befreien? Etwas, was Nathalie nicht verstand. Es blieb ihr nichts übrig, als mehr über Xenia und ihre Welt in Erfahrung zu bringen, wenn sie lebend zurückkehren wollte.
Zurück wohin, sagte eine leise Stimme in ihrem Inneren. Zurück zu der Familie, die sie nie gehabt hatte? Zurück in eine Welt, die nicht weniger gefährlich war? Zurück in eine tote Welt? Zurück zu Menschen, denen sie zumindest eine Erklärung schuldig war, befand sie schließlich und bemühte sich dann zu Xenia aufzuschließen.
„Was war das, diese Schlingpflanze? Was wollte sie ausgerechnet von mir? Schaut nicht schon wieder weg! Ich weiß, dass ich Euch meine Rettung zu verdanken habe.“
„Nein, Ihr habt keine Ahnung”, beschied ihr die andere ungewöhnlich gereizt.
„Das ist vielleicht richtig”, bestätigte Nathalie und schloss zu Xenia auf. „Aber ich habe das blaue Licht aus Eurer Hand gesehen. Damit habt Ihr sie vertrieben.“
Für einen Moment war Xenia abrupt stehen geblieben, ihr gesundes Auge funkelte.
„Denkt Ihr, Ihr habt ein Recht auf Wahrheit?“
Nach einem langen Moment fuhr sie mit milderer Stimme fort: „Diese Schlingpflanze nennt man Würger, weil sie ihre Beute, wie Ihr sicher nur zu gut gemerkt habt, würgen, bis sie erstickt. Es sind Pflanzen, obwohl sie keine Blätter ausbilden. Stattdessen haben sie eine Art Knotenpunkt, dem alle Schlingarme entspringen. Dort befindet sich auch der Schlund, über den sie die Beute aufnehmen und im Inneren verdauen. Sie lauern unter der Erde und spüren selbst feinste Erschütterungen. Normalerweise greifen sie keine größeren Lebewesen an.”
Nathalie runzelte unzufrieden mit der Antwort die Stirn. Xenia hatte ihr nicht alles gesagt, das stand fest. Warum verbarg sie etwas? Es musste mehr dahinterstecken, als Xenia sie glauben machen wollte.
„Aber das Licht…”, setzte sie deswegen an, wurde jedoch sofort unterbrochen.
„Es ist nicht gut, zu viel zu wissen. Auch wenn es eine Eigenart von euch Menschen ist, alles zu ergründen und zu hinterfragen. Gebt Euch zufrieden mit dem was ihr wisst, oder eben nicht wisst!”
Dabei klang ihre Stimme gefährlich scharf und leise. Ihr Gesicht hatte einen sonderbaren Ausdruck angenommen, den Nathalie nicht zu deuten wusste. Betroffen schwieg sie, um den Streit nicht zu vertiefen. Schließlich war sie von der fremden Frau abhängig, wollte sie mehr herausfinden und anschließend je den Weg zurückfinden.
Allmählich verlangsamte Xenia ihr Tempo und sie wanderten schweigend nebeneinander, dem Fluss folgend über die Ebene, bis es anfing zu dämmern. Als dann die Sonne am Horizont fast völlig versunken war, erschrak Nathalie unwillkürlich, als ihr bewusst wurde, was das bedeutete: Sie hatte sich vorgenommen, bis zum Mittag zurück im Haus zu sein. Stattdessen hatte sie sich von dieser wundersamen Welt vereinnahmen lassen und nur ihr eigenes Ziel verfolgt. Wie hatte sie ihrer Selbstsüchtigkeit erliegen und ihre Zieheltern vergessen können, die ihr gesamtes bisheriges Leben für sie dagewesen waren? Sie wussten nicht einmal wo sie war. Sie würden davon ausgehen müssen, dass ihr etwas zugestoßen oder sie weggelaufen war. Wie konnten sie ihr verzeihen, wenn sie eines Tages wie eine verlorene Tochter vor der Tür stand, mit schlechtem Gewissen und mit dem Herzen schwer von einem Geheimnis, das sie möglicherweise nicht teilen konnte?
„Jetzt ist es zu spät, um umzukehren“, erwiderte Xenia knapp als ihre Blicke sich begegneten. „Es sei denn Ihr wollt den Würgern ein weiteres Mal begegnen. Davon abgesehen, dass in der Nacht noch ganz andere Geschöpfe unterwegs sind. Ihr fallt zu sehr auf. Sie werden Euch überall aufspüren, sobald Ihr alleine reist.”
Keine Diskussion. Es war also entschieden, dass Nathalie ihre Gefährtin nicht verlassen und eine Nacht in dieser Welt verbringen würde. Im stummen Einvernehmen, so weit zu kommen wie irgendwie möglich, zogen sie weiter, bis schließlich nach einer schieren Ewigkeit eine Häusergruppe in Sicht kam. Abrupt hielt Xenia inne und blickte in Richtung der Ansiedelung. Mit bloßem Auge konnte man auf diese Entfernung im Dämmerlicht nicht viel ausmachen. Doch Xenia schien sich nicht daran zu stören. Ihr menschliches Auge hielt sie zu einem schmalen Schlitz zugekniffen, während dagegen winzige Lichter an ihrer Metalllinse blinkten und die Rädchen und Symbole stetig in Bewegung waren. Konzentriert, aber ohne große Anstrengung zoomte ihr Spezialauge das Bild des Dorfes heran, bis sie direkt vor die einzelnen Häuser sah. Vereinzelt erkannte sie das ein oder andere Licht, das seinen Schein durch die Fenster warf. Eilig scannte sie die Umgebung nach Bewegungen ab. Keine Aktivitäten außerhalb der Häuser, weder Freund noch Feind schienen an diesem stillen Abend unterwegs zu sein.
Die Menschenfrau war angekommen und sie hatte den Talisman umhängen, dessen Energie wie ein Leuchtfeuer pulsierte. Die Welt hielt den Atem an.
„Sollten wir das Dorf erreichen, bevor es vollkommen dunkel ist, werden wir dort übernachten”, beschloss Xenia und reichte der fröstelnden Nathalie ihre behandschuhte Hand. Sonderbare Geräusche drangen an ihre Ohren, deren Ursprung Nathalie lieber unergründet ließ. Ihre Furcht davor, die hereinbrechende Nacht ungeschützt im Freien verbringen zu müssen, ließ sie unwillkürlich schneller gehen. Auch wenn sie nicht überzeugt war, Xenia vertrauen zu können, war sie doch froh um die starke Hand, welche ihre fest gedrückt hielt.
Dem strammen Marschtempo war es zu verdanken, dass sie ihr Ziel erreichten und nicht in der offenen Landschaft lagern mussten. Tatsächlich war im Dorf niemand unterwegs, was Nathalie bei den grauenvollen Lauten, die in der anbrechenden Nacht plötzlich von überall zu hören waren, allerdings nicht sonderlich verwunderte. Eilig folgte sie ihrer Führerin, die auf ein etwas größeres Haus mit einem Schild über dem Eingang zusteuerte. Die Anschrift konnte Nathalie nicht entziffern, weil es bereits zu dunkel geworden war. Immerhin schien Xenia zu wissen, was sie tat.
Trotzdem wurde Nathalie ihr mulmiges Gefühl nicht los, als jene an der fremden Türe klopfte. Wer wusste, wo sie hingeführt worden war? Und was mochte sie hinter der grob gearbeiteten Holztür erwarten? Ob ihre Bedenken nun begründet waren oder nicht, würde sie selbst herausfinden müssen. Aber ein gewisses Maß an Vorsicht konnte sicherlich nicht schaden, wenn sie nicht wieder unangenehme Überraschungen erleben wollte. Wie ein scheues Tier tänzelte sie an ihrem Platz hin und her. Mit einem raschen Griff an ihren Gürtel überzeugte sie sich davon, dass ihr Messer noch an seinem Platz war.
Ihre eigenen Augen spielten ihr Streiche und sie sah, wie sich die Tür von selbst öffnete und finstere Gestalten, bis an die Zähne bewaffnet dahinterstanden und sie erwarteten, um sogleich über sie herzufallen. In gewisser Weise ähnelte ihr Aussehen dem der Plünderer, die vor kurzem sie und ihre Eltern bedroht hatten.
„Nein.”, beschwichtigte sich Nathalie mit einem leisen Murmeln. Sicher war es nicht das, was sie hier erwartete.
Erst nach einiger Zeit schlurften schwere Schritte heran, ein Schlüssel drehte sich unendlich langsam im Schloss und die Tür wurde ein Stück weit geöffnet. Ein feistes Gesicht schob sich hinaus und musterte die Fremden von oben bis unten, während die Szene von einer brennenden Kerze erhellt wurde, die der Mann in einer Hand hielt. Er hatte eine dunkle Stimme und klang alles andere als erfreut als er sich an Xenia wandte.
„Ihr wirkt für meinen Geschmack etwas zu dunkel, fremde Lady. Ich hoffe für Euch, dass das nichts mit Eurer Gesinnung zu tun hat.“
Xenias Augen wurden zu schmalen Strichen. „Habt Ihr etwas an meiner Wegkleidung auszusetzen? Oder glaubt Ihr mich gar den Schwarzen zugehörig? Allein die Anmaßung einer derartigen Vermutung! Ihr Unverschämter!”
Nathalie konnte aus der Erwiderung den Ärger, der darin mitgeschwungen hatte überdeutlich heraushören und sie fragte sich, wie der Mann wohl reagieren würde. Diesmal schüttelte dieser bestürzt den Kopf.
„Nein, nein, Lady. So etwas würde ich nie wagen. Selbstverständlich nicht. Bitte versteht mich nicht falsch. Ihr wisst doch, dass man in diesen Tagen ganz besonders achtsam sein muss. Auf keinen Fall wollte ich Euch kränken”, fügte er hastig hinzu. „Nur eines noch…, bevor ihr meine Stube betretet, zeigt mir beide eure Hände, bitte. Reine Vorsichtsmaßnahme, nichts weiter, ihr versteht.”
Fragend sah Nathalie zu Xenia auf, aber ihr Blick blieb unerwidert. So streckte sie dem ungeduldig wartenden Mann einfach ihre blanken Hände entgegen.
Er nickte bloß knapp und inspizierte dann Xenias schwarze Handschuhe. Obwohl er damit sichtlich unzufrieden schien, traute er sich offensichtlich nicht weitere unangenehme Fragen zu stellen, noch wagte er, die unheimliche Frau, mit der merkwürdigen Apparatur über einem ihrer Augen, aufzufordern, die Handschuhe auszuziehen. Stattdessen nickte er nochmals und wies die beiden Frauen mit einer ausladenden Geste an, das Haus endlich zu betreten. Sie folgten ihm in eine geräumige Stube, die vom Schein zahlreicher Kerzen erhellt wurde.
Der Mann, der offenbar der Wirt des Gasthauses war, verschwand hinter einer hohen Holztheke und überreichte Xenia einen Zimmerschlüssel. Als er ihn in ihre geöffnete Hand fallen ließ, zitterte er. Seine Augen waren die ganze Zeit über an Nathalie geheftet, als flehte er sie an ihm zu bestätigen, dass er in dieser Nacht nicht den größten Fehler seines Lebens gemacht hatte. Und Nathalie wünschte in diesem Augenblick nichts sehnlicher, als dass sie ihm diese Sorge nehmen könnte. Doch da sie die Wahrheit nicht wusste, wandte sie sich ab und ging mit gesenktem Haupt hinter ihrer Gefährtin her.
Im Vorbeigehen erhaschten sie einen kurzen Blick auf die Schankstube, bevor sie ihr ganz am Ende des langen Flures gelegenes Zimmer erreichten. Einige der Gäste sahen in ihre Richtung, andere waren in laute Gespräche vertieft und nahmen keinerlei Notiz von ihnen. Viele waren über große Krüge gebeugt, die auf den Tischen standen und mit einer dampfenden Flüssigkeit gefüllt waren. Die meisten Männer waren in bunte Gewänder gehüllt, wie sie auch der Wirt an hatte. Manche trugen aber auch schlichte Reisekleidung. Am auffälligsten fand Nathalie jedoch, dass keine Frau in der Gesellschaft zugegen war. Schon waren sie vorbei und schritten den spärlich erhellten Gang entlang.
Als sie gerade dabei waren, die Türe ihres Zimmers hinter sich zu schließen, wünschte der Wirt, der den beiden Frauen nervös ein Stück weit nachgelaufen war, eine gute Nacht, dann eilte er hastig zur Theke zurück, wo er sich vor Erschöpfung auf einen Barhocker fallen ließ. Schweißperlen rannen von seiner Stirn und er war äußerst froh, dass die Neuankömmlinge ihr Zimmer nicht noch einmal verließen, um den Schankraum aufzusuchen. Selbst wenn ihm dabei ein Geschäft entging, war es ihm so tausendmal lieber, als den unheimlichen Frauen nochmal gegenüber treten zu müssen.
Er hätte selbst nicht sagen können woher seine Furcht rührte. Nur eines wusste er mit Sicherheit: Dass die fürchterlichen Gerüchte, die täglich im Schankraum die Runde machten seine angekratzten Nerven nicht gerade besänftigten.
Kapitel 2
-Verbindungen-
Das Zimmer in dem Nathalie sich wieder fand, war spartanisch eingerichtet und beinhaltete nicht mehr als zwei schmale Einzelbetten und einen kleinen Schrank mit integriertem Spiegel. Da Xenia bereits eines der Betten für sich auserkoren hatte, ließ sie sich auf das frei gebliebene sinken. Leise löschte Xenia die beiden Kerzen in den Glaslaternen, dann legte sie sich noch immer angekleidet unter die sauberen Laken. Sie hatte sogar darauf verzichtet, ihre Stiefel auszuziehen. Mit einem mulmigen Gefühl spähte Nathalie in die Dunkelheit, die ihr viel dichter und schwerer vorkam, als gewöhnlich. Es war nicht schwer zu erraten, dass Xenia jederzeit aufbruchsbereit sein wollte. Als ob sie mit dem schlechtesten aller Fälle rechnete. Vielleicht keine unsinnige Rechnung, entschied Nathalie und tat es dem Beispiel ihrer Begleiterin gleich.