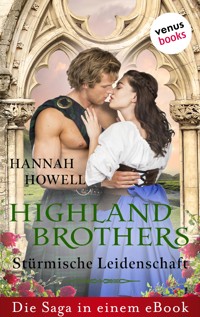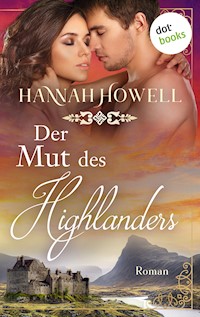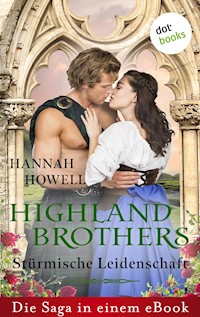4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Herrlich romantisch und hinreißend sinnlich! Die schottischen Highlands, Ende des 14. Jahrhunderts. Es sind dunkle, kriegerische Zeiten... Kurz vor ihrer Hochzeit wird die schöne, furchtlose Ailis vom feindlichen Clan der MacDubhs entführt. Doch bald schon entbrennt zwischen deren Anführer, dem starken und attraktiven Clan-Chief Alexander MacDubh, und der stolzen Ailis eine heftige Leidenschaft. Bis die beiden ungleichen Liebenden sich jedoch für immer vereinen können, ist ihre Liebe zahlreichen Gefahren ausgesetzt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Ähnliche
Hannah Howell
Stürmische LeidenschaftRoman
Ins Deutsche übertragen von Ursula C. Sturm
Edel Elements
Erstes Kapitel
Schottland, 1375
»Trinken wir auf die Braut, die unsere Clans schon bald vereinen wird!«
Ailis MacFarlane, der dieser Trinkspruch galt, verengte die dunkelbraunen Augen zu Schlitzen und ließ den Blick über die Männer schweifen, die um den Haupttisch im großen Saal von Leargan saßen. Es kostete sie erhebliche Mühe, die wütend zusammengepressten Lippen zu öffnen, um widerwillig einen Schluck Wein aus dem reich verzierten Becher zu nehmen. Die Knöchel zeichneten sich weiß an ihren langen, schlanken Fingern ab, so fest hielt sie den Pokal umklammert. Unter dem schweren, von Gobelin bedeckten Eichentisch klopfte sie verärgert mit der Fußspitze auf den Boden. Es drängte sie, ihrer Empörung Luft zu machen. Doch keiner der Männer, die hier in aller Ruhe Trinksprüche auf sie ausbrachten und Zukunftspläne für sie schmiedeten, beachtete sie oder ihre wachsende Entrüstung.
Ob sie ihr wohl Beachtung schenken würden, wenn sie aufstünde und ihre Wut lauthals herausschrie? Wahrscheinlich nicht. Man kümmerte sich kaum jemals um Ailis oder ihren Gemütszustand. Sie bedachte Donald MacCordy mit einem zornigen Blick.
Der Grund für die zunehmend feucht-fröhlichen Feierlichkeiten war ihr Verlöbnis mit ebendiesem Mann, dem ältesten Sohn und Erben des Gutsherrn von Craigandubh; eine Verbindung, die das Waffenbündnis zwischen den beiden Clans zweifellos festigen würde. Künftig würden die MacFarlanes und die MacCordys Seite an Seite gegen ihre immer zahlreicheren Feinde kämpfen.
Die beiden Clans waren einander seit Jahren freundschaftlich verbunden und gelegentlich sogar zu Hilfe geeilt. Diese Verbindung sollte nun bald ungleich stärker werden – durch ein gemeinsames Erbe und reiche Nachkommenschaft. Bis jetzt, dachte Ailis voller Verbitterung, waren glücklicherweise noch keine Nachkommen gezeugt worden – und das trotz Donalds wiederholten hartnäckigen Versuchen, ihrer habhaft zu werden, sobald sie allein waren.
In den vergangenen Tagen hatte es sie einige Mühe gekostet, ihrem künftigen Gemahl aus dem Weg zu gehen. Im Gegensatz zu ihrem Verlobten war sie fest entschlossen, den schicksalhaften Tag, an dem dieser lüsterne Kerl eine Frau aus ihr zu machen gedachte, noch möglichst lange hinauszuzögern. Seine aufdringlichen Hände waren wieselflink und stets feucht vor Schweiß, und seine allzu prallen Lippen erinnerten sie an die in der Heilkunde so viel gepriesenen Blutegel. Als erneut ein Trinkspruch auf die angehenden Brautleute ausgebracht wurde, hob Ailis ihren Becher und wünschte flüchtig, er möge Gift enthalten. Doch dafür hing sie viel zu sehr am Leben – selbst wenn sie es an Donald MacCordys Seite verbringen müsste.
Ihr war bewusst, dass sie mit ihren zwanzig Jahren längst verheiratet sein sollte. Ihr Onkel und Vormund, selbst kinderlos geblieben, hatte lediglich einen Bruder gehabt, und Ailis war dessen einziges überlebendes Kind. Daher würde sie vermutlich irgendwann Leargan, das kleine, aber prosperierende Gut ihres Onkels erben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Una, die bedauernswerte neue Frau ihres Onkels, ihm einen Erben schenken würde, schwand nämlich mit jedem Tag, an dem die hübsche, geistig aber etwas schlichte junge Frau unter Colin MacFarlanes Knute stand. Daher hießen die MacCordys – schon dank der verheißungsvollen Aussicht auf Leargan, aber auch in dem Bestreben, das Bündnis mit den MacFarlanes zu stärken – Ailis bereitwillig als Braut ihres zukünftigen Anführers willkommen.
Mit einem Mal kam Ailis ein erschreckender Gedanke: Bei all den Debatten um ihre Hochzeit und Mitgift, um die Aufteilung der Gemächer und die Zukunft der Clans waren kein einziges Mal ihre beiden Neffen und die Nichte erwähnt worden. Seit dem Tod ihrer Schwester Mairi vor zwei Jahren hatte sich Ailis um die drei Kinder gekümmert, die einer sechs Jahre währenden Liaison mit einem wilden Unbekannten entsprungen waren. Die siebenjährigen Zwillingsbrüder Rath und Manus und ihr Schwesterchen Sibeal waren für Ailis die einzige Freude im Leben. Was, wenn man ihr nicht erlauben wollte, weiterhin für die Kinder zu sorgen? Sie musste sich umgehend Gewissheit verschaffen.
»Onkel, was geschieht mit den Kindern meiner Schwester?«, fragte sie.
»Die Kinder haben wir in unseren Plänen bedacht«, antwortete Colin MacFarlane in kühlem, ruhigem Tonfall.
Die ausweichende Antwort, gepaart mit Donalds verdächtigem Lächeln, erregte sogleich ihr Misstrauen. »Ich erwarte ja gar nicht, dass man ihnen jeden Wunsch von den Augen abliest. Aber ich möchte mich weiterhin um sie kümmern, wie ich es meiner Schwester gelobt habe.«
»Wir sind uns deines Versprechens bewusst, Ailis. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf.«
Damit wandte sich Colin von seiner Nichte ab und widmete sich wieder dem Saufgelage. Ailis fluchte im Stillen. Kurz darauf erhob sie sich unauffällig und begab sich in ihre Gemächer. Den Feierlichkeiten weiter beizuwohnen wäre ihr vorgekommen, als tanze sie auf ihrem eigenen Leichenbegängnis. Alle dort unten wussten, dass sie buchstäblich mit dem Rücken zur Wand stand, und sie wussten auch, dass sie lieber den Teufel höchstpersönlich zum Gemahl nehmen würde als diesen Donald MacCordy.
»Wenn ich es mir recht überlege, ist Donald MacCordy wohl der Teufel«, murrte sie, als sie vor der Tür zu der kargen Kammer stand, in der ihr Onkel Mairis Kinder untergebracht hatte.
Es war ein kleines, feuchtes Loch, und selbst das gestand Colin MacFarlane den dreien nur äußerst widerstrebend zu. Er pflegte die Kinder ›das Bastardtrio‹ zu nennen. Manchmal musste sich Ailis sehr an sich halten, um diesem Mann keine Gewalt anzutun, denn sein Betragen den dreien gegenüber grenzte an schierer Grausamkeit. Dabei hatten sie weiß Gott genug durchgemacht. Aber anstatt die Kleinen auf Leargan zu verwöhnen und zu trösten, wurden sie von diesem gefühlskalten, herzlosen Mann in eine winzige, eiskalte Kammer gesteckt, und Ailis musste es hilflos mit ansehen. Sie hatte ein oder zwei Mal versucht, sie in ihren eigenen behaglichen Gemächern einzuquartieren, aber ihr Onkel hatte die Kinder stets brutal von dort vertrieben, ›da ihr Bräutigam es bestimmt nicht schätzen würde, wenn es in den Räumlichkeiten des Brautpaares vor ledigen Bälgern nur so wimmele‹. Ailis war nichts anderes übrig geblieben, als ihren Zorn hinunterzuschlucken und alles beim Alten zu belassen, denn die ständigen Zankereien und Tiraden waren für die Kinder weit schwerer zu ertragen als ihre schäbige Behausung.
Als sie nun leise in das Zimmer trat, blickte Ailis wie so oft von einem Kind zum nächsten und suchte darin einen Hinweis auf ihren unbekannten Vater. Mairi war von ihrem Geliebten derart besessen gewesen, dass sie sich von nichts und niemandem davon hatte abhalten lassen, ihn zu treffen. Nach dem Tod ihres Vaters hatte es denn auch keiner mehr versucht. Seit die Zwillinge zur Welt gekommen waren, hatte man sich allmählich damit abgefunden, dass Mairi nicht mehr verheiratet werden konnte. Nur ein einziges Mal hatte sich Ailis so weit erniedrigt, Mairi auf dem Weg zu einem Stelldichein zu folgen, und sich dabei hoffnungslos verirrt. Und obwohl die beiden Schwestern sich sehr nahe gestanden waren, war jeder Versuch, Mairi den Namen des geheimnisvollen Unbekannten zu entlocken, vergeblich geblieben.
Doch so sehr Ailis ihre Schwester auch vermisste – es war wohl das Beste, dass Mairi noch vor ihrer Mutter gestorben war, ehe die Schreckensherrschaft ihres Onkels Colin überhaupt begonnen hatte. Mairi hatte Schande über die Familie gebracht, und abgesehen von ihrer Mutterliebe hätte sie dem Groll ihres allzu stolzen Onkels nichts entgegenzusetzen gehabt. Zweifellos hätte Colin MacFarlane seiner liebeskranken, ehrlosen Nichte das Leben bei jeder sich bietenden Gelegenheit vergällt. Die empfindsame Mairi hätte ihre Kinder vor seiner Gehässigkeit auch nicht besser schützen können, als Ailis es nun tat.
Sie erwiderte das Lächeln der drei leicht abwesend und musterte die Zwillinge prüfend. Sie hatte das untrügliche Gefühl, in ihren Gesichtern am ehesten einen Hinweis auf ihren Vater finden zu können. Es waren zwei ansehnliche Knaben mit tiefblauen Augen und seidigem schwarzem Haar, genau wie sie selbst und Mairi es hatten. Die Augen und die schmalen Gesichter dagegen mussten sie von ihrem Vater geerbt haben. Die kleine Sibeal hatte rotblondes Haar – noch ein Hinweis? Ihre großen braunen Augen und das ovale Gesichtchen erinnerten stark an Ailis und Mairi. Was Ailis Kopfzerbrechen bereitete, war die Tatsache, dass alle ihr bekannten Männer, denen die Kinder ähnelten, zu den Widersachern der MacFarlanes gehörten. Mit einem dieser Clans, den MacDubhs, bekriegte sich ihre Familie erbittert, seit Colin MacFarlane den MacDubhs vor Jahren ihre Burg Leargan geraubt hatte. Ailis seufzte. Es war schon schlimm genug, dass ihre Schwester sich auf eine Affäre mit einem verheirateten Mann eingelassen hatte. Nicht auszudenken, wenn er auch noch zu ihren Todfeinden zählte! Sie schob den beängstigenden Gedanken beiseite und beugte sich über die Kinder, um ihnen einen Gutenachtkuss zu geben.
»Musst du wirklich Donald MacCordy heiraten, Tante?«, fragte Manus, während Ailis ihn zudeckte.
»Ja, mein Junge. Dieses furchtbare Schicksal lässt sich leider nicht abwenden.«
»Bist du sicher?«
»Ganz sicher. Ich habe viel und lange darüber nachgedacht. Ich habe keine andere Wahl.«
»Ich mag Donald MacCordy nicht«, flüsterte Sibeal. »Er verabscheut uns aus ganzem Herzen, das spüre ich.«
Ailis bemühte sich, den Worten des ernsthaften kleinen Mädchens nicht zu viel Bedeutung beizumessen. »Nun, mein Schatz, Männer sind immer befangen, wenn es um die Kinder eines Rivalen geht, das ist nichts Außergewöhnliches.« Doch die Kleine schenkte dieser Erklärung sichtlich genauso wenig Glauben wie sie selbst.
Eine halbe Stunde später lag auch Ailis im Bett, wälzte sich aber zu ihrem Unmut lange unruhig hin und her. Sibeal hatte Recht – bei Donald würden die Kinder keinen leichten Stand haben. Genau genommen musste sie sogar befürchten, dass Donald sie abgrundtief hasste. Er war mit Mairi verlobt gewesen, als deren verbotene Liebesbeziehung ans Licht gekommen war. Außerdem wusste Donald womöglich, wer Mairis Geliebter gewesen war, und verabscheute die Kinder aus diesem Grund nur noch mehr. Nur wie sollte sie ihm dieses Wissen entlocken?
Da riss ein Geräusch sie aus ihren Grübeleien. Blitzschnell wurde ihr klar, dass jemand verstohlen ihre Tür öffnete. Ailis griff nach dem Dolch, der sie überall hin begleitete und nun unter ihrem Kissen lag. Als die schemenhafte Gestalt an ihre Bettstatt trat und sich über sie beugte, stieß sie dem nächtlichen Besucher die Klinge tief in den Arm, zog sie mit einer raschen Bewegung wieder heraus und sprang gewandt aus dem Bett. Auf den Schmerzensschrei des Mannes hin stürmten sogleich mehrere Leute mit Kerzen in den Händen in ihre Kammer. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem nächtlichen Angreifer um Donald, was Ailis nicht im Geringsten überraschte. Er lag auf dem Boden, hielt sich den heftig blutenden Arm und brüllte wie am Spieß. Sie musterte ihn verächtlich, während sein Vater, sein Bruder und sein Cousin ihm zu Hilfe eilten.
»Du törichtes Frauenzimmer! Was, zum Teufel, hast du dir dabei gedacht, deinen künftigen Gemahl abschlachten zu wollen?«, bellte Colin MacFarlane. Er holte aus, doch sie hatte seinen schnellen, groben Schlag bereits erwartet, wich ihm geschickt aus, indem sie sich hinter den Bettpfosten duckte, und erwiderte seinen wütenden Blick.
»Du hättest ihn umbringen können!«
»So würde ich mit jedem Mann verfahren, der sich in tiefster Nacht in meine Kammer schleicht!«, fauchte sie. »Er hat kein Recht, hier zu sein.«
»Er kann es eben kaum noch erwarten«, murrte Donalds Vater. »Deswegen musst du ihm doch nicht gleich den Arm abhacken!«
»Ihr übertreibt. Es ist lediglich eine Fleischwunde, auch wenn er brüllt wie ein kastrierter Bulle. Und wenn er mir nichts Böses wollte, dann hätte er eben eine Kerze mitbringen und sich ankündigen sollen, anstatt wie ein Dieb hereinzuschleichen.«
Ailis konnte nicht fassen, dass man ihren Worten keinen Glauben schenken wollte.
Als das Spektakel schließlich vorüber war und sie wieder allein in ihrem Bett lag, schob sie erschöpft den Dolch unter ihr Kissen zurück. Zum Glück hatte ihr Onkel in seiner Erregung vergessen, ihn ihr wegzunehmen. Die Waffe würde ihr noch gute Dienste leisten, wenn es darum ging, den lüsternen Donald in seine Schranken zu verweisen. Sie verfluchte den Kerl im Geiste und schmiegte sich dann seufzend unter die Decken, fest entschlossen, sich von ihren Sorgen nicht den Schlaf rauben zu lassen.
»Was bist du nur für ein Narr!«, knurrte Duncan MacCordy, der feiste Gutsherr von Craigandubh, während er in seiner Kammer die Wunde seines Sohnes versorgte. »Ailis hätte dich töten können. Es ist doch wohl selbstverständlich, dass sie sich verteidigt, wenn sich jemand im Dunkeln an sie heranschleicht wie ein Dieb! Willst du mit deiner Geilheit nach diesem Weib all unsere Pläne vereiteln?«
»Woher sollte ich denn wissen, dass sie gleich einen Dolch zur Hand hat?« Donald bedachte seinen Cousin Malcolm, der leise lachte, mit einem bitterbösen Blick. » Das wird sie mir in der Hochzeitsnacht büßen! Ich werde sie mir vorknöpfen, dass ihr Hören und Sehen vergeht, genau wie ich es schon mit ihrer Schwester, dieser Hure, hätte tun sollen!«
»Mairi mag zwar eine Hure gewesen sein, aber sie hat uns damit das bestmögliche Werkzeug für Erpressung und Rache geliefert«, sagte Duncan. »Und bald bleibt der lieben Ailis nichts anderes mehr übrig, als sich uns zu fügen.« Er rieb sich erwartungsvoll die fleischigen Hände.
William, der jüngere Sohn des Gutsherrn, der von einfachem Gemüt war, runzelte die Stirn und fuhr sich nachdenklich mit der Hand über das Kinn. »Und du bist sicher, dass der alte Colin MacFarlane nicht weiß, wer die Kinder gezeugt hat?«
»Darauf verwette ich sogar mein Leben«, gab Duncan zurück. Er schüttelte den Kopf, sodass sein strähniges graues Haar hin und her schwang. »Und es kümmert den alten Narren auch gar nicht. Dem geht es nur um die Schande, darum, dass der Name MacFarlane besudelt ist. Wir können bloß hoffen, dass Barra MacDubh weiß, von wem die Bälger wirklich sind.«
»Das tut er bestimmt«, schnarrte Donald. »Dieser Hund weiß nur zu gut, dass er Mairi MacFarlanes Bauch gleich zweimal gefüllt hat. Seine Frau Agnes, dieses liederliche Weibsbild, hat es mir verraten, ehe sie starb. Zwei lange Jahre warte ich nun schon darauf, mich an diesem Hurensohn zu rächen. Und schon bald, sehr bald, ist es endlich so weit.«
Duncan sah seinen Sohn verdrießlich an. »Wir benötigen die Kinder, um an das Land der MacDubhs zu kommen, sonst gar nichts. Vergiss das nicht, Donald. Wehe, du benutzt sie nur dafür, deinen verletzten Stolz zu rächen. Denk daran, die Kinder sind auch MacFarlanes – deine kleine Braut ist ihre Tante.«
»O nein, sie ist mehr als das«, mischte Malcolm sich nun ein. »Diese Kinder sind ihr Ein und Alles, und du, Donald, solltest dir das von Anfang an hinter die Ohren schreiben. Wenn du so wenig Ungemach wie möglich haben willst, dann lass bei deinen Plänen hinsichtlich der Kinder Vorsicht walten.«
»Ailis wird meine Gemahlin, und als solche hat sie zu tun, was ich sage, sonst wird sie es bitter bereuen«, knurrte Donald. »Das elende Weib wird sich meinem Willen nicht lange widersetzen, ihr werdet schon sehen!«
Malcolm seufzte und schwieg. Wie schon so oft wünschte er, nicht auf seine Cousins angewiesen zu sein oder gar einem anderen Herrn zu dienen. Mit seinem eigenen Geschlecht verband ihn denkbar wenig. Doch er war an diese rauen, oberflächlichen Verwandten gebunden. Im Gegensatz zu ihnen hatte er erkannt, dass Ailis MacFarlane eine Frau mit außergewöhnlich viel Mut und Rückgrat war und die drei Kleinen liebte, als wären sie ihre eigenen. Sollten die Kinder ihrer Schwester je in Gefahr geraten, so würde Ailis sie gewiss verteidigen wie eine Wölfin ihre Welpen. Doch Donald war in dieser Angelegenheit offensichtlich nicht zu raten. Früher oder später, fürchtete Malcolm, würde ihnen sein blinder Hass noch reichlich Unannehmlichkeiten bereiten.
»Wenn Ailis erst hört, wer der Vater dieser Bastarde ist«, fuhr Donald düster fort, »dann wird ihr das Mitleid mit ihnen rasch vergehen.«
»Aber falls Barra MacDubh tatsächlich der Vater ist, warum hat er dann noch keine Ansprüche auf sie erhoben?«, fragte Malcolm.
»Der legt bestimmt nicht viel Wert darauf, seiner Familie zu eröffnen, wer seine Gespielin war. Genau wie Mairi es vorzog, Stillschweigen zu bewahren«, gab Duncan zurück.
»Wollen wir hoffen, dass er sich weiterhin bedeckt hält. Sein Bruder Alexander ist, soweit ich weiß, ein Mann der Tat; der sitzt nicht herum und wartet darauf, dass etwas geschieht«, warf Malcolm ein und stieß einen Seufzer aus, weil man ihn wieder einmal ignorierte.
Alexander MacDubh bemühte sich indessen redlich, seinen Missmut hinunterzuschlucken und Ruhe zu bewahren, was seinem jüngeren Bruder Barra allerdings nicht aufzufallen schien, denn der provozierte ihn ungerührt weiter. Das Abendmahl wurde zusehends zur Qual. Es herrschte gespanntes Schweigen im großen Saal von Rathmor – offenbar rechneten die anderen Männer damit, dass es noch schlimmer werden würde. Die Knappen, die gemeinsam mit der einen oder anderen Küchenmagd das Essen auftrugen, schlichen so geduckt zwischen den Sitzbänken umher, als erwarteten sie jederzeit einen Übergriff.
Barra hatte wieder einmal über den Durst getrunken. Als sein zänkisches Weib noch gelebt hatte, war Alexander gewillt gewesen, ihm sein Betragen nachzusehen, in der Annahme, er suche Vergessen im Rausch. Doch Agnes war vor zwei Jahren gestorben und Barra trotzdem seither kaum je nüchtern anzutreffen.
Allein schon das erzürnte Alexander über alle Maßen. Er hielt es für völlig unmöglich, dass sich Barra aus Trauer um diese Frau tagtäglich mit Bier voll laufen ließ – und selbst die Schande, die sie ihm bereitet hatte, sollte er längst überwunden haben. Besonders verstörend war die Tatsache, dass sich heute Agnes’ Tod zum zweiten Mal jährte und Barras Zustand sichtlich schlimmer war als sonst. Man würde ihn wohl ins Bett tragen müssen. Wenn Agnes es wenigstens wert gewesen wäre, dann hätte Alexander zumindest ein wenig Mitgefühl aufbringen können. Doch ihm fiel eigentlich nur ein einziger Anlass ein, auf Agnes den Becher zu erheben, nämlich weil sie nicht mehr unter ihnen weilte. Sie war ein bösartiges, unfreundliches Weib gewesen und hatte es genossen, alle Männer, Frauen und Kinder in ihrem Umfeld todunglücklich zu machen.
Alexander runzelte die Stirn. Um ganz ehrlich zu sein, hätte er aller Wahrscheinlichkeit nach auch keine Trauer über ihren frühen Tod verspürt, wenn Agnes ein Engel gewesen wäre. Sogar die Frauen, die er gelegentlich zu sich ins Bett holte, erhielten kaum mehr als ein Grunzen und ein oder zwei Münzen von ihm. Kaum zu glauben, dass er einst so ritterlich und galant gewesen war. Heute konnte er sich über seine damalige Einfältigkeit nur wundern. Die Frauenzimmer, mit denen seine Familie im Lauf der vergangenen zwölf Jahre gestraft gewesen war, hatten ihn ein für alle Mal von seiner umgänglichen Art und seiner Unkenntnis geheilt, und zwar mit derselben Gründlichkeit, mit der sie das Vermögen seines Clans verringert hatten. Barra war ganz einfach wie so viele andere herzensgute Männer den Reizen einer Frau erlegen und hatte dabei offenbar all seine Kraft und seinen gesunden Menschenverstand eingebüßt. Wäre Agnes noch am Leben gewesen, dann hätte Alexander ihr wohl irgendwann höchstpersönlich den Hals umgedreht.
Schließlich verlor er die Beherrschung. Er sprang auf, entwand seinem Bruder den Bierkrug und schmetterte ihn in die gegenüberliegende Ecke des großen Saales von Rathmor.
»Du hast bereits mehr als genug gezecht!« Sein großer, breitschultriger Körper zitterte vor Wut. Zornig starrte er Barra an.
Dieser nahm ohne mit der Wimper zu zucken den Krug seines Tischnachbarn, füllte ihn und trank einen Schluck. »Ich kann nie zu viel Bier getrunken haben.«
Alexander fuhr sich aufgebracht mit den Fingern durch das dichte goldblonde Haar. Er verstand seinen Bruder einfach nicht. »Verflucht noch einmal«, knurrte er. »Wie kommt es nur, dass du dich wegen Agnes, diesem lasterhaften Scheusal, schon seit zwei langen Jahren ständig betrinkst?«
»Wegen Agnes?« Barra blinzelte seinen Bruder ungläubig an. »Du denkst, ich trauere um Agnes?«
Als er plötzlich in Gelächter ausbrach, lief es Alexander eiskalt den Rücken hinunter. Dieses Lachen klang nicht befreiend oder ansteckend, wie man es von früher her kannte, als alles noch in Ordnung gewesen war; nein, beim Klang dieses Lachens begann Alexander ernsthaft an Barras geistiger Gesundheit zu zweifeln. Der irre Blick in den rot geränderten, trüben Augen, einst fast so tiefblau wie seine eigenen, beunruhigte Alexander nur noch mehr. Es kam schließlich immer wieder vor, dass der Alkohol Männer um den Verstand brachte. Er stieß einen wüsten Fluch aus und verpasste dem mageren Barra einen Hieb, der diesen von der Bank fegte. Während er zusah, wie sich sein Bruder vom strohbedeckten Boden aufrappelte und seinen Platz am Tisch wieder einnahm, ballte Alexander wiederholt die Hände zu Fäusten und unterdrückte das Bedürfnis, den Kerl zu ohrfeigen, bis er nüchtern wurde und wieder zu Sinnen kam. Die Tatsache, dass Barra nicht im Geringsten verärgert schien, machte Alexander nur noch wütender.
»Ich habe keineswegs den Verstand verloren, Alexander«, murmelte Barra. »Auch wenn ich mir oft wünsche, es wäre so. Vielleicht würde das meinen Höllenqualen endlich ein Ende setzen.«
»Ich dachte immer, deine Qualen seien an dem Tag zu Ende gegangen, als dein elendiges Weib seinen letzten Atemzug tat! Agnes war es doch, die dir die Hölle auf Erden bereitet hat.«
»Bei Gott, das hat sie, und sie hat dafür gesorgt, dass mein Leiden mit ihrem Tod nicht geendet hat! Ehe sie starb, hat mir Agnes das Einzige genommen, das mein Leben lebenswert machte.« Er lachte heiser. »Obwohl du ihr dafür sicher dankbar wärst!«
»Das Einzige, wofür ich Agnes im Entferntesten danken würde, ist ihr Tod.«
»Du wärst ihr dankbar, glaub mir. Weißt du, weshalb sie sich damals, obwohl sie bereits sterbenskrank war, von hier fort geschlichen hat – zu jenem kleinen Ausritt, der ihr dann den Todesstoß versetzte?«
»Nein.« Alexander fühlte sich mit einem Mal höchst unbehaglich.
»Hör gut zu, denn dies wird dich zweifellos erheitern. Agnes hat sich zur Hütte einer Pächterin ganz im Westen unseres Landes begeben und mir die einzige Freude genommen, die ich im Leben hatte: Sie hat Mairi MacFarlane die schneeweiße Kehle durchgeschnitten.«
Alexander kam ein schrecklicher Verdacht. Er packte Barra grob an den Schultern. »Was kümmert es dich, dass Agnes eine MacFarlane getötet hat?«
»Mairi war sechs Jahre lang meine Geliebte.« Alexander stieß ihn von sich, als hätte er die Pest. Barra wankte. »Mairi war kaum fünfzehn Jahre alt, als ich sie kennen lernte, und ich gerade zwanzig und frisch verheiratet mit der bösartigen Agnes, von der du dachtest, sie werde Rathmor einen Erben gebären! Bei Gott, es dauerte nicht einmal ein halbes Jahr, und meine Ehe war schon das reinste Fegefeuer!«
»Und dir fiel nichts Besseres ein, als dich zu einem Weib zu legen, dessen Onkel unseren Vater getötet hatte?«, zischte Alexander.
»Genau das, und geliebt habe ich sie obendrein!«
»Nein!«
»O doch. Ich brauchte Mairi wie die Luft zum Atmen. Nur sie hat verhindert, dass mein Herz zu Stein wurde, so wie deines. Das war Agnes natürlich ein Dorn im Auge. Ich habe es dir all die Zeit verschwiegen, weil ich weiß, wie sehr du die MacFarlanes hasst.« Er seufzte und fuhr fort, während der Schmerz ihn überwältigte: »Ja, Agnes hat mir damals meine Mairi genommen und dazu meine Kinder, meine Söhne und mein süßes Töchterchen.«
Bei diesen Worten wurde Alexander leichenblass. »Du hattest Kinder? Und Agnes hat sie getötet?«, stieß er zwischen den Zähnen hervor.
»Nein.« Barra schüttelte unbeholfen den Kopf. »Getötet hat sie sie nicht. Aber das Ergebnis ist für mich fast dasselbe – ich bekomme sie weder zu Gesicht noch weiß ich, wie es ihnen geht.«
Alexander schüttelte seinen Bruder unsanft. Seine Geduld hatte längst ein Ende. »Hör auf zu jammern wie ein Waschweib und erzähl mir von den Kindern! Erzähl mir alles!«
»Ich hatte Zwillinge – Rath und Manus haben wir sie genannt. Sie werden inzwischen etwa sieben sein.« Barra schluchzte. Vergeblich bemühte er sich, die Tränen zurückzuhalten und seine Gedanken zu ordnen. »Und Sibeal. Die Kleine muss nun fünf Jahre alt sein. Ich habe sie mit eigenen Händen zur Welt gebracht; dank meiner Hilfe hat sie ihren ersten Atemzug getan. Sie hatte Mairis wunderschöne Augen. Und jetzt habe ich alle vier verloren. Nun weißt du, warum ich der Trunksucht verfallen bin. Agnes hat an jenem schwarzen Tag nicht nur meine Mairi ermordet, sie hat auch sichergestellt, dass ich meine Kinder nie wieder sehen kann.« Er schüttelte den Kopf, nahm einen großen Schluck Bier und flüsterte dann: »Sie könnten genauso gut tot sein.«
»Du hattest Kinder – Söhne, verflucht –, und hast es mir verschwiegen?« Alexander war verletzt und aufgebracht zugleich.
»Nun, ich nahm stets an, du wärest nicht sehr erfreut, es zu erfahren«, murrte Barra. »Schließlich sind es Bastarde; das Blut der verhassten MacFarlanes fließt in ihren Adern.«
»Und das Blut der MacDubhs«, versetzte Alexander. Mehrere Männer an der großen Tafel brummten ihre Zustimmung.
»Meine Sibeal hat genauso rotblonde Haare wie ich«, seufzte Barra. »Und die Zwillinge haben meine Augen. Nein, in Wahrheit sind sie dunkelblau, wie deine. Allmächtiger, es ist, als hätte man mir das Herz herausgerissen.«
Alexander presste die Lippen aufeinander und kämpfte gegen seine Wut an.
Rührselige Trunkenbolde erregten zwar seinen Unmut, doch nun sah er Barra von einer völlig neuen Seite. Es machte keinen Unterschied, wie er selbst über die Liebe dachte, und auch Barras unglückliche Wahl seiner Geliebten tat nichts zur Sache. Sein Bruder hatte seine Kinder verloren, hatte sie zwei lange, düstere Jahre lang weder gesehen noch von ihnen gehört. Alexander war nur allzu bewusst, welche Auswirkungen ein derartiger Schicksalsschlag haben konnte, doch er verdrängte die schmerzliche Erinnerung. Es galt, eine Entscheidung zu treffen. Er wusste, dass sein eigener Verlust den Wunsch verstärkte, Barra und seine Kinder wieder zu vereinen. Die Kinder eines MacDubh gehörten nach Rathmor. Er beugte sich zu seinem Bruder hinunter.
»Was glaubst du wohl, Barra, wo sind deine Kinder jetzt?«, fragte er ruhig und betrachtete seinen Bruder dabei aus schmalen Augen.
Die trügerische Sanftheit ließ Barra aufhorchen. Er warf einen Blick in die Runde und nahm die teils mitleidigen, teils missbilligenden Mienen seiner Tischgenossen zur Kenntnis. Als er den vertraut angriffslustigen Glanz in Alexanders Augen gewahrte, schluckte er unruhig. Der Dunstschleier der Trunkenheit, in dem Barra bis jetzt Zuflucht gesucht hatte, hob sich ein wenig. »Auf Leargan«, krächzte er, gespannt auf die Reaktion seines Bruders.
»Ausgerechnet in der Obhut jenes Mannes also, der unseren Vater ermordet und uns Leargan gestohlen hat. Die Erben des kümmerlichen Vermögens, das uns noch geblieben ist, befinden sich in den Fängen eines Feindes, der seit langem danach trachtet, uns auch noch das letzte Hemd zu rauben.« Barra stieß einen unverständlichen Schrei aus und suchte in seiner Verzweiflung das Weite, während sich Alexander in den schweren Eichensessel fallen ließ und das Gesicht in den schwieligen Händen barg.
»Was hast du vor?«, fragte sein unternehmungslustiger Vetter Angus. »Du willst die Kinder doch hoffentlich nicht den blutbefleckten Händen von Colin MacFarlane überlassen?«
»Nein«, sagte Alexander. »Nein, ich lasse nicht zu, dass sie bei diesem Hurensohn aufwachsen. Durch ihre Adern mag das Blut unserer Feinde fließen, aber sie sind trotz allem Barras Kinder. Sie sind MacDubhs. Wir werden sie holen und hier in der Obhut ihrer Familie aufziehen. Wollen wir hoffen, dass das Gift der MacFarlanes noch nicht in ihre Herzen vorgedrungen ist. Bei Tagesanbruch reiten wir nach Leargan, und zwar ohne Barra, denn als Krieger ist er in seinem Zustand nicht zu gebrauchen.«
Zweites Kapitel
Erschöpft ließ sich Ailis neben ihrem treuen Gefährten Jaime ins weiche, duftende Gras fallen und überließ die spielenden Kinder eine Weile sich selbst.
»Ach, Jaime, ich glaube, ich werde alt. Die Kleinen haben mich recht ermüdet.« Sie grinste, als der Riese sein tiefes, volltönendes Lachen hören ließ, das so gut zu ihm passte.
»Das Herumtollen tut ihnen gut. Sie hatten nicht viel Gelegenheit dazu. Kinder wie sie müssen zuweilen laufen und springen, Herrin.«
Ailis nickte und betrachtete den großen, dunkelhäutigen Mann an ihrer Seite. Die abgenutzte braune Joppe spannte über seinem muskulösen Oberkörper. Mit seinen riesigen, starken Pranken hätte er einem Mann ohne größere Anstrengung das Genick brechen können. Doch sie fühlte sich in Jaimes Gegenwart geborgen und wusste auch die Kinder bei ihm in Sicherheit. Er hatte seine gewaltigen Kräfte unter Kontrolle und wusste sie wohl einzusetzen.
Ailis war überzeugt, dass ihr Begleiter geistig längst nicht so schwerfällig war, wie man ihm gemeinhin nachsagte. Mit etwas Geduld konnte man ihm alles Erdenkliche beibringen. Das Wichtigste, was sie ihn gelehrt hatte, war allerdings eine gewisse Selbstachtung, die ihm sein niederträchtiger Vater und etliche andere über die Jahre hinweg gründlich ausgetrieben hatten. Ailis war auf diese Leistung insgeheim stolz und hatte sich damit Jaimes grenzenlose Hingabe verdient; eine Hingabe, deren Inbrunst ihr gelegentlich schon fast unangenehm war. Doch es lag ihr fern, sich dagegen zu wehren – ein so loyaler Verbündeter war Gold wert, zumal sie auf Leargan nur wenige hatte.
Als eine kühle Brise die Hitze der Mittsommersonne ein wenig linderte, stieß sie ein zufriedenes Seufzen aus. »Du hast Recht. Auf Leargan müssen sich die Kinder stets ruhig verhalten, um meinen Onkel nicht zu reizen.«
»Er ist auch so schon hundsgemein zu ihnen.« Jaime richtete sich auf, um die Kleinen zu beobachten.
»Allerdings. Sie tun mir Leid. Sie sollten spielen dürfen, wie es sich für Kinder gehört. Im Handumdrehen werden sie erwachsen sein.« Sie verfolgte, wie die drei einander lachend nachliefen. Was für ein herrlicher, wolkenloser Sommertag!
Jaime warf ihr einen unruhigen Blick zu, dann platzte er plötzlich heraus: »Ich weiß, es ziemt sich für mich nicht, danach zu fragen oder Euch zu drängen, aber ... was geschieht mit mir, wenn Ihr Donald MacCordys Gemahlin werdet und mit ihm nach Craigandubh zieht?«
»Nun, du wirst natürlich mitkommen.« Sie tätschelte ihm die geballte Faust. »Sei unbesorgt! Ich werde dich nicht verlassen.« Auf Leargan würde ihm bestimmt niemand auch nur eine Träne nachweinen, denn dort galt Jaime als Schwachkopf – und noch dazu als einer, vor dem man sich fürchtete.
Jetzt öffnete er die Faust und presste beide Hände flach auf den Boden. »Ich danke Euch. Außer Euch und den Kindern begegnen mir alle mit Spott und Hohn oder Argwohn. Ihr seid die einzige freundliche Seele, die ich kenne. Ich bliebe nur ungern allein zurück.«
»Das wirst du nicht. Schon wegen der Kinder, die dich fest ins Herz geschlossen haben.« Als sie bemerkte, dass er plötzlich angespannt wirkte und erregt den Boden unter seinen Händen betrachtete, runzelte sie die Stirn. »Was ist los, Jaime?« Ailis legte ebenfalls eine Hand auf den Boden und stellte fest, dass er leicht bebte.
»Da k-kommt je-jemand«, stieß er hervor und verfluchte sich selbst für sein Stottern, dessentwegen er zum Narren abgestempelt worden war. Dank Ailis hatte er diese Schwäche beinahe völlig abgelegt, doch in Augenblicken großer Erregung kehrte sie zurück. »S-sie k-kommen aus dem N-norden«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, so schnell er konnte.
»MacDubhs«, flüsterte Ailis verängstigt. Die Kinder! Jaime trug keine Waffe bei sich, die Pferde waren ungesattelt und die schützenden Wälle von Leargan weit entfernt.
»Schon möglich. Jedenfalls sind es viele, und sie nähern sich geschwind. Wir müssen von hier fliehen.«
»Wir haben keine Zeit mehr!« Ailis sprang auf. Sie hörte bereits die Reiter, die rasch herannahten – aus einer Richtung, in der der Feind wohnte.
Erstaunlich behände für seine Körpergröße, setzte sich Jaime in Bewegung und sammelte die Kinder ein. Ailis nickte, als er vorschlug, sie solle mit ihnen auf einem großen Baum am Rand der Lichtung Schutz suchen. Er war zwar nicht uneinnehmbar, konnte sie aber vor den Blicken der Reiter verbergen, sodass sie mit etwas Glück vorbeipreschen würden. Flink hangelte sich Ailis auf den knorrigen Baum und nahm von Jaime ihre erschreckten Schützlinge entgegen. Kaum hatte er ihr das letzte Kind hinaufgereicht, da sprengten die Reiter auch schon auf die Lichtung. Anstatt ihrem Drängen zu folgen und selbst hinaufzuklettern, wandte Jaime sich um, bereit, dem Feind allein entgegenzutreten.
Alexander brachte sein sich aufbäumendes Ross knapp vor dem finsteren Hünen zum Stehen und war sogleich umringt von seinem Gefolge. Als sein Blick auf die Zwillinge und das rotblonde Mädchen fiel, die über ihm im Geäst kauerten, verspürte er einen Anflug von Heiterkeit. Ein derartiges Glück widerfuhr einem nicht alle Tage.
»Das Schicksal meint es heute wahrlich gut mit uns, Angus.« Er grinste seinen Vetter an, der wie üblich den ehrenvollen Platz zu seiner Rechten eingenommen hatte. »Die Früchte, die wir suchen, warten nur darauf, von uns gepflückt zu werden.«
»Ganz recht. Doch zuvor gilt es noch einen kräftigen Baum zu fällen«, bemerkte Angus mit einer Kopfbewegung in Richtung Jaime.
Alexander befahl seinen Mannen, den Bewacher des Baumes zu überwältigen, ihn aber nach Möglichkeit am Leben zu lassen. »Alles andere käme einem glatten Mord gleich. Er ist unbewaffnet und kämpft allein gegen drei Dutzend Mann.«
Ailis musste von oben zusehen, wie fast die Hälfte der Männer abstieg, die Waffen ablegte und sich Jaime näherte. Es handelte sich eindeutig um Angehörige der MacDubhs. Ihr gefror das Blut in den Adern. Offenbar trachteten sie Jaime nicht nach dem Leben, doch das war nur ein schwacher Trost, denn ihr getreuer Freund konnte es beim besten Willen nicht mit allen aufnehmen. Falls nicht bald ein Wunder geschähe, würden sie geschlossen dem Erzfeind ihres Clans in die Hände fallen ... Auf Leargan kursierten zahlreiche Gerüchte darüber, welch grausame Behandlung die blutrünstigen MacDubhs jenen unglücklichen MacFarlanes zuteil werden ließen, die in ihre Gefangenschaft gerieten. Dummerweise erinnerte sie sich ausgerechnet jetzt in aller Deutlichkeit an jedes einzelne davon. Die Stimme der Vernunft riet ihr zwar, den Wahrheitsgehalt einiger dieser Geschichten anzuzweifeln; doch Furcht unterlag nun einmal nicht den Regeln der Vernunft. Im Augenblick erschienen ihr selbst die schaurigsten Mären über die berüchtigten MacDubhs glaubwürdig.
Hoch zu Ross verfolgte Alexander, wie seine Männer auf den Riesen losgingen, der unter dem Baum Wache hielt und sich mit Zähnen und Klauen zur Wehr setzte, obwohl der Kampf nie und nimmer zu seinen Gunsten ausgehen könnte. Dass er sich einer solchen Überzahl von Feinden mit bloßen Händen in den Weg stellte, grenzte an Wahnsinn, trug ihm jedoch Alexanders ganzen Respekt ein. Offenbar war er gewillt, bis zum bitteren Ende zu kämpfen, um das Quartett, das sich auf dem Baum verschanzt hatte, zu verteidigen – mit welchen Waffen auch immer. Ob er wohl eine derart beachtliche Loyalität an den Tag legen würde, wenn er ahnte, wer der Vater der Kinder war, die er hier so tapfer verteidigte? Als Jaime schließlich zu Boden ging, empfand Alexander darüber keinerlei Siegerstolz. Er stieg vom Pferd, stellte sich unter den Baum und spähte zu den vier blassen Gestalten darin hoch.
»Steigt herunter und bringt die Kleinen mit«, befahl er. Bei genauerer Betrachtung bestand kein Zweifel mehr: Die rotgoldenen Locken des Mädchens und die Gesichtszüge der Zwillinge bestätigten, was Alexander bereits vermutet hatte – dass sie hier zufällig auf Barras Nachkommenschaft gestoßen waren.
»Euer wackerer Beschützer ist geschlagen. Ergebt Euch und kommt herunter.«
»Ergeben? Niemals!«, rief Ailis, ohne sich ihre Angst um die Kinder, sich selbst und den bewusstlosen Jaime anmerken zu lassen. »Wenn Ihr uns haben wollt, so müsst Ihr schon kommen und uns holen.«
Zähneknirschend bedeutete Alexander einigen seiner Männer, der Aufforderung seiner Widersacherin nachzukommen. Er wusste, dass sie damit lediglich versuchte, Zeit zu gewinnen, und er war fest entschlossen, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wer weiß, womöglich hatte sie ja berechtigte Hoffnung auf Rettung.
Er staunte nicht schlecht, als sie den ersten Mann, der auf den Baum steigen wollte, mit einem kräftigen Tritt ins Gesicht kurzerhand auf den Boden beförderte. Auch den zweiten, dritten und vierten ereilte ein ähnliches Schicksal in Gestalt ihres zierlichen gestiefelten Fußes.
Ganz gleich, welche Taktik sich seine Männer auch zurechtlegten, um den Baum zu erklimmen, sie schlug sie alle in die Flucht, tatkräftig unterstützt von den zwei Knaben. Obwohl die MacDubhs zahlenmäßig und körperlich überlegen waren, bot ihr Zufluchtsort ihr entschiedene Vorteile.
Nachdem acht seiner Männer erfolglos zu Boden gestürzt waren, riss Alexander der Geduldsfaden. Um nicht noch mehr wertvolle Zeit zu verschwenden, zog er sein Schwert und setzte Jaime, der mittlerweile wieder bei Bewusstsein, aber noch benommen war, die Klinge an den Hals. Es war ein reines Täuschungsmanöver – Alexander vermochte nicht zu sagen, ob ihr das Wohl ihres Beschützers am Herzen lag. Er beschloss, es auf einen Versuch ankommen zu lassen.
»Ihr habt uns lange genug zum Narren gehalten«, rief er. Aller Augen waren plötzlich auf ihn gerichtet. »Wenn Ihr nicht auf der Stelle herunterkommt, schneide ich dem Mann die Kehle durch.«
Obwohl Ailis wusste, dass sie nun wirklich auf verlorenem Posten stand, erwiderte sie: »Ihr habt ihn verschont, als er es vorhin mit Euch aufnahm – warum also sollte ich Euch glauben, dass Ihr ihm jetzt nach dem Leben trachtet?«
»Ich weiß genauso gut wie Ihr, dass Ihr nur Zeit zu schinden sucht. Und mir wird die Zeit langsam knapp.«
Diese kaltblütige Aussage bewog Ailis, endgültig die Lanze zu strecken. Schließlich erfüllte eine Strategie nur ihren Zweck, solange der Feind sie nicht durchschaute. Es hatte keinen Sinn, mit Jaimes Leben Zeit zu erkaufen, wenn keinerlei Hoffnung auf Rettung bestand. Niemand wusste, dass sie und die Kinder Leargan verlassen hatten, geschweige denn, wo sie sich aufhielten. Wahrscheinlich würde man ihre Abwesenheit erst in ein paar Stunden entdecken. Nein, Jaimes Leben war mehr wert als ein wenig Zeit. Blieb nur zu hoffen, dass sie seinen Tod nicht bloß hinauszögerte, wenn sie nun doch ihr eigenes Leben und das der Kinder aufs Spiel setzte. Sie bedachte den Mann, der ihren teuersten, ergebensten Freund bedrohte, mit einem finsteren Blick.
»Schwört, dass Ihr keinem von uns ein Leid antun werdet«, verlangte sie.
Starr vor Wut zischte Alexander: »Wir vergreifen uns doch nicht an wehrlosen Frauen und Kindern.«
»Ich habe Euch nicht nach Eurer Meinung gefragt, sondern einen Schwur verlangt; einen feierlichen Schwur, dass den Kindern nichts geschehen wird, solange sie in Euren Händen sind.«
Alexander ließ ein leises Knurren zwischen den gefletschten Zähnen hören, doch dann fügte er sich. »Ich schwöre es. Und nun schafft Eure Hinterteile von diesem verfluchten Baum herunter, sonst geht es dem Riesen an den Kragen.«
Ailis war entschlossen, sich von der augenscheinlichen Gereiztheit des Mannes nicht einschüchtern zu lassen. »Allein können die Kinder nicht herunterkommen«, wandte sie ein. »Es ist zu hoch. Jemand muss sie auffangen.« Zum wiederholten Male schärfte sie sich ein, dass sie um der Kleinen willen keine Angst zeigen durfte. Sie waren ohnehin schon höchst beunruhigt.
Es fiel Alexander nicht leicht, nur zuzusehen, als die drei schließlich heruntergereicht wurden. Sie konnten die Verwandtschaft mit den MacDubhs wahrlich nicht leugnen, was in ihm eine Welle von Gefühlen heraufbeschwor – eine Mischung aus schmerzlicher Trauer und tiefer Freude. Um seiner Empfindungen wieder Herr zu werden, lenkte er die Aufmerksamkeit auf die schlanke, wohlgeformte Frau, die eben flink vom Baum kletterte und die angebotene Hilfe geflissentlich ignorierte. Auch ihr Anblick ließ ihn nicht unberührt, wenngleich wohl die wenigsten Lust als ein Gefühl bezeichnet hätten.
Sie hatte rabenschwarzes Haar und ebenmäßige weiße Zähne, und sie wirkte trotz ihrer zierlichen Gestalt mindestens genau so sinnlich wie eine ungleich üppigere Frau, wenn nicht gar betörender. Als sie zu ihrem geschlagenen Beschützer eilte, signalisierte ihr Gang eine unmissverständliche Einladung. Alexander erkannte instinktiv, dass sie ihre Reize unabsichtlich einsetzte, ja, sich ihrer noch nicht einmal bewusst war, was ihn jedoch nicht davon abhalten würde, die Einladung anzunehmen.
Jaime setzte sich mühsam auf. Seine seelische Verfassung spiegelte sich nicht nur in seinem sonnengebräunten Gesicht wider, sondern kam auch in seinem starken Stottern zum Ausdruck, als er hervorstieß: »Ach, He-herrin, Ihr hä-hättet nicht herunterkommen dürfen. Ich b-bin es nicht wert. Ihr hä-hättet Euch w-weiter verschanzen sollen.«
Die Zwillinge klopften dem Riesen beschwichtigend den breiten Rücken; die kleine Sibeal nahm seine Pranke in die Händchen, um ihn zu trösten, und auch Ailis tätschelte ihm die dunklen Locken. »Nein, ich konnte dich nicht im Stich lassen. Gräme dich nicht, Jaime. Glaub mir, ich tat es nicht nur deinetwegen, sondern auch um meines eigenen Seelenfriedens willen. Ich hätte mir mein Lebtag lang Vorwürfe gemacht, wenn du unseretwegen umgekommen wärst.«
Alexander beobachtete die Szene stirnrunzelnd und befahl seinem Gefolge, die Habseligkeiten der MacFarlanes zusammenzusuchen und deren Pferde zu satteln. Dieser Jaime schien ihm etwas einfältig. Trotzdem hatte die Frau ihn offenbar derart ins Herz geschlossen, dass sie bereit war, sich in ihr Schicksal zu ergeben, um ihn zu retten. Das erstaunte ihn, denn es widersprach Alexanders Bild vom weiblichen Geschlecht. Doch im Augenblick sah er sich einem ganz anderen Problem gegenüber: Er begehrte sie, aber das allein reichte nicht aus, um sie mitzunehmen. Um sein Gewissen zu beruhigen, musste er sich einen guten Grund einfallen lassen.
»Was seid Ihr für diese Kinder?«, herrschte er Ailis an. »Ihre Amme?«
Ailis würde sich hüten, dem Mann auf die Nase zu binden, dass sie Colin MacFarlanes Nichte war, wenngleich er den Kindern freundlich gesonnen schien. Bei einer erwachsenen Angehörigen ihres Clans würden die MacDubhs bestimmt nicht so viel Milde walten lassen – schließlich hatten sie den MacFarlanes Blutrache geschworen. »Ja, das bin ich.«
»Dafür siehst du aber noch reichlich jung aus.«
»Ich bin zwanzig. Alt genug.«
»Dann wirst du uns begleiten. Ich brauche jemanden, der auf die Kinder aufpasst, denn auf Rathmor haben wir keine Kinderfrau.« Er packte sie am Arm und runzelte die Stirn, weil sie ihm nur widerstrebend folgte.
»Was ist mit Jaime?«, fragte sie und versuchte, sich seinem Griff zu entwinden.
»Was soll mit ihm sein? Wir lassen ihn hier.«
»Ich habe mich nicht ergeben, um sein Leben zu retten, nur damit er von Euch hier zurückgelassen wird und später Colin MacFarlanes Zorn ausgesetzt ist. Das wäre sein sicherer Tod.«
Alexander sah sich nach den drei Kindern um und wusste noch im selben Augenblick, dass das ein Fehler war – ihren flehenden Augen konnte er nicht widerstehen. Es war zweifellos unklug, einen so beherzten Krieger mit nach Rathmor zu nehmen, doch er vermochte den Kindern ihren stummen Wunsch nicht abzuschlagen und ihren Beschützer einem unbekannten, mit Sicherheit nicht gerade gnädigen Schicksal zu überlassen.
»Also gut«, schnarrte er, verdrossen über seine eigene Gutmütigkeit. »Wir nehmen ihn mit. Aber nur, wenn er schwört, uns keine Schwierigkeiten zu bereiten.«
Jaime zögerte und wechselte einen Blick mit Ailis, dann nickte er. Alexanders Gefolgsleute beobachteten misstrauisch, wie er aufsaß, und machten sich daran, ihre Spuren zu verwischen, so gut es ging. Sie traten lose Erdbrocken fest, fegten mit Ästen über das Gras und beseitigten sogar sämtliche Pferdeäpfel. Auf eine wilde Verfolgungsjagd und die unnötige Gefährdung von Rathmor konnte Alexander wirklich verzichten.
Er hievte die kleine Sibeal vor sich in den Sattel, während die Zwillinge gemeinsam auf ein Pferd gesetzt wurden. Die etwas hochmütig wirkende Amme saß allein und, wie Alexander halb bewundernd, halb belustigt feststellte, mit ungeniert gespreizten Beinen im Sattel. Nur mit Mühe riss er sich von dem reizvollen Anblick ihrer bestrumpften Schenkel los und gab das Zeichen zum Aufbruch. Zügig, aber ohne die Pferde allzu rasch ermüden zu lassen, ritten sie zurück nach Rathmor.
Alexander konnte nicht fassen, wie reibungslos die Angelegenheit bis jetzt verlaufen war. Sein Glück kam ihm fast schon verdächtig vor. Er hatte erwartet, Leargan angreifen zu müssen, und gehofft, der Überraschungseffekt werde die Tatsache aufwiegen, dass sie in der Minderzahl waren. Doch sie hatten das Risiko gar nicht erst eingehen müssen und ihr Ziel mit äußerst geringem Aufwand erreicht. Bis auf ein paar blaue Flecken und den einen oder anderen gebrochenen Knochen war seine Truppe unverletzt.
Trotzdem wurde er das Gefühl nicht los, dass er schon bald mit Komplikationen rechnen müsste – und das nicht zu knapp. Er schalt sich einen abergläubischen Narren. Auf nach Rathmor, ehe das Blatt sich wenden konnte!
Ailis ritt auf ihrer fuchsroten Stute neben ihm her, erleichtert, dass sie mit ihrer Behauptung, die Amme zu sein, durchgekommen war. Ihr Glück, dass der Mann in diesen Dingen offenbar nicht sehr bewandert war, sonst wäre ihm bestimmt klar gewesen, dass sie in ihrem Alter unmöglich eine so wichtige Rolle in ihrem Clan spielen konnte. Blieb zu hoffen, dass keines der Kinder ihre Tarnung auffliegen ließ. Zuvor hatte ein kurzer, scharfer Blick genügt, um eventuelle Einsprüche im Keim zu ersticken. Natürlich zwang sie die Kleinen nur ungern zum Lügen, aber die Wahrheit hätte ihnen allen gewiss nicht zum Vorteil gereicht.
Trotz der Fehde zwischen den Clans konnte sich Ailis nicht recht erklären, was sich die MacDubhs davon versprachen, Mairis uneheliche Kinder zu entführen. Ausgeschlossen, dass ihre Feinde wussten, was sie selbst vage vermutete. Trotzdem war die Verschleppung offenbar geplant gewesen. Doch nachdem er sogar Jaime verschont hatte, würde der blonde Anführer den Kindern wohl kaum ein Leid antun. Oder konnte es sein, dass Ailis sich zu dieser Annahme nur durch sein anziehendes Äußeres verleiten ließ?
Eines stand indessen unumstößlich fest: dass der gut aussehende, aber grimmig wirkende Anführer der MacDubhs sich an ihr vergehen würde. Sie schauderte, als ihr plötzlich aufging, um wen es sich handeln musste – um Alexander MacDubh, den berühmtesten und am meisten gefürchteten Angehörigen des feindlichen Clans. Man hatte ihn ihr von klein auf beschrieben, mit Worten, die jedem jungen Mädchen nur zu gut im Gedächtnis blieben. Von jeher hatten die Geschichten über den bestrickenden Galan, der sich aus Kummer über sein Schicksal in einen verbitterten, kaltherzigen Räuber verwandelt hatte, sie fasziniert und ihr Mitleid geweckt. Als junges Mädchen war sie stets hin und her gerissen gewesen zwischen dem Wunsch, den schönen Mann einmal zu Gesicht zu bekommen, und der Befürchtung, dies könne sich eines Tages erfüllen. Eine schreckliche Vorahnung erfüllte sie, seit sie in seinen tiefblauen Augen einen leider nur allzu bekannten Blick erhascht hatte: Alexander MacDubh begehrte sie. Und nun, da sie seine Geisel war, konnte er sie sich jederzeit zu Willen machen.
Angsterfüllt, aber auch mit ohnmächtiger Wut sann sie über ihre ausweglose Lage nach. Sie hatte keinerlei Verbündete auf Rathmor. Jaime würde sein Leben aufs Spiel setzen, wenn er versuchte, ihr zu Hilfe zu eilen. Und dass sie Colins Nichte war, machte die Sache nur noch verzwickter – wenn das erst ans Licht kam, würde man sie zweifellos ungleich rauer behandeln.
Vielleicht konnte sie Alexander ja von seinem Vorhaben abbringen, wenn sie weiterhin vorgab, nur die Amme der Kinder zu sein. Schließlich war er Gerüchten zufolge einst ein äußerst ritterlicher Verführer gewesen. Einer Ailis MacFarlane würde er mit dem größten Vergnügen alle möglichen Gemeinheiten angedeihen lassen, wohl wissend, dass jede einzelne ihrem hochmütigen Onkel ins Herz schneiden würde. Je länger sie sich darüber den Kopf zerbrach, desto unausweichlicher schienen ihr seine Zudringlichkeiten Also versuchte sie an etwas anderes zu denken, doch mit wenig Erfolg. Vergeblich kämpfte sie gegen die Entmutigung an, die zunehmend von ihr Besitz ergriff.
Als die finsteren Festungswälle von Rathmor vor ihr auftauchten, fiel es ihr noch schwerer, eine gefasste Miene zur Schau zu stellen. Wenn sie erst dahinter gefangen waren, wurde eine mögliche Rettung nicht nur unwahrscheinlicher, sondern auch kostspieliger und aufwändiger. Dann hing alles davon ab, wie viel Wert die MacCordys und die MacFarlanes darauf legten, eine Blutsverbindung zwischen ihren Clans herzustellen. Womöglich würde man gar nicht erst versuchen, sie zu befreien! Es war durchaus möglich, dass Colin MacFarlane die Kinder bloß als lästige, beschämende Bürde betrachtete und froh war, sie endlich los zu sein.
Mit einem Mal schien es ihr töricht, dass sie auf der Lichtung versucht hatte, Zeit zu gewinnen – just das konnte ihr nun zum Verhängnis werden, konnte ihre Tarnung auffliegen lassen und sie ihre Unschuld kosten. Während hinter ihr die schweren Tore von Rathmor mit lautem Gerumpel zugezogen wurden, kam sie zu dem Schluss, dass die Zeit sich nun als ihr schlimmster Feind entpuppen konnte.
»Wenn wir so weitermachen, machen wir nur unseren Pferden den Garaus«, stellte Malcolm MacCordy nüchtern fest. Er fuhr sich mit dem Ärmel über die Stirn und warf einen finsteren Blick zur Nachmittagssonne. Dann betrachtete er die Lichtung, auf der sie sich befanden.
»Nun, wir haben sie aber noch nicht gefunden«, gab Donald gereizt zurück, während er seinen Hengst neben dem Vetter zum Stehen brachte. Sein Vater, sein Bruder und die meisten Bewaffneten, die ihn begleiteten, murmelten zustimmend. »Sollen wir die Suche einfach aufgeben?«
»Von dem Augenblick an, da euch zu Ohren kam, dass die Kinder Leargan verlassen haben, hat euch die nackte Panik ergriffen«, flüsterte Malcolm. Colins Bewaffnete sollten nicht erfahren, welch großes Interesse die MacCordys an den Kindern hatten.
»Kein Wunder. Es war närrisch von Colin MacFarlane, die drei unbeaufsichtigt herumlaufen zu lassen. Genauso gut könnte er einen gefüllten Geldbeutel auf den Marktplatz legen und hoffen, dass sich niemand daran vergreift.«
»Aber wir gebärden uns nicht minder närrisch, wenn wir Stunde um Stunde sinnlos durch die Gegend galoppieren.«
»Wir brauchen die Kinder!«
Es kostete Malcolm erhebliche Mühe, seine Zunge im Zaum zu halten. Habgierig und hinterlistig, wie die MacCordys nun einmal waren, hatten sie es sich mit so gut wie allen Verbündeten verscherzt. Nur deshalb waren sie so erpicht darauf, die drei Kleinen in ihre Gewalt zu bringen. Sie waren praktisch mit allen verfeindet, vor allem mit den MacDubhs, die, wie Malcolm vermutete, hinter dem Verschwinden von Ailis und den Kindern steckten.
»So kommen wir nicht weiter«, stellte er schließlich fest und fügte, um Zurückhaltung bemüht, hinzu: »Ich glaube, wir sollten eine Rast einlegen und unsere Vorgehensweise überdenken.«
William stimmte ihm zu. »Gute Idee.«
»Ach, ja? Als ob du das beurteilen könntest, du hirnloser Wicht!«, schrie Donald seinem jüngeren Bruder ins Gesicht.
Im Nu entspann sich ein Streit zwischen den beiden. Malcolm stieg gemächlich vom Pferd, tränkte es und band es fest. Dann ließ er sich unter einem großen Baum ins Gras fallen und verfolgte mit matter Belustigung, wie sich der bereits ergraute Duncan in den verbalen Schlagabtausch seiner strammen Söhne einmischte. Während sich die drei zankten, folgten die übrigen Männer Malcolms Beispiel, tränkten ebenfalls ihre Rosse und ließen sie grasen.
Malcolm hätte seinen Vettern gern gesagt, dass es ihnen nicht weiterhalf, wenn sie in vollem Galopp durch die Gegend jagten und herumbrüllten, hütete jedoch wohlweislich seine Zunge.
Er seufzte und streifte sich träge ein paar Grashalme von der eleganten schwarzen Joppe, dann griff er nach seinem Wasserbeutel.
Mitten in der Bewegung hielt er plötzlich inne. Irgendetwas hatte kurz seine Aufmerksamkeit erregt – aber was? Mit zusammengekniffenen Augen suchte er sorgfältig den Boden ab, dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Jemand hatte geschickt die Spuren eines Kampfes verwischt, der hier vor nicht langer Zeit ausgetragen worden war. Moos und Gras waren niedergetrampelt und da und dort ausgerissen. Bei genauerer Untersuchung der Stelle fand er zudem noch feuchte Blutspuren. Sein Instinkt sagte ihm, dass Jaime hier in einen Kampf mit den Entführern von Ailis und den Kindern verwickelt gewesen sein musste.
Aber in welche Richtung mochten sie geritten sein? Schweigend suchte er die nähere Umgebung ab. Inzwischen hatten Donald, sein Vater und sein Bruder ihren Streit beigelegt und nahmen sein Tun argwöhnisch zur Kenntnis. Doch er beachtete die drei nicht weiter. Unweit der Lichtung stieß er auf deutliche Anzeichen dafür, dass sich hier eine größere Gruppe bewaffneter Reiter aufgehalten haben musste. Malcolm folgte den Spuren der Pferdehufe ein Stück weit. Rasch wurde ihm klar, in wessen Gewalt sich Ailis und die Kinder befanden. Seltsamerweise wies alles darauf hin, dass die Entführer auch Jaime in Gewahrsam genommen hatten. Malcolm verzog das schmale Gesicht zu einer grimmigen Grimasse und gesellte sich widerstrebend zu seinen Anverwandten. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie die MacCordys die Nachricht, dass ihre großartigen Pläne zunichte gemacht waren, aufnehmen würden.
»Sie waren hier, sind aber inzwischen längst über alle Berge«, verkündete er.
Donald musterte ihn finster und kratzte sich den gewaltigen Wanst. »Was soll das heißen? Wir sind doch erst vor kurzem hier durchgeritten und haben nichts bemerkt.«
»Ihr wart eben nicht aufmerksam genug.« Malcolm zeigte ihnen, was er entdeckt hatte; seine Vettern folgten ihm auf dem Fuß. »Ich nehme an, das Blut stammt von dem Koloss, der deine kleine Braut auf Schritt und Tritt bewacht, Donald. Und wohl auch von den Männern, die ihn zur Strecke brachten. Wer auch immer es war, hat sich große Mühe gegeben, sämtliche Spuren zu verwischen, um Zeit zu gewinnen. Auf diese Weise gelang es den Entführern, ungestört zu ihrem Unterschlupf zurückzukehren, ehe jemand die Verfolgung aufnehmen konnte«, schloss Malcolm und lehnte sich an den knorrigen Baum, unter dem er sich vorhin ausgeruht hatte. »Die Richtung, die sie eingeschlagen haben, lässt keinen Zweifel aufkommen, wer die Entführer sind.«
»Allerdings«, stimmte ihm Duncan zu, nicht ohne eine Fülle gotteslästerlicher Flüche und Verwünschungen auszustoßen. »Die MacDubhs. Und selbst wenn Alexander MacDubh nicht wusste, wer der Vater der Kinder ist, so wird es ihm aufgehen, sobald sein Bruder die Kleinen erblickt.«
»Ich bin sicher, er war bereits im Bilde«, widersprach Malcolm und fuhr sich mit den langen Fingern durch das dunkelbraune Haar. »Sonst hätte der Überfall nicht ausgerechnet um die Mittagsstunde stattgefunden. Außerdem verlässt niemand um diese Jahreszeit sein Land, wenn es nicht unbedingt sein muss; es sei denn, er hat einen guten Grund dafür. Wer im Sommer die Männer von der Feldarbeit abhält, der muss damit rechnen, im Winter Hunger zu leiden. Nein, MacDubh wusste, was er suchte, und es fiel ihm förmlich in den Schoß. Wahrscheinlich kann er sein Glück gar nicht fassen. Ich fürchte, dieses Spiel hast du verloren, Donald.«
»Nein!«, bellte dieser, dann dämpfte er rasch seine Stimme. »Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, unseren Verlust wettzumachen. Die Kinder gibt MacDubh nicht mehr her, das steht fest, aber Ailis wird er nicht behalten wollen. Er wird ein Lösegeld fordern. Selbst der größte Strohkopf muss erkennen, was eine Gefangene wie sie wert ist.«
»Ganz recht. Und die MacDubhs sind schlau. Doch wenn das Mädchen so klug ist, wie ich glaube, dann wird es sein Möglichstes tun, um zu verbergen, wer es wirklich ist.«
»Das glaube ich kaum«, wandte William ein und stellte wieder einmal unter Beweis, dass seine geistige Beschränktheit beileibe nicht erdichtet war. »Ailis kommt doch nur frei, wenn sie den MacDubhs verrät, wer sie ist, damit sie Lösegeld fordern können.«
Malcolm verzichtete darauf, seinen jungen Verwandten darauf hinzuweisen, dass er sich irrte; wusste er doch aus langjähriger Erfahrung, dass er gegen eine Wand redete. »Die MacDubhs haben geschworen, sich an den MacFarlanes für den Meuchelmord an ihrem Vater zu rächen. Sie würden sich diebisch freuen, Colins Nichte und einzige Erbin – von dem schwachköpfigen Weib, das er geheiratet hat, einmal abgesehen – in ihrer Gewalt zu wissen. Natürlich werden sie für Ailis ein Lösegeld fordern, aber erst werden sie das Mädchen schänden. Sie werden die Gelegenheit, sich an Colin zu rächen, indem sie sich an seiner Nachfahrin vergehen, garantiert nicht ungenützt verstreichen lassen.«
Donald stieß einen üblen Fluch aus. »Dieser Bastard MacDubh wird sie ohnehin entehren.«
»Zweifellos, genau wie jeder andere Mann es täte, der sich im Besitz einer so verlockenden Beute befindet«, stimmte Malcolm ihm zu. »Aber wenn sie geheim halten kann, wer sie wirklich ist, wird Ailis wenigstens nicht von einem Mann zum anderen gereicht. Natürlich wird sie nicht als Jungfrau zurückkehren, aber das ist noch zu verschmerzen. Wenn alle Männer auf Rathmor sich an ihr vergehen, ist sie am Ende körperlich wie seelisch nur noch ein Wrack. Wenn nicht, kannst du dich danach noch mit ihr vergnügen und endlich deinen Hunger stillen.«
»Ja, aber erst, nachdem mir schon wieder ein MacDubh zuvorgekommen ist! Erst trieb dieser elende Barra es mit Mairi, und jetzt ergeht es mir mit Ailis nicht viel besser. Ich bin es leid, dass die MacDubhs allen Weibern, mit denen ich verlobt bin, die Jungfräulichkeit stehlen!«
»Mit Mairi warst du doch gar nicht verlobt«, wandte William ein und duckte sich flink, um Donalds Faustschlag zu entgehen.
»Aber so gut wie.« Donald holte noch einmal aus, dann gab er auf und stemmte die behandschuhte Faust in die Seite. »Ich wartete damals darauf, dass ihr schwachsinniger Vater sie endlich für heiratsfähig erklärte, doch Barra MacDubh schob sein Schwert in meine Scheide, ehe die Verlobung feierlich verkündet werden konnte.«