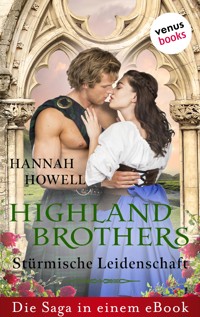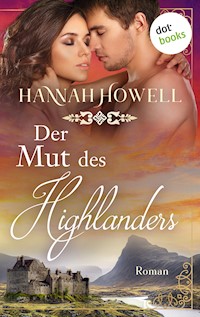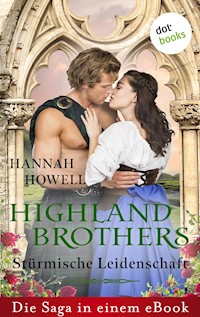Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
August 1400: Nach einem Schiffbruch findet sich Moira Robertson an der rauen Nordwestküste Schottlands wieder – das Unwetter hat ihr alles geraubt, außer den Kleiderfetzen, die sie am Leib trägt – und dem geheimnisvollen Fremden, der ihr auf dem Schiff zur Hilfe kam. Auch wenn sie langsam zu dem restpektlosen Unbekannten Vertrauen fasst, fürchtet sie, sich an dem Feuer, das er in ihr entfacht hat, zu verbrennen… "Wenigen Autoren gelingt es, die schottischen Highlands so kenntnisreich und farbenprächtig zu beschreiben wie Hannah Howell" [Publishers Weekly]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
August 1400: Nach einem Schiffbruch findet sich Moira Robertson an der rauen Nordwestküste Schottlands wieder – das Unwetter hat ihr alles geraubt, außer den Kleiderfetzen, die sie am Leib trägt – und dem geheimnisvollen Fremden, der ihr auf dem Schiff zur Hilfe kam. Auch wenn sie langsam zu dem restpektlosen Unbekannten Vertrauen fasst, fürchtet sie, sich an dem Feuer, das er in ihr entfacht hat, zu verbrennen…
"Wenigen Autoren gelingt es, die schottischen Highlands so kenntnisreich und farbenprächtig zu beschreiben wie Hannah Howell" [Publishers Weekly]
Hannah Howell
Verzehrende Leidenschaft
Historischer Liebesroman
Edel Elements
Edel ElementsEin Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 1995 by Hannah Howell
Published by Arrangement with KENSINGTON PUBLISHING CORP., NEW YORK, NY USA
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-144-7
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
1
Vor der Küste im Nordwesten Schottlands – August 1400
Na komm schon, Mädchen, meine Schmeicheleien verdienen doch wenigstens ein kleines Lächeln!«
Moira warf einen verstohlenen Blick auf den Mann vor ihr. Er ließ sie kaum aus den Augen, seit sie vor drei Tagen aufs Schiff gekommen waren. Die krumme Annie, ihre scharfzüngige Aufpasserin, hatte etwas über diesen Mann gegrummelt und Moira streng angewiesen, ihm aus dem Weg zu gehen. Doch das war gar nicht so einfach auf einem derart kleinen Schiff.
Der Mann hatte etwas Seltsames an sich. Sein schwarzes Haar war von grauen Strähnen durchzogen, und um die Taille war er so füllig, dass sein Wams spannte. Sein schwarzer Bart war struppig, und seinen Hut hatte er so tief in die Stirn gezogen, dass man seine Augen kaum sehen konnte.
Das alles wies auf einen schmuddeligen älteren Mann hin, doch Moira hatte noch einiges andere bemerkt, was in dieses Bild nicht recht passen wollte. Die engen Ärmel seines eleganten kurzen schwarzen Rocks ließen starke, schlanke Arme erahnen. Seine ebenfalls schwarze Hose saß so knapp, dass sich darunter lange, wohlgeformte Beine abzeichneten. Seine Stimme war tief und kräftig, die Stimme eines vor Lebenslust sprühenden jungen Mannes. Seine Bewegungen wirkten geschmeidig und elegant, auch sie passten nicht zu seinem offenkundigen Alter und seiner Leibesfülle. Als er sie jetzt anlächelte, war Moira überzeugt, dass er nicht der war, der zu sein er vorgab. Diese Erkenntnis verstärkte jedoch ihr Unbehagen. Als sie sich suchend nach der krummen Annie umblickte, stellte sie zu ihrem Verdruss fest, dass die gichtige Alte sich gerade an einen ebenso gichtigen alten Matrosen heranmachte.
»Sie wird gleich kommen, um Euch zu tadeln und Euch wegzuzerren«, meinte der Mann.
»Ich glaube, ich gehe lieber zu ihr.« Moira keuchte überrascht auf, als er sie bei der Hand packte und festhielt.
»Aber, aber! Ihr wollt der Alten doch nicht die Gelegenheit zu einer kleinen Schäkerei verderben, oder?«
Moira war über seine unverblümten Worte empört. Dass Annie möglicherweise ans Schäkern dachte, warf sie beinahe ebenso aus der Bahn wie die Berührung dieses seltsamen Mannes. Er fing an zu grinsen, runzelte dann aber die Stirn. Offensichtlich hatte er die Angst in ihrer Miene bemerkt. Daran war ihr Vormund schuld, der oft genug dafür sorgte, dass sie Männer fürchten gelernt hatte. Es war zwar unberechtigt, aber in dem Moment, als der Bursche sie bei der Hand gepackt hatte, war sie in Erwartung einer Ohrfeige erstarrt.
»Ach, mein armes, süßes, ängstliches Kindchen, Ihr braucht Euch doch vor dem alten George Fraser nicht zu fürchten!«
Da es sie ärgerte, dass dieser Mann sie als Kindchen bezeichnete, fasste sie sich ein Herz und befreite sich aus seinem Griff. »Meiner Meinung nach, Mr Fraser, sollte ein Kindchen gut aufpassen, wenn ein dreimal so alter Mann versucht, mit ihm zu schäkern.«
»Dreimal so alt?« George schnappte nach Luft, doch dann machte er sich an seinem Wams zu schaffen und zuckte die Schultern. »Das Alter hält einen Mann nicht davon ab, sich am Anblick eines hübschen jungen Mädchens zu erfreuen.«
»Dann sollte Euch vielleicht Eure Gemahlin davon abhalten.«
»Das hätte sie wohl getan, aber sie weilt nicht mehr unter uns.« Seufzend lehnte er sich an die Reling. »Meine gute Margaret hat sich vor drei Jahren ein Fieber eingefangen und ihren letzten Atemzug ausgehaucht.«
»Oh, das tut mir leid, Sir.« Sie tätschelte seinen Arm, doch ihr Mitgefühl schwand, als sie merkte, wie stark und schlank dieser sich anfühlte. »Ich wollte keine schmerzlichen Erinnerungen wecken.«
»He, Sir, lasst bloß Eure alten Pfoten von dem jungen Mädchen!«, fauchte die krumme Annie und zerrte Moiras Hand von seinem Arm, bevor er seine Hand darauf legen konnte.
»Wir haben uns doch nur über seine Gemahlin unterhalten«, protestierte Moira und versuchte, sich aus Annies eisernem Griff zu befreien. Aber die mit Altersflecken übersäte Klaue des Weibs lag wie eine Fessel um ihr Gelenk.
»Na, die sollte dem alten Lustmolch mal eine deftige Abreibung verpassen.«
»Annie«, ächzte Moira und errötete ob der derben Sprache ihrer Betreuerin. »Seine Gemahlin ist verstorben!«
»Ach so. Wahrscheinlich hat er sie mit seinen Liebeleien in den Tod getrieben.«
»Es tut mir leid, Sir.« Moiras Entschuldigung klang etwas unsicher, denn sie bemerkte, dass der Mann ein Grinsen unterdrückte.
»Jetzt komm schon.« Annie zerrte sie zu den kleinen Kajüten. »Du willst doch nicht etwa, dass der alte Bearnard dich im Gespräch mit einem Mann erwischt, oder?«
Der bloße Gedanke an ihren Vormund schickte Moira einen kalten Schauer über den Rücken. Sie hörte augenblicklich auf, sich gegen Annies festen Griff zu wehren. »Nay, das würde mir wahrhaftig nicht gefallen.«
Tavig MacAlpin sah seufzend zu, wie die krumme Annie Moira mit finsterer Miene abführte. Dann vergewisserte er sich, dass niemand ihn beobachtete, und rückte sorgsam die dicke Schicht um seine Taille zurecht. Seit er Moira Robertson zu Gesicht bekommen hatte, war ihm seine Verkleidung als ergrauender George Fraser wie ein wahrer Fluch erschienen, obwohl er wusste, dass sie momentan lebensnotwendig war. Die auf seinen Kopf ausgesetzte Summe war hoch genug, um selbst die standhaftesten Männer in Versuchung zu führen. Und die Männer auf dem kleinen Schiff waren nicht besonders standhaft.
Drei lange Tage hatte es gedauert, bis sich endlich eine Gelegenheit ergeben hatte, mit Moira ins Gespräch zu kommen. Allerdings fragte er sich, warum er überhaupt so erpicht darauf gewesen war. Er hatte sie eifrig beobachtet, wenn sie mit der gebeugten, grauhaarigen Pflegerin auf dem Deck herumschlenderte. Moiras leuchtend rotes Haar war immer zu festen Zöpfen geflochten, aber gelegentlich brachen ein paar widerspenstige Locken aus, um sich um ihr kleines, ovales Gesicht zu legen. Als er das Glück gehabt hatte, sie näher zu betrachten, staunte er, dass ihre weiche weiße Haut kaum Sommersprossen aufwies. Und er erinnerte sich noch sehr gut, wie verwundert er gewesen war, als er ihr zum ersten Mal in die Augen geblickt hatte. Er hatte mit braunen oder grünen Augen gerechnet, nicht jedoch mit den strahlenden blauen Augen, die dieses Mädchen besaß. Und wie groß diese Augen waren, dachte er nun und verzog den Mund zu einem schwachen Lächeln. Leise lachend gestand er sich ein, dass er keine Mühen gescheut hatte, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, nur damit er die großen blauen Augen mit ihren langen, dichten, dunklen Wimpern sehen konnte.
Er musste kichern, als ihm einfiel, dass er sich möglicherweise so gut an ihr Gesicht erinnerte, weil es von ihr sonst nicht viel zu sehen gab. Sie war ziemlich klein und ziemlich dürr. Es waren zwar weibliche Formen zu erahnen, aber auch die fielen eher klein aus. Moira Robertson gehörte mit Sicherheit nicht zu der Sorte Frauen, die Tavig normalerweise bevorzugte, doch er musste zugeben, dass sie dennoch seine volle Aufmerksamkeit erobert hatte.
Er fluchte, als er sich an die Angst erinnerte, die in ihren wundervollen Augen bei seiner Berührung aufgeflackert war. Diese Angst tauchte noch einmal überdeutlich auf, als die krumme Annie Moiras Vormund erwähnte. Selbst die Farbe auf Moiras hohen Wangenknochen war verblasst. Ihr Vormund, Sir Bearnard Robertson, war ein richtiger Tyrann, das hatte Tavig gleich bemerkt. Er hatte zwar nicht gesehen, dass der Kerl Moira schlug, traute es ihm jedoch durchaus zu. Er konnte nur hoffen, dass Bearnard das Mädchen in Ruhe ließ, zumindest so lange, bis er der Burg seines Cousins Mungan nahe genug und in Sicherheit war. Denn er wusste, wenn Bearnard Robertson die Hand gegen das Mädchen erhob, würde er dazwischentreten. Aber ein Kampf mit einem Mann in Robertsons Größe könnte seine Verkleidung ruinieren. Wenn man ihn erkannte, würde man ihn seinem hinterhältigen Cousin Iver ausliefern. Und dort erwartete ihn der Strick für eine Untat, die er nicht begangen hatte.
Plötzlich kam eine kühle Brise auf, und Tavig fröstelte. Fluchend zog er seinen schweren, schwarzen Umhang fester um sich und blickte finster in den Himmel. In die üblichen Abendwolken, Vorboten der nahenden Nacht, hatten sich ein paar unheilverkündende schwarze Wolken gemischt. Eine weitere eiskalte Böe wehte über das Deck, diesmal weit kraftvoller als die erste. Das verhieß nichts Gutes: Ein später Sommersturm zog auf. Tavig musste wohl oder übel bald in die winzige Kajüte zurück, die er mit drei weiteren Männern teilte. Das war ihm gar nicht recht, denn solche Nähe vergrößerte nur die Chance, enttarnt zu werden. Doch der Regen, den dieser Sturm mit sich bringen würde, war für seine Verkleidung weitaus gefährlicher. Deshalb nahm er sich vor, beim ersten Tropfen Schutz zu suchen.
* * *
Etwas Schweres lag auf Moiras Brust und holte sie langsam aus ihren Träumen. Als sie die Augen aufschlug, musste sie einen Schrei unterdrücken. Beim düsteren Licht einer Laterne, die man unvorsichtigerweise nicht gelöscht hatte und die nun wild an ihrem Haken tanzte, sah Moira, dass es sich nicht um die krumme Annie handelte, die sich auf sie gelegt hatte, sondern um Connor, den Bewaffneten ihres Vormunds. Einen Moment lang lag sie reglos da und wagte kaum zu atmen, bis sie merkte, dass von Connor keine Gefahr ausging; denn dazu war er viel zu betrunken. Ihre Angst schlug rasch in Zorn um.
Leise fluchend wand sie sich unter dem schnarchenden Mann heraus. Einen Moment lang dachte sie daran, sich auf dem Boden der Kajüte zum Schlafen zu legen, doch ihr wurde rasch klar, dass zwischen all den Betrunkenen, die dort lagen, kaum Platz für sie war. Deshalb drückte sie sich murrend an die Wand in der Hoffnung, sich von Connor fernzuhalten, der nach Alkohol und Schweiß stank. Zum hundertsten Mal fragte sie sich, warum sie sich nicht die Zeit genommen hatten, die Reise auf einem Pferdekarren zu bewältigen. Die Lösegeldforderung für ihre Cousine Una war schon vor Wochen eingetroffen. Ihr Vormund hätte genauso gut einen längeren, dafür aber bequemeren Weg wählen können, um seine Tochter zu retten. Selbst die schlechtesten Straßen hätten ihnen nicht so viel abverlangt wie diese Seereise. Und außerdem hätte sie dann nicht so beengt mit ihren Verwandten und deren Bediensteten in der viel zu kleinen Kajüte nächtigen müssen.
Das Schiff rollte, drehte sich um seine Längsachse. Moira runzelte die Stirn und spitzte die Ohren, während sie sich an den Rand des Strohsacks klammerte, um nicht gegen den laut schnarchenden Connor geworfen zu werden. Das kleine Schiff schlingerte in einer von Sturmböen gepeitschten See. Moiras Augen wurden groß, als sie hörte, wie Wind und Regen auf das Schiff einstürmten. Ja, sie waren wohl in ein Unwetter geraten, ein ziemlich schlimmes noch dazu, soweit sie das beurteilen konnte. Der Regen prasselte so heftig aufs Deck, dass es sich wie Trommelschläge anhörte, und der Wind heulte um das Schiff herum.
Annie! Moiras Herz machte vor Angst einen Sprung, als ihr ihre Begleiterin einfiel. Die Alte war nicht in der Kajüte. Vermutlich war sie hinausgeschlichen, um den Matrosen zu treffen, mit dem sie vorher geschäkert hatte, und saß nun in dem Sturm fest. Sie musste hinaus und sich vergewissern, dass Annie in Sicherheit war.
Mit angehaltenem Atem kroch Moira vorsichtig zum Fußende des Bettes. Sie holte ihren Umhang, den sie an einen Bettpfosten gehängt hatte, und warf ihn sich um die Schultern. Dann krabbelte sie auf allen vieren zur Tür. So, wie das Schiff rollte, wäre es unmöglich gewesen, aufrecht gehend einen Weg durch die Leute zu finden, die auf dem ganzen Boden verstreut lagen. Obwohl alle dank des reichhaltigen Alkoholgenusses tief zu schlafen schienen, bewegte sich Moira sehr behutsam, um niemanden aufzuwecken. Sie wollte lieber nicht gesehen werden. Wenn jemand sie ertappte, würde sie sich bestimmt vor ihrem Vormund rechtfertigen müssen.
Vor der Kajüte lehnte sie sich erst einmal an die Wand des engen Ganges und holte tief Luft. Was sollte sie nun tun? Vielleicht befand sich Annie ja in irgendeiner anderen Kajüte, im Trockenen und in Sicherheit? Doch diesen Gedanken verwarf sie kopfschüttelnd. Der Mann, mit dem Annie herumgeschäkert hatte, war nur ein einfacher Deckhelfer gewesen, ein armer Kerl ohne irgendeinen Rang. Er hatte bestimmt keinen eigenen Raum, zu dem er Annie hätte bringen können. Wenn überhaupt, befanden sich die beiden noch auf Deck. Es blieb ihr wohl nichts anderes übrig, als nachzusehen und sich zu vergewissern, dass die Alte wohlauf war.
Ihr erster Versuch wäre beinahe der letzte gewesen. Sobald sie die erste Stufe erklommen hatte, schlingerte das Schiff so heftig, dass sie stürzte und gegen die harte Wand prallte. Dort blieb sie erst einmal keuchend sitzen, bevor sie es erneut versuchte, auch wenn ihr ganzer Körper von dem Sturz schmerzte.
Als sie endlich auf dem Deck angelangt war, hätten der heulende Sturm und der prasselnde Regen sie beinahe gleich wieder vertrieben. Doch sie biss die Zähne zusammen und hangelte sich an allen Gegenständen in ihrer Reichweite vorwärts, um nach Annie zu suchen. Einerseits konnte sie sich kaum vorstellen, dass die Alte noch hier draußen war, doch sie lag auch nicht in ihrem Bett, wo sie hingehört hätte. Noch herrschte ein Zwielicht, das der Sturm nicht völlig verfinstert hatte, aber es würde trotzdem nicht leicht sein, in diesem Regen eine dürre alte Frau zu finden. Moira verfluchte die Alte herzhaft, während sie sich auf dem schlingernden Schiff mühsam weiterkämpfte.
Tavig sah die kleine Gestalt, die sich gegen Wind und Regen stemmte. Er schimpfte halblaut. In der letzten Stunde hatte er alles versucht, um zu seiner Kajüte zu gelangen, doch der Mannschaft fehlte ein Matrose, und der Kapitän hatte ihn aufgefordert mitzuhelfen. Tavig wusste, dass sich der Vermisste mit Annie herumtrieb. Außerdem wusste er, dass seine Verkleidung mit jedem Regentropfen schlechter wurde. Doch wenn er sich jetzt verdrückte, könnte es das Leben aller Leute auf diesem Schiff gefährden.
Und nun Moira. In der letzten Stunde hatte er inständig gehofft, dass er sich irrte und sie sich nicht auf die Suche nach ihrer liebestollen alten Begleiterin begeben würde. Hätte sich seine verdammte Hellsichtigkeit nicht wenigstens diesmal als falsch erweisen können? Doch nein – das Mädchen stolperte geradewegs in eine Menge Ärger, und das zu wissen bereitete ihm wahrhaftig keine Freude – noch dazu, weil ihm klar war, dass er gewissermaßen der Auslöser sein würde. Gerade fiel sie wieder hin, nur wenige Fuß von ihm entfernt, und klammerte sich an der Reling fest. Seufzend stolperte er zu ihr. Jetzt machte er sich nur noch Sorgen um ein einziges Leben.
»Was habt Ihr denn hier zu suchen?«, schrie er, um den wütenden Sturm zu übertönen. »Die wenigen Matrosen, die sich jetzt noch an Deck herumtreiben, sind alle angebunden. Und sobald wie möglich werden sich alle nach unten in Sicherheit bringen. Dort solltet auch Ihr Euch aufhalten.«
»Ihr doch genauso.«
»Ich musste helfen, die Schotten dichtzumachen.« Stirnrunzelnd blickte er zum Himmel, als Wind und Regen plötzlich nachließen. »Es sieht so aus, als müsste der Sturm Atem holen.«
»Gut. Jetzt werde ich Annie bestimmt finden.«
»Annie treibt es irgendwo mit ihrem Matrosen.« Er schüttelte den Kopf, als sie so heftig errötete, dass es selbst im Dämmerlicht nicht zu übersehen war.
»Das mag schon sein«, erwiderte sie verzagt. »Aber vielleicht steckt sie trotzdem in der Klemme. Sobald der Sturm losbrach, hätte sie sich in unsere Kajüte zurückziehen sollen.« Eine weitere Böe erfasste sie, und sie klammerte sich wieder fester an die Reling.
Tavig betrachtete sie. Wie konnte er sie nur dazu bringen, sich wieder unter Deck zu begeben? Dann erstarrte er. In ihm machte sich das kalte, bekannte Gefühl breit, dass er in Umständen feststeckte, die er weder beherrschen noch ändern konnte. Er bemühte sich, seine Angst und seine Hilflosigkeit nicht zu zeigen, aber er wusste, dass es ihm nicht ganz gelang, als er sagte: »Entfernt Euch von dieser Reling, Mädchen!«
Moira runzelte die Stirn. Seine Stimme klang seltsam angestrengt. Sie erstarrte. War Master Fraser etwa nicht nur der alte Lüstling, für den sie ihn gehalten hatte, sondern noch etwas weitaus Gefährlicheres?
»Das werde ich tun, sobald der Wind wieder etwas nachlässt«, erwiderte sie. Aber vielleicht sollte sie sich lieber möglichst rasch aus der Reichweite dieses Mannes entfernen?
»Der Wind wird nicht nachlassen«, fauchte er. »Wir befinden uns mitten in einem Unwetter. Die kleine Atempause wird nicht sehr lange dauern, danach wird der Sturm wahrscheinlich sogar noch heftiger toben. Und jetzt entfernt Euch endlich von dieser elenden Reling!«
In dem Moment, als sie beschloss, seiner Aufforderung zu folgen, nur damit er endlich Ruhe gab, bemerkte sie etwas, das sie innehalten ließ: Master Frasers Haar war nicht mehr so grau und stumpf wie vorher. Die graue Farbe war herausgesickert und hatte sich in klebrigen Klumpen an den Spitzen gesammelt. Verwundert starrte sie ihn an. Vor ihren Augen löste sich gerade eine der wenigen noch verbliebenen grauen Strähnen auf, die Farbe glitt nach unten. Master Fraser war mit Sicherheit nicht der, der zu sein er vorgab. Überwältigt von Neugier, streckte sie die Hand aus, um seine Haare zu berühren.
»Euer Alter wird vom Regen weggespült«, murmelte sie. Doch gleich darauf riss sie erschrocken die Augen auf, weil ihrem Gegenüber ein derber Fluch entfuhr.
»Ich wusste, dass das passieren würde«, grollte er. »Ich muss sofort ins Trockene.« Er packte sie so unsanft, dass sie gegen ihn taumelte.
»Hier steckst du also – um herumzuhuren!«
Bestürzt schrie Moira auf, als sie von ihrem Vormund, Sir Bearnard, grob gepackt und weggerissen wurde. »Nay, Sir, ich schwöre, ich bin nur hier, um die krumme Annie zu suchen«, erwiderte sie kläglich.
»Und das tust du in den Armen dieses Gauners?«, knurrte er und schüttelte sie heftig. »Willst du etwa all deinen Sünden auch noch die Lüge hinzufügen, du kleines Miststück?«
Als Bearnard mit seiner feisten Hand zum Schlag ausholte, drehte sich Moira rasch um. Sie versuchte, möglichst ruhig zu bleiben, um all die Spannung und den Widerstand aus ihrem Körper zu vertreiben. Im Lauf der Jahre hatte sie gelernt, dass Bearnards Schläge an Wucht verloren, wenn ihr Körper schlaff war. Sie gab keinen Laut von sich, als er sie mit dem Handrücken quer übers Gesicht schlug und sie auf das Holzdeck fiel. Auf allen vieren landend, senkte sie hastig den Kopf, ohne ihren Vormund ganz aus den Augen zu lassen. Sie wollte darauf vorbereitet sein und den schlimmsten Schmerz vermeiden, falls er beschloss, seinen brutalen Tadel noch mit ein paar Tritten zu verstärken.
Auf einmal störte ein seltsames Geräusch ihre Konzentration. Sie schüttelte den Kopf, aber das Geräusch stammte nicht daher, weil ihr Kopf vom Schlag ihres Vormunds dröhnte. Nein, dieses Geräusch war ein leises, grimmiges, wütendes Fauchen, ausgestoßen von dem Mann, der sich George Fraser nannte. Moira drehte sich herum und setzte sich aufrecht hin, um ihn besser sehen zu können. Sie sperrte den Mund vor Staunen weit auf, als sich der Bursche auf Bearnard stürzte und den viel größeren, schwereren Mann mit einem Fausthieb zu Fall brachte.
»Ihr seid wirklich ein schneidiger Kerl, Robertson«, grollte er verächtlich. »Es erfordert einiges an Mut, um ein kleines, zierliches Mädchen zu schlagen.«
»Hütet Eure Zunge, Sir«, schrie Bearnard, während er sich wieder aufrappelte. »Einem Mann, der einem Mädchen nachstellt, das gerade mal halb so alt ist wie er, steht es kaum zu, sich derart selbstgerecht über andere zu empören. Ihr seid doch nur ein alter Lustmolch, der versucht, ein törichtes junges Ding zu verführen.«
»Selbst wenn dem so wäre, würde es mich trotzdem noch zu einem besseren Mann machen im Vergleich zu einem brutalen Hundesohn, der sich anschleicht, um ein argloses junges Mädchen zu verprügeln.«
Bearnard schnaubte wutentbrannt, dann stürzte er sich auf Master Fraser. Die beiden Männer gingen krachend zu Boden. Moira schrie entsetzt auf. Ohne zu wissen, was sie tun sollte, trat sie näher an die Kämpfenden heran. Doch irgendetwas musste sie tun, um den Streit zu beenden, den sie, ohne es zu wollen, entfacht hatte.
»Sei bloß nicht so blöd!«, erklang eine tiefe Stimme hinter ihr, und Arme legten sich um ihre Taille.
Sie drehte den Kopf um. »Nicol!«, rief sie, als ihr Blick auf ihren Cousin fiel. »Wo kommst du denn her?«
»Ich bin Vater gefolgt, als er sich auf die Suche nach dir gemacht hat. Wahrscheinlich hatte ich eine Eingebung, dass du kurz davor stündest, eine große Torheit zu begehen. Grundgütiger, Moira, warum willst du denn mit dem alten Narren da herumtändeln?«
»Ich habe nicht mit ihm herumgetändelt. Ich war auf der Suche nach der krummen Annie, und Master Fraser wollte mich überreden, zurück in meine Kajüte zu gehen.«
»Es wäre besser gewesen, du hättest sie nie verlassen«, murrte Nicol, dann meinte er plötzlich: »Der Bauch deines Retters ist verrutscht!«
Was sollte das denn heißen? Moira blickte auf die Kämpfenden. Mittlerweile waren wieder beide auf den Beinen und umkreisten einander wachsam, jeder darauf bedacht, eine Blöße zu finden, um den anderen anzugreifen. Als sie Master Fraser musterte, riss sie erstaunt die Augen auf. Sein weicher Bauch beulte sich in einem unregelmäßigen Klumpen an seiner linken Seite. Sein Wams war aufgerissen, und irgendetwas hing ihm über dem Bund der anliegenden Hose. Als sie genauer hinsah, merkte sie, dass Master Frasers weicher Bauch nur aus zusammengerollten Lumpen bestand.
»Das Grau in seinen Haaren ist auch weggespült worden«, sagte sie.
»Aye«, pflichtete Nicol ihr bei. »Der Mann ist nicht der, der zu sein er vorgibt. Verflixt noch mal, ich glaube, ich weiß, wer das ist.«
Bevor Moira Nicol um eine Erklärung bitten konnte, hatte der sich schon zu seinem Vater aufgemacht. Bearnard war inzwischen zum Angriff übergegangen und hatte seinen Gegner, der um einiges kleiner war als er, mit einem Fausthieb niedergestreckt. Dabei hatte George Fraser seinen Hut verloren, den nun der Wind packte und aufs Meer hinauswehte. Seine mittlerweile vollkommen schwarzen Haare flatterten ihm um den Kopf, während er sich bemühte, Bearnard davon abzuhalten, die feisten Hände um seinen Hals zu legen. Fraser war nun eindeutig als ein junger, kräftiger Mann zu erkennen.
Nicol trat einen weiteren Schritt auf seinen Vater zu, während dieser mitten in seiner Bewegung innehielt. Die Mienen der zwei Männer verrieten Moira, dass sie nun beide den Mann erkannt hatten und überrascht waren, dass er an Bord war. Frasers Gesichtsausdruck sagte ihr, dass es ihm gar nicht recht war, erkannt worden zu sein. Sie erstarrte. Plötzlich hatte sie Angst um den Mann, der sie so galant hatte verteidigen wollen.
»Tavig MacAlpin!«, entfuhr es Bearnard. Er sprang hoch und griff nach seinem Schwert.
»Jawohl. Und was geht Euch das an?«, fauchte Tavig, während er langsam aufstand und sich vor den Robertsons aufbaute.
»Das geht jeden rechtschaffenen Mann zwischen hier und London etwas an.«
»Ihr seid kein rechtschaffener Mann, Robertson, sondern ein brutaler Schläger, der andere mit seinen Fäusten und seinem unerschöpflichen Vorrat an Brutalität in Schach hält. Achtung oder Zuneigung sind Euch fremd, deshalb weckt Ihr Furcht in den Menschen um Euch herum.« Tavig legte langsam die Hand auf sein Schwert und stellte sich auf den Angriff ein, mit dem er fest rechnete. »Es ist ein Wunder, dass Ihr so lange überlebt habt und dass Euch noch keiner den fetten Hals durchgeschnitten hat.«
»Und Ihr wärt wohl der Richtige dafür, stimmt’s? Nichts gefällt Euch besser, als Euch von hinten anzuschleichen und einem Mann die Kehle aufzuschlitzen – oder den Bauch, wie Ihr es bei Euren Freunden getan habt. Euer Cousin Iver MacAlpin hat eine stattliche Summe auf Euch ausgesetzt, und die werde ich mir holen.« Bearnard zückte sein Schwert und stürzte sich auf Tavig.
»Vater!«, schrie Nicol. »Sir Iver will den Mann lebendig.«
»Der Mistkerl verdient den Tod«, knurrte Sir Bearnard.
»Kommt doch und versucht es«, höhnte Tavig. »Na ja, vielleicht habt Ihr ja sogar Glück, aber bevor ich sterbe, schlitze ich Euch noch den Bauch auf, Mistkerl!«
Wutschnaubend griff Bearnard immer heftiger an, doch Tavig parierte jeden Schlag. Er wollte nicht sterben, aber er wollte auch nicht gefangen genommen werden. Wenn er an seinen verräterischen Cousin Iver ausgeliefert wurde, würde er einen langsamen, qualvollen Tod für zwei Morde sterben, die er nicht begangen hatte. Wenn er den Kampf gegen Robertson nicht gewinnen konnte, wollte er sicherstellen, dass der Mann ihn tötete.
»Nay, Onkel Bearnard!«, schrie Moira, als Tavig stolperte und Bearnard zum tödlichen Schlag ausholte.
Während Tavig fieberhaft vor Bearnards Schwert wegkroch, sah er, dass Moira zu ihrem Onkel stürzte. Er fluchte, als Bearnard das Mädchen wegstieß und sie gegen die Reling schleuderte, genau die Reling, vor der Tavig sie gewarnt hatte. Bearnard war kurz abgelenkt, was Tavig rasch nutzte. Er stürzte sich auf den Kerl und stieß ihn zu Boden. Mit zwei raschen, wütenden Fausthieben schlug er ihn bewusstlos. Dann richtete er sich wieder auf und eilte zu Moira, ohne weiter auf Bearnards Sohn Nicol zu achten.
»Mädchen, Ihr müsst von dieser Reling weg!«, herrschte er sie an, wobei er Nicol, der inzwischen das Schwert auf ihn gerichtet hatte, weiterhin kaum beachtete.
Moira war noch immer benommen von Bearnards Ohrfeige, doch während sie versuchte, der barschen Aufforderung dieses seltsamen Mannes zu folgen, richtete sich der erneut aufgekommene Wind gegen sie. Die Böen stürmten auf sie ein und drückten sie gegen die Reling. Der heulende Wind hielt sie so fest, dass sie sich kaum rühren konnte. Ihr war, als würde ihr der Atem aus dem Körper gepresst. Die groben Planken der Reling bohrten sich in ihren Rücken, während der Sturm sie immer stärker gegen das Holz drückte.
Sie sah, dass Tavig mit aller Kraft gegen den Wind ankämpfte und versuchte, sich ihr zu nähern. Dann hörte sie plötzlich ein unheilverkündendes Geräusch: das Splittern von Holz.
Die Reling, an die Moira gepresst wurde, gab nach. Tavig und Nicol stießen einen Warnschrei aus. Moira klammerte sich an die Bretter, doch ein Großteil der Reling hing nun über den schäumenden Wogen. Der Teil, an den sie sich klammerte, war nur noch mit einer schmalen Planke mit dem Rest verbunden. Vorsichtig versuchte sie, sich daran entlangzuhangeln und in die Reichweite von Nicols und Tavigs ausgestreckten Händen zu kommen. Sie war nur um Haaresbreite davon entfernt, als die Reling ihre letzte schwache Verbindung zum Schiff aufgab. Mit einem Schrei stürzte Moira in die sturmgepeitschte See.
Tavig klammerte sich an den unbeschädigten Teil der Reling und rief Moiras Namen. Er konnte kaum noch ihr weißes Nachthemd erkennen. Sie hielt sich noch immer an der Planke fest, aber ihr Köper befand sich schon zur Hälfte in der eiskalten, aufgewühlten See. Das Mädchen konnte den Kopf bestimmt nicht mehr sehr lange über Wasser halten, und sie konnte sich auch nicht allein daraus befreien. Bald würde sie in den hohen Wellen untergehen. Auf sich allein gestellt, hatte sie keine Chance zu überleben.
»Holt mir das Seil dort drüben!«, keuchte Tavig und deutete auf einen Strick, der an einem Poller vertaut war.
»Was könnt Ihr schon tun?«, rief Nicol, steckte das Schwert jedoch zurück in die Scheide und beeilte sich, Tavigs Befehl zu folgen.
»Ich springe ihr nach.« Tavig schlang das Tau um seine Schultern und trat zu der Lücke in der Reling.
Nicol packte ihn am Wams. »Seid Ihr von Sinnen? Das werdet Ihr nicht überleben!«
»Besser sterben bei dem Versuch, einen dürren Rotschopf zu retten, als am Galgen zu enden. Und vielleicht sterbe ich ja gar nicht.«
Mit einem Blick auf die tosenden Wogen erwiderte Nicol: »Doch, das werdet Ihr.«
»Mir wär’s lieber, wenn ich es nicht täte. Aber eines weiß ich: Ich muss jetzt zu Moira, sonst überlebt sie es nicht. Es ist allerdings verdammt schwer, der kleinen Stimme in mir zu folgen, die mich auffordert, ihr nachzuspringen. Ich hoffe nur, diese Stimme ist anständig genug, mir auch zu sagen, was passieren wird, nachdem ich in diese schwarzen, gefährlichen Wogen gesprungen bin.«
»Was plappert Ihr da, MacAlpin?«
»Das Schicksal, mein Bester, das verflixte Schicksal.«
Er betete, dass seine Eingebung weiterhin recht behielte, dann holte er tief Luft und sprang. Als er in dem kalten Wasser landete, geriet er einen Moment lang in Panik. Er ging in einer gischtbekrönten Welle unter und fürchtete, dass er nie mehr an die Oberfläche kommen würde. Doch dann begann er, gegen die widrigen Elemente zu kämpfen, und schaffte es, den Kopf über Wasser zu bekommen. Er atmete mehrmals tief durch, nicht nur, weil er es dringend nötig hatte, sondern auch vor Erleichterung. Als Nächstes sah er sich nach Moira um, und als er ihr weißes Nachthemd erblickte, schwamm er kraftvoll darauf zu.
Er verfluchte die stürmische See. Wie er bald erkannte, klammerte sich Moira noch immer verzweifelt an die Planke. Bei ihr angelangt, hievte er sich auf das kümmerliche Floß, schlang sich hastig das Seil um die Taille und band sich damit an der Planke fest. Sobald er sich sicher genug fühlte, packte er Moira an einem ihrer schlanken Handgelenke und zog sie aus dem Wasser. Sie sackte neben ihm zusammen. Während die kalten Wogen sie überliefen, sicherte er auch eine ihrer Hände mit dem Seil. Dann nahm er ihre freie Hand in die seine. Als er sich flach auf die nasse Planke presste, befand er sich Nase an Nase mit Moira.
»Ihr seid verrückt!«, keuchte sie und hustete, als eine weitere Welle über sie hinweglief und das Salzwasser in ihren Mund drang. »Jetzt werden wir beide ertrinken!«
Bei der nächsten Welle, die über sie hinwegspülte, konnte sich Tavig des Gefühls nicht erwehren, dass sie vielleicht recht hatte.
2
Moira vernahm ein heiseres Stöhnen. Es dauerte eine Weile, bis sie merkte, dass das furchtbare Geräusch aus ihrer eigenen Kehle stammte. Sie fühlte sich schrecklich. Ihre Wange war an etwas Feuchtes, Raues gepresst. Schließlich stellte sie fest, dass sie auf einem Strand lag, mit dem Gesicht im Sand. Ihr Körper tat so weh, dass sie am liebsten geweint hätte. Sie war völlig durchnässt. Plötzlich zog sich ihr Magen zusammen. Mühsam hob sie den Kopf und übergab sich unter schrecklichen Krämpfen.
Eine leise Männerstimme begleitete ihre Nöte. Sie faselte irgendeinen Unsinn, dass ihr Elend nur zu ihrem Besten sei und dass es ihr bald wieder besser gehen werde. Moira hoffte auf eine kleine Pause zwischen den Magenkrämpfen, in der sie dem Narren sagen wollte, er solle sich zur Hölle scheren und dort bleiben. Aber sie war sich nicht sicher, ob ihr diese Pause vergönnt sein würde. Ihr Körper war offenbar entschlossen, alles loszuwerden, was ihn störte, und diese Qualen erforderten all ihre Aufmerksamkeit.
Tavig lächelte schief, als er ihre abgehackten Flüche vernahm. Bald würde sie das Schlimmste hinter sich haben. Er rieb ihr den Rücken, während sie sich weiter erbrach. Ihr Elend war kaum mit anzusehen, aber er wusste, es war nicht zu vermeiden. Sobald sie etwas ruhiger atmete, zog er sie zu einer sauberen Stelle, an der sie gleich wieder zusammenbrach.
»Hier, spült Euch den Mund«, drängte er.
Moria schlug die Augen auf. Er hielt ihr einen groben Holzbecher unter die Nase. Sie stützte sich auf einen Ellbogen, kostete vorsichtig und stellte fest, dass der Becher Wein enthielt. Zuerst spülte sie den Mund damit aus, dann nahm sie vorsichtig einen kleinen Schluck von dem leicht bitteren Trank und sah sich um. Langsam fiel ihr wieder ein, was passiert war, und sie begriff, warum sie hier auf einem Strand kauerte, der von der aufgehenden Sonne in ein sanftes rosafarbenes Licht getaucht war. Schließlich wandte sie sich stirnrunzelnd Tavig zu.
»Woher habt Ihr den Wein und den Becher? Die Sachen sind doch nicht zusammen mit uns an Land gespült worden, oder?«
»Nay. In der Nähe gibt es eine Fischerkate.«
»Also auch jemanden, der uns vielleicht helfen könnte?«
»Das glaube ich nicht. Die Kate sieht aus, als ob sie schon länger nicht mehr bewohnt ist. Da dort drinnen noch etliche Vorräte herumliegen, jedoch weit und breit nichts von einem Boot zu sehen ist, kann ich mir nur vorstellen, dass der arme Besitzer auf einem Fischzug ertrunken ist.«
Moira bekreuzigte sich, dann gab sie Tavig den Becher zurück und streckte sich ermattet auf dem Strand aus. Tavigs Kleidung war schmutzig und zerlumpt, sie fragte sich, warum er sich nicht der letzten Reste seines einst recht kostbaren Leinenhemds entledigt hatte. Das, was noch davon übrig war, trug kaum dazu bei, seine breite, glatte, dunkle Brust zu verhüllen.
Bei dem traurigen Zustand seiner Kleidung fragte sie sich natürlich auch, wie ihre eigene aussah. Eine kühle Morgenbrise strich über den Strand und auch über ihren Körper – über so viel bloße Haut, dass von ihrem Nachthemd und ihrem Umhang wohl nicht mehr viel übrig war. Moira wusste, dass sie zumindest hätte nachsehen sollen, ob sie noch sittsam bedeckt war, aber sie war zu schwach, um sich zu rühren. Ihr Körper fühlte sich von oben bis unten völlig zerschlagen und kraftlos an.
»Was ist mit Eurem Bart passiert?«, fragte sie. Seine glatten Gesichtszüge waren viel zu attraktiv für ihr seelisches Gleichgewicht.
»Ich habe ihn abrasiert. Ich konnte das Ding nicht mehr ertragen«, erwiderte er und streckte sich neben ihr aus.
»Und Eure Gemahlin, die an einem Fieber gestorben ist?«
»Eine Lüge, fürchte ich. Geht es Euch besser?«
»Noch nicht wesentlich. Ich glaube, ich bleibe einfach hier liegen und warte, bis ich sterbe. Mir ist eiskalt, ich fühle mich schon fast wie eine Leiche. Am besten schaufelt Ihr mir ein Grab und sucht mir ein Leichentuch.«
»Ich fürchte, das, was Ihr und ich am Leibe tragen, reicht nicht einmal zusammengenommen für ein Leichentuch.«
»Also bin auch ich nur in Lumpen gehüllt und wahrscheinlich nicht einmal sittsam bedeckt.«
»So schlimm ist es auch wieder nicht. Zumindest sind die Teile von Euch bedeckt, die ich sehr gern ein bisschen eingehender betrachten würde.«
Moira fragte sich, warum sie nicht errötete, ja, nicht einmal empört war. Wahrscheinlich war sie noch zu erschöpft, um sich über seine Frechheit aufzuregen. »Ihr seid ganz schön unverschämt für einen Mann, der zum Tod durch den Strang verurteilt worden ist.«
»Verurteilt bin ich zwar, aber noch bin ich frei.«
»Kein Verurteilter kann wirklich frei sein. Ihr seid nur knapp mit dem Leben davongekommen, und ich genauso. Dafür danke ich Euch. Ich weiß noch, dass Ihr nach mir in die kalten Fluten gesprungen seid. So etwas zu tun ist reichlich sonderbar. Aber ich bin natürlich dankbar für den Moment des Wahnsinns, der Euch befallen haben muss.«
»Ihr habt versucht, Euren Vormund davon abzuhalten, mich zu zerstückeln. Diese Ablenkung hat mir womöglich das Leben gerettet, also musste ich mich wohl revanchieren. Und außerdem – hätte ich tatenlos dastehen und zusehen sollen, wie das Mädchen wegschwimmt, das zu heiraten mir bestimmt ist?«
Tavig wartete geduldig, bis die Bedeutung dieser Worte ihr bewusst wurde. Ihr Gesicht war sehr einfach zu lesen: Zuerst zeichnete sich Verwirrung ab, dann ein allmähliches Begreifen, bei dem ihre herrlichen blauen Augen sehr groß wurden. Er bezweifelte, dass sie ihm glauben würde. Wahrscheinlich hielt sie ihn für verrückt. Selbst er wusste nicht so recht, ob er Herr seiner Sinne war. Doch während er sich um Moira gekümmert hatte, ging ihm allmählich auf, warum ihrer beider Leben plötzlich so eng miteinander verwoben war. Sie waren Gefährten, die das Schicksal füreinander bestimmt hatte. Davon war er mittlerweile so gut wie überzeugt.
Moira bräuchte eine Weile, um sicherzugehen, dass sie sich nicht verhört hatte. Selbst als sie anfing, es zu glauben, verstand sie es nicht. Der Mann musste verrückt sein. Oder wollte er sie etwa auf die Probe stellen, ob sie noch genügend Verstand hatte zu erkennen, wie lächerlich das war, was er soeben gesagt hatte?
»Ich glaube, Ihr habt so viel Wasser geschluckt, dass es Euch den Verstand zerfressen hat, Sir MacAlpin«, sagte sie schließlich.
»Eine höchst ungewöhnliche Reaktion auf einen Heiratsantrag«, murmelte er.
»Heiratsantrag? Das ist doch blanker Unsinn! Ich glaube, Ihr habt das nur gesagt, weil Ihr sehen wolltet, ob mein Kopf inzwischen klar genug ist, um es als Unsinn zu erkennen.«
»Unsinn? Wahnsinn? So etwas tut mir in der Seele weh!«
»Hört auf, Euch über mich lustig zu machen, und helft mir lieber hoch.« Sie streckte die Hand aus. »Glaubt Ihr, das Schiff ist untergegangen?«, fragte sie, während er sie hochzog, danach aber ihre Hand nicht losließ.
»Nein, das glaube ich nicht. Auf dem Strand liegen jedenfalls keine Wrackteile herum.« Er ignorierte ihren Versuch, ihm ihre Hand sanft zu entziehen. »Während ich darauf gewartet habe, dass Ihr wieder zu Euch kommt, bin ich in beiden Richtungen ziemlich weit gelaufen.«
Mit ihrer freien Hand zog sich Moira die Reste ihres feuchten Umhangs über die Beine. Gottlob war seinem rätselhaften Blick sonst kaum etwas ausgesetzt. Ihre Lage war peinlich genug, sie hatte wahrhaftig keine Lust, sich auch noch um die Sittsamkeit zu sorgen. Stattdessen lenkte sie ihre Gedanken wieder auf die schwierige Frage, was sie nun tun sollte.
»Wenn das Schiff den Sturm überstanden hat, werden meine Verwandten nach uns suchen«, meinte sie. »Ich glaube, ich sollte einfach hierbleiben.«
»Ach wirklich?«, fragte er gedehnt.
»Mir ist klar, dass Ihr nicht erpicht darauf seid, sie wiederzusehen. Deshalb kann ich es verstehen, wenn Ihr die Chance zur Flucht ergreift.«
»Wie freundlich von Euch.«
Sie starrte ihn finster an. Mittlerweile hatte sie es aufgegeben, ihre Hand auf sanfte Art und Weise aus seiner zu lösen, und entwand sich nun gewaltsam seinem festen Griff. »Sir MacAlpin, ich fange an zu glauben, dass Ihr meinen Plan nicht gutheißt.«
»Ich wusste doch gleich, dass Ihr ein schlaues Mädchen seid.« An ihrem verdrießlichen Gesicht erkannte Tavig, dass sie allmählich wütend wurde; deshalb beeilte er sich, eine Erklärung hinzuzufügen. »Falls Eure Verwandten nicht glauben, dass Ihr tot seid, also die Hoffnung hegen, dass Ihr überlebt habt und irgendwo an Land gespült worden seid, gibt es eine ewig lange Küste, die sie absuchen müssten. Es würde Tage dauern, bis sie Euch finden. Und diese Zeit haben sie nicht, stimmt’s?«
Moira schimpfte halblaut. Zu ihrem Leidwesen musste sie ihm recht geben. Ihre Verwandten hatten nicht die Zeit, nach ihr zu suchen, selbst wenn sie es für möglich hielten, dass sie noch am Leben war. Sie mussten Sir Bearnards Tochter Una befreien, und zwar noch in diesem Monat. Bei dem Versuch, mit Unas Entführer zu verhandeln, hatten sie bereits viel zu viel Zeit vergeudet, jetzt blieben ihnen nur noch drei Wochen. Natürlich stellte das auf Sir Tavig MacAlpin ausgesetzte Kopfgeld eine gewisse Versuchung für sie dar, aber diese Versuchung wog das Risiko, Una zu verlieren, nicht auf. Sir Bearnard hatte mit seiner Tochter Großes im Sinn. Er dachte daran, mit einer geschickt eingefädelten Ehe sein Ansehen und seinen Wohlstand zu mehren.
Moira blieb wohl nichts anderes übrig, als sich um sich selbst zu kümmern. Von Tavig, der seelenruhig neben ihr saß und sie beobachtete, konnte sie kaum noch mehr Beistand erwarten. Er musste seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Wenn er bei ihr bliebe, bestand die Möglichkeit, dass er ihren Verwandten wieder in die Hände fiel. Nach einem Wiedersehen mit Sir Bearnard gelüstete es diesem Mann bestimmt nicht. Und wie sehr konnte sie jemandem trauen, dem zwei Morde angelastet wurden, selbst wenn er sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte, um ihres zu retten?
»Nun, dann mache ich mich wohl auf die Suche nach einem Sheriff oder dergleichen«, sagte sie schließlich.
»Glaubt Ihr wirklich, dass Ihr hier viel Hilfe finden werdet? Ihr seid völlig zerlumpt und habt keinerlei Möglichkeit zu beweisen, dass Ihr seid, wer Ihr zu sein behauptet. Das sage ich jetzt nicht, um Euch zu beleidigen, aber im Moment kommt Ihr daher wie eine arme kleine Bettlerin. Und obendrein könnte man Euch noch für eine Diebin halten, weil Eure zerrissenen Kleider aus einem ziemlich kostbaren Stoff gefertigt sind.«
»Habt Ihr denn einen besseren Plan?«, erwiderte sie ungehalten, denn es ärgerte sie, dass er ihre Einfälle ständig mit triftigen Argumenten durchkreuzte.
»Jawohl, meine zornige Braut.«
»Ich bin nicht Eure Braut!«
Tavig überhörte ihren mürrischen Einspruch. »Ihr könnt bei mir bleiben, und ich werde Euch an einen sicheren Ort bringen.«
»Sicher? In Eurer Nähe? Ich habe gehört, was mein Cousin Nicol sagte, als Eure Verkleidung sich auflöste. Ihr seid auf dem direkten Weg zum Galgen. Ich glaube nicht, dass das ein sicherer Ort ist.«
»Noch liegt die Schlinge nicht um meinen Hals, Liebes.« Er stand auf, klopfte sich den Sand von den Kleidern und streckte ihr die Hand hin. »Nun kommt. Wir sollten uns jetzt besser auf den Weg machen. Vor uns liegt eine lange, harte Reise.«
Ein wenig argwöhnisch ließ sie sich von ihm hochhelfen. »Wohin reisen wir?«
Er schlug die Richtung ins Landesinnere ein und lächelte schwach, als er hörte, wie sie ihm eilig folgte. Ihr Argwohn kränkte ihn nicht, er war ihr kaum zu verübeln. Vor dem Gesetz galt Tavig als Mörder, auch wenn er ihr das Leben gerettet hatte. Da sie ihn kaum kannte, konnte sie nicht beurteilen, ob die Anklage gegen ihn rechtens war. Ebenso wenig konnte er ihr verübeln, dass sie ihn für leicht verrückt hielt, wenn er so unvermittelt übers Heiraten redete, dachte er und musste ein wenig grinsen. Ja, er hätte sie sogar für etwas beschränkt halten müssen, hätte sie nicht ein gewisses Zögern und Misstrauen an den Tag gelegt.
»Sir Tavig«, ächzte Moira, als sie ihm mühsam über einen steinigen Hang hinauf zu dem Heideland folgte, das den Strand säumte. »Wohin bringt Ihr uns?«
»Zur Burg meines Cousins.« Er half ihr die letzten paar Schritte hoch, dann schlug er den Weg zu einer kleinen, reetgedeckten Kate ein, die nur wenige Meter von ihnen entfernt lag. »Er wird uns helfen, und er wird auch einen Priester für uns auftreiben, der uns trauen kann.«
Moira beschloss, dass es wohl am besten wäre, sein albernes Geschwätz von einer Heirat zu überhören. »Kenne ich diesen Cousin? Ihr habt doch bestimmt mehrere. Sir Iver habt Ihr ja wohl nicht im Sinn, der ist doch hinter Euch her. Mit einem Namen wäre mir sehr gedient.«
»Mungan Coll.« Als Tavig hörte, dass sie abrupt stehen blieb, wandte er sich fragend zu ihr um.
»Der Mungan Coll, zu dem wir unterwegs waren, als ich ins Meer stürzte? Der Mungan Coll, der meine Cousine Una als Geisel hält?«
»Richtig, genau der.«
»Ihr wollt mir einreden, dass ich bei einem solchen Mann in Sicherheit wäre?«
»Jawohl, doch ich merke, dass Ihr kaum geneigt seid, mir zu glauben. Seht es doch einmal so: Ihr werdet dann immerhin an einem Ort sein, an dem Euch Eure Verwandten bestimmt finden.« Er nahm sie bei der Hand, ignorierte ihr leichtes Zögern und zog sie zu der Fischerkate.
»Aye – als Gefangene gleich neben Una. Zweifellos würde auch für mich ein gewisses Lösegeld gefordert werden.« Das beunruhigte sie freilich am meisten, denn sie war sich nicht sicher, ob ihre Verwandten auch nur einen Farthing für sie locker machen würden.
»Nay. Mungan würde niemals meine Frau zur Geisel nehmen.«
Er schob sie in die Hütte. Sie blieb in der niedrigen Tür stehen und schimpfte weiter halblaut, während er ein Feuer und ein paar Talglichter anzündete. Sein Plan behagte ihr ganz und gar nicht, aber sehr zu ihrem Verdruss fiel ihr absolut nichts Besseres ein.
Als es in dem nahezu fensterlosen Raum etwas heller wurde, setzte sie sich auf eine derbe Bank vor einen ebenso schlichten Holztisch. Mürrisch sah sie zu, wie Tavig ein paar Lebensmittel auftrieb und sich anschickte, Hafergrütze zu kochen. Seine Selbstständigkeit ärgerte sie, denn dabei wurde ihr nur allzu klar, warum sie auf Gedeih und Verderb an ihn gebunden war. In ihren achtzehn Lebensjahren war sie noch nie auf eigenen Füßen gestanden. Schon der Gedanke, sich allein durchs Leben schlagen zu müssen, erfüllte sie mit Angst und Schrecken. Einen längeren Zeitraum, in dem sie zwangsläufig auf sich allein gestellt war, würde sie wohl kaum überstehen.
Sie tröstete sich mit dem Gedanken, dass ihre mangelnden Fertigkeiten nicht allein ihre Schuld waren; denn ihre Eltern, ihre Ammen und Mägde hatten sie kaum einen Handgriff tun lassen. Das hatte sich allerdings drastisch geändert, als sie zu Sir Bearnard Robertson und seiner Familie gezogen war. Dort hatte man sie unverzüglich damit beauftragt, sich ans Nähen und Weben zu machen. Aber diese Fertigkeiten würden ihr jetzt nicht viel nützen. Die krumme Annie, die sie vor zwei Jahren unter ihre alternden Fittiche genommen hatte, hatte sich zwar angeschickt, ihr ein paar nützlichere Dinge beizubringen, doch die Zeit hatte nicht gereicht, um sehr viel mehr zu lernen als den einigermaßen geschickten Umgang mit einem Messer.
Also kann ich mich immerhin ein bisschen verteidigen, sinnierte sie. Das war wenigstens etwas, auch wenn es beileibe nicht reichte. Dies wusste sie nur zu gut. Es würde ihr weder Kleidung noch Nahrung einbringen und sie auch nicht vor rauer Witterung schützen. Sie bräuchte Tavig MacAlpin, wie sie sich zu ihrem großen Verdruss eingestehen musste. Finster funkelte sie die Schüssel mit dem Haferbrei an, die er ihr gereicht hatte.
»Na kommt schon, Kleine, warum seid denn Ihr so trübe gestimmt?« Tavig setzte sich ihr gegenüber und begann zu essen.
»Ihr meint wohl abgesehen von der Tatsache, dass ich gerade mehrere Stunden im eiskalten Meer herumgeworfen worden bin und dabei fast ertrunken wäre?« Sie musste zugeben, dass er es verstand, einen ausgezeichneten Haferbrei zu kochen, doch das trug kaum dazu bei, ihre Laune zu heben.
»Aber Ihr habt überlebt. Ihr seid ein bisschen herumgeschleudert worden, aber die Wellen haben Euch lebend ans Ufer gespült.«
»Und was ist mit der Tatsache, dass ich nichts anzuziehen habe bis auf ein zerrissenes Nachthemd und einen lädierten Umhang?«
»Ich finde, dass Eure Kleidung die Strapazen recht gut überstanden hat.«
»Ach ja? Und dass ich nicht die geringste Ahnung habe, wo wir uns befinden, was ist damit? Ich sitze auf einer einsamen Heide fest und habe keine Ahnung, wohin ich unterwegs bin und wie ich dorthin gelangen soll.«
»Zerbrecht Euch nicht Euer hübsches Köpfchen darüber. Ich bringe Euch in Sicherheit.«
»Aye, und noch eines«, murrte sie und kratzte den Rest Haferbrei mit kurzen, heftigen Bewegungen aus der Schüssel.
»Und das wäre?«, fragte er, als sie nicht weitersprach und nur verdrossen in die leere Schüssel starrte.
»Ich kann nicht für mich sorgen. Ich kann nichts tun, was getan werden muss, um diese Strapaze zu überleben. Ich muss mich gänzlich darauf verlassen, dass Ihr mir helft und mich an einen sicheren Ort schafft.«
»Es ist doch nicht so schlimm, wenn eine Frau sich auf ihren Mann verlassen muss.«
Moria schlug mit dem Holzlöffel auf den Tisch. »Wenn wir schon zusammenbleiben müssen, dann könnt Ihr vielleicht wenigstens mit diesem albernen Geschwätz aufhören. Ich finde es überhaupt nicht lustig.«
»Das freut mich. Die Ehe ist nichts, worüber man sich lustig machen sollte. Sie ist eine sehr ernste Angelegenheit.« Beinahe musste er lachen über den absolut angewiderten Blick, mit dem sie ihn bedachte.
»Warum beharrt Ihr darauf?«
Es musste ein Scherz sein, und dieser Scherz tat ihr weh. Sie hatte sich mehr oder weniger damit abgefunden, als alte Jungfer zu enden und sich vielleicht eines Tages um Unas Kinder zu kümmern. Da für sie keine Ehe vereinbart, ja nicht einmal erwogen worden war, ging sie davon aus, dass sie keine Mitgift besaß. Dieser Mangel und noch dazu ihr rotes Haar, etwas, was viele als schreckliche Farbe betrachteten, wenn nicht sogar als Zeichen des Teufels, rückte die Ehe für sie in unerreichbare Ferne. Und dann war da noch ihre Gabe – ihre heilenden Hände –, doch die hielt sie streng geheim, denn auch so etwas erregte nur Furcht bei den Leuten; aber vor einem Ehemann würde sie sie wohl kaum auf Dauer verbergen können. Aus all diesen Gründen war sie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich am besten für sie war, Jungfrau zu bleiben und auf die Ehe zu verzichten. Und jetzt neckte dieser Kerl sie ständig damit. Es kam ihr ziemlich grausam vor.
»Ihr wisst nicht einmal, wer ich bin«, fuhr sie fort. »Wir kennen uns wahrhaftig nicht lange genug, um eine dauerhafte Partnerschaft in Erwägung zu ziehen. Abgesehen davon sieht es so aus, als ob Euer Leben kein sehr langes sein wird.«
»Seid so freundlich und erinnert Euch daran, dass ich noch nicht tot bin, meine Beste. Ich nehme an, Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich Euch erklärte, dass ich völlig unschuldig bin und diese Männer nicht getötet habe«, meinte er und goss ein bisschen Wein in zwei Becher.
»Warum seid Ihr dann zum Tode verurteilt worden? Und noch dazu von Eurem Verwandten? Ich habe gehört, was Cousin Bearnard sagte, und Ihr habt nichts davon abgestritten.«
»Nur, weil ich zum Strang verurteilt worden bin, heißt das noch lange nicht, dass ich das Verbrechen verübt habe. Es sind genügend unschuldige Männer am Galgen gelandet, dessen bin ich mir ganz sicher. Und was heißt das schon, von einem Verwandten vor Gericht gezerrt und verurteilt zu werden? Gibt es einen besseren Weg, um sich eines rechtmäßigen Erben zu entledigen, eines Erben, dem alles zusteht, was der andere begehrt?«
Es klang, als ob er die Wahrheit sagte. Die tiefe Bitterkeit, die in seiner wohltönenden Stimme mitschwang, ließ seine Worte umso aufrichtiger klingen. Moira hätte ihm zu gern geglaubt, aber sie bemühte sich, an ihren Zweifeln und ihrem Argwohn festzuhalten. Es war nicht der rechte Zeitpunkt, um zu vertrauensselig zu sein.
»Wo waren denn Eure anderen Verwandten?«, fragte sie. »Haben alle diese Lüge geglaubt? Ist keiner aufgestanden, um Euch zu verteidigen?«
Sie entdeckte einen gequälten Ausdruck in seinen dunklen Augen, wollte sich aber von Mitgefühl nicht an ihren Fragen hindern lassen. »Hat sich keiner zu Eurem Fürsprecher erklärt? Hat keiner gegen die Strafe protestiert oder gegen die Anklage Einspruch erhoben?«, fuhr sie fort.
»Leider muss ich all Eure Fragen bejahen, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Der Mann, der mir das angetan hat, mein Cousin Iver, hat viele starke Verbündete. Auch ich habe einige Verbündete, aber wenn sie mir vor aller Augen geholfen hätten, hätten sie sich mehr Schaden zugefügt als mir Vorteile gebracht. Sie haben weder die Macht noch die Mittel, um sich gegen Iver und seine Freunde zu stellen. Ich konnte ihnen nicht erlauben, ihr Leben für mich aufs Spiel zu setzen. Immerhin haben sie mir durch das wenige, was sie für mich tun konnten, die Flucht ermöglicht.«
»Ihr könnt noch nicht sehr lange auf freiem Fuß sein, sonst wärt Ihr inzwischen schon bei Mungan Coll.« Moira wünschte von ganzem Herzen, seine Geschichte klänge nicht so plausibel, denn sie war sehr versucht, ihm zu glauben.
»Das stimmt. Ich fiel einem hübschen Gesicht zum Opfer, hinter dem sich ein schwarzes Herz verbarg.«
»Eine reizende Erklärung dafür, dass Ihr herumgetändelt habt, statt wegzurennen.«
Tavig grinste. »Aye. Das lockende Funkeln von Mädchenaugen kann einen Mann sehr leicht ablenken.« Er langte über den Tisch und nahm sanft ihre Hand. »Doch Ihr braucht nicht zu befürchten, dass ich weiter herumstreune, wenn ich erst einmal verheiratet bin. Ich bin ein Mann, der einen Schwur sehr ernst nimmt.«
Sie entzog ihm ihre Hand. »Ihr seid ein Mann, dessen Verstand leider ziemlich getrübt ist.«
»Welch böse Worte!«
Er wirkte so komisch betrübt, dass Moira fast lachen musste, doch sie hielt sich zurück. Es war wahrhaftig nicht besonders lustig. Für sie stand außer Frage, dass sie zur Jungfernschaft verdammt war. Wenn er sie nicht neckte, dann war er verrückt. Weder das eine noch das andere war Grund zur Heiterkeit. Sie beschloss, sich ab sofort stärker zu bemühen, sein lächerliches Gerede von der Ehe zu ignorieren. Schließlich stand sie vor der enormen Aufgabe, am Leben zu bleiben, bis sie wieder bei ihren Verwandten war. Das war jetzt erst einmal das Wichtigste.
»Warum wart Ihr auf diesem Schiff?«
»Als ich vor den treuen Stiefelleckern meines Cousins floh, erfuhr ich, dass Euer Schiff zum Land meines Cousins Mungan unterwegs war. Es war zwar riskant, aber dort, wo ich war, zu verweilen, wäre weit gefährlicher gewesen.« Er lächelte sie schief an. »Ihr glaubt mir kein Wort.«
»Ich muss erst darüber nachdenken.« Sie faltete die Hände und bemühte sich um eine möglichst strenge Miene. »Aber im Moment ist es für uns wohl besser, wenn wir unsere nächsten Schritte besprechen.«
»Ich habe es Euch doch schon gesagt, wir gehen zur Burg meines Cousins Mungan.« Er räumte das Geschirr ab und legte es in eine Schüssel mit Wasser.
Als er anfing abzuspülen, fragte sich Moira kurz, ob sie nicht diese Aufgabe übernehmen sollte, da er ja die Mahlzeit zubereitet hatte. Sie wusste, dass es nicht richtig war, ihn alle Arbeit machen zu lassen; aber irgendwie schob sie die Schuld an ihrer düsteren Lage zum Teil auch auf ihn. Es würde ihm eine Art Buße sein, wenn er sie ein bisschen bediente.
Während sie ihm zusah, fragte sie sich, wie jemand selbst in solch unrühmlichem Zustand noch so gut aussehen konnte. Seine Kleidung war zerrissen und verschmutzt, das schwarze Haar wirr und steif von dem Salzwasser, in dem sie so lange geschwommen waren. Außerdem bemerkte sie Blutergüsse und Schwellungen in seinem Gesicht und auch an den Stellen, an denen seine Haut durch die zerrissenen Kleider schimmerte. Manche dieser Blessuren stammten vielleicht von der gewaltigen Wucht der stürmischen Wellen, das meiste hatte er sich jedoch vermutlich bei seinem Kampf mit Sir Bearnard zugezogen. Sie dachte daran, wie gut sie sich um all seine Schrammen kümmern könnte. Doch wie um alles in der Welt kam sie jetzt auf solche Gedanken? Der Mann hatte nicht nur ihr Leben in ein Chaos gestürzt, sondern hatte offenbar auch eine beunruhigende Wirkung auf ihren gesunden Menschenverstand. Moira lenkte ihre abschweifenden Gedanken wieder zurück zu der Frage, was als Nächstes zu tun war. Das war weitaus wichtiger als die Überlegung, wie glatt seine dunkle Haut war oder wie wohlgeformt seine Beine waren.
»Sir Tavig, Ich hatte nicht vergessen, dass Ihr vorhabt, uns zu Mungan Coll zu bringen«, beeilte sie sich zu sagen in der Hoffnung, dass sie ihren Kopf von allen unnützen Gedanken frei halten konnte, wenn sie redete.
»Was wollt Ihr denn sonst noch wissen?«
»Wie kommen wir dorthin? Unsere Kleidung ist zerfetzt, wir haben keine Pferde und keine Vorräte.«
»Wohl wahr.« Er wischte sich die Hände an einem schmutzigen Lumpen ab, dann setzte er sich wieder an den Tisch. »Ich glaube, für den Anfang können wir hier genug finden.«
»Aber das wäre Diebstahl.«
»Mädchen, der Mann, der hier hauste, ist tot, dessen bin ich mir nahezu sicher. Und wenn er doch noch am Leben ist, dann ist er geflohen, ohne einen Gedanken an sein Hab und Gut zu verschwenden. Hört auf, Euch den Kopf darüber zu zerbrechen, ob wir rechtens handeln oder nicht. Was auch immer mit diesem Mann passiert ist, er hat alles zurückgelassen, und jetzt wird es verrotten, oder es wird mitgenommen. Und wir haben es bitter nötig, uns an seinen kärglichen Hinterlassenschaften zu bedienen.«
»Ich sehe ja ein, dass Ihr recht habt, doch es fällt mir trotzdem schwer, Dinge zu nehmen, die einem anderen gehören.«
»Wenn ich Geld bei mir hätte, würde ich es als Bezahlung dalassen, aber das Geld würde bestimmt auch nur gestohlen werden. Wenn es Euer schlechtes Gewissen beruhigt, verspreche ich Euch, dass ich entweder zurückkehren oder jemanden herschicken werde. Wenn der Mann noch am Leben ist, wird er bezahlt werden.«
»Das ist sehr freundlich von Euch, aber vielleicht könnt Ihr ja gar nicht zurückkehren.«
»Dann tut Ihr es eben.«
»Das würde ich gern, doch ich fürchte, ich habe kein Geld.« Sie spürte, wie sie errötete. Doch gleichzeitig fragte sie sich, warum es sie so verlegen machte, einem solchen Mann ihre Armut zu gestehen.
»Überhaupt keines?« Tavig fand ihre Verlegenheit richtig liebenswert, zumal er diesmal keine Schuld daran trug.
»Nay. Mein Onkel Bearnard behauptet, meinem Vater ist das Geld nur so durch die Finger geronnen.«
»Tja nun, mir macht das nichts aus. Eine reiche Erbin wäre zwar auch nicht schlecht gewesen, aber ich brauche das Geld nicht, also kann ich gern auch ein armes Mädchen zur Frau nehmen.« Er grinste, als sie ihn wieder zornig anfunkelte.
Moira sagte sich, dass er solche Dinge sicher nicht von sich gab, um ihr wehzutun. Schließlich konnte er nicht wissen, dass ihre Armut zu den vielen Dingen gehörte, die sie dazu verdammten, unverheiratet zu bleiben. Es war zwar nicht etwas, was sie sich gewünscht hätte, aber sie hatte sich stets bemüht, es hinzunehmen. Doch obwohl sie einsah, dass er nicht absichtlich versuchte, sie zu verletzen, ärgerte sie sein munteres Geschwätz über eine Heirat.
»Es wird langsam Zeit, dass Ihr Euch einen neuen Witz einfallen lasst«, murrte sie.
Tavig schüttelte den Kopf und setzte eine betrübte Miene auf. »Also gut, meine kleine Braut. Zum Glück kettet uns unsere Lage noch gut zwei Wochen aneinander, denn ich sehe, dass ich wohl noch kräftig um Euch werben muss.«
Sie ging nicht auf seine letzten Worte ein, weil sie seine ersten so beschäftigten. »Gut zwei Wochen? Warum so lang?«
»Wie ich schon sagte – wir haben keine Pferde.«
»Richtig. Aber wir können uns doch bestimmt welche besorgen.«
»Nun, ich habe kein Geld, und Ihr habt auch keines. Da Ihr ganz offenkundig nicht zugänglich seid für die Notwendigkeit des Stehlens, muss ich Euch leider sagen: Nein, wir können uns keine Pferde besorgen.«
»Wie kommen wir dann zu Eurem Cousin?«
»Zu Fuß.«
»Zu Fuß?«, fragte sie völlig entgeistert.
»Aye, meine Liebe, Ihr werdet Eure hübschen Füße benutzen müssen.«
»Aber Euer Cousin wohnt meilenweit von hier, oder?«
»Richtig. Eben deshalb werden wir gut zwei Wochen für den Weg brauchen.«
Moira starrte ihn fassungslos an. Sie beschloss, sich ab sofort weniger den Kopf darüber zu zerbrechen, dass Tavig ein verurteilter Mörder war, sondern mehr darüber, dass sie es sehr wahrscheinlich doch mit einem Verrückten zu tun hatte.
3
Jetzt sehe ich erst recht wie eine Bettlerin aus!«
Als Tavig Moira von oben bis unten betrachtete, bemühte er sich, ein Grinsen zu unterdrücken. Ihre Klage war kaum zu widerlegen. Sie hatten in der Kate zwar Nähzeug aufgetrieben und ihre Kleidung so gut wie möglich ausgebessert, aber die Bemühungen waren deutlich sichtbar; denn der Faden war dunkel, Moiras Nachthemd hingegen weiß. Ein verblasster blauer Plaid, den sie sich um die Taille geschlungen hatte, diente als Rock, ein alter, verwaschener brauner Kittel aus Halbwolltuch als Mieder. Nur ihre zarten Züge und die weiche weiße Haut ließen erahnen, dass sie wohl doch keine armselige Bettlerin war.
Als er sich selbst betrachtete, hätte er beinahe laut aufgelacht. Sein feines weißes Leinenhemd, das nun mit ordentlichen dunklen Stichen zusammengehalten wurde, sah aus, als wäre es gestreift. Das grobe dunkle Wams, das er trug, war uralt und fleckig, und außerdem stank es nach Fisch, genau wie die schlecht sitzende Hose. Der Mann, dessen Kleider sie beschlagnahmt hatten, hatte es als Fischer ganz offensichtlich nicht zu Reichtum gebracht.
»Wir geben tatsächlich ein ziemlich schäbiges Paar ab«, murmelte er.
»Findet Ihr denn wirklich, dass wir diese Dinge überhaupt nehmen sollten? Vielleicht ist der Mann ja doch nicht tot, sondern nur ein Weilchen verreist.« Moira hatte noch immer das ungute Gefühl, einen Diebstahl zu begehen.
»Mädchen, wenn Ihr gesehen hättet, in welch kläglichem Zustand sich die wenigen Tiere befanden, die dieser Mann besaß, wärt Ihr Euch genauso sicher gewesen wie ich, dass ihm etwas zugestoßen ist. Um diese armen Geschöpfe hat sich schon seit Tagen keiner mehr gekümmert. Am besten wäre es wohl gewesen, ich hätte sie gleich getötet, um ihrer Not ein Ende zu bereiten. Aber stattdessen tat ich, was ich für sie tun konnte, was wahrhaftig nicht viel war, und ließ sie frei. Entweder fallen sie den Wölfen zum Fraß, oder aber sie schlagen sich irgendwie durch, bis sie von einem armen Bauern aufgegabelt werden, der dann irgendeinen Nutzen aus ihnen zieht. Falls der Fischer doch noch am Leben ist, hat er es verdient, seine Tiere zu verlieren, weil er sie so schlecht behandelt hat.«
»Damit mögt Ihr recht haben«, stimmte sie zögernd zu. »Dennoch – trotz all Eurer Begründungen werde ich das Gefühl nicht los, dass ich dem Bewohner dieser Kate etwas stehle.«