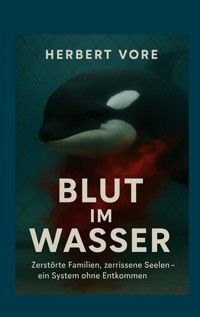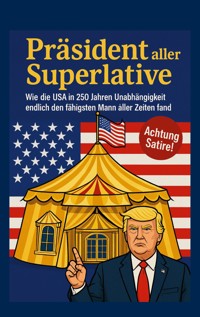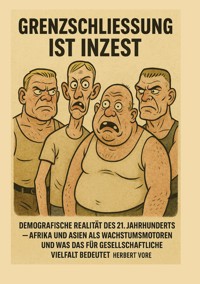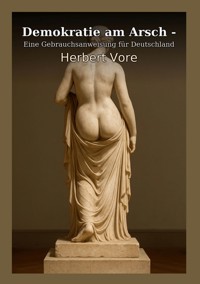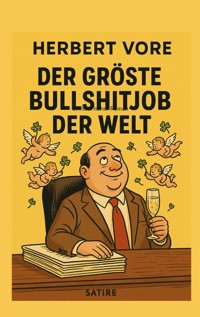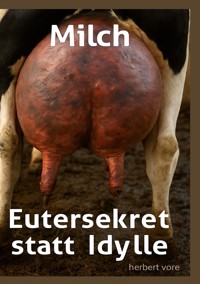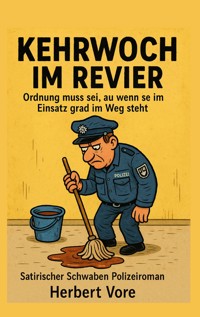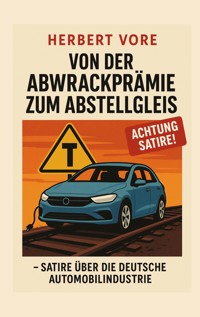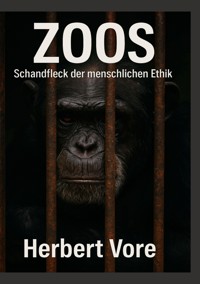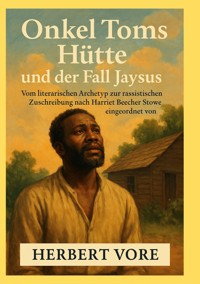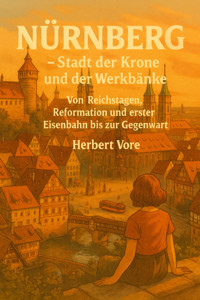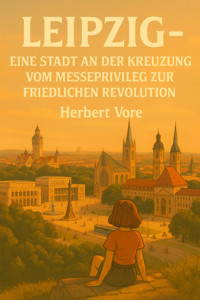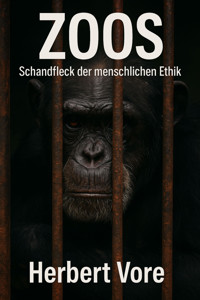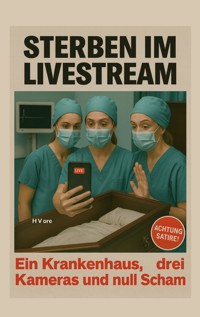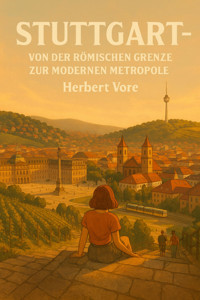
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erzählt die Geschichte Stuttgarts als spannungsreiches Panorama – vom römischen Vorposten am Neckar über das Gestüt im Nesenbachtal, Residenz, Reformation und Dreißigjährigen Krieg bis zu Barock, Karlsschule, Königreich, Eisenbahn, Industrialisierung, Automobilpionieren, Weimarer Moderne, Diktatur und Zerstörung, Wiederaufbau, der Ernennung zur Landeshauptstadt Baden-Württemberg und der vielschichtigen Gegenwart. Jeder Abschnitt ist erzählerisch verdichtet und zugleich präzise, mit Blick für die alltäglichen Handgriffe, die große Epochen überhaupt erst tragen. Nicht Monumente stehen im Rampenlicht, sondern Methoden: ordnen, bauen, lernen, erinnern, übersetzen. Der Band verbindet historische Tiefe mit moderner Lesbarkeit. Er macht verständlich, wie Topographie, Technik, Politik und Kultur ineinandergreifen: der Kessel als Formgeber, Schiene als Takt, Motor als Wandel, Verwaltung als Maschine der Demokratie, Architektur als Klimaantwort. Ergänzende Zusatzteile – Zeitleiste, Personen- und Ortsprofile, Spaziergänge, Begriffe, Methodik – runden das Leseerlebnis ab und machen das Buch zugleich zu einem verlässlichen Begleiter für Studien, Unterricht, Stadtspaziergänge und Debatten. Das Ergebnis ist eine erzählerische Stadtbiographie, die zeigt, warum Stuttgart nie nur Ort, sondern immer auch Haltung war: Genauigkeit ohne Pose, Maß ohne Müdigkeit, Zukunft als tägliche Praxis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Deutsche Erstausgabe September 2025
© 2025 Herbert Vore
Alle Rechte vorbehalten
Impressum
Herbert Vore
c/o COCENTER
Koppoldstr. 1
86551 Aichach
Bilder mit Dall-E generiert, Textpassagen können mit Cvhat GPT generiert sein
Rechtlicher HinweisDieses Werk ist reine Fiktion. Alle Personen, Orte, Organisationen und Handlungen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit real existierenden oder verstorbenen Personen, tatsächlichen Orten, Ereignissen oder Strukturen ist zufällig und nicht beabsichtigt.
Es handelt sich weder um Rechtsberatung noch um medizinische, psychologische oder sonstige professionelle Beratung. Die dargestellten Technologien, wissenschaftlichen Ideen und gesellschaftlichen Entwicklungen sind spekulativ und dienen ausschließlich der erzählerischen Darstellung.
Die Lektüre dieses Buches entbindet niemanden von der eigenen Verantwortung. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Handlungen, Unterlassungen, Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus dem Inhalt dieses Werkes entstehen könnten.
Stuttgart –
Von der römischen Grenze zur modernen Metropole
geschrieben von
Herbert Vore
Prolog
Am Morgen glänzt die Stadt wie frisch gewaschen. Auf der Königstraße strömen Menschen aneinander vorbei, unter ihnen ein Netz aus Tunneln und Leitungen, über ihnen Glasfassaden, die den Himmel in Stücke schneiden. Straßenbahnen summen, Busse atmen, irgendwo öffnet eine Bäckerei, und der Duft zieht wie ein zarter Faden durch den Talkessel. Wer hier steht, sieht eine Gegenwart, die sich selbstverständlich gibt. Doch unter jedem Pflasterstein liegt eine Frage, die älter ist als alle Schaufenster: Wie wird aus einem Tal eine Stadt, aus einem Namen eine Geschichte, aus Zufall ein Wille.
Stuttgart beginnt nicht mit einem Schlag der Stunde, nicht mit einem lauten Gründungsruf. Es beginnt mit dem Wasser. Der Neckar zieht in einem weiten Bogen durch das Land, der Nesenbach sammelt die kleinen Rinnsale und bringt sie in Bewegung. An diesen Ufern liest man die erste Schrift der Gegend, nicht in Buchstaben, sondern in Spuren. Römer legten Wege an, schnitten Schneisen in Wald und Hang, setzten Stein auf Stein und nannten Ordnung, was vorher nur Gelände war. Ihre Gutshöfe wärmten sich an unterirdischen Heizanlagen, ihr Alltag roch nach Kalk und Öl, nach gebranntem Ton und feuchter Erde. Wachtürme sahen den Himmel kommen und gehen. Münzen glitzerten im Staub. Ein Reich hinterließ keine Poesie, sondern Fundamente, und manchmal ist das genug, damit eine Landschaft nicht wieder vergisst, dass hier ein Anfang möglich ist.
Dann verliert sich der Lärm der Legionen. Wind weht durch verwilderte Aufschüttungen. Wälder schließen sich, als hätten sie nur kurz gezögert. Und wieder ist es Wasser, das eine neue Richtung weist. Im Schutz des Tales entsteht ein Gestüt, nichts weiter als Ställe, Zäune, Futterplätze, Hände, die zupacken. Pferde stampfen die Erde fest und schreiben so ihren Namen in den Boden. Stuotgarten. Ein nüchterner Begriff, eine praktische Einrichtung, und doch eine Entscheidung mit Reichweite. Denn wo Tiere gesammelt werden, kommen Menschen. Wo Menschen bleiben, entstehen Regeln, Arbeit, Hoffnung, Streit. Ein Ort legt die erste Hülle an.
Ein Jahrhundert greift ins nächste, und auf Pergament rückt der Name in die Welt. Eine Urkunde fixiert, was vorher nur gesprochen wurde. Schrift macht Dinge zäh. Der Markt bekommt seinen Platz, das Gebet bekommt seine Stunde, das Handwerk seinen Zunfttisch. Mauern fassen die Unruhe der Menschen, Tore öffnen sie wieder. Man zahlt Abgaben und erwirbt zugleich ein Stück Schutz. Aus Vorsatz wird Gewohnheit, aus Gewohnheit wird Form. So wächst in einem engen Tal das, was andere Städte auf Ebenen fanden. Hier muss alles enger sitzen, dichter geplant, klüger verteilt. Der Kessel zwingt zur Verdichtung und lehrt die Menschen, mit Raum zu rechnen wie mit einer kostbaren Ware.
Macht findet, was wächst. Die Grafen von Württemberg treten in das Bild und mit ihnen das, was Städte über Jahrhunderte prägt: Verwaltung, Recht, das endlose Gespräch zwischen Befehl und Zustimmung. Eine Residenz ist mehr als der Sitz eines Fürsten. Sie ist ein Magnet. Sie zieht Geistliche, Schreiber, Handwerker, Händler an. Sie bringt eine neue Grammatik mit. Plätze entstehen nicht zufällig, Straßen werden zu Achsen, Gebäude zu Zeichen. Das Alte Schloss hebt seine Türme wie Finger, die in die Zeit zeigen. Hinter den Arkaden werden Entscheidungen geformt, die weit über die Stadt hinaus wirken. Stein spricht eine Sprache, die alle verstehen.
Die Reformation bricht durch wie ein Sommergewitter. In kurzer Zeit liegt der alte Kalender durchnässt am Boden, und ein neuer trocknet in der Sonne. Kanzeln werden zu Werkbänken des Wortes, Schulen wachsen heran, damit das Lesen nicht nur den wenigen vorbehalten bleibt. Glaube und Macht greifen ineinander, reiben sich, stoßen sich ab, suchen ein Gleichgewicht, das nie lange hält. Dann wieder dunkelt der Himmel. Dreißig Jahre lang zählt man nicht Ernten, sondern Verluste. Soldaten zehren die Vorräte auf, Krankheiten gehen durch Gassen, die sonst nach Brot und Leder riechen. Als der Frieden kommt, hat die Stadt eine neue Eigenschaft gelernt. Sie kann aus wenig viel machen, aus Bruchstücken Pläne, aus Müdigkeit den nächsten Tag.
Wird es hell, setzen Fürsten Zeichen. Barocke Fassaden, breite Linien, die Absicht, Glanz als Regierungsform zu verwenden. Straßen werden gerade, Plätze werden Bühnen, und die Stadt lernt, dass Darstellung auch Arbeit ist. Karl Eugen gründet eine Schule, die bleibt, obwohl sie verschwindet, weil einer ihrer Schüler die Sprache so weit aufspannt, dass sie bis heute trägt. Schiller verlässt die engen Schlafsäle und findet Worte, die gegen Mauern breiter sind als deren Sockel. Auch das ist Stuttgart. Disziplin und Aufbruch in derselben Zeile.
Das neunzehnte Jahrhundert bringt Schienen. Eisen nähert sich dem Kessel, sucht Steigungen, überwindet sie, bohrt, brückt, bindet. Plötzlich ist die Stadt kein Ziel mehr, sondern ein Knoten. Waren kommen, Menschen kommen, Ideen kommen. Werkhallen wachsen, Maschinen lernen das Wiederholen, Gesichter werden müde und hoffnungsvoll zugleich. Aus dem Summen der Werkbänke treten neue Klänge hervor. Ein Motor brennt seine Möglichkeiten in die Luft. Daimler und Maybach, Benz am Rhein, und auf einmal hat das Gehen Räder. Was im Hinterhof geschraubt wird, verschiebt die Welt. Stuttgart lernt, was Geschwindigkeit bedeutet, und kennt seither die Mühen, ihr gerecht zu werden.
Zwischen den Kriegen trägt die Stadt zwei Gesichter. Das eine wendet sich der Zukunft zu, baut Wohnungen, denkt Licht und Luft, setzt mit weißen Wänden ein Versprechen. Das andere sieht, wie eine politische Bewegung Räume schließt und Menschen aus ihnen vertreibt. Der Nationalsozialismus legt seine Hand auf Ämter, Vereine, Häuser. Jüdische Nachbarn verschwinden, erst aus den Schaufenstern, dann von den Straßen, dann aus der Stadt. Fabriken stellen um, Zwangsarbeiter füllen die Lücken, und der Himmel antwortet mit Feuer. Nächte lang brennt, was Jahrhunderte gehalten hat. Als der Krieg endet, bleibt ein Schutthaufen, der dennoch eine Form hat. Er sieht aus wie Arbeit.
Nach dem Einmarsch der Amerikaner beginnt ein zweiter Anfang. Trümmerfrauen stapeln Steine, Männer richten Dachstühle, Kinder tragen Eimer. Man streitet über Rekonstruktion und Neuerfindung und entscheidet sich oft für das Neue. Breite Straßen, sachliche Fassaden, ein Bild, das die Zukunft nicht mit Schnörkeln belastet. Mit dem Wirtschaftswunder wächst das Selbstvertrauen. Menschen aus dem Süden und Osten kommen, bringen ihre Sprachen, ihre Gerichte, ihre Geschichten mit. In Werkhallen läuft die Produktion, in Theatern hebt sich der Vorhang, in Museen hängen Bilder, die die Stadt mit anderen Städten verbinden. Politik findet ihren Sitz, als Baden und Württemberg zusammenfinden. Stuttgart übernimmt Verantwortung und behält dabei die Eigenart, die das Tal ihr aufdrängt. Auch Macht muss hier mit Hängen und Kurven rechnen.
So steht die Stadt heute da, als Bündel von Schichten, die sich nicht sauber trennen lassen. Weinberge an den Hängen, ein Bahnhof als Streitfall, Museen wie leuchtende Speicher, Forschungslabore, die an einem Morgen arbeiten, der noch keinen Namen hat. Der Kessel hält die Wärme, und mit ihr die Stimmen. Es sind viele. Die der Vergangenheit und die derer, die erst kommen. Wer hier geht, geht immer durch mehrere Zeiten zugleich. Unter Fußsohlen liegt römischer Schotter, an Fassaden spiegelt sich barocke Absicht, in Hallen summen Motoren, die nicht mehr nach Benzin riechen wollen. In den Parks sitzen Menschen, die in Sprachen lachen, die anders klingen und dasselbe meinen.
Dieses Buch folgt den Linien, die sich durch all das ziehen. Es erzählt nicht nur Ereignisse, sondern Haltungen. Es fragt, was eine Stadt zusammenhält, wenn Grenzen sich verschieben, wenn Mauern fallen und neue entstehen, wenn Macht wechselt und Arbeit bleibt. Es sucht die Orte, an denen Entscheidungen Gestalt bekommen haben, und es scheut den Blick auf die Schatten nicht. Denn auch das gehört zu Stuttgart. Die Fähigkeit, aus einem Gestüt eine Residenz zu machen, aus einer Residenz eine Industriestadt, aus einer zerstörten Stadt eine Hauptstadt. Die Fähigkeit, nach vorn zu gehen und die alten Steine im Rücken zu wissen.
Wer diese Seiten aufschlägt, betritt kein Museum. Er betritt eine Werkstatt. Hier wird stetig geschraubt, geplant, verworfen, neu begonnen. Der Neckar fließt weiter, der Nesenbach murmelt unter Gittern, die Straßen tragen Lasten, und die Menschen halten den Faden, der alles verbindet. Aus Tal wird Stadt. Aus Stadt wird Geschichte. Aus Geschichte wird Auftrag. Diese Geschichte beginnt jetzt. Und sie beginnt hier.
Kapitel 1: Am Rand des Imperiums
Am Anfang steht das Gelände. Ein Fluss, der mehr verspricht als er gibt, Hänge, die den Blick begrenzen, Auen, die im Frühjahr glänzen und im Herbst schwer werden. Der Neckar nimmt die Kurven des Landes an, und im engen Tal des Nesenbachs sammelt sich Wasser wie Geduld. Wer hier lebte, bevor die römischen Feldzeichen auftauchten, kannte die Jahreszeiten als Maß aller Dinge. Es gab Wege, aber keine Straßen. Es gab Grenzen, aber sie waren aus Wald.
Dann kommen Vermesser. Nicht mit Geschichten, sondern mit Messlatten. Sie spannen Schnüre, setzen Pflöcke, ziehen Linien, die das Gelände nicht bittet, aber duldet. Im ersten Jahrhundert nach Christus greifen römische Truppen in den Südwesten vor. Sie bringen das, was Rom überall mitbringt, wo es ernst wird: Ordnung in Form. Eine Straße ist keine Spur mehr, sie ist ein Versprechen. Zwischen den Hügeln entsteht ein Netz von Trassen, deren Steine so dicht liegen, dass Füße aufhören, nach Halt zu tasten. Was heute als Neckar Odenwald Limes erinnert wird, war damals nicht Theorie, sondern tägliche Praxis: Wachtürme, die mit Sichtweite arbeiten, kleine Kastelle, die mit Garnisonen atmen, Patrouillen, die das Dazwischen sichern. Grenzen werden nicht nur markiert, sie werden organisiert.
Doch Rom ist nie nur Militär. Es ist auch Alltag, der sich niederlässt. In den Mulden der fruchtbaren Böden entstehen villae rusticae, Gutshöfe mit Hofmauern, Speichern und den für das Imperium typischen Annehmlichkeiten. In den Wohnräumen zirkuliert warme Luft unter dem Estrich, Hypokausten verwandeln Kälte in Zivilisation. Die Werkstatt riecht nach Öl und Metall, der Hof nach Heu, eine kleine Badeanlage nach Kalk und Dampf. Nebenan liegt das Land, in Flure geteilt, als wäre es ein Text, den man Absatz für Absatz besser lesen will. Getreide, Hülsenfrüchte, Weinreben an windgeschützten Lagen, Obstbäume, die im Frühjahr die Hänge hell machen. Die Höfe versorgen die Truppen, aber sie produzieren auch Überschüsse, die in die kleinen Märkte der Region wandern. So verbindet sich die straffe Logik des Heeres mit der weicheren der Ernte.
Zwischen Hof und Kastell zirkuliert mehr als Ware. Lateinische Worte wandern in die Zungen der Einheimischen, zumindest als Lehnwörter für Dinge, die es vorher nicht gab. Straßenbau wird zu einer Technik, nicht nur zu einem Zustand. Entwässerungsgräben werden so selbstverständlich, dass man sie erst bemerkt, wenn sie fehlen. Recht wird als Schema erfahrbar, das Klagen und Antworten in eine Form presst, die länger hält als die beteiligten Personen. Kulte erscheinen, mischen sich oder stehen nebeneinander: lokale Gottheiten neben Merkur und Mithras, Altäre, an denen Schlacht und Bitte nicht mehr zu trennen sind. Was entsteht, ist kein Ersatz, sondern ein Geflecht.
In den Kastellen herrscht der andere Rhythmus. Wecksignale, Wachwechsel, Trainingslärm. Der Tageslauf ist gerastert, die Verantwortung exakt. Für die Männer, die aus Galien, Hispanien oder von jenseits der Alpen hierher verschlagen wurden, ist das Tal am Neckar ein Außenposten und doch eine Welt für sich. Auf den Türmen sind die Nächte lang. Der Blick streift über Waldsäume, Nebel, die morgens aus dem Fluss steigen, über schmale Felder, in denen halbnackte Pfähle sich in den Wind stemmen. Man sitzt auf dem Absatz der bekannten Welt und weiß, dass man die Grenze nicht nur hält, sondern erst schafft.
Gleichzeitig beginnt der Austausch auf leisen Sohlen. Einheimische bringen Felle und Salz, nehmen Keramik mit, rot glänzend, hart gebrannt, mit Mustern, die Geschichten erzählen, ohne ein Wort zu sprechen. Terra sigillata wird zum alltäglichen Luxus, der auf Tischen steht, die zuvor nur Holz und Ton kannten. Münzen klirren in Beuteln, die an Gürtel gebunden sind, und werden zu kleinen Lehrern: Kopf und Schrift, Gewicht und Wert, die Idee, dass Vertrauen zählbar sein kann. Ein Händler erzählt vom Rhein, ein Veteran von einer Stadt, deren Häuser so hoch sind, dass man darüber streiten kann, ob sie den Himmel beleidigen. Und wenn die Nacht tief ist, erzählt jemand von einer Frau, die an einem Brunnen lacht, der süßer schmeckt als jeder Wein. So wird Rom nicht nur durch Mauern, sondern durch Sehnsucht gebaut.
Der Boden nimmt diese Zeit in sich auf, ohne zu widersprechen. Später werden daraus Spuren. Ein zusammengebrochener Ofen, der noch den Abdruck der letzten Flamme trägt. Ein Brunnen, in dessen Schacht jemand ein Messer fallen ließ, das er nicht vermisste, bis er durstig war. Ein Fundament, dessen Steine sich so eng aneinander schmiegen, als hätten sie sich geschworen, nicht zu reden. Archäologen werden sie heben und in Vitrinen legen, und die Gegenwart wird sich vorbeugen, um zu sehen, was sie längst weiß: dass hier Ordnung war, bevor hier unsere Ordnung war.
Aber keine Grenze bleibt ewig still. Im dritten Jahrhundert wird der Druck von Norden spürbar. Gruppen, die die Römer Alamannen nennen, drücken gegen eine Linie, die zunehmend mehr Kosten als Sinn produziert. Das Imperium kämpft an vielen Fronten und in sich selbst. Auf den Türmen ist die Luft schwerer geworden. Meldereiter kommen häufiger, Boten bleiben kürzer. Entscheidung wird zu etwas, das man verschiebt, bis Ausweichen selbst zur Entscheidung wird. Am Ende zieht sich die Grenze zurück, an den Rhein, eine alte starke Linie. Der Abzug ist kein Schauspiel, sondern eine Folge von Gesten: Listen, Inventare, Nägel, die man aus Balken zieht, Türen, die man offenlässt, weil es keine Rolle mehr spielt.
Was zurückbleibt, ist kein Nichts. Die Höfe stehen, manche weiter genutzt, andere geplündert, wieder andere als Steinbruch für neue Bedürfnisse. Wege verlieren ihren Belag, behalten aber ihre Richtung. Ein Kind läuft einen Saum entlang, weil die Luft dort leichter ist, und findet die Trasse, ohne zu wissen, dass sie römisch ist. In den Wäldern schlagen wieder Zweige über Pfade, aber darunter liegt, was war, als stiller Druck auf dem Boden.
So beginnt die Geschichte des Tales, das später Stuttgart heißen wird. Nicht mit einem Gründungsakt, sondern mit einem Einzug, der vieles hinterlässt, wenn er wieder geht. Das Imperium hat Rillen in die Landschaft gezogen, die noch spürbar sind, wenn Gras darüber steht. Technik, Recht, Sprache, Rituale, die Art, Land zu lesen und Wasser zu führen, die Idee, dass ein Ort mehr sein kann als der Zufall seiner Bewohner. Am Rand des Imperiums lernt eine Region, was Zentrum bedeutet. Und als das Zentrum weiterzieht, bleibt diese Lektion im Boden zurück.
Wer heute die Karte aufschlägt, sieht Flüsse und Straßen, die sich kreuzen. Wer darunter die alte Karte legt, bemerkt, wie wenige Wege wirklich neu sind. Man kann in diesem Tal gehen und auf Stein treffen, der die Wärme von Händen hält, die vor zwei Jahrtausenden gearbeitet haben. Man kann an einem Hang stehen und wissen, dass hier Wache gehalten wurde, nicht mit Pathos, sondern mit Müdigkeit. Man kann einen Bach sehen, der trocken gefallen ist, und begreifen, dass selbst Wasser manchmal nur ein langer Satz ist, der eine Pause macht.
Kapitel eins endet nicht mit einem Abschied, sondern mit einem Echo. Rom geht, aber das Gehen ist kein Löschen. Es ist der erste große Abdruck in einer Abfolge von Schichten, die die Stadt bis heute trägt. Der Rand des Imperiums wird zur Grundlage einer Geschichte, die mit jeder weiteren Schicht deutlicher wird: dass Ordnung, wenn sie gut gelegt ist, lange nachhallt. Und dass ein Tal, das gelernt hat, Linien zu halten, auch später Linien zeichnen wird, an denen eine Stadt wachsen kann.
Kapitel 2: Das Gestüt im Tal
Bevor eine Stadt entsteht, entsteht ein Zweck. Im Nesenbachtal war dieser Zweck ein Stall. Keine Kapelle, kein Markt, kein Rathaus – ein Gestüt. Die Überlieferung weist auf Liudolf von Schwaben, Sohn des Königs Otto, der im 10. Jahrhundert die fruchtbare Senke am Hang des Schurwalds auswählt. Der Ort ist nicht prunkvoll, sondern praktisch. Wasser in Reichweite, Grasland für Heu, sanfte Hänge für Weiden, windgeschützt und doch nah an den Wegen zum Neckar. Ein eingefriedetes Gelände, ein „Garten“ im Sinn der Zeit, darin die „Stuot“ – die Herde. Aus Stuotgarten wird Schritt für Schritt Stuttgart.
Am Anfang ist das Gelände karg eingerichtet: Pfostenlöcher, die einen Zaun tragen, eine hölzerne Palisade, Gräben, die bei Regen das Wasser wegführen. Zwei große Langhäuser, querliegend zu den Weiden, mit Schilfdach und Holzbinderwerk. In einem die Stuten mit ihren Fohlen, im anderen die Reit- und Arbeitspferde, die Sättel, Zaumzeug, Heukraxen. Der Boden ist mit Spreu bestreut, damit die Feuchtigkeit verschwindet, bevor sie Krankheit wird. Ein Nebengebäude für Hafer und Salz – beides kostbar, beides nötig. Daneben die Schmiede: Amboss, Blasebalg, Feuer. Ein Hufschmied, der mehr Arzt als Handwerker ist, prüft Sehnen, tastet Fesselgelenke, schaut in Augen, die Geschichten von Lasten erzählen.
Der Tageslauf richtet sich nach dem Licht. Noch bevor die Hügel heller werden, sind Stalljungen bei der Arbeit. Sie karren Dung aus, tragen frisches Wasser in Trog und Kübel, massieren die Flanken der Tiere, damit die Winterhaut weich fällt. Der Schmied erhitzt Eisen, formt Hufeisen, ritzt kleine Zeichen ein, die Bestand und Besitzer kenntlich machen. Ein Sattler flickt Riemen, ein Schreiner richtet aus krumm gewachsenen Stämmen Stangen für einen provisorischen Reitplatz. Wenn die Sonne zwischen die Pfosten fällt, ist das Gestüt bereits eine Welt in Bewegung.
Pferde bedeuten im 10. Jahrhundert mehr als Transport. Sie sind Machtübersetzer. Ein Herzog ohne schlagkräftige Reiterei bleibt Bittsteller, einer mit verlässlicher Zucht kann Züge planen, Boten schicken, Grenzen verdichten. Die Auswahl ist streng: Stuten, die auf kargem Gras Kondition halten; Hengste, deren Schritt nicht nur schnell, sondern ausdauernd ist. Fohlen, die in den ersten Wochen lernen, dem Menschen zu folgen, nicht aus Angst, sondern aus Gewohnheit. Man notiert nicht mit Feder, sondern mit Gedächtnis. Namen werden laut, wenn ein Tier aus dem Paddock geführt wird, und sie bleiben, als wären sie eingekerbt.