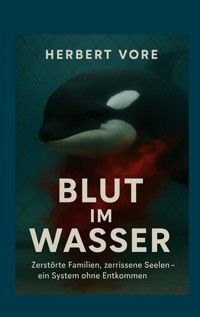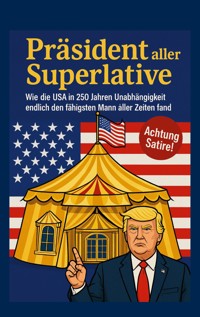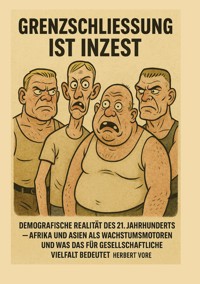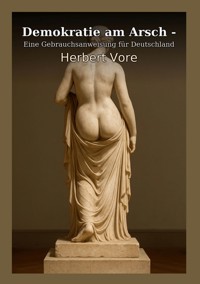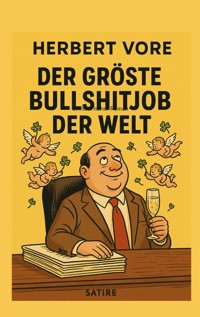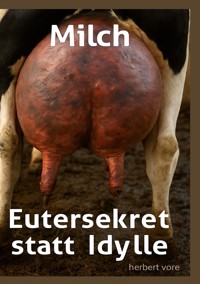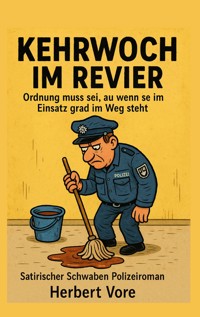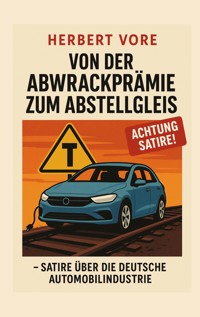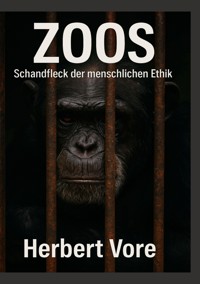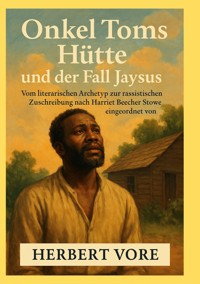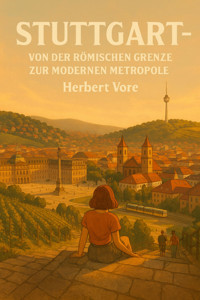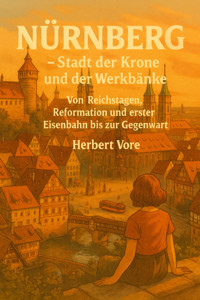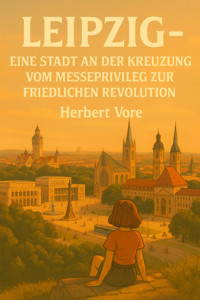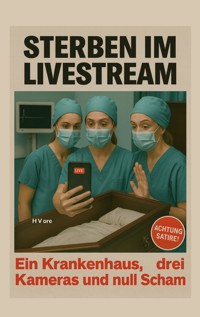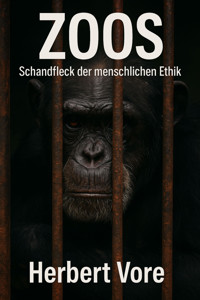
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Tiere hinter Gittern. Kinder vor den Scheiben. Pfleger mit Futtereimern. Alltägliche Szenen – doch was passiert jenseits des Sichtbaren? In diesem schonungslosen Buch entlarvt Herbert Vore die Institution Zoo als moralischen Irrtum. Systematische Tierquälerei, psychisches Leid, Tötung gesunder Tiere und der Missbrauch des Artenschutz-Narrativs gehören zum Alltag – in Nürnberg, Berlin, Leipzig, Stuttgart, Köln, Dortmund, München-Hellabrunn und weltweit. Mit juristischer Präzision, ethischer Tiefe und dokumentierten Vorfällen analysiert das Buch die dunkle Realität hinter den Gehegen. Es stellt unbequeme Fragen: Dürfen Tiere für Bildung leiden? Was sagen Zoos über unsere Gesellschaft aus? Und welche Alternativen gibt es wirklich? Ein leidenschaftliches Plädoyer für das Ende der Gefangenschaft – und den Beginn einer neuen Beziehung zwischen Mensch und Tier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zoos
Schandfleck der menschlichen Ethik
geschrieben von
Herbert Vore
Herbert Vore
c/o COCENTER
Koppoldstr. 1
86551 Aichach
Rechtlicher Hinweis
Dieses Buch ist ein Werk der öffentlichen Meinungsäußerung und Aufklärung. Es verfolgt das Ziel, kritisch über die Praxis zoologischer Einrichtungen in Deutschland und darüber hinaus zu informieren und auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten, Medienberichte, Fachliteratur sowie eigener Recherchen eine ethische, juristische und gesellschaftliche Bewertung vorzunehmen.
Die in diesem Buch genannten Institutionen, Personen oder Organisationen werden ausschließlich im Rahmen zulässiger Meinungsäußerung oder sachlicher Berichterstattung genannt. Wo Kritik geübt wird, erfolgt sie auf Grundlage der verfassungsrechtlich geschützten Meinungsfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
Alle Angaben zu Vorfällen, Zuständen, Zitaten und Verantwortlichkeiten wurden sorgfältig recherchiert und beruhen auf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung frei zugänglichen Quellen (z. B. Presseartikel, amtliche Berichte, wissenschaftliche Studien, öffentlich einsehbare Stellungnahmen oder dokumentierte Aussagen). Sollte sich nach Veröffentlichung dieses Buches eine Sachlage geändert oder ein Fehler eingeschlichen haben, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Korrekturen können in künftigen Auflagen berücksichtigt werden.
Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf juristische Vollständigkeit und ersetzt keine rechtliche Beratung. Die Darstellung rechtlicher Fragen – etwa zur Anwendung des Tierschutzgesetzes, der EU-Zoorichtlinie oder internationaler Artenschutzabkommen – erfolgt auf Basis öffentlich zugänglicher Interpretationen, Gesetze und Rechtsprechung, jedoch nicht im Sinne einer verbindlichen juristischen Einschätzung.
Sofern konkrete Vorwürfe gegenüber Einrichtungen oder Behörden geäußert werden, sind diese als Meinungsäußerung oder gesellschaftskritische Analyse im Sinne eines ethischen Diskurses zu verstehen. Sie richten sich nicht gegen einzelne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, sondern gegen institutionelle Strukturen, Haltungsbedingungen und politische Rahmenbedingungen.
Die Erwähnung von Städten, Zoos, Tierarten, Todesfällen und Haltungsbedingungen erfolgt ausschließlich zu dokumentarischen und aufklärenden Zwecken. Alle Informationen dienen der Förderung des öffentlichen Interesses an einer transparenten und ethisch vertretbaren Auseinandersetzung mit der Haltung nichtmenschlicher Tiere.
Urheberrechtlicher Hinweis:Alle Texte, Ideen und Strukturelemente dieses Buches sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung von Auszügen oder Inhalten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Autors, sofern sie nicht im Rahmen von Zitaten mit korrekter Quellenangabe erfolgt.
Vorwort
Als Kinder sehen wir Tiere im Zoo mit leuchtenden Augen. Wir drücken uns die Nasen an Glasscheiben platt, rufen nach Löwen, lachen über Affen, staunen über Elefanten. Doch was wir dabei nicht sehen – oder nicht sehen wollen – ist das, was außerhalb unseres Blickfelds liegt: Das Leiden hinter den Kulissen. Die Stille nach den Besucherstimmen. Die Stunden, in denen ein Tier nichts tut außer im Kreis zu laufen. Die Momente, in denen seine Augen nicht mehr beobachten, sondern leer durch das Gitter blicken.
Dieses Buch ist ein Versuch, das Unsichtbare sichtbar zu machen.
Der Zoo gilt in unserer Gesellschaft noch immer als Ort des Staunens, als Bildungsstätte, als harmloses Familienvergnügen. Seine PR-Abteilungen erzählen Geschichten von Artenschutz, Aufklärung und moderner Tierhaltung. Doch die Realität ist eine andere – dokumentiert, belegt, bekannt, aber verdrängt. Verdrängt von einer Gesellschaft, die sich gern tierlieb gibt, solange Tierliebe bequem bleibt. Verdrängt von politischen Instanzen, die Milliarden in neue Gehege investieren, während gleichzeitig echte Schutzprojekte in Herkunftsregionen unterfinanziert bleiben. Und verdrängt von einem Mediensystem, das aus süßen Tierbabys Einschaltquoten und Likes generiert, aber das gebrochene Wesen ihrer Mütter aus dem Bild schneidet.
Ich schreibe dieses Buch nicht als Gegner von Wissenschaft oder Bildung. Ich schreibe es als Mensch, dem die ethische Frage unter den Nägeln brennt: Dürfen wir Tiere zur Unterhaltung einsperren? Dürfen wir fühlende, leidensfähige Lebewesen in künstlichen Lebensräumen ausstellen, damit Kinder einmal einen Eisbären sehen können – in einem Betonbecken bei 30 Grad, tausende Kilometer entfernt von Eis und Jagd? Dürfen wir Delfine durch Ringe springen lassen, Gorillas in Zuchtbuchfamilien zwingen, Elefanten mit Haken führen, weil wir glauben, dass das Wissen über Tiere nur dort beginnt, wo wir sie besitzen?
Tiere sind keine Pädagogen. Sie sind keine PR-Maskottchen. Sie sind keine biologischen Anschauungsobjekte.
In den vergangenen Jahren haben sich Stimmen gemehrt, die das Konzept Zoo hinterfragen. Whistleblower aus den Zoos selbst, Tierrechtsorganisationen, kritische Journalisten, engagierte Biologen und Philosophen – sie alle liefern Belege, dass das Leiden systematisch ist. Dass selbst modernste Anlagen die Grundbedürfnisse vieler Arten nicht erfüllen können. Dass Zuchtprogramme mehr Probleme erzeugen als lösen. Dass Verhaltensstörungen, Medikamentenvergabe und Tötungen zum Alltag gehören. Dass das wirtschaftliche Überleben des Zoos oft über dem Wohl des einzelnen Tieres steht.
Ich habe in diesem Buch recherchiert, dokumentiert, verglichen, analysiert. Ich habe Fälle gesammelt, von Knut in Berlin bis zu den Pavianen in Nürnberg. Ich habe gesetzliche Grundlagen geprüft und ethische Konzepte hinterfragt. Ich habe mir angeschaut, was Zoos behaupten – und was sie verschweigen. Und ich habe gefragt: Wie könnte eine Welt ohne Zoos aussehen? Gibt es Alternativen, die Bildung ermöglichen, ohne Leid zu erzeugen? Gibt es Technologien, pädagogische Konzepte, Schutzgebiete, virtuelle Räume, in denen Kinder lernen können, was ein Tier ist – ohne dass dafür ein Tier sterben muss?
Ich glaube: Ja.
Dieses Buch ist kein Aufruf zum Hass. Es ist ein Aufruf zur Veränderung. Ein Plädoyer für Mut, für Empathie, für eine neue Form des Miteinanders zwischen Mensch und Tier. Wer dieses Buch liest, soll nicht nur empört sein – sondern inspiriert. Inspiriert dazu, Fragen zu stellen, zu diskutieren, zu fordern. Denn der Zoo ist nicht naturgegeben. Er ist eine Entscheidung. Und Entscheidungen kann man ändern.
Für Knut. Für alle, die hinter Gittern geboren wurden, ohne je die Freiheit zu riechen.
Kapitel 1 – Die Illusion der Wildnis: Zoos im 21. Jahrhundert
Zoos sind Orte der Widersprüche. Auf der einen Seite versprechen sie Nähe zur Natur, Bildung über Artenvielfalt und Schutz bedrohter Tiere. Auf der anderen Seite stehen Betonmauern, Verhaltensstörungen und das Eingesperrtsein fühlender Lebewesen. Wer mit wachem Blick durch einen Zoo geht, sieht nicht nur exotische Tiere, sondern auch ein System, das seine eigene Legitimation aus längst vergangenen Jahrhunderten zieht – und das bis heute kaum hinterfragt wird. Dieses Kapitel zeichnet die historische, gesellschaftliche und architektonische Entwicklung der Zooidee nach und zeigt, warum moderne Zoos trotz Glasfassaden, Themenwelten und Erlebnisinszenierung keine artgerechte Alternative zur Freiheit sein können.
1.1 Vom königlichen Tiergarten zum öffentlichen Spektakel
Die Geschichte der Tierhaltung zu Schaustellungszwecken ist so alt wie die Geschichte der Herrschaft selbst. Schon im alten Ägypten, in China, Babylon oder im Rom der Kaiserzeit hielten Machthaber exotische Tiere – als Machtsymbole, nicht aus pädagogischem Interesse. In Europa waren es später die Fürstenhöfe, die sogenannte Menagerien unterhielten: begrenzte Gehege für Giraffen, Löwen, Tiger, Elefanten. Sie waren nicht Teil eines ökologischen Denkens, sondern Ausdruck imperialer Überlegenheit. Tiere standen sinnbildlich für die Kontrolle über das Fremde, das Wilde, das Weltumspannende.
Erst im Zuge der Aufklärung und der entstehenden bürgerlichen Öffentlichkeit wandelte sich das Prinzip: Mit der Gründung des London Zoo 1828 und des Berliner Zoos 1844 begann die Ära der zoologischen Gärten als Bildungsstätten. Nun wurden Tiere „wissenschaftlich“ sortiert, katalogisiert, der Öffentlichkeit präsentiert – jedoch meist in engen Käfigen, mit Gitterstäben und Fliesenboden. Die Tiere wurden dem Publikum zur Betrachtung überlassen wie Gemälde im Museum. Doch auch hier ging es nie um das Tier an sich – sondern um seine Funktion: als Exponat, als Lernobjekt, als Projektionsfläche.
1.2 Der Mythos der Modernisierung
Ab dem späten 20. Jahrhundert begannen viele Zoos, sich neu zu erfinden. Die Kritik an klassischen Käfigen wuchs, die Forderung nach artgerechter Haltung wurde lauter. Die Antwort darauf war die sogenannte „gehegefreie“ Architektur: Panoramaglas statt Gitter, nachgebaute Landschaften statt Betonbunker, thematische Erlebniswelten statt Käfigparaden. Zoos gaben sich ein grünes Image, nannten sich „Tierparks“, „Erlebniszoos“, „Geo-Zoos“, betonten ihre Rolle als Naturschutzakteure und Bildungsorte. Tiergehege wurden größer, Pflanzen wurden eingeführt, Besucher sollten sich fühlen, als seien sie mitten in Afrika, Asien oder Südamerika.