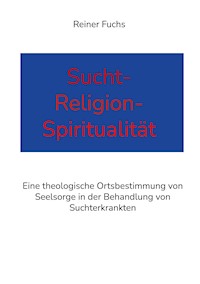
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hat Religion und Spiritualität einen Ort in der Psychosomatik? Kann Seelsorge in diesem Segment von Klinik und bio-psycho-sozialer Medizin einen eigenen spezifischen Beitrag ausweisen? In der vorliegenden Studie werden diese Fragen am konkreten Beispiel der Positionierung von Seelsorge am Ort der Klinik im Kontext der Suchtnachbehandlung durchbuchstabiert. Das Buch publiziert eine Dissertation, die in und aus eigener Praxis entstanden ist. Sie legt Gewicht auf eine empirische Grundlegung in einer qualitativen Analyse von Interviews mit Betroffenen (Grounded Theory) in Kombination mit der Machtanalytik M. Foucaults und eröffnet eine Perspektive auf Sucht als eine blockierte Macht-Ohnmacht Subjektivierung mit konstitutiv-irrationaler Todes-Dynamik. Die Machtverhältnisse der säkularen Suchtspiralen werden religionssoziologisch als Ort religiöser Praktiken, als Gewalt stummer Sakralisierungen identifiziert. Kann der Erfahrungsschatz der säkularen Anonymen Selbsthilfebewegung mit ihrem spirituellen Genesungsprogram hier Anregungen für eine Lösungssperspektive anbieten? Mit Hilfe einer differenzlogisch, topologisch, performativ formatierten Theologie können die Praktiken des 12-Schritte-Programms als eine säkulare Form christologischer Spiritualität erschlossen werden. Sie verweisen auf eine subjektivem Zugriff entzogene (anonyme) Macht, die sich am Ort eigener Machtlosigkeit des Subjekts (sujet der Sucht), seinerseits in einem Transgressionsereignis zeitigt, das den tödlichen Totalisierungszugriff der Sucht auf den Menschen unterläuft und Anwaltschaft für die Entstehung nüchterner, nicht-soueräner Subjekt-agency eröffnet. Im Vergleich der Grammatiken von Genesungsnarrativen Betroffener und denjengen der ersten christologischen Dogmen, fällt auf, dass beide als performative Sprechakte im Modus von ungetrennt und unvermischt funktionieren und genau darin jenes anonyme schöpferische Ereignis inmitten der rettenden performance der Genesung zur Sprache zu bringen vermögen. Dieses Sprechen ist eine Ortsangabe für Seelsorge in der Suchtbehandlung. Reiner Fuchs, Dr. theol., ist als Pastoralreferent in der Klinikseelsorge in Bad Grönenbach tätig. Er hat in Würzburg und Salzburg Kath.Theologie studiert .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 955
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Kapitel I Stationäre Suchttherapie als Ort der Seelsorge - eine Positionierung der Kirche in der Welt von heute?
1 Klinische Suchtbehandlung – Seelsorge an einem Ort der Therapie
2 Die „Rückkehr der Religion“ am Ort der Klinik: Die Macht in der Differenz von Spiritualität und Religion
2.1 Das klinische Setting stationärer Psychosomatik, Spiritualität und Seelsorge – Außenbegegnungen provozieren Innenüberschreitungen
2.2 Die Differenz von Religion und Spiritualität
2.2.1 Die Ambivalenz in der Begegnung von PatientInnen und Seelsorge – die Hoffnung auf spirituelle Macht und die Angst vor religiöser Gewalt
2.2.2 Die Begegnung zwischen therapeutischem Team und der Seelsorge - die prekäre Machtsignatur des Ortes
2.2.3 Fazit: Die prekäre Machtsignatur des Ortes - Die ernüchterte Identität der Seelsorge
2.3 Souveräne Positionierungsvarianten der Seelsorge – Der Ohnmacht am Ort der Differenz ausweichen
2.3.1 Ein souveräner Auftritt – eine Trennung vom Außen im Modus aktiver Stärke
2.3.2 Ein souveräner Abtritt – eine Trennung vom Außen im Modus aktiver Schwäche
2.3.3 Souveräner Idealismus – eine Vermischung von Spiritualität und Seelsorge im Modus aktiver Stärke
2.3.4 Souveräner Realismus – eine Vermischung religiös-kirchlicher Gewalt und spiritueller Macht im Modus aktiver Schwäche
3 Fazit: getrennt oder vermischt– keine Ortsgrammatik der Kirche in der Welt von heute: Was nun?
Kapitel II Das Dogma der Pastoral des II. Vatikanums – Die polare Ekklesiologie des Konzils als Basis einer heterotopischen Platzierung der Seelsorge in der Sucht von heute
4 Die societas perfecta - Das einheitliche Identitätsformat der Kirche vor dem II. Vatikanum
5 Die Kirche als Volk Gottes in der Welt von heute - Das zweiheitliche Identitätsformat der Ekklesiologie des Konzils
5.1 Die dogmatische Ortsbestimmung ad intra - Christus ist das Licht der Völker
5.2 Die pastorale Ortsbestimmung ad extra – die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums
5.3 Der Ort der Pastoral – Freude und Hoffnung, Trauer und Angst in den Bedrängnissen der Menschen von heute
5.4 Die göttliche Berufung des Menschen – Die Menschwerdung als locus theologicus des Konzils
5.5 Die geheimnisvolle Unmittelbarkeit von Mensch und Gott in Christus durch den Heiligen Geist
5.6 Pastoral als Dienst an der Menschwerdung – Die Darstellung der Mission einer christologischen Spiritualität
5.7 Die Würde des Menschen und der Menschenrechtsdiskurs
5.8 Die Lehre von der Freiheit des Gewissens
6 Gott und Religion – Differenzen in Nostra Aetate
7 Die Erklärung zur Religionsfreiheit
8 Zur Methodik von Pastoral
8.1 Das Werden der Kirche am Ort der Pastoral – die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums deuten
8.2 Der Dialog in drei Schritten: Sehen-Urteilen-Handeln als abduktive Methodologie von Pastoral
9 Fazit: Das Dogma der Pastoral des II. Vatikanums als Basis der Seelsorge am Ort stationärer Suchttherapie
Kapitel III Eine qualitative Analyse des Suchtphänomens: Die Souveränität der Sucht und die Ohnmacht des Menschen – ein Ort von Religion
10 Qualitative Sozialforschung
10.1 Zum Verfahren der Grounded Theory (GT)
10.2 Indikatoren einer adäquaten Verortung der GT
10.3 Zur Methodologie: Grounded Theory entsteht
10.3.1 …induktiv gegenstandsverankert
10.3.2 …mit theoretischer Sensibilität
10.3.3 …ständig vergleichend
10.3.4 …kreativ
10.3.5 …abduktiv
10.3.6 …experimentell bewährend
10.4 Zur Anwendung der GT
10.4.1 Die Datenerhebung: Leitfadeninterviews
10.4.2 Die Datenanalyse: Das Kodieren und die Darstellung der Analyse: Tabellen und Kommentare
11 Das offene Kodieren Sucht - ein Macht-Ohnmacht Tätigkeitsort
11.1 Zum Verfahren des offenen Kodierens
11.2 Ergebnisse des offenen Kodierens
11.2.1 Räume: Zwei Lebenswelten
11.2.2 Relationen: Parallelwelten und Drehbühne
11.2.3 Bewegungen: Gegen-Platzierungen
11.2.4 Zeiten: zeitpünktlich und zeitlos
11.2.5 Produktivität: Subjektivität und Objektivität
11.2.6 Ambiguität: „ein streichelnd würgendes Ungeheuer“
11.2.7 Strategie: Innen-Außen Überschreitungen
11.2.8 Denken-Wollen-Tun: Individualisierung und Totalisierung
11.2.9 Anonymität: abwesende-Anwesenheit
11.2.10 Körper: Ort unausweichlichen Zugriffs
11.2.11 Handeln auf Handeln: Formierung als Subjekt und Objekt
11.2.12 Fazit: Sucht ist ein binärer Macht-Ohnmacht-Tätigkeitsort
12 Die theoretische Sensibilität als Forschungsperspektive:Wie Menschen zu Subjekten gemacht werden? - Zur Machtanalytik M. Foucaults und ihre Anwendung in der Grounded Theory
12.1 Grundlegendes zum Denken M. Foucaults
12.2 Geschichte-Machtanalytik-Dispositive: Kritik ihrer Herkunft und Genealogie ihrer Entstehung
12.3 Die Frage nach der Subjektkonstituierung – ein Projekt relationaler Machtanalytik
12.4 Wie funktioniert Macht? - Dispositive als Technologie der
12.4.1 Wo setzt relationale Machtanalyse an? – Machtdispositive und ihre Widerlager
12.5 Sucht als subjektkonstituierendes Dispositiv - Thesen zur Anwendung foucaultscher Machtanalytik
12.5.1 Strukturelle Zuordnungen von Machtanalytik und Sucht im offenen Kodieren
12.5.2 Funktionale Zuordnungen - Anwendung eines allgemeinen Analyserasters im offenen Kodieren: Sucht als Subjekttechnologie funktioniert
12.6 Typologische Zuordnungen von Machtanalytik und Sucht - Typologien historischer Machtverhältnisse als Analyseraster
12.7 Die Machtform der Souveränität als „Todesmacht“
12.7.1 „Das Recht, Sterben zu
machen
und leben zu
lassen“
12.7.2 Ihr Instrument: Die peinliche Marter
12.7.3 Ihr Ziel: Wiederherstellung verletzter Asymmetrie der Macht
12.7.4 Ihre Durchführung: Die Wiederherstellung verlorener Souveränität in der öffentlichen Liturgie der Marter
12.7.5 Die Abwesenheit des Souveräns und die Wirksamkeit seiner Macht
12.7.6 Die Anwesenheit von Schuldigem, Henker, und Volk
12.7.7 Der Vorgang des Sterben
machens
– Die Verausgabung souveräner Macht
12.7.8 souveräne Macht funktioniert durch einschließende Ausschließungen, anwesende Abwesenheit
12.7.9 Widerstand gegen die Repräsentanten souveräner Macht
12.7.10 Der Bruchpunkt souveräner Dominanz
12.8 Bio-Macht und Bio-Politik als „Lebensmacht“
12.8.1 Von der Nein-sagenden ‚Macht zum Tode‘ zur Ja-sagenden ‚Macht zum Leben‘.“
12.8.2 Bio-Macht
12.8.3 Die Bio-Politik
12.8.4 Durchführung: Die detaillierte Dressur des individuellen Körpers und die Normalisierung der vielen Individuen
12.8.5 Das Funktionieren der ‚Lebens-Macht‘-Technologie: Die Relation von Bio-Macht und Bio-Politik
12.8.6 Die Effizienz panoptischer Mechanik: Die anonyme Anwesenheit der Macht; die sichtbare Unsichtbarkeit abwesend anwesender Macht – souveräne Macht ohne König
12.9 Gouvernementalität
12.9.1 Ihr Ziel: Die Konstituierung des souveränen Staates durch ‚Führung der Führungen‘ der vielen Einzelnen
12.9.2 Ihr Instrument: Die Kombination von Bio-Macht, Bio-Politik und Pastorat
12.9.3 Die Durchführung: Das Hirte und Herde Spiel als die permanente Führung der vielen Einzelnen durch den Staat
12.9.4 Der Bruchpunkt der Gouvernementalität – die Anonymisierung der relationalen Eigendynamik in der Ununterschiedenheit von Hirte und Herde
12.9.5 Widerstand gegen totalisierende Formen von Subjektivierung
12.9.6 Abschließende Bemerkung: Das Dreieck von Souveränität, Disziplin und Gouvernementalität
12.9.7 Zur Zuordnung von Machtanalytik und formaler Kodier-Analysestruktur der Grounded Theory
13 Das Axiale Kodieren: Eine Genealogie des Subjekts der Sucht: Die Produktion des Sterben Machenden Nicht-Menschen
13.1 Ursächliche Bedingungen von Sucht: Ihre Herkunft und Entstehung
13.1.1 Ursächliche Bedingungen in der GT
13.1.2 Ursächliche Bedingungen: Die mikro-und makrophysikalische Struktur von Sucht
13.1.3 Die Strategie des souverän handelnden Subjekts
13.1.4 Das nicht-diskursive Ereignis ihrer Entstehung am Nicht-Ort. Ein Gewaltakt
13.1.5 Die Macht durchdringt den Körper
13.1.6 Fazit: Sucht als Souveränitäts-Dispositiv
13.2 Handlung und Interaktion: Sucht als blockiertes Machtverhältnis souveräner Strategie, bio-politischer Technik und gouvernementaler Taktik
13.2.1 Methodische Vorbemerkungen: Handlungs-und Interaktionsanalyse als Dispositivanalyse
13.2.2 Sucht als Dispositiv in der Perspektive foucaultscher Macht-Typologie
13.2.3 Handlungsanalyse: Die Konstituierung des Individuums als Subjekt der Sucht in der Dichotomie von Subjektivierung und Subjektivation
13.2.4 Kontext und intervenierende Bedingungen: Sucht als Dispositiv einer Utopie von Platzierung und Gegenplatzierung – der Sterbenmachende Mensch auf der Drehbühne von Macht und Ohnmacht
13.2.5 Kontext und intervenierende Bedingungen – der Ortswechsel von Macht und Ohnmacht in der Sucht
13.2.6 Konsequenzen: Der Mensch in der Utopie der Sucht – ein Subjekt des Sterben-machens
14 Das selektive Kodieren: Sucht als Form souveräner Religion – die Victimisierung des Menschen als stumme Sakralisierung
14.1 Selektives Kodieren: das Finden einer ‘Kernkategorie’ und einer ‘roten Faden Geschichte’
14.2 Zur unsagbaren Macht der Sucht - Soziologische Perspektiven auf Religion
14.3 Sucht als Sakralisierung – eine befremdliche Durchdringung
14.4 M. Riesebrodts
Theorie der Religionen
–menschliche Praktiken des Verkehrs mit übermenschlichen Mächten und deren Heilsversprechen
14.4.1 Definieren: Religion als Verkehr mit übermenschlicher Macht
14.4.2 Wo entsteht Religion? – An Orten der Machtlosigkeit im Entzug menschlicher Kontrolle
14.4.3 Verstehen: Wie funktioniert Religion – Die Analyse ihrer systematischen Praktiken
14.4.4 Erklären: Der Sinn religiöser Praktiken – das Heilsversprechen
14.4.5 Interventionistische Praktiken
14.4.6 Fazit: Sucht als eine Form variabler virtuoser Dramatisierung des Kontakts mit überpersönlicher Macht – eine stumme Sakralisierung
14.5 R. Caillois: Religion als Positionierungsvarianten angesichts der Ambivalenz des Heiligen
14.5.1 Das Heilige als das Andere des Profanen – eine relationale Macht
14.5.2 Herausforderungen im Umgang mit der Macht des Heiligen: seine Ambivalenz des tremendum et fascinosum
14.5.3 Orte des Heiligen – profane Räume: Topologien der Heilsökonomie
14.5.4 Die Polarität und Dialektik des Heiligen - Rein und Unrein
14.5.5 Zwischenbilanz: Sucht als Form der Begegnung mit dem Heiligen
14.5.6 Typen von Sakralisierungen: Kontakt-Syntaxen des Profanen mit der ambivalenten Macht des Heiligen
14.6 Die Rote-Faden-Geschichte des selektiven Kodierens: Sucht als stumme/verschwiegene Menschopfer-Religion
15 Prozess und Matrix: Sucht als säkulare Form souveräner Religion
15.1 Prozess und Matrix
15.2 Sucht als Form souveräner Macht
15.2.1 Drehbühne souveräner Ermächtigung
15.2.2 Drehbühne souveräner Entmächtigung
15.3 Sucht als Form souveräner Religion
15.3.1 Riesebrodt: Sucht als Religion
15.3.2 Caillois: Sucht als Religion der Gewalt
15.3.3 Die Matrix getrennt und vermischt
15.4 Sucht als Drehbühne souveräner Religion
15.4.1 Erster Akt: Ermächtigung
15.4.2 Zweiter Akt: Entmächtigung
15.5 Fazit: Wer spricht Wo und Wie das letzte Wort?
16 Der Genesungsweg der Anonymen Selbsthilfebewegung – Ihre
Spiritualität der Machtlosigkeit
als Widerlager gegen die Gewalt souveräner Sucht
16.1 Die Anonyme Selbsthilfebewegung und das Funktionieren ihres spirituellen Genesungsweges als Form nicht-souveräner Religion
16.1.1 Herkunft und Entstehung: Im Meeting Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen
16.1.2 Signifikante Eigenschaften der Anonymen Selbsthilfebewegung
16.2 Die Spiritualität des Zwölf Schritte Programms der Anonymen Alkoholiker als nicht-souveräne-Religion
16.2.1 Genesung: Die Entstehung des Heterotopos der Genesung in der Herkunft des Tiefpunkts der Utopie der Sucht
16.2.2 Erster Schritt: Das Bekenntnis der Machtlosigkeit als Kritik der Victimisierung stummer Sakralisierung
16.2.3 Zweiter Schritt: Die Genealogie der spirituellen Genesung im
sacrifice
anonymer Sakralisierung
16.2.4 Dritter Schritt: Ja zum Entzug – Zustimmung zu einer Lebensform nicht-souveräner Subjekttechnologie als sujet der Fürsorge
‚höherer Macht
‘
16.3 Prozess und Matrix: Der spirituelle Genesungsweg von AA: Das
sacrifice
der Abstinenz souveränen Menschenopferkultes – die anonyme Präsenz „höherer Macht“ im Entzug
16.3.1 Die Matrix der
höheren Macht
: Ungetrennt und unvermischt – Das Innen-Außen Verhältnis des Heterotopos der Genesung
16.3.2 Der Prozess der Spiritualität des A-Programms: Das
sacrifice
der Abstinenz souveränen Menschenopferkultes – Das Sühneopfer anonymer Sakralisierung im Entzug
Kapitel IV Die Spiritualität der A-Bewegung als anonyme Christologie: Das doppelte sacrifice und die Machtlosigkeit in seiner Differenz: nicht-souveräne Erlösung
17 Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums unterscheidend deuten: Menschwerdung in der Sucht, auf dem spirituellen Genesungsweg der ABewegung und christologischer Spiritualität
18 Machtanalytische Stichproben nicht-souveräner Erlösungsmacht christologischer Spiritualität
18.1 Ursächliche Bedingungen Herkunft und Entstehung von Erlösung als Dispositiv nicht-souveräner Spiritualität – die Menschwerdung Jesu Christi
18.1.1 Die Herkunft im nicht-diskursiven Zugriff souveräner Gewalt: Die Jungfrau Maria zur Zeit Kaiser Augustus als Ort des Tiefpunkts
18.1.2 Die nicht-souveräne Behandlung subjektiven Handelns: Die Botschaft des Engels als nicht-souveräne Macht der Berufung
18.1.3 Die Verkörperung nicht-souveräner Macht – die menschliche Geburt des göttlichen Kindes
18.1.4 Das Nicht-Souveränitäts-Dispositiv der Erlösung: Die Gottesgebärerin Maria - Jungfrau und Mutter und die Hoheit von Menschensohn und Gottessohn
18.2 Ursächliche Bedingungen Herkunft und Entstehung von Genesung als Dispositiv christologischer Spiritualität – die Menschwerdung des Menschen R.
18.2.1 Die Herkunft im nicht-diskursiven Zugriff souveräner Gewalt: Die Hölle der Mutter R. am Tiefpunkt ihrer nassen Alkoholikerin-Parallelwelt
18.2.2 Die nicht-souveräne Behandlung subjektiven Handelns: Die Notwendigkeit der sozialen Offenlegung – Die Botschaft der Therapeuten als Ort nicht-souveräner Berufung
18.2.3 Die Verkörperung nicht-souveräner Macht – die menschliche Geburt des göttlichen Kindes im offenlegenden Gespräch mit dem Ehemann
18.2.4 Das nicht-souveränitäts-Dispositiv der Erlösung: Das Zusammenspiel von Sakralem und Säkularem in der Durchdringung von Singulärem und Sozialem – Die Menschwerdung von R. als Gottesgeburt in der Alkoholikerin R. – das Menschenkind in göttlicher Hoheit
18.3 Handlung und Interaktion: Eine Genealogie des sujets der Erlösung als Lebensform: Die Genesung des Mannes mit der verdorrten Hand als eine Spiritualität der Machtlosigkeit
18.3.1 Das Handlungsgeflecht der Macht in Ohnmacht-Spirale des Erlösungs-Dispositivs: Das sacrifice der Übertretung des religiösen Tabus – das sacrifice der Kapitulation – das nicht-souveräne Kommen der Macht, größer als wir selber
18.4 Handlungsanalyse der Passionsgeschichte: Die Konstituierung des Menschen als Sujet der Erlösung in der Differenz von Subjektivation und Subjektivierung - die Auferweckung Jesu und die Auferstehung Christi
18.4.1 Die Maschen des Tiefpunkts: Der Mensch Jesus im Fadenkreuz religiöser und politischer Gewalt
18.4.2 Das sacrifice doppelter Abstinenz von souveräner Subjektivierung im Angesicht souveräner Gewalt: Die diskursive Darstellung des Sterben-machens souveräner Macht am Kreuz und die nicht-diskursive (diskrete) Hoffnung auf nicht-souveräne Macht des Lebens im Entzug – Tod und Auferstehung Jesu
18.4.3 Die Entstehung der Genesung R.‘s als sujet nicht-souveräner Macht: Auferweckung und Auferstehung aus dem toten Leben der Sucht
19 Prozess und Matrix der Erlösung: Die Christologie der Konzilien – Die Syntax göttlicher Erlösung in Jesus Christus durch den Heiligen Geist
19.1 Die Hoheitstitel Jesu - die Benennung der Syntax christlicher Erlösung
19.2 Das Bekenntnis von Nizäa: Jesus Christus als Ort der Nicht-Souveränität von Gott und Mensch
19.2.1 Jesus Christus der Sohn Gottes: Die Gottesgeburt in Gott selbst - das homoousios von Vater und Sohn als sacrifice im Heiligen
19.2.2 Jesus Christus der Menschensohn: Geboren von der Jungfrau Maria - das homoousios von Gottessohn und Menschensohn als sacrifice im Profanen
19.3 Das Bekenntnis von Konstantinopel Der Heilige Geist als die Macht nicht-disziplinierender Relativierung von Gott und Mensch in Maria der Jungfrau
19.4 Das Bekenntnis von Ephesus Die Jungfrau Maria als Mutter - Die Gottesgebärerin bringt Gott als Mensch zur Welt: Das sacrifice des Menschen
19.5 Das Bekenntnis von Chalkedon: Jesus Christus - eine Person in zwei Naturen - ungetrennt und unvermischt: Die nicht-gouvernementale Matrix der Erlösung
19.6 Das Bekenntnis des II. Vatikanums: Der Sohn Gottes hat sich in seiner Menschwerdung mit jedem Menschen vereinigt - Im Dienst an dessen Menschwerdung
19.6.1 Die Genesungsgeschichte von R. als Prozess von Menschwerdung in Christus
Kapitel V Pastoral am Ort stationärer Suchttherapie: Eine christologische Spiritualität der Machtlosigkeit
20 Die heterotopische Positionierung von Suchtkrankenpastoral in den Differenzen vor Ort
20.1 Suchtkrankenpastoral in der Differenz von Klinik und Kirche, von Religion und Spiritualität, von Religionsgemeinschaft und Pastoralgemeinschaft
20.2 Ihre polare Identität als christologische Spiritualität der Machtlosigkeit
20.3 Pastorale Positionierungen in christologischer Matrix
Literaturverzeichnis
Anhang
Vorwort
Das vorliegende Buch publiziert meine Dissertation, die ich 2017 abgeschlossen habe. Sie ist berufsbegleitend während meiner Klinikseelsorgetätigkeit in einer Psychosomatischen Klinik entstanden. Die konkreten alltäglichen Fragen der Kooperation mit dem psychosozialen Behandlungs-team haben eine generelle Problemstellung dieses Arbeitsfeldes offengelegt: die Frage nach der Verhältnisbestimmung von Säkularem und Sakralem. Wie plausibilisiert sich die Präsenz des Sakralen in Form eines Religionsrepräsentanten mit seiner sakralen Perspektive am Ort staatlich formatierter säkularer bio-psycho-sozial-evidenzbasierter Gesundheitsbehandlung spätmoderner Gesellschaft. Die im 19. und 20. Jahrhundert gängige Zuordnungsmatrix bearbeitet diese Thematik über die Verhältnisbestimmung von Staat und Kirche, also den beiden großen Kir-chen in ihrem jeweiligen Format des konfessionellen Milieus. Mit deren Verschwinden in der Spätmoderne entsteht die Notwendigkeit einer Neujustierung. Die gesellschaftliche Pluralisierung und Individualisierung im Umgang mit Religionen - nicht zuletzt auch im Zuge der Migrationsentwicklungen - manifestiert sich unter anderem in der Entstehung des Spiritualitäts-Diskurses Ende des 20. Jahrhunderts und findet hier auch neue Berührungsflächen mit den Entwicklungen im staatlichen Gesundheitswesen. Jetzt werden in psychosomatischen Fachgesellschaften (DGPPN 2016) religiöse und spirituelle Praktiken als mögliche Faktoren von Pathogenese und Salutogenese diskutiert.
Meine Studie diskursiviert diese prinzipielle Fragestellung am konkreten Ort Psychosomatische Klinik entlang der Behandlungsindikation Suchterkrankung. Daher habe ich auch Sucht-Religion-Spiritualität und die Frage der Positionierung der Seelsorge in diesem Feld als Buchtitel gewählt.
Die Bestimmung des Verhältnisses von Säkular und Sakral ist im Kontext christlicher Sprachtradition mit dem Begriff der Christologie kodiert: die Bezeichnung des Zueinanders von Mensch und Gott folgt mit ihrer Grammatik des ungetrennt und unvermischt sprachlich einer Negativbestim-mung. Sie baut konstitutiv auf die tätige , die performative Leerstelle, die Transformation im Entzug. Der Entzug ist in der Suchtbehandlung ein elementarer Vorgang, ein prekärer Ort ambivalenter Erfahrung der Gewalt der Sucht, eigener Machtlosigkeit, aber auch überraschender Genesungsressource. Daher läuft die Studie auf die Bedeutung dieser Leerstelle zu: der Entzug als eine Art Scharnier-Ereignis von Säkularem und Sakralem, theologisch gesprochen: der säkulare Ort der Machtlosigkeit als Ort der Offenbarung der verborgen-transformierenden Gegenwart Gottes. Der Titel der Dissertation formuliert dieses Programm:
Souveräne Sucht und nicht-souveräne ErlösungSuchtkrankenpastoral als Widerlager gegen die Gewalt der Sucht – eine christologische Spiritualität der Machtlosigkeit.
Sucht ist eine Form von Gewalt und die Irrationalität ihrer Macht kann religionssoziologisch als ein Momentum des Sakralen erschlossen werden. Das ist ein Ergebnis der qualitativen sozialwissenschaftlichen Analyse von Patient*inneninterviews im ersten Teil der Studie im Kontrast mit der Machtanalytik M. Foucaults und der Religionssoziologie R. Caillois‘. Sie erörtert das Gewaltpotential von Religion und behauptet schließlich Pastoral als ein spirituelles Widerlager gegen die Gewalt stummer Sakralisierung in der Sucht.
Meine Studie ist über Jahre hinweg entstanden, daher kann es den Eindruck erwecken, dass dort Verhandeltes nicht mehr aktuell ist. Ja und Nein.
Aktualität besitzt zweifelsfrei die Diskursivierung der Verwobenheit von Religion und Gewalt. Ich schreibe diese Vorwort im Herbst 2021, in der vierten Welle der Corona-Pandemie und drei Jahre nach Veröffentlichung der MHG Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche mit all den ihr folgenden Aufarbeitungsmassnahmen inklusive deren Verwer- fungen, die noch kein Ende absehen lassen. In diesen zeigt sich seitens einiger Leitungsfiguren der katholische Kirche realitätsverweigerndes und bagatellisierendes Agieren gepaart mit gleichzeitiger eigenartiger potjemkinscher Souveränität, das an Verhaltensdynamiken von Süchtigen erinnert. Im Kontext der Klinikseelsorge ist der radikale Abstieg der Katholischen Kirche hinsichtlich ihrer Autorität in spätmoderner Gesellschaft schon lang und nun durch der Missbrauchskrise und die Pandemie aktuell noch rasant beschleunigt mit Händen zu greifen. Eine Bewegung, die in den 90er Jahren noch freundlich-zögerlich als Rückkehr der Religion und Spiritualität als Teil spätmoderner Lebensführung wahrgenommen wurde, hat spätestens seit den Terroranschlägen in New Yorck ihren deutlich ambivalenten Charakter gezeigt: Die Auseinandersetzung um den Gewaltgehalt von Religionen. Dieser Aspekt ist nun in den Missbrauchsgeschehnissen der Kirche ganz nah auf den Pelz gerückt und trifft sie direkt. Die machtkritischen Anfragen aus dem klinischen Kontext an die Seelsorge die ich bereits Mitte der neunziger Jahre vorfand (weil dort Missbrauchsgeschichten längst angekommen waren), und die sich damals für viele binnenkirchlich tätigen Kolleg*innen befremdlich, weil ungewohnt und völlig überzogen anhörten, bestimmen heute die Kooperationsebene im bio-psycho-sozialen Feld: der Seriositäts-, Plausibilitäts- und Legitimationsanfrage der Thematisierung und Praktizierung von Religion und Spiritualität -und schon gar kirchlicher Seelsorge-, kann heute als Klinikseelsorger*in niemand mehr ausweichen. Wenn es der Klinikseelsorge nicht gelingt, an die gängigen lebenswissenschaftlichen Konzepte im Gesundheitswesen diskursanschlussfähig ihren spezifisch theologischen Beitrag in säkularen Angrenzungsflächen auszuweisen und dazu noch nachvollziehbar ihre Kompetenz in der Identifizierung von religiöser Gewalt und der widerständigen Distanzierung von dieser durch die eigenen religiös-spirituellen Praktiken transparent zu machen, wird sie hier nicht bestehen können.
Fehlende Aktualität der Studie zeigt sich darin, dass fachlichen Referenzen, die in den letzten Jahren publiziert wurden und ungeheuer interessante Weiterführungsimpulse erkennen lassen, nicht mehr diskutiert werden. Dazu zählen neben dem Empfehlungspapier der DGPPN zu Spiritualität und Religion in der Psychotherapie sicher auch die diesbezüglichen Kommentierungen von Hilarion Petzold und seinem Vorschlag eines Angrenzungskonstrukts beider Fachbereiche, und natürlich auch die Entwicklungen im Bereich spiritual care, wie sie z.B. von M. Utsch, E. Frick oder S. Peng-Keller vorgelegt wurden. Wichtige Berührungsflächen ergeben sich zu den Vulnerabilitäts-Studien von H. Keul, insbesondere hinsichtlich der Rezeption sakraltheoretischer Theorien und deren victim-sacrifice-differenzierenden Opferdiskurses. Zudem sind unterdessen die ersten Bände von H.-J. Sander und G. M. Hoff in der Reihe Glaubensräume erschienen, in denen deren differenzlogisch-topologisch-performativer Ansatz systematischer Theologie entfaltet wird, deren Anfänge die Entwicklung meiner Arbeit sehr motiviert und orientiert haben und mittlerweile theologische Grundlagen-Folien anbieten, die hier begonnene Debatte weiter voran treiben zu können. Ihrer unkonventionell-inspirierenden Art Theologie zu betreiben, verdanke ich eine eigene diskursive Beweglichkeit. Ihre Gesprächsbeiträge sind mir nach wie vor in ihrer Komplexität und Abstraktheit sehr instruktive Unterstützung in der pastoralen Positionsbestimmung sowohl im säkularen Feld des Gesundheitswesens als auch in der gegenwärtigen Kirchenkrise. Zuletzt möchte ich noch auf die aktuellen pastoraltheologischen Anschlußstellen verweisen, die in den Arbeiten von Ch.Bauer vorliegen. In seiner Rezeption des Spiritualitätsdiskurses von Michel de Certeau mit der Betonung des Bruchs und des Anderswo als Offenbarungsort, lassen sich sehr deutlich weiterführende Perspektiven entfalten.
Die Theologie zeigt also prinzipiell Potential für die Bearbeitung des skizzierten Themenfeldes. Die Kontrastierung jenes theoretischen Erschließungsvermögens mit den realen Herausforderungen des Klinikalltags und den dort verwendeten Konzepten und Diskursformaten erlebe ich als bereichernde Spannung, aber auch als einen großen, noch weitgehend unbestellten Acker. Theologie als Referenzwissenschaft ist in der Psychosomatik nach wie vor ungewöhnlich. Beide Fachgebiete agieren weitgehend in ihren Blasen, aber Patientenorientierung und Kultursensibilität in der Behandlung werden die beiden Bereiche stärker zur Kooperation nötigen. Als ein erstes Zeichen der Zeit kann hier auch die oben genannte Auseinandersetzung um die Missbrauchskrise in der katholischen Kirche und religiös-spirituellen Kontexten überhaupt identifiziert werden. Sie bringt unausweichlich die Kirche vor die Auseinandersetzung mit dem Gewaltpotential ihrer Religion, exakt mit Gefahren religiöser Gewalt wie z.B im Rahmen ihres Klerikalismus und sie bringt die Psychosomatik - an deren Ort sich die traumatisierten Betroffenen jener Gewalt zur Behandlung begeben - damit in Berührung, dass Gewalt nicht nur eine bio-psycho-soziale Gegebenheit ist, sondern auch ein Ort hoch ambivalenter Sakralität sein kann. Diese Herausforderungen werden nicht von jeweiliger Seite allein gelöst werden können, hier werden Kooperationsformen entstehen müssen, um der Komplexität dieser Aufgabe und damit letztlich den Betroffenen, die abklärende und aufklärende Unterstützung wünschen, gerecht zu werden.
Ich habe mich entschieden, die Dissertation ungekürzt und in der Form zu publizieren, wie sie eingereicht wurde. Sie ist aus der Praxis entstanden und in ihr erprobt. Sie bietet reichhaltige und unterschiedlichste Ansätze für weitere Diskussionen. Sie möchte in der Debatte, wo und wie und das Weltkulturerbe des christlichen Glaubens in den vielfältigen Herausforderungen der Welt von heute konstruktive Lösungsansätze anbieten kann, einen kleinen Dialogbeitrag beisteuern.
Ich wünsche eine anregende Lektüre.
Bad Grönenbach im November 2021
Einführung
Souveräne Sucht und nicht-souveräne Erlösung Suchtkranken-pastoral als Widerlager gegen die Gewalt der Sucht – eine christologische Spiritualität der Machtlosigkeit.
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Erfahrung des Autors in der Seelsorge mit suchtkranken Menschen im Rahmen der Klinik für Psychosomatische Medizin in Bad Grönenbach. Sie rückt Suchttherapie als Ort einer Pastoral ins Blickfeld, die sich in der Welt von heute nach einem christologischen Formular strukturiert, das erstmals mit dem Glaubensbekenntnis des Chalcedonense (451 n. Chr.) entwickelt wurde. Diese Strukturierung ist alt, aber sie besitzt große Aktualität, denn sie liefert den Schlüssel zu einer kreativen Verhältnisbestimmung von Säkularem und Sakralem, so dass das eine das andere in seiner Existenz bestärkt. Sie erschließt sich allerdings nicht einfach von selbst, sondern verlangt eine Reihe von Tiefenbohrungen, ehe sie überhaupt in den Blick gerät. Die vorliegende Studie verfolgt das Ziel, Suchtkrankenpastoral als eine christologische Pastoral topologisch am konkreten Beispiel von Bad Grönenbach zu entwickeln.
Ihr Ausgangspunkt ist einerseits die Situation in der Klinik mit ihrer therapeutischen Konzeption und die Menschen, die mit ihrer Suchterkrankung dorthin kommen, um auf ihrem Genesungsweg Unterstützung zu finden.1
Sie thematisiert den spezifischen Beitrag und die Positionierung der Seelsorge in diesem bio-psycho-sozialen Behandlungsrahmen. Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei der Tatsache zu, dass die Klinik eine enge Zusammenarbeit mit der Anonymen Selbsthilfebewegung pflegt, die ihren Genesungsweg als eine Spiritualität der Machtlosigkeit begreift. Spiritualität ist daher ein virulentes Thema in der Klinik. Sie wird mit großem Respekt als Genesungsressource gewürdigt, wohingegen Religion mit deutlichem Ressentiment belegt ist. Wie positioniert sich Seelsorge an solch einem heterogenen Ort? Worin liegt ihr Proprium und wie erbringt sie ihren Beitrag, die Frohe Botschaft des Evangeliums zur Sprache zu bringen?
Ein, mit dieser Fragestellung sich selbst vergewissern wollender Blick der Seelsorge in Theologie und Kirche lässt sichtbar werden, wie wenig dieses Themenfeld dort bisher Beachtung fand. Das Phänomen Sucht als ein Zei-chen der Zeit ist im Rahmen der Theologie, insbesondere der Dogmatik, bislang kaum bearbeitet worden (Fuchs, Sellmann, Bell D’Avis 2006, 7-13). Einen Beitrag zu diesem aktuell noch ausstehenden Diskurs will diese Studie leisten und geht dazu den im Folgenden skizzierten Weg.
Eine einführende Situationsanalyse des Ortes (Kapitel I) beschreibt eine hohe Ambivalenz bei PatientInnen und TharapeutInnen im Umgang mit der Seelsorge im Hinblick auf die Themen Religion und Spiritualität. Sie stellt die Seelsorge vor die Außen-Anfrage ihrer Bedeutung für diesen Ort der Klinik, für jene Menschen, die sich dort, um zu genesen, mit dem Thema Sucht kritisch befassen. Darf, soll, kann Seelsorge dabei einen hilfreichen Beitrag leisten? Das verlangt zuerst Selbstvergewisserung der Seelsorge hinsichtlich des eigenen kirchlichen Standpunktes.
Auf dem Boden der Dokumente des II. vatikanischen Konzils lässt sich die Anfrage seitens der Seelsorge mit einem selbstvergewissernden Blick auf dessen Aussagen prinzipiell bejahen, denn es bestimmt Seelsorge als Pastoral. Sie wird topologisch gefasst. Die bedrängenden Erfahrungen, vor die Menschen heute geraten, werden als locus theologicus begriffen. Sie besitzen konstitutive Bedeutung für die Darstellung des Evangeliums in der Welt von heute und damit für die Kirche selbst. Ihre Aufgabe besteht darin, im Glauben an die Berufung des Menschen von Gott einen hilfreichen Beitrag zur Menschwerdung aller Menschen hier und heute zu leisten. Auf dem Fundament dieser Verwobenheit von Pastoral und Dogmatik als einem Kernstück der Lehre des II. Vatikanums wird Seelsorge mit suchtkranken Menschen im Kontext der Klinik als ein pastorales Projekt mit grundlegender dogmatischer Bedeutung erfasst (Kapitel II).
Die weitere Strukturierung der Arbeit erfolgt entlang der Methodologie von Pastoral: Analytik-Hermeneutik-Pragmatik.
Ab Kapitel III wird Seelsorge mit Suchtkranken als Pastoral entwickelt. Der Methodologie von Pastoral folgend wird zuerst als Grundlage ihrer Tätigkeit Sucht als Zeichen der Zeit erforscht. Dies geschieht im Rahmen qualitativer Sozialforschung unter Verwendung der Methode der Grounded Theory (GT) (10). Dabei kommt der topologische Ansatz der Studie zum Tragen. Qualitative Leitfadeninterviews mit suchtkranken Menschen zeigen im offenen Kodieren (11) Sucht als ein Macht-Ohnmacht Phänomen, das im Merkmal des Kontrollverlustes eine unsagbare Machtdynamik zeigt, eine Art anwesend abwesender Machteffekt. Man kann sie nicht greifen und Subjekten zuordnen. Wie funktioniert Sucht mit diesem Merkmal? Als leitende Forschungsperspektive zur weiteren Funktionsanalyse wird die Machtanalytik M. Foucaults ausgewählt (12). Mit seinem relational gefassten Begriff von Macht als ein Dispositiv, das Subjekte konstituiert und seinen in historischen Studien entwickelten Machttypologien, kann diese Macht-Ohnmacht Dynamik der Sucht als ein Souveränitätsdispositiv, als ein Gewaltverhältnis, erfasst werden, das in seiner diskursiven Taktik im Modus getrennt-vermischt als eine totalisierende, souveräne Subjekttechnologie Subjekte des Sterben-machens konstituiert. Das bedeutet NichtMenschwerdung - topologisch gesprochen - die unsagbare Macht der Sucht sitzt in der Utopie (13).
Um in der Analyse des Funktionierens dieses unsagbaren Machttypus diskursiv weiterzukommen, liefert Foucault das Stichwort der Sakralisierung. Die sakrale Perspektive auf das Suchtgeschehen wird im Rahmen des selektiven Kodierens (14) weiterverfolgt. Unter Erweiterung der Forschungsperspektive mit der soziologischen Theorie der Religionen von M. Riesebrodt und der Sakralsoziologie von R. Caillois wird diese unsagbare Macht der souveränen Subjektkonstituierung als eine sakrale Dimension der Sucht identifiziert und als eine Form stummer Sakralisierung souveräner Religion mit der Prozessmatrix des getrennt und vermischt kodiert. Die sakrale Dimension der Nicht-Menschwerdung wird hier als Form einer utopischen Menschenopfer-Religion in den Blick gerückt (15). In sakraler Perspektive zeigt sich der säkulare Prozess der Nicht-Menschwerdung als ein Prozess victimisierender Menschwerdung: Der Mensch fällt dem Heiligen der Sucht zum Opfer.
Damit ist ein großer Schritt in der Aufgabe des Erforschens von Sucht als Zeichen der Zeit abgeschlossen. Allerdings verlangt die Methode der Pastoral die Pluralität in den Zeichen der Zeit zu respektieren und zu unterscheiden, welche darin als Zeichen der Gegenwart Gottes zu bestimmen sind. Als Kriterium dieser Anwesenheit gilt die Menschwerdung des Menschen. Hier kommt nun die Bedeutung der Anonymen Selbsthilfebewegung am Ort der Klinik ins Spiel.
Das Zeichen von Menschwerdung im Zeichen der Sucht bezeugen die genesenden Mitglieder der Anonyme-Selbsthilfebewegung (16). Diese Gemeinschaft von Genesenden beschreibt ihren Genesungsweg als eine Spiritualität der Machtlosigkeit. In ihm verbindet sich Säkulares und Sakrales auf eine Weise, die am Ort totalen Zugriffs souveräner Sucht ein funktionierendes Widerlager darstellt. Im Horizont genannter Forschungsperspektiven zeigt sich das Funktionieren ihrer Spiritualität in gewisser Weise als Spiegeleffekt souveräner Subjekttechnologie, so wie Foucault ihn verwendet, wenn er erläutert, wie im verborgenen, virtuellen Raum hinter dem Spiegel eine wichtige Umstellung passiert, die zur Verwandlung von einer Utopie zu einer Heterotopie führt. In diesem Sinne ist ihre Spiritualität der Machtlosigkeit eine Nicht-Souveränitäts-Strategie. Auch sie lebt von einer unsagbaren Macht in ihrem Dispositiv: Die Anonymität der „Macht größer als wir selbst“, die sich am Ort des Tiefpunkts zeigt und ihn als Wendepunkt präsentiert. Es geschieht Menschwerdung am Ort der Nicht-Menschwerdung der Sucht.
Ein solches Zeichen ist im Auftrag des Konzils, die Zeichen in den Zeichen hinsichtlich ihrer potentiellen Gottesgegenwart zu unterscheiden, signifi-kant (17). Ist dieser Genesungsweg als ein Ort der Gottespräsenz zu identifizieren und damit seine Darstellung als ein Aggiornamento in der Darstellung des Evangeliums von der Erlösung, der Berufung des Menschen in Jesus Christus durch den Heiligen Geist?
Um die Belastbarkeit dieser These zu überprüfen erfolgt der nächste Schritt der Methode Pastoral: Die nicht-souveräne Spiritualität der Machtlosigkeit am Ort souveräner Sucht im Licht des Evangeliums betrachten, unterscheiden und zu einem Schluss zu kommen, ob hier Gottespräsenz identifiziert werden kann. Das ergäbe Kriterien für die Positionierung von Pastoral im Feld der Suchtbehandlung.
Zu diesem Zweck wird die eigene Tradition daraufhin befragt, wie in ihr das Funktionieren der Menschwerdung Jesu Christi überliefert ist (Kapitel IV). Drei Stichproben werden daraufhin unter Verwendung der machtanalytischen und sakralsoziologischen Kategorien untersucht: Die Berichte seiner Menschwerdung in seiner Geburt; sein Leben mit anderen am Beispiel seiner Heilungsgeschichte und sein Leiden, Sterben und Auferstehen (18). Hier zeigt sich, dass seine Menschwerdung, formal betrachtet, so funktioniert, wie Menschwerdung im A-Programm bezeugt wird: nichtsouverän. Beide können als Nicht-Souveränitätsdispositiv beschrieben werden, deren unsagbare relationale Macht in ihrer Form anwesender Abwesenheit - im Entzug – anonym - souveränitätsabstinent – in unsagbarer Weise, die Funktionsmatrix des getrennt und vermischt in ungetrennt und unvermischt verwandelt und darin das blockierte Machtverhältnis der Ge-walt, das die Sucht bedeutet, löst. Diese Lösung bedeutet christlich gesprochen die Auferweckung Jesus aus den Toten. Sie erwirkt die Erlösung des Menschen in Jesus Christus. Beide sind in diesem Geheimnis verbunden, das sie in ihrer Unterschiedlichkeit gleich werden lässt. Wie wichtig es ist, sich genau in dieser Formatierung der Nicht-Souveränität dieses Machtverhältnisses zu bewegen, um nicht in verdeckte Souveränitäten abzugleiten, demonstrieren die ersten Konzilien (19). Sie formulieren Qualitätskriterien dieses Funktionierens anhand der Hoheitstitel, die Jesus verliehen wurden. Hier zeigt sich, wie präzise die Vergabe der Titel Gottes Sohn und Menschensohn die Zuordnung von Gott und Mensch, von Sakralem und Säkularem in der Matrix des ungetrennt und unvermischt zu halten vermag, um zu verhindern, dass die Botschaft von der Erlösung des Menschen in Jesus Christus zu einem Souveränitäts-Dispositiv verkehrt werden kann, denn sie ist der Inbegriff des Widerlagers jedweder Souveränität, insbesondere ihrer Form religiöser Gewalt. Jesus Christus ist der Ort nicht-souveräner Erlösung. Im Heiligen Geist bietet er sich jedem Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort an, um geschlossene Utopien zu Heterotopien neuen Lebens zu öffnen. Diese christologische Spiritualität und jene Spiritualität der Machtlosigkeit leben beide von jener relationalen, anonymen Macht. Insofern kann Suchtkrankenpastoral auf dem Boden des chris-tologischen Bekenntnisses von Chalkedon als eine christologische Spiritualität der Machtlosigkeit und die Spiritualität der Anonymen Selbsthilfebewegung als eine Anonyme Christologie bezeichnet werden. Beide stellen ein wirksames Widerlager gegen die Gewalt der Sucht dar.
Im dritten Schritt lautet die Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach der Positionierung von Suchtkrankenpastoral im Feld stationärer Suchttherapie (Kapitel V): Suchtkranken-pastoral hat sich am Ort der Klinik, bei den Menschen die nach Ausweg-Lösungen in den Bedrängnissen ihrer Suchterkrankung suchen, heterotopisch in den dort auftretenden Differenzen zu positionieren. In diesen Heterotopoi sind neue Aufbrüche zu erwarten. Dort kann sie das finden was sie braucht, um das Evangelium für heute bedeutsam aussagen zu können und damit einen humanisierenden Beitrag in der stationären Suchttherapie anbieten zu können.
1 Die Erfahrung der Seelsorge, auf die sich die folgenden Ausführungen beziehen, betreffen den Zeitraum von 1994 bis 2014; seit 2015 arbeitet die Klinik nach einer Umstrukturierung im Unternehmen nach einem veränderten Konzept.
Kapitel I
Stationäre Suchttherapie als Ort der Seelsorge - eine Positionierung der Kirche in der Welt von heute?
Seelsorge im Krankenhaus ist für die Kirche und viele gläubige Menschen noch selbstverständlich, denn es ist allgemein bekannt, dass der Auftrag des Evangeliums das Besuchen der Kranken ausdrücklich einschließt. Für viele jener Menschen, die sich nicht mehr als christlich identifizieren und auch für viele Klinikträger, und deren Personal sind diese Selbstverständlichkeiten Vergangenheit. Der Beitrag des Vorsitzenden der Geschäftsführung/CEO des Helios-Konzerns F. de Meo in einem kurzen mündlichen Statement auf dem Abschlussplenum des 1. Ökumenischen Kongresses der Seelsorgenden im Krankenhaus und Gesundheitswesen2 hat das verdeutlicht. Er sehe, nach Rücksprache im eigenen Konzern, die Tätigkeit und den Effekt der Seelsorge im Krankenhaus hauptsächlich im Bereich der emotionalen Entlastung für Patienten und Personal als hilfreichen Beitrag. An diesem Kriterium werde seitens des Trägers die Seelsorge gemessen. Wo dieser Effekt nicht hinreichend erzielt werde, müsse man sich umschauen, wo diese Leistung anderweitig eingekauft werden könne. Die Realität zeigt, dagewesene Selbstverständlichkeiten der Präsenz von Seelsorge im bio-psycho-sozial konstruierten Gesundheitswesen gehören der Vergangenheit an. Die Gegenwart mutet einen erheblichen Überhang an ungeklärten Fragen zu. Die vorliegende Arbeit problematisiert und erörtert diese Thematik der Positionierung von Seelsorge im Krankenhaus exemplarisch im Bereich stationärer psychosomatischer Behandlung von Suchterkrankungen in der Klinik für psychosomatische Medizin in Bad Grönenbach. Die Fragen nach dem aktuellen Beitrag der Seelsorge werden konkret formulier- und auch problematisierbar, wo Seelsorge solche Orte aufsucht, an die sich, gemäß der heutigen gesellschaftlichen Ordnung der Dinge, Menschen begeben, die süchtig sind und nach Genesung suchen. Sucht wird in unserem Gesellschaftssystem als Krankheit begriffen, die es entlang bio-psycho-sozialer Therapieverfahren zu behandeln gilt. Zu den verschiedenen Intervallen dieses langen Therapieprozesses zählt in der Regel ein längerer stationärer Klinikaufenthalt3. Der empirische Gehalt der hier vorgelegten Studie gründet in den Erfahrungen des Autors als Klinikseelsorger im Rahmen der stationären Psychotherapie in der Klinik für Psychosomatische Medizin in Bad Grönenbach. Da auf dem weiten Feld der Suchtarbeit mit unterschiedlichsten Personengruppen und verschiedensten Konzepten und Zielsetzungen gearbeitet wird, ist es zunächst erforderlich, diese Klinik als ein spezifischer Ort medizinisch-therapeutischen Handelns und ihr therapeutisches Setting zu charakterisieren, um anschließend mit der Erörte-rung des benannten Problemhorizonts fortzufahren.
1Klinische Suchtbehandlung – Seelsorge an einem Ort der Therapie
Die Klinik für Psychosomatische Medizin befindet sich im ländlichen Raum am Ortsrand des kleinen Marktes Bad Grönenbach im südlichen Unterallgäu. Sie hat wie viele Kliniken in den letzten Jahren zahlreiche Veränderungen erfahren. Aktuell ist sie ein Unternehmenszweig des Helios Konzerns. Die Erfahrungen und Aussagen über die therapeutische Arbeit, auf denen diese Arbeit basiert, beziehen sich auf die Klink und ihr Konzept bis zum Jahr 2014. Ab da begann eine grundlegende Umstrukturierung des Unternehmens mit grundlegenden Veränderungen im Therapiekonzept. Heute versteht sich die Klinik als eine Einrichtung für psychosomatische Rehabilitation.4 Die folgende Klinikbeschreibung bezieht sich daher auf die Einrichtung, wie sie in den Jahren 1994-2014 gearbeitet hat. Bei vielen Veränderungen im psychotherapeutisch-medizinischen Bereich blieb in diesem Zeitraum die Grundkonzeption der Klinik stabil. In diesem Zeitraum stellte sie ca. 150 Therapieplätze zur Verfügung. Sie verstand sich als Rehabilitationsklinik und behandelte „schwerpunktmäßig Menschen mit chronifizierten Störungen, die unter Krankheitsfolgen und sozialen Beeinträchtigungen zu leiden haben“ (Klinikprospekt 2002, 4). Dabei lag neben verschiedensten anderen Indikationen ein traditioneller Schwerpunkt auf der Behandlung von suchtkranken Menschen, die nach ihrem Entzug zur stationären Psychotherapie kamen. Das von ihr entwickelte therapeutische Konzept verband „auf dem Hintergrund humanistischer Werte psychodynamische Therapie mit erlebnisaktivierenden Verfahren und störungsspezifischen Elementen der Verhaltenstherapie“ (ebd.). Es war ein psychotherapeutisches Konzept. Psychiatrische PatientInnen wurden nicht aufgenommen. Die Klinik bot auch keine Langzeittherapie für Suchtkranke. Das Setting verlangte die Fähigkeit, sich kritisch mit sich und anderen auseinandersetzen zu können. Im Vordergrund stand die Behandlung im gruppentherapeutischen Setting im Rahmen der therapeutischen Gemeinschaft. Der Gemeinschaft als Lernort für die Begegnung mit sich selber, mit anderen und mit der transzendenten Dimension wurde zentrale Bedeutung beigemessen. Mit dem Begriff des Transzendenten war neben der individuellen und der sozialen auch die dritte Säule humanistisch integrativer Psychotherapie benannt, die sich im therapeutischen Konzept niederschlug (Klingelhöfer 2001, 9-15). Ein besonderes Merkmal der Klinik stellte ihre Verbundenheit mit der 12-Schritte Tradition der Anonymen Selbsthilfebewegung dar. Sie sah sich in der Linie des so genannten Herrenalber Modells, als dessen Initiator Dr. Walter Lechler gilt (Lechler 2006, 2009). Er verband in seiner Klinik in Bad Herrenalb humanistische Psychotherapie mit dem 12-Schritte-Programm der Anonymen Selbsthilfegruppen. Die Anonyme Selbsthilfebewegung ist eine Selbsthilfegemeinschaft von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Entstanden ist sie aus den Anonymen Alkoholikern 1935 in den USA. Ihr Kernstück ihres Genesungsweges, den sie als einen spirituellen Weg begreifen, stellt das 12-Schritte Programm dar. Mit den amerikanischen Soldaten kam es nach 1945 nach Deutschland und wurde von Walter Lechler in den Rahmen seiner stationären medizinisch-psychologischer Suchttherapie in Bad Herrenalb mit einbezogen.
Diese Linie wurde von Dr. Konrad Stauss aufgegriffen und in der Klinik in Bad Grönenbach weiterentwickelt.5 „Wir arbeiten daher vom ersten Tag der Klinikbehandlung an eng mit den Selbsthilfegruppen zusammen. Ziel ist es, für eine möglichst große Zahl von Patienten diese Selbsthilfegruppen zur Ergänzung oder Alternative zur ambulanten psychotherapeutischen Weiterbehandlung werden zu lassen“ (Klinikprospekt 2002, 10). Die Anonyme Selbsthilfebewegung versteht den von ihr vertretenen Genesungsweg als einen spirituellen Weg. Damit war auch das Thema der Spiritualität im Kontext der Klinik, als einem psychotherapeutisch arbeitenden Profitunternehmen ohne jegliche religions-gemeinschaftliche Verpflichtungen, präsent. Neben diesem Referenzsystem brachte die Verwurzelung in der Tradition der humanistischen Psychotherapie noch zahlreiche andere religiöse und spirituelle Konzepte mit ins Gespräch. So repräsentierten unterschiedlichste buddhistische, schamanistische, und andere religiöse und spirituelle Konzepte und Praktiken die religiöse Pluralität in der Klinik, in der sich in gewisser Weise die Pluralisierung im Umgang mit Religion in der postmodernen Gesellschaft abbildete. Diese so genannte Rückkehr der Religion konnte also auch hier im Gesundheitswesen diagnostiziert werden (Pollack 2009). Dadurch besaß die Klinik ein eigenes charakterliches Merkmal.
Die katholische Klinikseelsorge in Bad Grönenbach fand sich also im Kontext der säkularen Einrichtung Klinik im Horizont des wissenschaftlich gültigen bio-psycho-sozialen Verständnisses von Sucht und deren Therapie, angereichert mit multiperspektivischen Religions-/Spiritualitätskonzepten aus dem Rahmen der anonymen Selbsthilfebewegung, humanistischer Psychotherapie, östlicher Religionen und der gesamten Vielfalt und Unüberschaubarkeit mehr oder weniger expliziter religiös-spiritueller Konzepte der ankommenden PatientInnen. Der Ort der Klinik repräsentierte die postmoderne, pluralisierte Gesellschaft mit ihren religiösen Renaissancen. Hier kommen über dieses ganz konkrete und praktische Scharnier Rückkehr der Religion in Form des spirituellen Genesungsweges der Selbsthilfebewegung gesellschaftliche Gruppen und Themen miteinander in Berührung, die sich sonst eher äußerlich zugeordnet hatten: professionelles Krankenhaus mit nicht-professioneller Selbsthilfebewegung, Medizin mit Religion und Spiritualität, Klinik mit der Seelsorge und Kirche, Seelsorge mit 12-Schritte Spiritualität und pluraler Religions-/ Spiritualitäts-Rückkehr. Die Not der Menschen und das Sich-Einlassen auf diese verschiedenen Bedürfnisse und Wege, die in der Suche nach Genesung darin auftauchen, lassen am Ort der Klinik ein Feld verschiedenster Außenbegegnungen entstehen.
Was bedeutete das für die Seelsorge? Wie gestaltet sie von sich aus diese Beziehungen. Hat sie eigene Standpunkte? Kann sie mit diesen dort bestehen? Manch kirchlichen Vertreter beseelte das zunächst mit einer euphorischen Hoffnung, auch die Seelsorge könne wieder zurückkehren, sie könne hier im Rahmen der Suchtarbeit von diesem religiösen Treibhausklima profitieren, auf diesem Markt selbstbewusst ihr Produkt präsentieren, einen konstruktiven Beitrag in der Suchttherapie leisten, damit selbst in neuer Frische ihre Bedeutung für die Gesellschaft zurückgewinnen und dafür von dieser auch Akzeptanz und Anerkennung erfahren. Doch eine solch utopische Erwartung übersah die Ambivalenzen der konkreten Situation vor Ort. Sich so an den Ort stationärer Suchttherapie zu begeben bedeutete nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Seelsorge keine triumphale Rückkehr ins Leben. Sie bewirkte zunächst Ernüchterung.
Was kennzeichnete diese ernüchternde Ortsbegehung? Die konkreten historischen Erfahrungen der Seelsorge im Begehen des Ortes der Klinik ab dem Jahr 1994, werden im Folgenden im Sinne einer Analyse dieser Begegnung im Hinblick auf die These von der Rückkehr der Religion und ihre Bedeutung für die Seelsorge entfaltet.
2Die „Rückkehr der Religion“ am Ort der Klinik: Die Macht in der Differenz von Spiritualität und Religion
2.1Das klinische Setting stationärer Psychosomatik, Spiritualität und Seelsorge – Außenbegegnungen provozieren Innenüberschreitungen
Die Klinik für Psychosomatik und die Seelsorge sind sich gegenseitig fremde Orte. Stationäre Psychotherapie und Seelsorge stehen nach den damaligen und gegenwärtigen Rahmenbedingungen in keinem selbstverständlichen Zusammenhang. In der Psychosomatik wird nach bio-psycho- sozialem Paradigma therapiert. Religion und Glaube sind hier Randphänomene. Seelsorge steht als Dienst der Kirche im Horizont des Evangeliums. Sie hat keinen Versorgungsauftrag im gesellschaftlichen Gesundheitswesen. Beide Disziplinen besitzen so gut wie keine gemeinsame Berufstradition am Ort der Klinik. Hier nun kamen sie über die ihnen beiden als ein Außen ihrer selbst begegnende die Selbsthilfebewegung in Kontakt. Beweggründe, sie auf diese Abenteuer einzulassen, gab es auf beiden Seiten, aber auch gehörige Widerstände.
Motivationslage der Klinik
Auf Seiten der Klinik sind markante Erfahrungen des Gründers und damaligen Chefarztes mit der Bedeutung der Anonymen Selbsthilfegruppen im Rahmen der Suchtbehandlung maßgeblich. Dr. Stauss hatte als Arzt die Erfahrung gemacht, dass es in der Behandlung suchtkranker Menschen möglich war, „sie körperlich zu entgiften und durch den Entzug zu begleiten, aber es war kaum möglich, sie zu einer lebenslangen Abstinenz von dem Suchtmittel zu motivieren, obwohl diese Patienten wussten, welche verheerenden Folgen eine weitere Einnahme der Suchtmittel für ihre körperliche und psychosoziale Existenz hatte” (Stauss 1994, 185). Viele verloren auf diesem Weg ihr Leben. Wegweisend für ihn und das Konzept der Klinik wurde die Begegnung mit einem ehemaligen Patienten, der von seiner Genesung mit Hilfe des spirituellen Programms der Anonymen Selbsthilfegruppen berichtete und die Erfahrungen mit vielen genesenden Suchtkranken in den Folgejahren seines Engagements in der Anonymen Selbsthilfebewegung und dem ,Herrenalber Modell’ von Walter Lechler. Die Entdeckung, dass inmitten der Ohnmacht der Alkoholsucht in der Praxis des spirituellen Selbsthilfe-Programms die Sucht gestoppt werden konnte, eröffnete neue Handlungsperspektiven und zugleich Fragestellungen. „Da das 12-Schritte Programm seine Wurzeln in der christlichen Tradition hat, erschien es mir notwendig, die Genesungs- und Heilungserfahrungen, die wir über 16 Jahre in der Klinik gemacht haben, auf dem Hintergrund der christlichen Tradition zu verstehen. So entstand eine Dia log suche, erst mit den hier am Ort ansässigen Gemeindepfarrern“ (Stauss 1994, 187). Die Bewegung der Begegnung zwischen Kirche und Klinik kommt also von außen. Sie kommt am Ort der Klinik vom Außen ihrer selbst: Aus dem nicht-professionellen Milieu der Selbsthilfe. Sie kommt am Ort der gesellschaftlich professionell gültigen bio-psycho-sozialen Krankheits- und Gesund heits-ordnung von deren Außen, nämlich aus dem Bereich der dort verschwiegenen und für unbedeutend gehaltenen Sphäre der Spiritualität. Die Genesungserfahrungen der PatientInnen und deren Beschreibung als ‘spiritueller Weg‘ überschreitet gewissermaßen sowohl das Format der bio- psycho-sozialen Krankheits- und Gesundheitslehre (also des säkularen Dogmas), als auch deren bio-psycho-sozialer Praxis, die den Ort, der Klinik formatiert. Diese Überschreitung des Ortes der Therapie durch dieses Außen greift schließlich in der Anfrage der Klinik auch auf die Kirche zu.
Motivationslage der Seelsorge
Die Kirche wird vom Außen ihrer selbst auf die säkulare Bedeutung des von ihr zu verkündenden Evangeliums hin angefragt. Sie muss entscheiden, ob sie diesen fremden Ort ihrerseits als bedeutsamen Ort der Darstellung des Glaubens, der Rede von Gott identifiziert und in ihn investiert. Die Kirche findet sich in der Situation vor zwei Problemen: Sie weiß um den evangelischen Auftrag an sie, die Kranken zu besuchen, ist aber in der gegenwärtigen Realität an ihrem Ort nicht präsent. Hier besteht offensichtlicher Handlungsbedarf. Sie weiß, dass sich die Umsetzung dieses Auftrags gerade im Feld stationärer Psychosomatik aufgrund gegenseitiger Ressentiments äußerst prekär gestaltet. Die Anfrage der Klinik erscheint daher als eine echte Chance, hier einen Schritt weiter zu kommen. Doch genau da eröffnet sich ein zweites Problem. Die Außenanfrage eröffnet neue Handlungsmöglichkeiten, den Glauben am fremden Ort zur Sprache bringen zu können. Doch die Klinikanfrage ist nicht auf die klassische Seelsorge gerichtet, die den kirchlichen Sinn des Evangeliums plausibilisiert, sondern nach dessen säkularer Bedeutung im Angesicht der Sucht. Die Anfrage von außen durch die PatientInnen über die Klinik an die Kirche, überschreitet gewissermaßen den Ort der klassischen Seelsorge. Das bedeutet kirchliches Neuland. Die PatientInnen markieren einen Ort, der bislang weder von der Klinik mit ihrer Therapie, noch von der klassischen Seelsorge betreten werden konnte. Beide hatten jeweils den anderen Teil ausgeschlossen. Die Realität der PatientInnen verwies aber auf die Existenz dieses Ortes und auf die Notwendigkeit, ihn in im Angesicht der Not der Suchtkrankheit mit in das Behandlungsspektrum aufzunehmen. Diese Problemlage ist typisch für die Gesellschaft am Ende der Moderne. Für die sakrale Bedeutung solch säkularer Orte, steht seitens der Kirche noch keine Tradition in der Darstellung des Glaubens zur Verfügung. In diesem Sinn ist Rückkehr von Religion kein Zurück zu Bekanntem, sondern ein Wagnis des Aufbruchs in ein neues Land. Es stellt sich die Frage, ob die Seelsorge diese Herausforderung neuer Ortsbegehung annehmen soll, will und überhaupt kann.
Das Bistum Augsburg entschied sich für diesen Aufbruch. Mit der Errichtung einer Seelsorgestelle in der Klinik erkannte sie die Autorität dieses Ortes für die Gottesrede an und identifizierte sich mit ihm. Diese Entscheidung eröffnete ein, von allen Beteiligten zunächst weitgehend in seiner Komplexität und Schwierigkeit unterschätztes Begegnungsfeld. In der Begegnung wurden gravierende Differenzen freigelegt, die auf den ersten Blick die Richtigkeit dieses Projektes stark in Zweifel geraten ließen. Auf den zweiten Blick jedoch schien sich darin eine zukunftsweisende, konstruktive Perspektive für alle Beteiligten zu entwickeln.
2.2Die Differenz von Religion und Spiritualität
In vielfältigem Sinn konkretisiert sich am Ort der Begegnung, sowohl im Hinblick auf die Klinik als auch auf die Seelsorge, die Rückkehr der Religion.
Das bedeutet Konsequenzen für die Klinik: Mit dem Ankommen der Seelsorge in der Klinik zeigte sich sehr schnell eine grundlegende Differenz in der Betrachtung in Sachen Religion und Spiritualität. Wie bereits oben erwähnt, beginnt diese Begegnung in einem gesellschaftlichen Großwetter- klima sich pluralisierender religiös-spiritueller Bewegungen der 80er und 90er Jahre. Die Zeit philosophisch und politisch motivierter Religions- und Kirchenkritik war einer erstaunlich pragmatisch orientierten Experimentierfreudigkeit in Sachen Spiritualität und Religion gewichen. Die Globalisierung brachte reichhaltige Begegnungsmöglichkeiten mit fremden, vornehmlich östlich geprägten Religionen, die Esoterikwelle erzeugte unüberschaubare Mutationen psycho-spirituell-religiöser Angebote auf dem Markt und der kontrollierende Zugriff der kirchlichen Milieus verblasste in rasantem Tempo. Im Bereich der Psychotherapie pflegte insbesondere die Richtung der Humanistischen Psychotherapie die Nähe zu diesem optimistischen Aufbruch, während z.B. die klassische Psychoanalyse weitgehend ihrer kritischen Religionsabstinenz die Treue hielt.
Für die Klinik bedeutete dies hinsichtlich ihres Verhältnisses zu Religion einerseits die Anwesenheit eines, eher im Hintergrund befindlichen, kritischen Potentials im Sinne der Religionskritik, markiert durch den Begriff der ekklesiogenen Neurose. Andererseits bedeutete es ein eher im Vordergrund stehendes innovatives Potential, markiert durch den Begriff der Spiritualität. Motiviert durch die positiven Erfahrungen, z.B. mit dem 12- Schritte Programm der Anonymen-Gruppen, erhält Spiritualität als eine Art positiver Transzendenzbezug eine Bedeutung für die Suchttherapie. Spiritualität wird als Genesungsfaktor primär mit nicht religionsgemeinschaftlich gebundenen Gruppierungen, wie eben beispielsweise der A-Bewegung in Verbindung gesetzt. Seelsorge dagegen wird in ihrer Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft der Kirche als Religion identifiziert. Die Ankunft der Seelsorge in der Klinik ruft daher zunächst nicht wie vermutet das mögliche Potential gegenseitiger Bereicherung auf, sondern im Gegenteil das religionskritische Potential. Mit der Seelsorge kehrt Religion im Sinne notwendiger Nicht-Verdunkelung ihrer Gefährlichkeit in die Klinik zurück. Das initialisiert sich an der Kombination von nun realer Anwesenheit der Seelsorge im therapeutischen Milieu mit den in der therapeutischen Arbeit immer wieder offenbar werdenden Anteilen an religiös/kirchlich erfahrenen Verletzungen in den Biografien der PatientInnen. Seelsorge wird zur konkreten Repräsentanz des mit und in Religion und Kirche real erlebten, aus der Geschichte bekannten und vermuteten Gewaltpotentials von Religion. Mit der Seelsorge kehrt die Unausweichlichkeit vor der Ambivalenz von Religion zurück. Die Auseinandersetzung mit Religion unter der Perspektive ihres Gewaltpotentials war möglicherweise am Ende der Moderne, unter dem Rückgang des kirchlichen Einflusses und der optimistischen Auffassung von Spiritualität bestimmter Therapieszenen, in den Hintergrund getreten. Nun stand sie wieder im Raum. Diesmal noch prekärer als vorher, denn beides besaß gleiche Autorität: das Wissen um die Gewalt von Religion und das Wissen um das heilende Potential von Spiritualität. Keines durfte durch das jeweils andere ausgespielt werden und in der Seelsorge verkörperte sich beides. Die Kirche als Religionsgemeinschaft und zugleich als Quelle heilender Spiritualität; eigentlich eine Unmöglichkeit. Glaubte man therapeutischerseits in der Folge religionskritischer Auseinandersetzung religiöse Gewalt durch den Ausschluss von Kirche und die Tabuisierung von Religion bannen zu können, blockierte nun die Autorität der Genesungserfahrungen der PatientInnen mit dem A-Programm und deren offensichtlich vorhandene, aber noch nicht präzise benennbare Verbindung mit dem christlichen Glauben, diesen Mechanismus. Das erzeugte eine prekäre Lage, in der Orientierungsmuster mit entsprechenden Identifikationen wie: Religion ist prinzipiell gewaltförmig und gefährlich, dazu gehört auch die Kirche; Spiritualität ist eine hilfreiche, weil von religiöser Gewalt und Kirchlichkeit gereinigte Form des Transzendenzbezugs, nicht mehr hinreichende Reichweiten aufwiesen. Es entstand ein Ort ohnmächtiger Sprachlosigkeit.
Das ist für bedeutsam für die Seelsorge: Die Entscheidung der Kirche, sich an den Ort der Klinik zu begeben, verlieh auch ihr Anteil an der Rückkehr der Religion. Der konkrete Ort entlarvte die idealistische Hoffnung, über das Aufkommen der Spiritualitätsbewegung und das angefragt werden von der Klinik, auf schnellem Wege verloren gegangene Autorität auf fremdem Terrain wieder zurück gewinnen zu können, als Utopie und führte zu gründlicher Ernüchterung. Der Kirche kehrt hier Religion am Ende der Moderne zunächst über die Opfer zurück, die die Religion in ihrer Gewalttätigkeit selbst erzeugt und zurückgelassen hatte. In der Anfrage der Klinik an die Kirche, kehren die Früchte dieser Religion zur Kirche zurück. Ihre eigene Ausschließung des Diskurses über ihr Gewaltpotential, hatte zu ihrer Ausschließung von jenen Orten geführt, an denen diese Verletzungen offengelegt werden konnten und mussten: die Psychotherapie. Ist sie nun in der Lage und entschlossen, diesen Ort zu betreten, kann und darf sie der Konfrontation mit der Gewalttätigkeit von Religion, deren Tatsächlichkeit in den Zeugnissen der Opfer Autorität besitzt, nicht mehr ausweichen. Darin liegt die erste Zumutung der Ernüchterung. Der Strudel der Renaissance von Religion spült die Kirche nicht in den Strom vielfältigster Neugier, bejahender Interessen und wohlwollender Willkommensgrüße und subsumiert Seelsorge problemlos unter der positiv konnotierten Kategorie der Spiritualität, sondern konfrontiert sie mit dem Sog ihres Gewaltpotentials. Sie konfrontiert den Glauben mit seiner Religionsförmigkeit, die Seelsorge mit der Problematik religiös-manipulativen Zugriffs auf Menschen. Mit diesem kritischen Gehalt bleibt der Ort der Begegnung aber trotz allem heterogen. Er erschöpft sich nicht darin. Er steht zugleich auch im Zeichen der Initialzündung dieser Begegnung, mit der Autorität, die den Zeugnissen jener Menschen innewohnt, die Spiritualität als Ressource ihres Genesungsweges bekennen und zwecks weiterer Orientierung auf diesem Weg die Kirche nach ihrem Beitrag befragen. Wie kann hier von Gott gesprochen werden, so dass beide Wahrheiten gewürdigt werden? Das ist mit der bisherigen Sprache der Kirche nicht zu machen. Das verlangt ein verändertes Sprechen der Kirche von Gott vor Ort. Dieses Sprechen kann nur im aufmerksamen Wahrnehmen der ambivalenten Atmosphäre und deren Inhalte gründen. Daher sollen als Nächstes die Befürchtungen und die Hoffnungen, so wie sie von den PatientInnen und Teilen des therapeutischen Teams gegenüber der Seelsorge geäußert wurden, präzisiert dargestellt werden.
2.2.1Die Ambivalenz in der Begegnung von PatientInnen und Seelsorge – die Hoffnung auf spirituelle Macht und die Angst vor religiöser Gewalt
Die meisten PatientInnen bezeichnen sich selbst längst nicht mehr als kirchlich. Einige verwenden noch die christliche Terminologie, aber viele sprechen von sich selbst als Menschen, die zu Religion Abstand halten, weil sie ihren Zugriff fürchten. Für andere ist Religion schlichtweg uninteressant, eben gar kein lebensrelevantes Thema, ein Anachronismus, eine Art Luxuswelt oder ein Zeichen von Lebensschwäche im Sinne traditioneller Religionskritik. Wer wirklich im Leben steht, braucht doch so etwas gar nicht. Wieder andere positionieren sich im Zwischenbereich dieser Standpunkte. Sie bezeichnen sich nicht als religiös, sondern als spirituell. Der Begriff der Spiritualität markiert hier die Möglichkeit einer weltanschaulichen Verortung zwischen den Gegensatzpolen von gläubig und ungläubig, von theistisch und atheistisch. Es ist ein Ort der eher als non-theistisch zu beschreiben ist. ,Gott’, ,Jesus Christus’, oder ,Heiliger Geist‘ als zentrale Begriffe christlicher Tradition kommen in der Darstellung eigener Religiosität kaum vor und wenn, dann in einer irgendwie singulären Verstehensweise, losgelöst von der Deutungshoheit kirchlicher Tradition. Man bekennt sich nicht zu Gott, ist deswegen aber nicht ungläubig. An diesem Ort ist man eben spirituell Die positive Ortsbestimmung dieser Spiritualität bleibt inhaltlich und begrifflich weitgehend unspezifiziert, bzw. in Form zeitgenössischer Multivarianz, aber ihre negative Ortsbestimmung ist signifikant: Spiritualität gilt als nicht-dogmatisch, eher non-theistisch, nicht- religionsgemeinschaňlich, und schon gar nicht kirchlich. Insbesondere die katholische Kirche ist bei vielen mit negativem Ressentiment belegt. Sie gilt als entfremdende, übergriffige Institution – im populären Sprachegebrauch eben als dogmatisch, gemeint ist dogmatistisch. Sie wird als Institut der Macht wahrgenommen, das unter Absehung, Verdächtigung und Entwertung subjektiver Erfahrung und Eigenständigkeit der Einzelnen von außen das Leben der Menschen bestimmt, orientiert und moralisch bewertet. Sie erscheint intolerant, autoritär, totalitär und fern der eigenen Lebensfragen. Da wo die Kirche spricht, verstummt das Individuum. Also gilt die Kirche vielen nicht als kompetente Ansprechstation, sondern als Religion der Macht. Sie steht im Ruf, im Namen Gottes Zugriffsrechte auf den Menschen zur Geltung zu bringen.
Einige Beispiele sollen das konkretisieren.
Glaube und Religion in der Herkunftsfamilie
Viele suchtkranke Menschen stammen aus Familien, in denen Elternteile schon suchtkrank waren und die Sucht das Familienleben dominiert hat. Oft besitzt das Doppelleben der Familie auch eine kirchliche Komponente. Am Sonntag schön brav in die Kirche gehen, da ist nach Außen alles in Ordnung. Kaum ist man zu Hause, geht der übliche Wahnsinn mit Trinken, Brüllen und Prügeln wieder los. Wie konnte der Vater/die Mutter so etwas tun? Wieso hat Gott meine Gebete nicht erhört? Warum hat keiner etwas gemerkt? Oft entsteht dann in der Pubertät ein Abbruch dieser Glaubensform und in der Therapie stellt sich die Frage, ob es sich lohnt, da noch einmal einen Anfang zu probieren und wenn ja, wie?
Gewalt von kirchlichen Mitarbeitern
Menschen, die in ihrer Biografie gravierende Übergriffe von kirchlichen Mitarbeitern erlebten wie z.B. sexueller Missbrauch von Pfarrern an Mädchen oder körperliche Gewalt an Kindern in kirchlichen Internaten und Ordenshäusern. Diese Menschen wurden dadurch in ihrem Glauben völlig irritiert, können nicht mehr in die Kirche gehen, bzw. an kirchlichen Feiern teilnehmen können und überhaupt an der Vertrauenswürdigkeit der Kirche und ihrer Botschaft zweifeln. Das Terrain ihres kirchlichen Erlebens ist wie verbrannte Erde.
Religiöse Gewalt von Eltern/Erziehungsberechtigten
Menschen, die in ihrer Kinder- und Jugendzeit in fundamentalistisch orientierten Familien oder religiösen Gemeinschaften sehr rigide erzogen wurden, die Gottesrede als pädagogische Keule erlebten und unter diesem religiösen Abhängigkeitssystem selbst eine Abhängigkeitserkrankung entwickelten. In vielen Fällen spielt hier die Frage nach der Sünde, der Scham und dem Ausschluss aus der Gemeinschaft, also der religiösen Sanktionierung eine wichtige Rolle.
Die Abwendung von Religion erscheint als Protest und Schutz gegen real erlebte Gewalt und unterlassene Hilfeleistung. Spiritualität reklamiert ein Recht auf eigenständige Gestaltung eines Transzendenzbezuges jenseits der Ordnung einer Religionsgemeinschaft mit ihrer Theorie und Praxis. Die Kirche mit ihrem Glauben spielt daher bei Suchtkranken als kompetente Dialogpartnerin in der Auseinandersetzung um den eigenen Genesungsweg in der Regel eine geringe Rolle.6 Wird sie von den Betroffenen doch eher als eine Art Abhängigkeitssystem erlebt, das mehr Parallelen als Alternativen zur Suchtstruktur des eigenen Lebens darstellt. Jenen möchte man doch gerade entkommen, wieso sollte man sich dann zu dieser hinwenden? Hier kann also in keiner Weise von einer Rückkehr der Religion in einem traditionell kirchlichen Sinne einer Rückgewinnung ehemaliger Macht und Autorität unter den Menschen die Rede sein. Sie begegnet in erster Linie der Rückseite dieses triumphalen Habitus, nämlich ihrer Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit unter den von Sucht bedrängten Menschen. Das stellt der Seelsorge die Gretchenfrage: Wie hältst du’s mit der Religion? Wenn Religion annähernd das ist, als was sie von den PatientInnen erlebt und bezeichnet wird, und wenn Seelsorge das Einklagen und Durchsetzen der Autorität dieser Religion als wahrer Glaube unter den Menschen gilt, dann muss jenen Recht gegeben werden, die mit allergrößter Deutlichkeit vor der Seelsorge im Kontext stationärer Suchttherapie warnen. Sie käme wie der Wolf zu den sieben Geislein, als guter Hirt betitelt, doch in Realität als ein Wolf im Schafspelz.
In der Begegnung von PatientInnen und Seelsorge überkreuzen und verschränken sich aber auch zugleich die Perspektiven religiöser Gewalt und Spiritualität. Patienten, die die Anregung, sich mit der Bedeutung von Spiritualität als Ressource ihrer Genesung zu befassen, ernst nehmen, stehen vor der Frage der Orientierung auf diesem Gebiet. Hier steht in der Tradition der Klinik als erstes Referenzsystem das 12-Schritte Programm zur Disposition. Daneben können auch noch die anderen meist unspezifischen spirituellen Konstrukte auf mögliche Anschlussfähigkeit angefragt und erprobt werden. Auf dieser Ebene gewinnt dann auch das Gesprächsangebot der Seelsorge Interesse. Die dort angesprochene Themenpalette besitzt ein reichhaltiges Spektrum. Auch hierzu einige Konkretisierungen:
Spiritualität: etwas Fremdes im eigenen Leben
„Ich hab‘ schon so lang getrunken und gekifft. Ich schaff’s nicht allein damit aufzuhören. Hier sagt man mir, ich solle irgendwie einen Zugang zu etwas Spirituellem suchen, zu einer höheren Macht. Das sei wichtig für die Genesung. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ich habe so was in meinem Leben bisher nicht gehabt. Sie sind doch von der Kirche. Was meinen sie dazu?”
Diffuse Relikte christlicher Vorstellung von Religiosität/Spiritualität
„Mit der Spiritualität, das scheint mir wichtig, ist mir aber fremd. Ich habe noch einige Erinnerungen an meinen Kinderglauben, aber den habe ich schon lang hinter mir gelassen>, so nach dem Motto Alter Mann mit weißem Bart da oben und so … Das einfach wieder aufzunehmen, kann’s ja auch nicht sein. Außerdem mit Kirche hab ich’s nicht, vieles, was sie macht, finde ich nicht in Ordnung. Aber was soll ich tun?”
Andere Bezüge zu Spiritualität: buddhistisch, esoterisch, etc.
„Ich glaube ja an was Höheres, an positive Energie im Universum, dass alles mit allem verbunden ist und dass mein Leben einen Sinn hat und geführt ist. Aber das ist nicht unbedingt christlich, dazu brauche ich auch keine Kirche. Das kann ich doch überall erleben, und wie man das nennt, ist doch auch egal. Ich nenn’s am liebsten Kraft oder Energie, oder Liebe oder höheres Selbst. Aber in der Sucht, wenn’s mir schlecht geht, da ist das alles wie weggeblasen. Da hilft mir das, was ich sonst so schön erlebe, gar nicht. Da, wo ich es dringend brauchte, habe ich keinen Zugang zu dieser Kraft. Wie kann sich das ändern?”
12-Schritte Spiritualität
Viele PatientInnen gehören der A-Bewegung an oder beginnen sich mit ihr zu befassen, Sie formulieren ihren Glauben entlang dieser Tradition und sprechen hier von der Erfahrung einer höheren Macht, die sie suchen, indem sie sich an den 12 Schritten orientieren und in die A-Gruppen gehen. Auch sie suchen Unterstützung, ihren Weg zu finden und besser zu verstehen. “Wie ist das mit der höheren Macht gemeint? Über das ,...Gott, wie wir ihn verstehen,...’7, stolpere ich jedes Mal, das bringe ich kaum über die Lippen. Das weckt so viele Widerstände Für einige scheint das ein absolutes Hindernis für den Einstieg ins A- Programm, den sie aber gern vollziehen möchten. Sie wollen ihre Irritation besser verstehen und diese Blockaden überwinden.
Glaube an Gott
Einige kirchlich sozialisierte Patienten sagen: „Ich glaube ja an Gott und bete auch, und doch hilft mir das nicht. Solange es mir gut geht, fühle ich mich getragen, aber in der Sucht hilft das alles nichts. Manchmal denke ich, Gott will mir gar nicht helfen.“ Andere sagen: „Manchmal frage ich mich, ob ich da für etwas bestraft werde! Mach ich da was falsch oder was muss ich denn noch tun?“ Der Glaube erscheint wie ein Sahnehäubchen für gute Zeiten, und in der Begegnung mit der das eigene Leben bedrohenden Gewalt als zahnloser Tiger oder gar als Macht, die noch tiefer in den Abgrund hineintreibt.8
In diesen Beispielen zeigt sich die bereits oben angesprochene Verschiebung des Fragehorizontes an die Seelsorge. Die in der Rückkehr der Religion





























