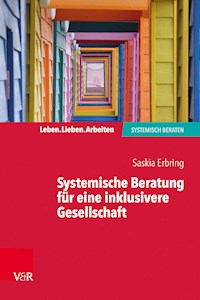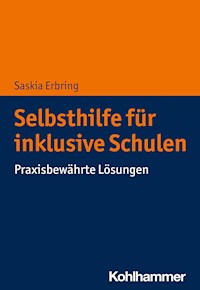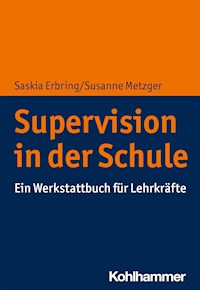
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Inklusion, heterogene Lerngruppen, digitaler Unterricht - die Ansprüche an Schulen wachsen. Damit wächst auch der Bedarf an Supervision als wirkungsvoller Reflexion beruflicher Tätigkeit. Das Buch zeigt - nah am Schulalltag -, was Supervision will, was sie leistet und auf welchen Grundlagen sie beruht. Vorgestellt werden Einzel-, Gruppen- und Teamsupervision, Supervision im gesamten Kollegium, Schulleitungssupervision, kollegiale Supervision und Selbstsupervision - alle Supervisionsformen illustriert anhand zahlreicher Fallbeispiele. Dabei hat das Buch durchweg die Ziele systemischer Supervision im Blick: Verbesserung der Kommunikation, Erweiterung professioneller Kompetenzen, persönliche Entlastung und eine höhere Zufriedenheit mit dem eigenen beruflichen Handeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorinnen
Dr. Saskia Erbring ist Professorin für Beratung an der Fachhochschule Erfurt und arbeitet freiberuflich als Supervisorin M. A. (DGSv). Sie berät Schulleitungen und Steuergruppen zu Schulentwicklungsthemen und veranstaltet schulinterne Fortbildungen zu Inklusion und Lehrer*innengesundheit. Ausgebildet als Lehrerin für Sonderpädagogik sowie als Lehrerin in Sekundarstufen arbeitete sie ursprünglich an einer Kölner Gesamtschule. Als Autorin publiziert sie Artikel und Bücher zum Thema Inklusion und Schulentwicklung aus unterschiedlichen Fachperspektiven.
Susanne Metzger ist Supervisorin M. A. (DGSv) und arbeitet in eigener Praxis in Bonn. Nach dem Studium der Germanistik und Theologie sammelte sie langjährige Erfahrung als Gymnasial- und Beratungslehrerin in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen und an der Europäischen Schule in Brüssel. Sie leitet schulinterne Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Kollegiale Fallberatung und Peer Counselling und coacht Lehrkräfte aller Schulformen im Rahmen von Einzel-, Gruppen- und Teamsupervision.
Saskia Erbring, Susanne Metzger
Supervision in der Schule
Ein Werkstattbuch für Lehrkräfte
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-036889-7
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-036890-3
epub: ISBN 978-3-17-036891-0
Inhalt
1 Supervision im schulischen Kontext
1.1 Vorüberlegungen zum Buch
1.2 Systemische Supervision – eine kurze Einführung
1.3 Wirksamkeit von Supervision im schulischen Kontext
2 Einzelsupervision
2.1 Einzelsupervision mit Lehrkräften oder: »Meine Schwäche wird meine Stärke.«
2.2 Theoriebezug: Kontextualisierung und Reframing
3 Gruppensupervision
3.1 Gruppensupervision mit Lehrkräften oder: »Perspektivwechsel mit Hüftschwung«
3.2 Theoriebezug: Zirkularität und Autopoiese
4 Supervision im Ausbildungskontext
4.1 Supervision mit Studierenden oder: »Ich wusste schon immer, dass ich was in Richtung Pädagogik machen werde. Nun studiere ich auf Lehramt.«
4.2 Theoriebezug: Berufsbiografische Aspekte in der Supervision mit angehenden Lehrkräften
5 Leitungssupervision
5.1 Supervision mit Schulleitungen oder: »Was sollen wir denn noch alles machen! Irgendwann ist mal genug!«
5.2 Theoriebezug: Gesundheitsressourcen in der Supervision
6 Teamsupervision
6.1 Teamsupervision mit Lehrkräften einer Fachkonferenz oder: »Aus der Sackgasse in den Adlerhorst«
6.2 Theoriebezug: Die Beobachtung zweiter Ordnung in der Supervision
7 Supervision in Großgruppen
7.1 Supervision mit einem Kollegium oder: »Gemeinsam aus der Problemtrance«
7.2 Theoriebezug: Selbstorganisation
8 Supervision ohne Supervisor*in
8.1 Kollegiale Supervision in der Schule oder: »Im Raubtierkäfig«
8.2 Theoriebezug: Lernen und Beraten nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen
9 Selbstsupervision
9.1 Externalisierung und Visualisierung oder: »Die innere Chairperson aktivieren«
9.2 Theoriebezug: Professionalisierung im schulischen Kontext
10 Zur Ethik systemischer Supervision oder: »Was machen wir hier eigentlich wie und wozu?«
11 Glossar: Verzeichnis systemischer Begriffe
Literatur
1
Supervision im schulischen Kontext
1.1 Vorüberlegungen zum Buch
Der Bedarf an Supervision in beruflichen Zusammenhängen wächst stetig, denn sich verändernde Arbeitsfelder und komplexe Arbeitsbedingungen erfordern ein hohes Maß an Selbstreflexion. Supervision bietet hierfür ein über Jahrzehnte entwickeltes und erprobtes Setting mit einem spezifischen Repertoire an Methoden und Techniken. Wir wollen anhand von Beispielen einen Einblick vermitteln, wie Supervision im Kontext des Arbeitsfeldes »Schule« stattfinden kann. Dabei ist es uns wichtig, neben praxisnahen Einblicken in die Supervision auch einen Bezug zu den theoretischen Grundlagen systemischer Supervision herzustellen.
Unter Supervision versteht man die Beratung von Berufstätigen zu Fragen und Problemen, die aus ihrer beruflichen Arbeit erwachsen. Supervision hat die Aufgabe, die Kommunikation und Beziehungsgestaltung im beruflichen Kontext zu reflektieren und zu verbessern. Schon die Vorläufer von Supervision in der Mitte des letzten Jahrhunderts, sogenannte Balint-Gruppen für Ärzt*innen, hatten die Interaktion zwischen Professionellen und ihren Klient*innen im Blick: Die Ärzt*innen thematisierten Fragen und Fälle aus ihrer Berufspraxis und fanden im Rahmen der Balintgruppen einen Raum zur Selbstreflexion und Klärung ihrer Anliegen (Lubau-Plozza, 1984). In ähnlicher Weise wurde von Berufstätigen in der Sozialen Arbeit früh der Bedarf an professioneller Beratung angemeldet und in Deutschland seit 1962 als »Praxisberatung« in die Ausbildungsgänge integriert (Möller, 2015, S. 96).
Wie in der Medizin und der sozialen Arbeit befassen sich auch Lehrkräfte in der Schule täglich mit Menschen, mit denen sie als Einzelne oder in Gruppen auf vielfältige Weise interagieren. Da der Fokus in der Schule aber zunächst auf Wissensvermittlung liegt, schien lange eine Beratung von Lehrkräften nur hinsichtlich fachmethodischer und -didaktischer Kompetenzen erforderlich. Erst in jüngerer Zeit rücken die pädagogischen Anforderungen bei der Wissensvermittlung und bei den vielen Aufgaben darüber hinaus drängender in den Blick. So wird deutlich, dass sich eine Reflexion schulischer Arbeit nicht nur auf die Wissensvermittlung in Schulstunden beziehen sollte, sondern auf alle Interaktionen innerhalb und außerhalb der Schulstunden, einschließlich der Kommunikation mit Kolleg*innen, Schulleitung, Eltern und Behörden.
Mit diesem Buch wollen wir Chancen und Möglichkeiten von Supervision im Kontext von Schule darstellen. Dabei machen wir deutlich, wie Supervision dazu beitragen kann, vorhandene Ressourcen zur Bewältigung der herausfordernden schulischen Aufgaben zu nutzen und die Gesundheit der Lehrkräfte zu erhalten. Wir zeigen außerdem, wo und wie Supervision in der Schule stattfinden kann, auf welchem Fundament sie sich bewegt und welche Veränderungen sie ermöglicht. Sie schafft – wie der Blick aus dem »Adlerhorst« – eine hilfreiche Distanz und ermöglicht so eine neue und gelassene Sicht auf den »Raubtierkäfig« Schule ( Kap. 6, Kap. 8).
Dabei konzentrieren wir uns auf sogenannte → systemische Supervisionskonzepte, die sich in verschiedenen Beratungskontexten bewährt haben und die für schulische Beratungsangebote besonders geeignet erscheinen (Hubrig, 2007). Auch in ärztlichen und therapeutischen Berufen wird vielfach systemisch gearbeitet. So ist seit 2008 Systemische Therapie als wissenschaftliches Verfahren anerkannt, nachdem zuvor in Studien die Wirksamkeit systemischer Interventionen nachgewiesen werden konnte (Sydow/Beher/Retzlaff/Schweitzer-Rother, 2006). Systemische Beratungskonzepte sehen den Menschen einerseits als Teil sozialer Systeme, andererseits als eigenes in sich geschlossenes System, das aber selbst Ressourcen und Kompetenzen zur Bewältigung beruflicher und persönlicher Probleme mitbringt ( Kap. 1.2).
Zentrale Ankerpunkte systemischer Beratung sind → Multiperspektivität und → Zirkularität. Sowohl Multiperspektivität als auch zirkuläres Denken sind hier aber nicht nur Thema, sondern auch Leitlinie unserer eigenen Ausführungen. Multiperspektivisch – mit Beispielen aus unterschiedlichen Settings und Schulformen, mit unterschiedlichen Protagonist*innen und Zielvorgaben – wird hier betrachtet, wie Supervision in der Schule gestaltet werden kann. Dabei beziehen wir unsere Ausführungen auch auf Ausbildungskontexte und Schulleitungen. Darüber hinaus spannen wir einen weiten Bogen von Selbstsupervision über Einzelsupervision, Gruppen- und Teamsupervision bis zur Supervision in Großgruppen und wollen so Interesse wecken für die Vielzahl der Supervisionsmöglichkeiten in Schulen. Zirkulär ist unser Vorgehen, da wir kein umfassendes Fundament für die systemische Supervision darlegen, sondern, geleitet durch praktische Supervisionsbeispiele, einzelne jeweils passende Aspekte systemischer Begründung erläutern. Theorie und Praxis sollen sich so wechselseitig ergänzen und erklären. Zirkulär ist unser Vorgehen auch, weil die Leser*innen durch die Lektüre des Buches neue Ideen für sich entwickeln können in die Zukunft von Schule hinein, die sie gestalten werden.
Das erste Kapitel zeigt die spezifische Situation der Supervision im schulischen Kontext, ihre systemische Richtung und ihre Wirkungsweise. In den Kapiteln 2 bis 9 werden Beispiele aus der Praxis präsentiert, die jeweils ein anderes Format von Supervision zum Thema haben. Mit der Berücksichtigung von Einzel-, Gruppen-, Team- und Selbstsupervision soll deutlich werden, auf welch vielfältige Weise Supervision in Schule stattfinden kann.
Jedes dieser Kapitel besteht aus einem ersten Teil, der aus der Praxis berichtet, während der zweite Teil einen Theoriebezug herstellt. Praxis- und Theorieteil korrespondieren inhaltlich und stellen zumindest punktuelle Bezüge her. So sollen die Grundlagen systemischer Beratung deutlich werden, die Voraussetzungen und Ziele, aber auch das Menschenbild, welches den konkreten Interventionen zugrunde liegt.
Unser Ziel ist es, ein Kaleidoskop supervisorischer Aktivitäten in der Schule zu zeigen, das einlädt, mit dem Werkzeug der Supervision Schule professionell(er) zu gestalten.
In den Fallbeispielen berichten wir von Beispielen aus unserer Supervisionserfahrung. Diese Fallschilderungen wurden soweit verfremdet, dass die Anonymität der Supervisand*innen und die Vertraulichkeit gewahrt bleiben.
Am Ende des Buches haben wir ein Glossar systemischer Begriffe zusammengestellt, das einen vertiefenden Zugang zum theoretischen Hintergrund systemischer Supervision ermöglichen soll. Die dort verzeichneten Begriffe sind im Text durch einen Pfeil markiert.
1.2 Systemische Supervision – eine kurze Einführung
Reflexion im Sinne des Nachdenkens und Sprechens über schulische Prozesse und Themen findet selbstverständlich auch ohne Supervision statt – in Pausen, auf Konferenzen und bei Tür-und-Angel-Gesprächen sowie zuhause, mit Partner*innen oder im Freundeskreis. Was also bietet → systemische Supervision über diese bekannten Gesprächsformate hinaus?
Ein Austausch über ungelöste berufliche Fragen und Belastungen findet an Schulen häufig mit einer deutlichen Problemorientierung statt. Dies lässt sich leicht beobachten, beispielweise während der Pausenzeiten im Lehrer*innenzimmer. Allzu oft bleiben die angesprochenen → Probleme ungelöst, nicht selten verstärken sie sich sogar, wenn auch die Gesprächspartner*innen keinen Lösungsansatz finden. Nicht ohne Grund leiden übermäßig viele Lehrkräfte an Burnouterscheinungen und finden keinen Ausweg mehr aus dem Überlastungserleben.
Supervision bietet die Möglichkeit, fokussiert und mit dem Paradigma der → Lösungsorientierung an Fragestellungen heranzugehen. Supervision und verwandte Formate berufsbezogener Beratung wie Kollegiale Fallberatung oder Coaching stehen daher schon seit einigen Jahren im Interessensfokus von Forschung und Praxis der Lehrer*innenbildung. Supervision ist aus dieser Sicht eine »Lernumgebung« für Erwachsene (Erbring, 2009) und bietet spezifische Methoden, Techniken, Materialien und Medien, welche zur aktiven Auseinandersetzung mit einer für sie persönlich relevanten Fragestellung anregt. Die Reflexionsangebote der Supervision bringen zum Vorschein, wo und wie in der Schule mit Freude und Erfolg gearbeitet wird, wo noch Entwicklungsbedarf besteht und wie Fragen und Probleme in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern wie Unterricht oder Schulleitung gelöst und bewältigt werden können, im Einzelfall, in Gruppen oder im gesamten Kollegium.
Als organisatorische Parameter der Supervision kommen unterschiedliche Supervisionsformate infrage: Einzelsupervision, Gruppensupervision oder Teamsupervision sowie Supervision in Großgruppen (z. B. Kollegien). Außerdem lässt sich Supervision im Hinblick auf unterschiedliche Statusgruppen organisieren, z. B. als Leitungssupervision oder im Ausbildungskontext. Und schließlich gibt es neben Supervision unter professioneller Leitung, was der Regelfall ist, auch noch Supervisionsformen, wo sich Supervisand*innen gegenseitig oder selbst supervidieren ( Kap. 8.1 und Kap. 9.1).
Über den sogenannten → Kontrakt regeln die Beteiligten den äußeren und inhaltlichen Rahmen der Zusammenarbeit (Berker, 1999, S. 79 f.). Der Kontrakt beinhaltet auch eine Schweigeverpflichtung, die innerhalb der Gruppe einschließlich der Supervisor*innen eingegangen wird. Die Schweigeverpflichtung trägt zu einem verbindlichen Rahmen bei, der es ermöglicht, dass auch persönlich bedeutsame Fragen angesprochen werden.
Neben der Reflexion von als problematisch erlebten Situationen wird in systemischer Beratung besonderer Wert auf die Umsetzung neuer Erfahrungen und die Einübung neuer Verhaltens- und Kommunikationsweisen gelegt. Mit der Reflexion entsteht demnach die Möglichkeit, eine Außenperspektive auf ein Problem einzunehmen und somit aus gewohnten Interpretationen und Handlungsmustern herauszutreten. Sobald die Kommunikationsmuster im Problemsystem erkannt wurden, lassen sie sich auch verändern. Ein wichtiger Grundsatz systemischer Beratung lautet deshalb: Nicht das → Problem ist zu verändern, sondern die Kommunikation (Schlippe/Schweitzer, 2003, S. 90).
In → systemischer Supervision wird davon ausgegangen, dass Beschreibungen, Kommunikationen und Verhaltensweisen die Konstruktion von Problemen bedingen und damit Möglichkeitsräume eingeschränkt werden. Mithilfe einer fragenden und forschenden Grundhaltung und dem Fokus auf den Lösungsraum treten die jenseits vom Problem liegenden Lösungen in den Blick (Schlippe/Schweitzer, 2003, S. 35 ff.). Der → »ethische Imperativ« von Foerster bringt diese Forderung in einen Satz: Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Denn nur wer frei ist und auch anders agieren könnte, kann verantwortlich handeln (Foerster/Pörksen, 1999, S. 25).
Zielführend für systemische Supervision ist es daher, den Blick auf einen größeren Kontext frei zu machen und simple Ursache-Wirkungs-Zuschreibungen zu vermeiden. »Systemisch« ist somit weniger ein Kanon von Werkzeugen, sondern die systemische Perspektive (Schlippe/Schweitzer, 2003, S. 31 ff.). Supervisionskonzepte gelten demnach als mehr oder weniger systemisch, je deutlicher dies gelingt (Kleve, 2011, S. 47). Folgende systemische Grundannahmen sind dabei richtungsweisend und deshalb auch die Basis für systemisches Arbeiten in der Supervision (Schlippe/Schweitzer, 2003, S. 179):
Jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den Kontext kennt.
Jedes Verhalten hat eine sinnvolle Bedeutung für die Kohärenz des Gesamtsystems.
Es gibt keine vom Kontext losgelösten Eigenschaften einer Person.
Es gibt nur Fähigkeiten. Probleme ergeben sich manchmal daraus, dass Kontext und Fähigkeit nicht optimal zueinander passen.
Jeder scheinbare Nachteil in einem Teil des Systems zeigt sich an anderer Stelle als möglicher Vorteil.
Die Fragen in folgender Tabelle können dabei nützlich sein.
Tab. 1.2.1: Fragenkatalog zum systemischen Arbeiten in der Supervision
Dabei lässt sich eine professionelle Beziehungsgestaltung als tragendes Element des Supervisionssettings (→ Systemische Supervision) verstehen (Schlippe/Schweitzer, 2017):
Einerseits bietet Supervision einen verlässlichen Rahmen und sorgt in der Prozessgestaltung für Stabilität und Sicherheit. Dazu gehören zunächst ein empathischer Kontaktaufbau (→ Joining), Wertschätzung und Ressourcenorientierung. Die Supervisand*innen werden mit ihren vorhandenen Kompetenzen gesehen, was auch das Vertrauen in deren Fähigkeiten zur Lösung des eigenen Problems miteinschließt. Für eine sichere Basis sorgt außerdem ein klarer äußerer Rahmen in Form eines → Kontrakts, der regelmäßig überprüft und angepasst werden kann. Hilfreich ist zudem eine transparente Gesprächsführung mit ausreichend Gesprächsanteilen für die Supervisand*innen.
Andererseits erzeugt Supervision Instabilität und Fluktuationsverstärkung. Innerhalb des sicheren Rahmens wird ein Spannungsbogen von Interesse, Neugier und Irritation ermöglicht. So können → zirkuläres oder hypothetisches Fragen, überraschende Kommentare und → Reframing die Dekonstruktion bisheriger Sicherheiten einleiten. Vorübergehende, produktive Unsicherheit kann auch dort entstehen, wo Unterschiede verdeutlicht werden, wo versteckte Themen angesprochen und wo gegensätzliche Ansichten und Tabus ausgesprochen werden.
Auf der Basis eines verlässlichen Rahmens sorgt die*der Supervisor*in also für wichtige Interaktionen, für Stabilität und Instabilität in einem angemessenen Verhältnis. Diese Steuerung geschieht einmal auf der Mikroebene des Prozesses durch Blicke, Lächeln, Bestätigen oder Infragestellen. Zum anderen auch auf einer übergeordneten Ebene, indem die Supervisorin Kontrakte schließt, Aufträge klärt, Angebote formuliert, das Thema erweitert oder neue Bezüge herstellt. Im Rahmen einer konstruktiven Beratungsbeziehung sind Irritation und Perturbation durch den*die Supervisor*in allerdings ethisch nur vertretbar, wenn sie auf dem Fundament einer stabilen Beziehung eingesetzt werden (Schlippe/Schweitzer, 2010). Grundsätzlich ist die Beziehungsgestaltung zwischen Supervisor*in und Supervisand*in in der Einzelsupervision besonders wichtig, weil dort der Fokus auf nur einem Gegenüber liegt. Mittelbar wirkt sie aber auch in der Gruppen- und Teamsupervision.
1.3 Wirksamkeit von Supervision im schulischen Kontext
Der Beitrag von Supervision zur Professionalisierung von Lehrpersonen wurde im deutschsprachigen Raum erstmals umfassend von Denner (2000) untersucht. Sie zeigt in ihrer repräsentativen Untersuchung, dass schulinterne Gruppenberatung einen Beitrag zur individuellen, kollegialen und institutionellen Professionalisierung innerhalb der beruflichen Tätigkeit von Lehrkräften leistet. Zudem gehen von der Teilnahme an Supervision in den untersuchten Szenarien innovative Impulse zur Veränderung und Weiterentwicklung von Unterricht und Schule aus. Denner stellt eine Perspektiverweiterung der teilnehmenden Lehrpersonen im Hinblick auf deren selbstreflexive Fähigkeiten fest, die über das Supervisionssetting hinausreicht (ebd., S. 353 ff.). Diese Erweiterung der Perspektiven deutet darauf hin, dass Supervision für Lehrkräfte den »Möglichkeitsraum« vergrößert – Lehrkräfte fühlen sich weniger auf eine einzige Sichtweise auf die Problematik festgelegt. Stattdessen können sie mithilfe der Supervision die Fähigkeit erwerben, in Lösungsfindungsprozessen multiple Perspektiven einzubeziehen. Dies trägt letztlich auch zu einer höheren Zufriedenheit bei.
Anknüpfend an diese Untersuchungsergebnisse wurde in den Arbeiten von Erbring (2007; 2009) der Beitrag von Supervision zur Professionalisierung von Lehrkräften an der Ausprägung kommunikativer Professionalität gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrkräfte ihr Kommunikationsverhalten im Supervisionssetting innerhalb dieses Zeitraumes signifikant veränderten.
Pädagogisch professionelle Kommunikation wurde im Kategorienschema mit der Ausbalancierung von Selbstverantwortungsanteilen konzeptualisiert. Professionelle Kommunikation beruht demnach auf einer selbstverantwortlichen Haltung und ist durch die Vermeidung von fehlplatzierter Verantwortungsabgabe oder Überverantwortlichkeit geprägt. Hinweise hierauf enthält der Ansatz von Clark (1995), der die Kommunikation von Lehrpersonen sowohl als geeigneten Ansatzpunkt zur Förderung der professionellen Entwicklung von Lehrpersonen als auch zur Erforschung pädagogischer Professionalität herausarbeitet. Im englischen Originaltext bezeichnet Clark diese Fähigkeit als »thoughtful teaching« (ebd., S. 31). Evident wird pädagogische Professionalität in der Beziehungsgestaltung, genauer gesagt in der angemessenen Ausbalancierung von Selbstverantwortungsanteilen der Beteiligten. Kommunikative Professionalität wird somit zum Indikator für pädagogische Professionalität.
Clark stellt fest, dass hinsichtlich der Fähigkeit professionell zu kommunizieren bei Lehrpersonen Entwicklungspotentiale bestehen. Kommunikationsprozesse im Unterricht weisen demnach häufig ungünstige Manifestationen auf, die von ihm auf langjährig etablierte kommunikative Gewohnheiten der Lehrpersonen zurückgeführt werden. So haben sich bei vielen Lehrpersonen aufgrund mangelnder Erfahrung symmetrischer Arbeitsbeziehungen in der eigenen Lernbiografie unproduktive Lernhaltungen ausgeprägt. Die Etablierung symmetrischer Lehr-Lern-Beziehungen im Hinblick auf die Beziehungsebene der Kommunikation ist dadurch für viele Lehrpersonen erschwert.
Pädagogische Professionalität lässt sich, dem Ansatz folgend, im Sinne einer hohen Sensibilität der Lehrperson gegenüber den Situations- und Kontextfaktoren konzeptualisieren. Ansatzpunkt der professionellen Entwicklung sieht Clark im Hinterfragen und Reflektieren von Kommunikationsprozessen. Die in der Kommunikation konkretisierten Haltungen lassen sich in Gesprächen mit anderen Lehrpersonen über Erfahrungen und Probleme des beruflichen Alltags reflektieren. Indem Lehrpersonen sich in kleinen Gruppen über Dilemmata und Fragen des Berufsalltags austauschen, entsteht nach Clarks Auffassung der Mut, neue Handlungspraktiken zu lernen und zu erproben. Eigene Ziele und Bedürfnisse lassen sich somit in den bewussten Erfahrungshorizont einholen, gewohnte Wege und Erklärungen hinterfragen und gegebenenfalls modifizieren. Um die erforderlichen Entwicklungen anzustoßen und zu begleiten, befürwortet Clark konkret Beratungs- und Supervisionssettings.
In der Untersuchung von Erbring (2007; 2009) wurde eine Supervisionsgruppe über 15 Supervisionssitzungen hinweg wissenschaftlich begleitet. Die Supervisionen dauerten jeweils 120 Minuten und folgten einem gleichbleibenden Ablaufschema:
Ablaufschema einer Supervision
Phase 1 Anfangsrunde mit persönlicher Befindlichkeit
Phase 2 Rückmeldung zu Themen der letzten Sitzung
Phase 3 Themensammlung zur aktuellen Sitzung
Optional Festlegung von Reihenfolge und Zeitrahmen für die einzelnen Themen
Phase 4 Bearbeitung der Einzelthemen
Phase 5 Abschlussrunde zur Sitzung
Die Sitzungen innerhalb des Zeitraumes (eines Jahres) wurden videodokumentiert, transkribiert und diskursanalytisch ausgewertet. Sowohl die Inhalts- als auch die Beziehungsebene der Kommunikation wurde im Kategorienschema berücksichtigt. Für die Analyse wurde die in jeder Sitzung obligatorische Phase der Themensammlung (Phase 3) ausgewählt, um Veränderungen der Kommunikation in der Gruppe zu verfolgen. Diese Phase kann als Kern jeder Supervisionssitzung angesehen werden, die hohe Anforderungen an die Beteiligten stellt: In dieser Phase soll das eigene Thema bzw. die eigenen Themen kurz vorgestellt werden, wobei die eigene Sichtweise auf das Problem explizit gemacht werden soll. Die anderen Beteiligten haben die Aufgabe ihr Verständnis des Themas zu sichern. Anders als in den anderen Phasen der Supervision findet hier kein Methodeneinsatz statt (z. B. Rollenspiele), sodass eine weitgehend authentische Gesprächssituation vorliegt.
Inhaltsanalytisch betrachtet wurden während der Phase der Themensammlung von den 12 Lehrkräften im Jahresverlauf 83 Themen eingebracht, hauptsächlich zur pädagogischen Arbeit und zu schulorganisatorischen Aspekten. Außerdem wurden von den teilnehmenden Lehrpersonen häufig Themen zur Teamarbeit und zur Zusammenarbeit in der Supervisionsgruppe angesprochen. Die Themen sind im Jahresverlauf gleichmäßig verteilt.
In der Auswertung der Beziehungsebene zeigen die Ergebnisse der Studie, dass die summierten Anteile der Kategorien professioneller Kommunikation im Jahresverlauf deutlich zunehmen, während sich die Anteile der Kategorien habitueller Kommunikation verringern. Der Anteil der Kategorien habitueller Kommunikation beträgt in der ersten Sitzung 72 % und in der 15. Sitzung nur noch 16 %, während die Kategorien professioneller Kommunikation von 9 % in der ersten Sitzung auf 68 % in der letzten Sitzung zunehmen.
Die Veränderungen des Kommunikationsverhaltens lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass die beteiligten Lehrkräfte sowohl ihr instruktionsbezogenes als auch ihr konstruktionsbezogenes Kommunikationsverhalten professionalisieren konnten (instruktionsbezogen: von manipulativen Einflussnahmen zur Sachinformation; konstruktionsbezogen: von eingreifendem Helfen zur Verständnissicherung).
2
Einzelsupervision
2.1 Einzelsupervision mit Lehrkräften oder: »Meine Schwäche wird meine Stärke.«
Einzelsupervision ist im Ablauf und im Hinblick auf die Rolle der Supervisor*innen von Gruppen- oder Teamsupervision zu unterscheiden. Auch die Beziehung zwischen Supervisand*in und Supervisor*in ist unterschiedlich ausgeprägt. So haben in einem Zweiersetting Sprechen und Handeln von Supervisor*innen größeres Gewicht als in einer Gruppen- oder Teamkonstellation, wo die Gruppe zusätzlicher Ideengeber oder kritisches Korrektiv sein kann. Vor allem aber fehlt in der Einzelsupervision die Gruppe als eigenständige, vielseitige Beziehungsgröße und Beratungsressource.