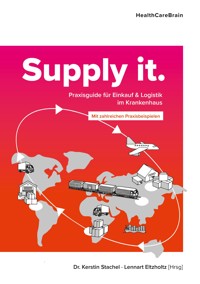
Supply it E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Praxisnah & verständlich: Fachwissen kompakt für den erfolgreichen Einkauf im Gesundheitswesen. Top-aktuelle Inhalte: Von Digitalisierung bis Nachhaltigkeit: Die Zukunft der Krankenhauslogistik. Erfahrungswissen aus erster Hand: Expert*nnen mit über 20 Jahren Praxis teilen ihr Know-how. Von erfahrenen Praktiker*nnen entwickelt, vermittelt dieses Buch einfach und verständlich umfangreiches Fachwissen und hilfreiche Softskills: Für Ihren erfolgreichen Einstieg in das Supply Chain Management in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Erfahren Sie das Wichtigste über Krankenhausfinanzierung, Vergaberecht, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Compliance und die Medical Device Regulation. Nutzen Sie den Einblick in unsere praxiserprobten Verhandlungsstrategien und die dazugehörige Führungsphilosophie. Von Medizinprodukten, Arzneimitteln bis hin zu Strom und Labormaterial - hier finden Sie umfassende Informationen zu allen Bereichen der Beschaffungslogistik im Klinikalltag. Bleiben Sie am Puls der Zeit und entdecken Sie, wie Nachhaltigkeit, New Work und Künstliche Intelligenz den Einkauf und die Logistik revolutionieren können. Profitieren Sie von 20 Jahren Erfahrung unserer Expert*nnen und heben Sie Ihre Fähigkeiten auf ein neues Level! Mit nützlichen Checklisten und weiterem Bonusmaterial, die auf der Internet-Plattform HealthCareBrain.eu immer auf dem neuesten Stand sind. mit Beiträgen von: Dr. Christian Bichler, Stefan Bode, Thomas Couturier, Thomas Dierkes, Jan Edel, Dr. Tjarko Geelvink, Christopher Glogger, Clemens Graf von Wedel, Ingo Gurcke, Dagmar Hozová, Valentin Klumb, Dr. Florian Immekus, Dr. Clemens Jüttner, Johannes Müer, Justine Neumann, Josefine van den Oever, Alexander Pfahlbusch, Mathias Schönfeld, Martin Schumm, Eva Stichler, Niels Törkel, Fiona Walter, Dr. Stefan Waßmann
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Herausgeberteam
Dr. Kerstin Stachel
Lennart Eltzholtz
c/o Block Services
Sana Einkauf & Logistik GmbH
Stuttgarter Str. 106
Oskar-Messter-Straße 24
70736 Fellbach
85737 Ismaning
Autorenverzeichnis
Dr. Christian Bichler
Sana Kliniken AG
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Stefan Bode
Sana Einkauf & Logistik GmbH
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Thomas Couturier
UBCouturier GmbH
Amtsgerichtsstraße 25 D-35423 Lich
Thomas Dierkes
Sanimed GmbH
Friedenstraße 26 49477 Ibbenbüren
Jan Edel
Sana Einkauf & Logistik GmbH
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Lennart Eltzholtz
Sana Einkauf & Logistik GmbH
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Dr. Tjarko Geelvink
Ameos Klinikum Eutin
Hospitalstraße 22 23701 Eutin
Christopher Glogger
Sana Einkauf & Logistik GmbH
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Clemens Graf von Wedel
EnPortal GmbH
Moordiek 1 23820 Pronstorf
Ingo Gurcke
Marsh Medical Consulting GmbH
Bismarckstraße 2 32756 Detmold
Dagmar Hozová
Sana Kliniken AG
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Valentin Klumb
Ebner Stolz Partnerschaft mbB
Joseph-Schumpeter-Allee 25 53227 Bonn
Dr. Florian Immekus
Mühlenkreiskliniken AöR
Hans-Nolte-Straße 1 32429 Minden
Dr. Clemens Jüttner
Sana Kliniken AG
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Johannes Müer
Sana Einkauf & Logistik GmbH
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Justine Neumann
EnPortal GmbH
Moordiek 1 23820 Pronstorf
Josefine van den Oever
Universitätsklinikum Magdeburg AöR
Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg
Alexander Pfahlbusch
BKO-Unternehmensberatung
Siebengebirgsstr. 8 53639 Königswinter
Mathias Schönfeld
Sana Einkauf & Logistik GmbH
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Martin Schumm
Ebner Stolz Partnerschaft mbB
Joseph-Schumpeter-Allee 25 53227 Bonn
Kerstin Stachel
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106 70736 Fellbach
Eva Stichler
Marsh Medical Consulting GmbH
Bismarckstraße 2 32756 Detmold
Niels Törkel
BKO-Unternehmensberatung
Siebengebirgsstr. 8 53639 Königswinter
Fiona Walter
Sana Einkauf & Logistik GmbH
Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning
Dr. Stefan Waßmann
Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Leipziger Str. 44 39120 Magdeburg
Vorwort
Wir (Dr. Kerstin Stachel und Lennart Eltzholtz) haben uns am Universitätsklinikum Bonn kennengelernt und gemeinsam einen professionellen Einkauf aufgebaut. Der Weg war steinig und herausfordernd, aber jeder Tag hat uns Freude gemacht. Lennart Eltzholtz ist nun Geschäftsführer bei Sana Einkauf & Logistik und Kerstin Stachel war zuletzt kaufmännische Direktorin am Universitätsklinikum Magdeburg.
Wir sind Einkaufs- und Logistikfans, weil:
es Querschnittsaufgaben sind, bei denen wir all unsere Talente einsetzen können.
weil wir mit allen Abläufen und Menschen in einem Krankenhaus in Berührung kommen.
weil wir im ständigen Dialog mit spannenden Persönlichkeiten sind.
weil Logistiker und Einkäufer Unternehmer im eigenen Unternehmen sein dürfen (müssen).
Ein guter Einkäufer muss ein Alleskönner sein: Er liebt Daten, ist ein harter Verhandler, ein leidenschaftlicher Personalentwickler, er liebt die Umsetzung von Gesetzen und ist ein exzellenter Projektmanager.
Ein guter Logistiker ist ein Zauberkünstler, dem es gelingt, komplexe Prozesse so zu gestalten, dass es für alle anderen wirkt, als würden sich die Dinge von selbst erledigen.
Solche Personen gibt es nicht? Eher selten, das stimmt! Aber: Man kann vieles lernen. Mit diesem Buch teilen wir unser Wissen und unsere Praxiserfahrung. Wir haben erfahrene Experten mit ins Boot geholt, die ebenso leidenschaftlich wie wir im Gesundheitswesen arbeiten und besondere Fachkenntnisse in Spezialbereichen haben. Gemeinsam mit unseren Experten schreiben wir über Themen wie zum Beispiel Labor- oder Stromeinkauf zu denen es bislang – nach unserem Wissen – noch keine praxisorientierten Publikationen gibt.
Das Buch
Unkompliziert. Empathisch. Spannend. Das ist HealthCareBrain.
Das Buch ist ein Buch von Praktikern für Praktiker. Wir wollen keine Zeit mit komplizierten Texten und umständlichen wissenschaftlichen Ausführungen verlieren. Wir wollen, dass ihr schnell den Zugang zu komplexen Themen findet. Zumindest so gut, dass ihr mit Experten das Beste für euer Unternehmen rausholt. Wir erlauben es uns, euch zu duzen, denn wir sitzen alle im gleichen Boot und wir möchten euch das Wissen persönlich und nahbar vermitteln. Parallel zu diesem Buch geht die Internetplattform HealthCareBrain an den Start. Hier bekommt ihr begleitende Informationen zum Buch wie beispielsweise Checklisten und Vorlagen.
Das Buch ist in insgesamt acht Bereiche unterteilt. Mit Querverweisen und einem umfangreichen Stichwortverzeichnis machen wir euch das Auffinden von Informationen so einfach wie möglich. Ihr könnt also von Anfang bis zum Ende lesen, quer einsteigen, euer Wissen in einem Spezialbereich vertiefen oder schnell nachschlagen, wenn ihr eine konkrete Frage habt.
Bereich 1: Das Basiswissen für den Einstieg ins Gesundheitswesen
Das Buch beginnt mit einem Einstieg in die Welt des Einkaufs und des Gesundheitswesens und vermittelt ein Verständnis für die komplexen und wahrlich komplizierten gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Sprache der Medizin. Wenn ihr schon seit einigen Jahren im Gesundheitswesen seid, dann könnt ihr den größten Teil dieses Bereichs überspringen, als Nachschlagewerk nutzen und euren jungen Mitarbeitern und Quereinsteigern bei der Einarbeitung an die Hand geben. Bitte schaut euch unbedingt die zehn Bausteine zum Aufbau eines professionellen Einkaufs an. Ihr erfahrt nicht nur in aller Kürze, wie wir die Themen angehen, sondern unsere Pyramide ist euer Navigationssystem durch das Buch.
Bereich 2: Was müssen Einkäufer und Logistiker können?
In diesem Bereich geht es um die Kompetenzen, die Einkäufer und Logistiker mitbringen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Wir glauben, dass die Fähigkeit ein guter Moderator und Verhandler zu sein, erfolgsentscheidend ist. Wir geben dir einen Einblick in die relevanten Theorien und wir erläutern dir wie wir moderieren und verhandeln. Und „Last but not least“ widmen wir uns den Zukunftsthemen New Work und Nachhaltigkeit. Dabei geht es uns nicht darum, Modethemen abzuarbeiten, sondern tatsächlich praxisnah zu überlegen, wie diese Konzepte im Krankenhaus umgesetzt werden können, denn eins ist klar: Diese Konzepte können und müssen in Krankenhäusern umgesetzt werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mitarbeiter, Patienten und die Bürger erwarten dies zu Recht, aber: Es ist ein langer und steiniger Weg. Wir gehen mit euch die ersten Schritte und helfen euch hoffentlich dabei, zumindest die einfachen Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
Bereich 3: Die sechs Kernaufgaben des strategischen Einkaufs
Wir erläutern dir praxisnah die sechs Kernaufgaben des strategischen Einkaufs von der Beschaffungsmarktanalyse bis hin zum Einkaufscontrolling. Je länger du schon im Einkauf bist, desto mehr kannst du überspringen. Lesenswert für Profis, die unsere Vorträge noch nicht gehört haben, sind der Beitrag zur Investitionsplanung, unsere Praxistipps zum Umgang mit Lieferengpässen und die Einblicke in die Praxisprojekte Orthopädie und Herzzentrum.
Bereich 4: Finanzierungsinstrumente und Einkaufsgemeinschaften
Warum packen wir Finanzierungsinstrumente und Einkaufsgemeinschaften in einen Bereich? Gute Frage! Und ja, perfekt ist die Kombination wahrscheinlich nicht. Aber erst mal zweckmäßig. Beide Themenbereiche zeichnen sich dadurch aus, dass sie euch entweder sehr intensiv beschäftigen oder gar nicht. Wenn ihr in einem Konzern arbeitet, dann habt ihr vermutlich eine Konzernstrategie und das Thema Einkaufsgemeinschaften beschäftigt euch nicht. Ebenso ist es mit dem Thema Finanzierung: In manchen Krankenhäusern macht die Finanzabteilung klare Vorgaben in anderen ist die Kreativität des Einkaufs und der Lieferanten gefragt.
In Kapitel 1 haben wir die wichtigsten alternativen Finanzierungsinstrumente für euch zusammengefasst. Im Kapitel 2 erfahrt ihr, welche Faktoren die Liquidität beeinflussen und wie ihr zu mehr Liquidität beitragen könnt. In Kapitel 3 dreht sich alles um Einkaufsgemeinschaften und wir zeigen euch, wie ihr den maximalen Erfolg aus der Zusammenarbeit für euer Krankenhaus generieren könnt.
Bereich 5: Logistik im Krankenhaus
Im Bereich Logistik erklären wir zunächst die Grundlagen der Stationsversorgung und der Lagerhaltung. Immer mehr Krankenhäuser entscheiden sich für eine Versorgung durch externe Dienstleister. Wir haben zusammengestellt, worauf es bei einer Zentralisierung der Logistik zu achten gilt und welche Vor- und Nachteile eine externe Logistik hat.
Euer Alltag in Einkauf und Logistik ist mittlerweile durch Lieferengpässe geprägt. Irgendetwas fehlt immer. Entscheidend ist damit, wie es euch gelingt, Strategien zu entwickeln, um mit diesen Situationen umzugehen. Im Kapitel – „Nicht lieferfähig. Irgendetwas fehlt immer“ – teilen wir unser Wissen, wie man praxisnahe Strategien zur Sicherstellung der Versorgung entwickeln kann.
Bereich 6: Digitalisierung
Die Überschrift spricht für sich! Ohne Digitalisierung geht es nicht, aber worauf gilt es zu achten, wenn man eine vollständige Digitalisierung erreichen will? Wir haben für euch die Grundlagen einfach erklärt: z. B. Wie funktioniert ein Barcode? Wie erreiche ich eine hohe Stammdatenqualität? Die Lektüre von Bereich 6 ist für jeden ein Muss, der sich in Einkauf und Logistik im Krankenhaus einarbeiten möchte. Für Profis eignet sich der Anfang dieses Bereichs als Nachschlagewerk. Am Ende wagen wir einen Blick in die Zukunft und stellen aktuelle Trends und Entwicklungen vor. Klar ist: Künstliche Intelligenz, Big Data, Blockchain, NFTs und das Metaverse werden irgendwann den Krankenhauseinkauf erreichen. Wir haben uns Gedanken gemacht, was das bedeuten könnte und welche Einsatzmöglichkeiten es für diese Technologien bereits heute gibt und in Zukunft geben wird.
Bereich 7: Spezialbereiche
Gemeinsam mit Experten geben wir einen Einblick in die Beschaffung von Arzneimitteln, Energie, Lebensmittel, Dienstleistungen, Labormaterialien, Versicherungen und wir zeigen, wie man einen Baueinkauf organisiert. Für viele von euch sind dies wahrscheinlich Themen, mit denen ihr im Alltag nicht oder nur am Rande konfrontiert werdet, aber spätestens als Einkaufsleiter oder Mitglied der Unternehmensleitung müsst ihr euch Gedanken machen, wie ihr den Einkauf in diesen Spezialbereichen organisiert, denn wie immer: Ihr könnt eine Menge Geld verlieren oder gewinnen. Hinzukommt: Unterliegt euer Krankenhaus dem Vergaberecht, gibt es in diesen Bereichen besonders viele Besonderheiten zu beachten. Wir geben euch Tipps, wie ihr die Einhaltung des Vergaberechts und eine wirtschaftliche Beschaffung in Einklang bringt.
Bereich 8: Recht und Compliance
Niemand kommt um diese Themen drum herum und manchmal wird man von den Regularien geradezu erdrückt – insbesondere, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet, dass dem Vergaberecht unterliegt, aber je besser ihr informiert seid, desto einfacher wird es. Also seht die Einhaltung von Gesetzen als sportliche Herausforderung. Wir erläutern die Grundlagen und geben Tipps zur praxisnahen Umsetzung. Ihr erfahrt außerdem wie ihr Korruption vorbeugen könnt. Eine Strafanzeige und damit eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft kann jeden treffen, ihr findet eine Checkliste, die euch im Fall der Fälle hilft einen kühlen Kopf zu wahren.
Und noch ein Hinweis: Selbstverständlich respektieren wir die individuelle Geschlechtsidentität jedes Menschen. Zur besseren Lesbarkeit haben wir bei Personenbezeichnungen überwiegend die männliche Form genutzt. Die männliche Form gilt in allen Fällen, in denen dies nicht explizit ausgeschlossen wird, für alle Geschlechter. Wenn wir die weibliche Form verwenden, gilt dasselbe.
Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre!
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann nutzt das Kontaktformular auf HealthCareBrain oder schreibt an [email protected].
Wir freuen uns auf euer Feedback.
Herzlichst
Kerstin und Lennart
Thomas Lemke CEO Sana Kliniken AG und DKG-Vizepräsident
„Wir brauchen grundlegende Reformen und eine integrative Gesundheitspolitik. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Herausforderungen für alle Krankenhäuser riesig werden. An erster Stelle steht die Gewinnung und Bindung von exzellenten Fachkräften in allen Bereichen. Einkauf und Logistik als zentrale Schnittstellenfunktion im Krankenhaus muss hohe Komplexität beherrschen und Prozesse interdisziplinär managen. Durch zunehmenden Kostendruck und globale Lieferketten wird die Bedeutung von Einkauf und Logistik weiter wachsen. Einkauf & Logistik brauchen innovative Konzepte, nachhaltige Netzwerke, Internationalität und neue Formen der Arbeitsorganisation, um zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“
Laura Wamprecht Managing Director bei Flying Health
„Der Durchbruch bei künstlicher Intelligenz wird das Gesundheitswesen am stärksten verändern: KI-Tools wie ChatGPT & Co. werden in der Diagnose, Therapieentscheidung und Vorhersage von Rückfällen oder Komplikationen eine zentrale Rolle spielen.“
Jonah Grütters, Dualer Student Healthcare Management und Vorstandsbeauftragter für Externes bei Hashtag Gesundheit e.V
„Krankenhäuser müssen innovative Strukturen leben, wenn sie Arbeitgeber der Zukunft sein wollen! Junge Fachkräfte werden zukünftig nur dorthin gehen, wo ihre Arbeit und ihre Persönlichkeit wertgeschätzt werden.
Dazu braucht es mehr Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und generationenübergreifende Formate wie z.B. Tandem-Mentoring-Programme!“
Julia von Grundherr spielraumconsulting
„Jeder kann in seinem direkten Umfeld damit beginnen, Spielräume zu gestalten, um wieder mehr Sinnstiftung und Wirksamkeit in die Arbeit zu bringen. Ob partizipativ gestaltete Meetings oder mehr Selbstorganisation auf Station – New Work ist ein individueller Prozess und eine Haltung, die überall möglich ist, wo Menschen tätig sind – auch und gerade in Kliniken!“
Zukunft von Einkauf und Logistik
Prof. Dr. Jochen A. Werner Ärztlicher Direktor und Universitätsklinikum Vorstandsvorsitzender Essen
„Die immense Bedeutung der Digitalisierung für systemische Funktionen im Gesundheitswesen wird unterschätzt. Neben der Makroebene steht die Optimierung interner Abläufe im Fokus. Digitalisierung bei Einkauf und Logistik sorgt für mehr Preistransparenz, eine Übersicht der Lagerbestände in Echtzeit, kürzere Transportwege und somit mehr Effizienz und Nachhaltigkeit.“
Geoff Martha Chairman and CEO, Medtronic
“Patients benefit when Buying Groups streamline procurement processes and increase the speed and efficiency of MedTech companies’ access to large networks of healthcare providers. When MedTech companies and GPOs collaborate, there’s an acceleration of needs-based innovation and positive impact on patients’ access to care.”
Inhalt
Autorenverzeichnis
Vorwort
Basiswissen für den Einstieg: Einkauf, Logistik, Krankenhaus, Medizin
1.1 Warum mit „einkaufen“ beschäftigen? Das kann doch jeder!
1.2 Mit 10 Bausteinen zum professionellen Einkauf
1.3 Komplexe und vielfältige Logistik: Patienten, Material, Abfall
1.4 Wie funktioniert ein Krankenhaus? Willkommen in der Krankenhauswelt.
1.5 Woher kommt das Geld?
1.6 Unser Körper – Medizin für Einkäufer von Dr. Tjarko Geelvink
Was müssen Einkäufer und Logistiker können?
2.1 Kompetenzprofil von strategischen Einkäufern
2.2 Kompetenzprofil von Logistikern
2.3 Einkaufserfolg durch Moderation
2.4 Menschen verstehen und erfolgreich Verhandlungen führen von Kerstin Stachel, Dr. Stefan Waßmann und Lennart Eltzholtz
2.5 Nachhaltiger Einkauf: Trend oder strategisches Muss für die Zukunft? Von Dr. Clemens Jüttner und Fiona Walter
2.6 Eine Reise vom Taylorismus über Lean Management zu New Work von Dr. Kerstin Stachel
Die 6 Kernaufgaben des strategischen Einkaufs
3.1 Bedarfssteuerung: Die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort
3.2 Bedarfe erheben: Investitionsplanung
3.3 Leistungsbeschreibung: Schreib genau auf, was du brauchst
3.4 Beschaffungsmarktanalyse & Markterkundung – Wer könnte die Ware liefern?
3.5 Lieferantenmanagement: Lieferanten finden, binden, entwickeln, beurteilen
3.6 Portfoliomanagement: Priorisieren und Verbindlichkeit schaffen
3.7 Kosten nachhaltig reduzieren – Preisverhandlungen richtig vorbereiten
3.8 Einkaufscontrolling
3.9 Praxisbeispiel: Standardisierung und Projektberichtswesen
Finanzierungsinstrumente und Einkaufsgemeinschaften
4.1 Alternative Finanzierungsmodelle und Make or Buy Entscheidungen
4.2 Working Capital Management im Krankenhaus von Mathias Schönfeld
4.3 Einkaufsgemeinschaften: Angebote, Erfolgsfaktoren, Konditionen
Logistik im Krankenhaus
5.1 Warenlogistik von Johannes Müer und Thomas Dierkes
5.2 Logistische Herausforderungen: Nicht lieferfähig! Irgendetwas fehlt immer!
Digitalisierung und Nutzung von IT
6.1 Operative IT-Systeme in einem Krankenhaus: Welche Systeme produzieren welche Daten?
6.2 Business Intelligence: Datawarehouse
6.3 Social Media und Social Collaboration
6.4 Tools für die digitale Zusammenarbeit
6.5 Künstliche Intelligenz
6.6 Big Data
6.7 Web 3.0 und Blockchain-Technologie im Gesundheitswesen
6.8 Datenschutz und Informationssicherheit
Spezialbereiche einfach und praxisnah erklärt
7.1 Einkauf und Logistik von Arzneimittel von Dr. Florian Immekus und Stefan Bode
7.2 Einkauf von Bau- und Instandhaltungsleistungen von Josefine van den Oever und Kerstin Stachel
7.3 Einkauf von Dienstleistungen
7.4 Strategischer Energieeinkauf von Justine Neumann und Clemens Graf von Wedel
7.5 Logistik und Einkauf für Labore von Thomas Couturier und Jan Edel
7.6 Speisenversorgung: Beschaffung und Logistik von Niels Törkel, Alexander Pfahlbusch und Stefan Rudolph
7.7 Einkauf von Versicherungen von Ingo Gurcke, Eva Stichler
Recht und Compliance
8.1 Vergaberecht von Dagmar Hozová, Martin Schumm und Valentin Klumb
8.2 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz von Dr. Kerstin Stachel, Lennart Eltzholtz, Fiona Walter
8.3 Medical Device Regulation: Zulassung von Medizinprodukten von Dr. Kerstin Stachel, Dr. Christian Bichler, Lennart Eltzholtz
8.4 Korruption: Definition und Prävention
8.5 Im Fokus der Staatsanwaltschaft: Checkliste für den Ernstfall
Erkenntnisse im Überblick: Finns Reisführer in die wundervolle Welt des Krankenhauseinkaufs und der Logistik
Index
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Über uns
In diesem Bereich findet ihr alle Grundlagen, die ihr braucht, um einen Einkauf aufzubauen und euch im Krankenhaus zurechtzufinden. Wir steigen ein mit einigen wichtigen Begriffsdefinitionen und erläutern, wie man die Einkaufsstrategie aus der Unternehmensstrategie ableitet.
Mit den zehn Bausteinen unserer Pyramide erklären wir Schritt für Schritt, wie man einen professionellen Einkauf aufbaut. Am Ende jedes Bausteins findet ihr eine Checkliste, die es euch ermöglicht zu prüfen, wo ihr steht und euch offene To-dos aufzeigt. Alle Themen, die in diesem Kapitel stichwortartig vorgestellt werden, vertiefen wir im Buch. Das Pyramidenkapitel ist euer Navigationssystem durch die Einkaufsthemen in diesem Buch. Wir erzählen in diesem Kapitel die eine oder andere Anekdote, die wir erlebt haben. Warum? Es ist normal, wenn ihr eine große Change-Management-Aufgabe angeht, dass ihr Unglaubliches erleben werdet. Nehmt es mit Humor. Löst die Probleme wertschätzend und habt Geduld mit eurem Team. Veränderung bedeutet, dass die Mitarbeiter schnell neue Fähigkeiten erwerben und lieb gewonnene Gewohnheiten loslassen müssen. Das ist eine Herausforderung, die ihr begleiten müsst. Wir hoffen, dass ihr bei der Lektüre ab und zu mal schmunzelt und erkennt, dass ihr mit merkwürdigen Ereignissen sowie Problemen nicht allein seid. Die Logistik in einem Krankenhaus ist komplex und vielfältig, wir geben einen kurzen Überblick über die verschiedenen Bereiche und Herausforderungen und ihr erfahrt, welche Schwerpunkte wir wo in diesem Buch vertiefen.
Habt den Mut und die Ausdauer egal was passiert, – weiter am Ziel zu arbeiten.
Das Gesundheitswesen ist ein einzigartiges Universum voller Geheimnisse, Magie und mit wunderbaren Menschen. Aber auch komplex und voll von Fachbegriffen. Nur wenn du diese in den Grundzügen verstehst, wirst du ein erfolgreicher Einkäufer oder Logistiker werden. Wir erläutern kurz die wichtigsten Rahmenbedingungen des deutschen Gesundheitswesens, die Besonderheiten der Krankenhauswelt und des Finanzierungssystems.
Besonders stolz sind wir auf den Beitrag von Tjarko. Er hat es geschafft, die Wunderwelt des menschlichen Körpers in wenigen Seiten kurz und verständlich zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis für Bereich 1
1.1 Warum mit „einkaufen“ beschäftigen? Das kann doch jeder!
1.1.1 Begriffsdefinition: Beschaffung/Einkauf
1.1.2 Einkaufsstrategie aus den Unternehmenszielen ableiten
.
1.1.3 Merkmale eines professionellen strategischen Einkaufs
1.2 Mit 10 Bausteinen zum professionellen Einkauf
1.2.1 Baustein 1: Gesetze kennen und umsetzen
.
1.2.2 Baustein 2: Mitarbeiter qualifizieren
1.2.3 Baustein 3: Digitalisierung und Datenqualität
1.2.4 Baustein 4: Organisation auf den Reifegrad abstimmen
1.2.5 Baustein 5: Projekte
1.2.6 Baustein 6: Standardisierung
1.2.7 Baustein 7: Investitionsplanung
1.2.8 Baustein 8: Einkaufsgemeinschaft
1.2.9 Baustein 9: Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Bedarfsträgern
1.2.10 Baustein 10: Selbstverständnis des Einkaufs – Der Patient im Mittelpunkt
1.3 Komplexe und vielfältige Logistik: Patienten, Material, Abfall
1.4 Wie funktioniert ein Krankenhaus? Willkommen in der Krankenhauswelt
.
1.4.1 Das Unternehmen Krankenhaus – Eigenschaften und Merkmale
1.4.2 Wer will was warum? Die Anspruchsgruppen
1.5 Woher kommt das Geld?
1.6 Unser Körper – Medizin für Einkäufer von Dr. Tjarko Geelvink
1.6.1 Diagnostik und Therapie
1.6.2 Der menschliche Körper
1.6.3 Radiologische Leistungen
1.6.4 Das Nervensystem
1.6.5 Organsysteme im Bauch
1.6.6 Die Harn- und Geschlechtsorgane
1.6.7 Sinnesorgane
1.6.8 Labormedizinische Leistungen
1.6.9 Neugeborene, Kinder und Jugendliche
Literatur zum Bereich Basiswissen für den Einstieg
1.1 Warum mit „einkaufen“ beschäftigen? Das kann doch jeder!
Einkauf(en) kann jeder – ich heile, du bestellst – im Dschungel der Paragrafen – Schreibs Auf Papier – Investition sucht Planung – Datenexperte mit Moderationstalent gesucht – ein bisschen mehr Augenhöhe
Einkaufen kann jeder. Machen wir schließlich jeden Tag. So glaubt jeder Arzt, jede Pflegekraft, jeder Techniker, dass sie einkaufen können. Jeder „wurschtelt“ vor sich hin. Die Lieferanten freuen sich, können sie ihre Produkte doch zu hohen Preisen verkaufen.
Die Industrie war und ist es gewohnt, die Produkte direkt dem Arzt, der Pflege, dem Medizintechniker, dem Mitarbeiter der IT-Abteilung zu verkaufen. Der Einkauf wird nicht ernst genommen. Die Folge: Als Spaßbremse, Verhinderer oder bürokratische Einrichtung fristet der Einkauf ein Schattendasein. Die Bedarfsträger haben kein Verständnis für die Beschaffungsprozesse oder Vorgaben des Vergaberechts und verstehen nicht, warum eine Beschaffung so lange dauert.
Viele Jahre war der Einkauf in Krankenhäusern ein Bestellwesen oder eine administrative Rechtfertigungsabteilung. Eine strategische Steuerung war nicht möglich, da der Einkauf keinen Überblick hatte, was im Krankenhaus passierte und schon gar nicht proaktiv eingebunden wurde. Die Folge Maverick-Buying und damit hohe Kosten.
Man spricht im Beschaffungsmanagement von Maverick-Buying, wenn Abteilungen eigenmächtig Materialien oder Dienstleistungen kaufen, ohne die Einkaufsabteilung einzubeziehen.
Wir hoffen, dass diese Zeiten in eurem Krankenhaus vorbei sind und ihr bereits ein großes Stück auf dem Weg zum strategischen Einkauf geschafft habt. Wo ihr steht, könnt ihr mit den Checklisten am Ende jeden Abschnitts in Kapitel 1.2 überprüfen! Außerdem gelangt ihr mit diesem QR-Code zu einer vollständigen Checkliste, mit der ihr den Reifegrad eures Einkaufs prüfen könnt.
1.1.1 Begriffsdefinition: Beschaffung/Einkauf
Bevor wir starten, erst einmal eine Begriffsdefinition: Der Begriff Einkauf und Beschaffung werden in diesem Buch synonym verwendet.
Kummer et. al. definieren Beschaffung wie folgt, (…) alle Maßnahmen zur Versorgung eines Unternehmens mit jenen Produktionsfaktoren, die nicht selbst erstellt werden.“ (Kummer et al. 2018 S. 90). In der Praxis ist die Begrifflichkeit „Einkauf“ stärker verbreitet als der Begriff „Beschaffung“ (Vgl. Large 2013 S. 20).
Ein professioneller, strategischer Krankenhauseinkauf ist für alle Beschaffungen von sämtlichen Leistungen und Produkten, die von extern bezogen werden, zuständig oder zumindest eng in die Prozesse eingebunden. Die Liste der Leistungen, die ein Krankenhaus bezieht, ist lang. Hier in diesem Buch findest du ausführliche Informationen beispielsweise zur Beschaffung von Medizinprodukten, Laborleistungen, Dienstleistungen, Energie, Lebensmitteln und Versicherungen.
Praxischeck: Wie zentral ist dein Einkauf wirklich?
Frage deine Mitarbeiter, wofür das Team sich zuständig fühlt. Du wirst überrascht von den Antworten sein. Selten wirst du hören: „Wir sind verantwortlich für den Bezug von sämtlichen Dienstleistungen (Anwälte/Berater/Versicherungen/Honorarverträge etc.) und für sämtliche Produkte, die von extern bezogen werden, egal für welche Abteilung oder Klinik.
Gründe, warum es Sinn macht, einen zentralen Einkauf zu etablieren und Maverick Buying zu unterbinden:
Es werden in jedem Fall bessere Konditionen erzielt, als es in dezentralen Lösungen möglich ist.
Die Funktionstrennung zwischen Bedarfsträger und Besteller reduziert das Risiko von dolosen Handlungen/Korruption.
Der Bedarfsträger kann sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und muss nicht in die Rolle des harten Verhandlers schlüpfen.
Je häufiger man Angebotsvergleiche durchführt, Verträge abschließt und Konditionen verhandelt, desto größer das Know-how und desto wahrscheinlicher, dass die Verhandlungsergebnisse vorteilhaft für das Krankenhaus sind.
Werden Verträge von unterschiedlichen Personen verhandelt, so kommt es häufig zu Mehrkosten, da der Überblick verloren geht und die Konditionen nicht aufeinander abgestimmt sind.
Für Krankenhäuser, die dem Vergaberecht unterliegen, ist es einfacher sicherzustellen, dass das Vergaberecht in allen Bereichen richtig und vollumfänglich angewendet wird.
Bitte glaube nicht, dass das Vergaberecht eingehalten wird, wenn dies jemand behauptet. Die Materie ist komplex. Wir haben immer wieder erlebt, dass dezentrale Bereiche der Meinung waren, dass sie aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz eine Ausschließlichkeitserklärung schreiben und dann eine freihändige Vergabe durchführen könnten. So mussten wir in einem Projekt von einem Medizintechnikingenieur hören: „Ich bin Ingenieur und kann jederzeit eine Ausschließlichkeitserklärung schreiben, dann ist klar, dass nur ein Lieferant infrage kommt, und wir können uns den Aufwand für eine Ausschreibung sparen.“ Natürlich geht das nicht! Selbst wenn auf technischen Produkten häufig Patente sind, ist es noch recht schwer, auf ein Vergabeverfahren zu verzichten.
Mit nachfolgendem QR-Code kannst du dir eine hilfreiche Checkliste runterladen, um die Zuständigkeiten für die verschiedenen Bereiche in deinem Krankenhaus zu identifizieren.
1.1.2 Einkaufsstrategie aus den Unternehmenszielen ableiten.
Die Einkaufsstrategie leitet sich aus den Unternehmenszielen ab. Strategien sind „geplante Maßnahmenbündel zur Erreichung von Zielen“ (Dillerup u. Stoi 2016 S. 131).
Grundlage für die Unternehmensstrategie ist eine sorgfältige Analyse des Marktumfeldes. Die Unternehmensleitung macht sich ein klares Bild darüber, welche Mitbewerber (Konkurrenten) es gibt, welche medizinischen Schwerpunkte in Zukunft in der Region gebraucht werden, welche Anforderungen der Träger/ Eigentümer hat.
→ Merke: Es muss nicht jeder Bereich direkt in der Einkaufsabteilung angesiedelt sein, aber falls Bereiche Leistungen selbst beziehen, sollte zumindest bei größeren und langfristigen Verträgen der Einkauf einbezogen werden.
Aus den übergeordneten Unternehmenszielen werden für die unterschiedlichen Bereiche und Abteilungen Unterziele abgeleitet. Sinnvoll ist es, nach dem ZAK-Prinzip (Ziel-Aktion-Kennzahl) zu arbeiten. Dies bedeutet, das Ziel wird formuliert, die Aktion definiert und eine Kennzahl festgelegt, mit der die Zielerreichung gemessen wird. Weiterhin wird für jedes Ziel definiert, bis wann dieses erreicht werden soll.
Typische Beiträge des Einkaufs zum Unternehmenserfolg und damit Einkaufsziele sind:
Reduktion von Preisen und Mengen
effiziente Gestaltung von Logistikprozessen,
Versorgungssicherheit
die Kooperation mit Einkaufskooperationen zur Erzielung von Kostensenkungen über Mengenbündelungen
die Gestaltung von nachhaltigen Lieferantenbeziehungen
Rechtssicherheit und somit die Vermeidung von dolosen Handlungen
Der Begriff dolose Handlungen (nach lateinisch dolosus ‚arglistig, trügerisch‘) fasst in der Fachsprache des Wirtschaftsprüfers Bilanzmanipulationen, Untreue, Unterschlagung und alle anderen zum Schaden des Unternehmens vorsätzlich durchgeführten Handlungen zusammen (Wikipedia: Dolose Handlungen: Zugriff im April 2023).
Operative Tätigkeiten grenzen sich von strategischen Aufgaben dadurch ab, dass sie kurzfristigen und ausführenden Charakter haben. Typische Beispiele für operative Einkaufstätigkeiten (oder auch Tagesgeschäft) sind das Auslösen einer Bestellung, die Abklärung von Konditionen, die Beschwerde über eine unvollständige Lieferung beim Lieferanten oder die Konkretisierung einer Bedarfsanforderung (Welche Qualität? Welche Menge?) gemeinsam mit dem Bedarfsträger.
Praxisbeispiel:
In der Unternehmensstrategie ist folgendes Ziel definiert: Das Krankenhaus wird Qualitätsführer in der Herzmedizin für die Region bis zum Jahr 2025. Im Jahr 2025 liegt der Marktanteil bei 70 Prozent.
Ziel (Z): Die Einkaufsstrategie könnte dann folgendes Ziel enthalten: Es wird sichergestellt, dass wir als Marktführer in der Herzmedizin die besten Preise für innovative kardiologische Produkte im Vergleich zu Mitbewerbern haben.
Aktionen (A) könnten sein: Neuverhandlungen mit den Lieferanten, Etablierung von Entwicklungspartnerschaften etc.
Als Kennzahl (K) wird der Preis für die relevanten Produkte der Herzmedizin gewählt.
Die Unternehmensleitung überprüft regelmäßig die Erreichung der Unternehmensziele. In diesem Prozess gibt der Einkauf Feedback über seine Zielerreichung. Der strategische Einkäufer ist idealerweise eng mit den Lieferanten vernetzt und erkennt Innovationen frühzeitig. Er gibt diese Marktimpulse regelmäßig an die Unternehmensleitung weiter. Die sechs Kernaufgaben des strategischen Einkaufs werden im Bereich 3 beschrieben.
1.1.3 Merkmale eines professionellen strategischen Einkaufs
Bevor wir erläutern, wie man einen Einkauf aufbaut, lasst uns einen Blick auf die Merkmale eines professionellen Einkaufs werfen:
Die Einkaufsstrategie wird aus der Unternehmensstrategie abgeleitet.
Gesetze werden eingehalten.
Sämtliche Beschaffungen laufen über den Einkauf: Trennung von Bedarfsträger und Besteller.
Der Einkauf wird an jeder Lieferantenverhandlung beteiligt.
Rechnungen werden nur bezahlt, wenn zuvor eine Bestellung über den Einkauf ausgelöst wurde.
Beschaffungsprozesse werden im Vier-Augen-Prinzip durchgeführt, um dolose Handlungen zu vermeiden.
Entscheidungen werden transparent und nachvollziehbar dokumentiert.
Der Beschaffungsprozess ist digitalisiert, für den Bedarfsträger ist der Beschaffungsprozess einfach und der Status einer Bestellung jederzeit nachvollziehbar.
Die Professionalisierung des Einkaufes erfordert die Umsetzung zahlreicher Einzelschritte, die sich zehn Themenbereichen (Bausteinen) zuordnen lassen.
1.2 Mit 10 Bausteinen zum professionellen Einkauf
Grundlagen schaffen – mit Gesetzen (richtig) umgehen – Mitarbeiter qualifizieren – Einkaufsrichtlinie anstatt Maverick Buying – Prozesse und Produkte standardisieren – richtiges Projektmanagement will gelernt sein – Anwender, Einkauf und Industrie in Balance
Die Bausteine für den Aufbau eines professionellen Einkaufs haben wir während unserer gemeinsamen Zeit am Universitätsklinikum Bonn entwickelt.
Der Aufbau eines professionellen Einkaufs ist ein mühevoller Weg, der mit vielen Konflikten einhergeht. Die Anwender müssen den Einkauf erst einmal als Mehrwert begreifen, die Lieferanten haben kein großes Interesse an einer starken Einkaufsabteilung, denn schließlich arbeitet ein guter Einkauf gegen die klassischen Vertriebsstrukturen. So sucht die Industrie eher den Schulterschluss mit dem Bedarfsträger und versucht eine Professionalisierung des Einkaufs zu verhindern oder zumindest zu erschweren.
→ Merke: Egal was du im Einkauf bewegen willst, ohne die Unterstützung des Vorstandes oder der Geschäftsführung wird es nicht gelingen.
Erstmals wurden die Bausteine in der Zeitschrift f&w im Jahr 2011 publiziert. Seither ist viel passiert und wir haben viele Projekte und Neuorganisationen von Einkaufsabteilungen begleitet. Wir sind von der Pyramide weiterhin absolut überzeugt. Allerdings stellen wir die Bausteine in einer geänderten Reihenfolge vor, da wir glauben, dass diese Reihenfolge erfolgversprechender ist.
Die Pyramide in Abbildung 1 visualisiert die zehn Themenbereiche in Form von Bausteinen. Die Pyramide ist so zu verstehen, dass alle Bausteine benötigt werden und optimal zu gestalten sind, um einen zukunftsfähigen und professionellen Einkauf in einem Krankenhaus zu etablieren. Der Weg zur Spitze der Pyramide beginnt links unten mit Baustein 1. Es darf kein Baustein vergessen werden und man sollte beim Fundament der Pyramide anfangen, denn sonst ist es unmöglich, die Spitze der Pyramide zu erreichen.
Wie bei einem Haus: Wer mit dem Dach beginnt und das Fundament vergisst, wird sich nie über sein fertiges Haus freuen können. Klar könnt und müsst ihr in der Praxis parallel an den Bausteinen arbeiten. Dies erfordert viel Fingerspitzengefühl. Je stabiler euer Fundament, umso erfolgreicher werdet ihr sein. Werden einzelne Bausteine vernachlässigt oder gar nicht entwickelt, so wird der Aufbau eines strategischen Einkaufs nicht gelingen. Zu allen Bausteinen gibt es in diesem Buch ausführliche Artikel von uns oder von Fachexperten. Wir verweisen jeweils auf die relevanten Kapitel in diesem Buch, die du zur Vertiefung lesen kannst.
Das „Pyramidenkapitel“ ist euer Navigationssystem durch das Buch.
Unser Fazit zum Aufbau eines professionellen Einkaufs vorneweg: Es lohnt sich und es macht Freude, den Weg gemeinsam mit den Ärzten und Pflegekräften zu gehen, denn am Ende stehen die Akzeptanz des Einkaufs und der Stolz darauf, dass man qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen gemeinsam eingekauft hat. Der Einkauf wird nach und nach zu einem anerkannten operativen und strategischen Partner von Lieferanten und Bedarfsträgern aus allen Bereichen.
1.2.1 Baustein 1: Gesetze kennen und umsetzen.
Ganz am Anfang musst du dich mit den rechtlichen Grundlagen auseinandersetzen, die für dein Krankenhaus gelten. Ein Verstoß gegen rechtliche Rahmenbedingungen gefährdet nicht nur den Einkaufserfolg, sondern bringt dich im schlimmsten Fall in das Visier von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft (siehe hierzu ausführlich Kapitel 8.4 und 8.5) oder dein Krankenhaus muss Fördermittel zurückzahlen.
Leider ist der Dschungel der rechtlichen Rahmenbedingungen kompliziert und die Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Das wichtigste Thema für den Einkauf ist das Vergaberecht. Dies gilt für alle öffentlichen Häuser und für private oder freigemeinnützige Häuser, wenn dies entsprechend in den Förderbescheiden verankert ist. Die Vertiefung zum Vergaberecht findet ihr im Kapitel 8.1.
Abbildung 1: Bausteine eines professionellen Einkaufs
Unterliegt dein Krankenhaus dem Vergaberecht, dann musst du dies als Einkäufer beherrschen. Wir haben erlebt, dass die Verantwortung für das Vergaberecht in eine Vergabestelle abgeschoben wurde. Mancher Vorstand oder Geschäftsführer versteht dies fälschlicherweise auch als sinnvolle Umsetzung des Vier-Augen-Prinzips.
Frei nach dem Motto: Wenn die Vergabestelle nicht weiß, was beschafft werden soll, dann ist sie neutral und nicht korruptionsanfällig.
In einer solchen Struktur wurde beispielsweise ein Verfahren gerügt, weil die Leistungsbeschreibung nicht herstellerneutral war. Der Mitarbeiter der Vergabestelle sagte: „Nein, die Leistungsbeschreibung habe ich nicht gelesen. Der Bedarfsträger muss doch wissen, dass er das nicht darf.“
Das ist der Tod jedes Einkaufserfolgs! Warum? Weil ein Vergabeverfahren nichts anderes ist als eine professionelle Struktur für einen Beschaffungsprozess und auch wenn manche Regularien sehr bürokratisch sind, wird jede Einkaufsrichtlinie in einem privaten Unternehmen ähnlichen Prinzipien folgen.
Die Prinzipien in Kürze:
Hole mehrere Angebote ein.
Definiere vorher genau, was du brauchst.
Mache den Einkaufsprozess transparent und nachvollziehbar und sorge dafür, dass du die gewünschte Qualität zum besten Preis bekommst.
Lege genau fest, anhand welcher herstellerneutralen Kriterien du die Qualität beurteilst.
Und sorge dafür, dass du nur bei leistungsfähigen Lieferanten beschaffst, die dann auch liefern können.
→ Merke: Nur die vergaberechtlichen Regularien abzuarbeiten ohne Interesse am Beschaffungsgegenstand wird nie zu einem Einkaufserfolg führen. Das bedeutet: Wer den Vergabeprozess durchführt, muss genau verstehen, was er eigentlich beschaffen soll, also die Leistungsbeschreibung im Detail kennen und gemeinsam mit dem Bedarfsträger die Eignungsund Zuschlagskriterien festlegen.
In Krankenhäusern, die das Vergaberecht nicht anwenden müssen, gibt es in der Regel Beschaffungsrichtlinien, die vorgeben, wie der Einkauf zu erfolgen hat.
Für öffentliche Häuser gelten weiterhin Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung, der Mittelstandsförderung, Tariftreuegesetze, Runderlässe der Ministerien etc. Sowohl das Vergaberecht wie auch diese Gesetze sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Wenn ihr Glück habt, gibt es in eurem Krankenhaus einen Überblick, was für euch gilt, wenn nein, dann macht euch die Mühe und gewinnt einen Überblick über die Gesetzeslage.
In den einzelnen Krankenhäusern werden diese Regelungen individuell ergänzt durch interne Dokumente zur Unterschriftenregelung, Dienstanweisungen zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption.
Natürlich sind das Vergaberecht und die Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung nicht die einzigen Gesetze, die ihr beachten müsst. In einem Krankenhauseinkauf seid ihr für die Beschaffung von unterschiedlichsten Produkten und Dienstleistungen verantwortlich. Dies bedeutet, ihr müsst vor der Auftragserteilung sicherstellen, dass alle Gesetze eingehalten werden, die speziell für das zu beschaffende Produkt oder die Dienstleistung relevant sind.
Diskutiert mit den Fachabteilungen, welche Vorschriften zu berücksichtigen sind. Fragen, die ihr stellen solltet:
Welche Anforderungen hat der Datenschutz?
Ist der Personalrat zu beteiligen (Personalratsvertretungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz)? Der Personalrat kann nach der Beschaffung den Einsatz zum Beispiel von technischen Geräten wie einem Konferenzsystem verhindern/verzögern.
Gibt es besondere Vorschriften für die sterile Aufbereitung der Medizinprodukte (Medizinprodukte-Betreiberverordnung) oder für die Entsorgung (Kreislaufwirtschaftsgesetz)?
Sind bauliche Maßnahmen erforderlich: Statik, Strahlenschutz, Traglast, Kälte, Kühlung etc. Die Beschaffung eines Gerätes, dass harmlos wirkt, kann umfangreiche Baumaßnahmen nach sich ziehen, vor allem, wenn Geräte in Gebäude eingebaut werden, die schon recht alt sind.
Gibt es Brandschutzauflagen zu beachten? Unser Lieblingsbeispiel ist der Snackautomat. Wusstest du, dass ein Snackautomat eine Brandlast ist? Nicht überall stehen darf und ggf. sogar eingehaust werden muss?
Gibt es Vorgaben der Informationssicherheit?
Gibt es Vorgaben der Arbeitssicherheit oder des Gesundheitsschutzes bei dem Produkt?
Kann das Produkt mit den Krankenkassen abgerechnet werden? Müssen ggf. zusätzliche Verhandlungen mit den Kassen geführt werden?
Diese Liste ist nicht vollständig. Ihr fragt euch jetzt: Wie kann ich das denn alles wissen? Ihr müsst das nicht wissen, ihr müsst in eurem Beschaffungsprozess nur die richtigen Fachabteilungen vor der Bestellauslösung involvieren. „Ja aber, wenn alle mitreden, dann werde ich ja nie fertig,“ wendet ihr zurecht ein. Das stimmt! Je mehr Erfahrung ihr habt, je besser eure Moderationsfähigkeiten (siehe Kapitel 2.3) und je höher euer Standardisierungsgrad ist, desto einfacher wird es. Insbesondere bei großen oder komplexen Beschaffungsvorhaben lohnt es sich zu Beginn eine große Runde einzuberufen, um zu hören, welche Anforderungen die einzelnen Verantwortlichen haben. Dies erspart euch viel Kummer und Ärger und vor allem reduziert bzw. vermeidet ihr Folgekosten. Je früher die Verantwortlichen und der Personalrat/Betriebsrat eingebunden sind, desto besser verstehen die Verantwortlichen das Projekt und können ihren Beitrag zu dem Beschaffungsprojekt leisten.
Wenn ihr neu in eurem Krankenhaus seid, dann macht ihr am besten einen Antrittsbesuch und lasst euch von anderen Bereichen sagen, was in der Vergangenheit bei Beschaffungen nicht gut gelaufen ist. Ihr merkt dann schnell, wie ihr eure Prozesse effizienter gestalten könnt.
Hier die Checkliste für Baustein 1:
Unterliegt mein Krankenhaus dem Vergaberecht?
Wenn ja:
Wenn nein:
Binde ich die Experten aus den nachfolgenden Abteilungen systematisch in den Beschaffungsprozess ein:
1.2.2 Baustein 2: Mitarbeiter qualifizieren
Einkäufer in einem Krankenhaus zu sein bedeutet, für alles und nichts zuständig zu sein, da es im Grunde nichts gibt, was nicht eingekauft wird. So fordert heute in einer Universitätsklinik z. B. ein Wissenschaftler Munitionskugeln für eine Exkursion nach Ghana an und morgen benötigt ein Klinikdirektor kompetente Unterstützung bei der Ausschreibung eines Magnetresonanztomografen (MRT) oder von Tierkäfigen. Hinzu kommen tausende Verbrauchsmaterialien vom Kugelschreiber bis zum Herzschrittmacher.
Einkauf und Logistik waren in der Vergangenheit in Krankenhäusern häufig Bereiche, denen man seitens der Geschäftsführung/des Vorstands nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat, und es wurden dort Mitarbeiter eingesetzt, die entweder eine klassische Verwaltungslaufbahn absolviert hatten oder die als Quereinsteiger in diesen Bereich gekommen sind. Der Logistikbereich war ein Bereich, um Mitarbeiter unterzubringen, die in anderen Bereichen des Krankenhauses nicht mehr eingesetzt werden konnten.
In der Praxis führte genau diese Personalauswahl dazu, dass der Einkauf zur bürokratischen Bestellabteilung wurde. Der Einkauf wird zur Nacherfassung im Materialwirtschaftssystem benutzt und Maverick Buying (Direktbestellungen beim Lieferanten) prägen die Realität.
Welche Anforderungen an die Qualifikationen eines Einkäufers gestellt werden müssen, haben wir in Kapitel 2.1 für euch zusammengestellt.
Ihr müsst die Mitarbeiter im Einkauf kontinuierlich so qualifizieren, dass die Bedarfsträger und Lieferanten in euren Mitarbeitern echte Sparringspartner sehen, die Ausschreibungen, Preisverhandlungen, Vertragsgestaltungen etc. zuverlässig meistern und Lieferantenkontakte professionell pflegen.
Hierzu gehört eine regelmäßige Qualifikation zu rechtlichen Fragestellungen, zu persönlichen Qualifikationen und zu Produktwissen. Ein Anteil der Mitarbeiter sollte ein relevantes Hochschulstudium und/oder eine spezifische Ausbildung zum Beispiel als Facheinkäufer beispielsweise im Rahmen einer BME-Qualifikation (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V.), abgeschlossen haben.
Letztendlich müsst ihr erst einmal mit den Menschen arbeiten, die da sind. Ihr müsst sie auf die Reise hin zu einem professionellen Einkauf mitnehmen. Einige werden das Potenzial haben, euch zu unterstützen, andere werden es nicht schaffen. Es ist eure Aufgabe herauszufinden, wer kann und will und wer nicht. Wie das geht? Dies geht nur über eine enge Führung: Klare Aufgaben vorgeben, Ziele setzen, Hilfestellung geben und Wissenslücken durch individuelle Fortbildungen schließen.
Mit manchen Mitarbeitern sind wir fast täglich am Anfang Checklisten durchgegangen, um sicherzustellen, dass sie auf dem Weg bleiben. Egal was in Büchern zu Führungstheorien steht; jemand, der aus einer völlig anderen Welt kommt und keine Weiterbildungen genossen hat, sondern in einem Bereich gelandet ist, mit dem er sich eigentlich nicht auskennt, wird sich nur in sehr seltenen Fällen allein in die richtige Richtung entwickeln. Hinzukommt, dass diese Mitarbeiter häufig unsicher und unglücklich sind, weil sie im Grunde wissen, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen sind. Wer gibt dies aber gerne zu? Es ist eure Aufgabe herauszufinden, welche Stärken die Mitarbeiter haben. Wofür könnt ihr eine Person einsetzen? Welche Schulungen braucht jeder Einzelne hierfür? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich Mitarbeiter tatsächlich komplett ändern können und zu Höchstleistern im neuen System werden. Das Gegenteil ist aber auch möglich: nämlich, dass Mitarbeiter über diesen Wandel krank werden oder ihr euch von Mitarbeitern trennen müsst.
Nicht alle Aufgaben können mit den vorhandenen Mitarbeitern bewältigt werden oder es entstehen Vakanzen, weil Mitarbeiter ausscheiden. Kann man einfach so einen Mitarbeiter, der den Einkauf aus einem anderen Unternehmen kennt, ins Krankenhaus setzen und hoffen, dass es funktioniert? Klar kann man! Aber dann wird man in 98 Prozent der Fälle enttäuscht. Auch diese Einkäufer müssen geschult werden und an die Komplexität eines Krankenhauses herangeführt werden.
Wir haben es immer gewagt, sehr junge Leute auf verantwortungsvolle Positionen zu setzen. Hierzu gab es ein Traineeprogramm und eine enge Begleitung. Am Anfang wurde dies als „Team Jugend Forscht“ belächelt, aber der Vorteil dieses jungen Teams war, dass es sehr agil und innovativ mit der komplexen Struktur umgegangen ist und natürlich viel sicherer in einer digitalisierten Welt agierte.
Die erfahrenen Mitarbeiter akzeptierten dieses Konzept nach anfänglicher Skepsis, da sie sahen, dass ihnen damit Aufgaben abgenommen wurden, die für sie sehr mühevoll, weil fremd waren.
Im Bereich 3 findet ihr alles über Kompetenzen und Qualifikationen, die Einkäufer und Logistiker haben sollten.
Hier die Checkliste für Baustein 2:
Habt ihr klar definiert, welche Qualifikationen für welchen Arbeitsplatz erforderlich sind?
Gibt es einen Weiterbildungsplan für die Themen, die alle kennen müssen: Vergaberecht, Kommunikation, Warenwirtschaftssysteme
Gibt es individuelle Weiterbildungspläne für die einzelnen Mitarbeiter?
Ist ein entsprechendes Budget eingestellt?
Wird das Know-how der Lieferanten eingebunden?
Habt ihr für die Mitarbeiter klare Ziele und Aufgaben definiert? Weiß jeder, wo er steht?
1.2.3 Baustein 3: Digitalisierung und Datenqualität
Die Digitalisierung ist eine der wesentlichsten Voraussetzungen für einen effizienten Einkauf und umgekehrt legt die Digitalisierung im Einkauf den Grundstein für eine Vielzahl von Prozessen im Krankenhaus, insbesondere in der Logistik und im Controlling. Ohne eine fehlerfreie Pflege der Materialstammsätze wird beispielsweise eine Kostenträgerrechnung nicht funktionieren und die automatische Rechnungsbearbeitung scheitert, wenn die Bestelldaten nicht sauber angelegt sind.
Die Digitalisierung von Prozessen ist eine Herausforderung, weil sie die Arbeit der Mitarbeiter komplett verändert. Widerstände sind vorprogrammiert. In diesem Abschnitt geben wir einen kurzen Einblick in unsere Erfahrungen mit Change-Management-Projekten. Welche IT-Systeme im Krankenhaus eingesetzt werden und welche Anforderungen an die Datenqualität gestellt werden müssen, findet ihr in Kapitel 6.
Vergleicht man das Gesundheitswesen z. B. mit der Lebensmittelindustrie, so stellt man fest, dass viele Möglichkeiten der IT-Unterstützung von Logistikprozessen in Krankenhäusern noch nicht vollumfänglich genutzt werden. Im Supermarkt ist es selbstverständlich, dass Packungen mit eindeutigen Barcodes versehen sind. Im Gesundheitswesen ist dies bis heute alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Man kann es im Grunde einfach zusammenfassen: Das gesamte Gesundheitswesen und die Krankenhäuser hinken der Industrie mindestens zehn Jahre hinterher! Das kostet Geld, Zeit und Nerven und muss sich dringend ändern.
Für alle, die es eilig haben, geht es jetzt weiter zu Kapitel 6 oder zum nächsten Baustein. Für alle, die Lust haben, etwas über eine ganz besondere Erfahrung zu lesen, nämlich die Umstellung von einer papierbasierten Bestellanforderung hin zu einer digitalen Anforderung, dürfen gerne weiterlesen. Ich habe mit Lennart diskutiert, ob diese Erfahrungen nicht zu düster sind und wir doch darauf verzichten sollten. Heute sind wir ja alle schon deutlich weiter, aber ich habe mich entschieden, diese Erfahrungen zu teilen, weil sie sehr plastisch zeigen:
dass Digitalisierung bedeutet, dass sich Menschen verändern müssen.
dass Projekte in der Regel nicht an einem bösen Willen scheitern, sondern an Überforderung und Unkenntnis.
dass die Einführung einer neuen Technologie eine echte Führungsaufgabe ist.
dass Führung bedeutet, Akzeptanz für das System herzustellen, Mitarbeiter zu schulen und am Ende die Nutzung verbindlich durchzusetzen.
dass die Ursachen für Probleme nur gefunden werden, wenn man sich sehr intensiv um das Detail bemüht.
dass das Kümmern um Menschen im Projektmanagement mit eingeplant werden muss.
Als ich 2008 im Einkauf anfing, dachte ich, es wäre gut, mit einfachen Fragen anzufangen. Ich bat das Team, mir für jeden Bereich darzustellen, welches die Hauptlieferanten sind und welche Produkte dort bezogen werden. Als ich nach zwei Wochen immer noch nichts hatte, fragte ich nach. Die Antwort: „Ja, wir arbeiten dran, aber das dauert, wir müssen die Daten aus SAP abschreiben und in Excel eintragen. So schnell geht das nicht.“ Ich schaute die Mitarbeiter völlig fassungslos an und mehr als ein „Was machen Sie?“ fiel mir in diesem Moment nicht ein. Bislang hatte ich geglaubt, was im System drin ist, kann man auch rausholen. Ja, aber leider hatte niemand den Antrag bei der IT-Abteilung gestellt, dass die Auswertungen in SAP freigeschaltet werden. Als ich die IT-Abteilung fragte, warum diese Auswertungen nicht automatisch freigeschaltet wurden, sagte man mir: „Na ja woher sollen wir wissen, dass diese gebraucht würden?“ Ich dachte, dass so etwas nur mir passiert, aber ich traf später noch Kollegen, welche die gleiche Erfahrung gemacht hatten. Analysiert man die Gründe, warum so etwas passiert, dann kommt man wieder auf den Baustein Schulung: SAP wurde so kostengünstig wie möglich eingeführt und die Mitarbeiter waren indem, was das System kann, nicht geschult. Das gleiche galt auch für die IT-Abteilung: Auch dort hatten sich die Mitarbeiter größtenteils selbst eingearbeitet.
Fazit: Ihr müsst einen guten konstruktiven Kontakt zu eurer IT-Abteilung haben. Die Mitarbeiter in der IT-Abteilung müssen eure Bedürfnisse verstehen, nur dann können Sie euch unterstützen. Sorgt dafür, dass sowohl die IT wie auch die Mitarbeiter in der Nutzung der IT-Systeme bestmöglich geschult sind und wissen welche Möglichkeiten die Systeme bieten.
Eine riesige Herausforderung ist die Digitalisierung von Prozessen über das gesamte Krankenhaus. Wir haben in Bonn angefangen, als fast alles noch papierbasiert war. Ich erhielt vom Vorstand die Aufgabe, eine elektronische Anforderung einzuführen. Schließlich musste ich in den Vorstand gehen und mitteilen, dass ich zunächst mehr als 1.000 PCs bräuchte, denn die Stationen und Kliniken hatten keine PCs. PCs waren ein Privileg von einigen wenigen. Wir schrieben das Jahr 2008 wohlgemerkt. Entsprechend amüsant war dann auch der Rollout der elektronischen Anforderung, denn für die Mitarbeiter war nicht nur die Anforderung neu, sondern auch der PC. Mit den Anekdoten könnte man ein eigenes Buch füllen, denn natürlich waren die Mitarbeiter keine Digital Natives, die nur darauf gewartet haben, dass sie einen PC bekommen. Im Gegenteil!
Die Projektleiterin hatte mit viel Widerstand in den Chefarztsekretariaten zu kämpfen. Für die Sekretariate waren die elektronischen Prozesse ungewohnt. Plötzlich aber steigerte sich die Nachfrage an Sekretariaten, die unbedingt angebunden werden wollten. Ich fragte die Projektleiterin: „Wie haben Sie denn das geschafft?“ Nun sagte sie: „Ich bringe den Mitarbeitern in den Sekretariaten noch ein paar andere Dinge bei: Die meisten kannten noch nicht mal die Funktion Copy Paste. Die sind jetzt so glücklich, da sie sich echt viel Arbeit sparen.“
Irgendwann hatten wir alle Bereiche angeschlossen, trotzdem gab es immer noch massenhaft Papieranforderungen. Wir entschieden gemeinsam mit dem Vorstand, dass ab einem bestimmten Datum keine papierbasierten Anforderungen mehr angenommen werden. Wir führten die Bestellungen dann nicht mehr aus, sondern sendeten die Papieranforderungen zurück. Ein riesiger Aufschrei ging durch das Krankenhaus, wir gefährden die Patientenversorgung. Nun, da mussten wir durch. Veränderung tut eben manchmal weh. Nach wenigen Tagen ebbten die Beschwerden ab und wir hatten das Gefühl, es funktioniert nun. Einige Wochen später häuften sich die Beschwerden über einen Mitarbeiter. Ich holte ihn zum Gespräch in mein Büro und er sagte, „ja, grade ist alles ein bisschen viel, aber ich bekomme das in den Griff“, da er zuverlässig war, glaubte ich seinen Worten. Es wurde aber nicht besser. Ich hatte grade wieder einen Anruf erhalten und ich entschied mich sofort mit ihm zu sprechen und ging in sein Büro. Als ich die Tür öffnete, war ich sprachlos. Das ganze Büro war voll mit Papieranforderungen, der Schreibtisch quoll über und der Mitarbeiter sah mich mit rotem Kopf an. „Was machen Sie da, fragte ich? „Nun, sie haben doch verboten, dass Papieranforderungen an uns gesendet werden. Das können wir den Pflegekräften doch nicht antun. Die können doch gar nicht tippen. Ich mach das jetzt für sie.“ Natürlich konnte das nicht gehen und er war hoffnungslos überfordert.
Auch hier kommen wir zurück zum Baustein Schulung. Wir mussten die Pflegekräfte besser schulen und mithilfe von Scannern konnte die Arbeit erleichtert werden.
Was diese Geschichte zeigt: Die vollständige Digitalisierung ist ein steiniger Weg mit vielen menschlichen Befindlichkeiten und Ängsten. Diese darf man nicht ignorieren, sondern diese müssen ernst genommen werden.
Heute kann vermutlich jeder mit einem PC umgehen, aber in vielen Krankenhäusern ist die Anforderung immer noch nicht so einfach, wie wir das aus dem Internet gewohnt sind. Viele Prozesse sind nicht vollständig bzw. durchgängig digitalisiert und die Stammdaten sind schlecht gepflegt. Wie es richtig geht, beschreiben wir in Kapitel 6.
Fazit: Aktuell gibt es zahlreiche Entwicklungen, die unser Leben noch digitaler machen. Auch die Krankenhauswelt wird sich erneut komplett verändern und ihr dürft die Menschen auf diesem Weg nicht verlieren. Manchmal muss man dafür ungewöhnliche Wege gehen.
Hier die Checkliste für Baustein 3:
Lest sorgfältig
Kapitel 6
.
Werden alle Funktionalitäten des Warenwirtschaftssystems genutzt?
Sind alle Mitarbeiter in den Anwendungen, die sie benutzen sollen, geschult?
Ist die Übermittlung einer Bedarfsanforderung an den Einkauf einfach und der Status einer Beschaffung jederzeit nachvollziehbar?
Plant ihr bei der Einführung neuer IT-Tools entsprechend Zeit für die Personal- und Organisationsentwicklung ein?
1.2.4 Baustein 4: Organisation auf den Reifegrad abstimmen
Dieser Baustein wurde bewusst erst an die vierte Stelle gesetzt, denn eine Zentralisierung ohne entsprechend qualifizierte Mitarbeiter führt zur fehlenden Akzeptanz und ohne entsprechende IT-Strukturen ist der manuelle Aufwand zu hoch. Das Ergebnis: Prozesse dauern zu lange und sind fehleranfällig.
Traditionell ist der Einkauf in Krankenhäusern geprägt von einer Unterteilung in Sachgebiete. Diese Unterteilung orientiert sich an den Sachkonten, welche die Krankenhausbuchführung vorsieht: medizinischer Bedarf, Wirtschaftsbedarf, Laborbedarf und Investitionsgüter. Manchmal zentral häufig dezentral werden IT-Dienstleistungen, Beratungsleistungen, technische Dienstleistungen (Betriebstechnik, Medizintechnik) und Ersatzteile beschafft. Die Apotheke ist oftmals für andere Produkte wie Chemikalien oder Reagenzien für die Labore zuständig.
Organisatorisch solltet ihr zunächst dafür sorgen, dass alle Bestellungen über den Einkauf bzw. die Apotheke laufen. Die Regelung (keine Direktbestellung) und die Funktionsweise der Prozesse werden in einer Einkaufsrichtlinie beschrieben. Dies ist eine wesentliche Veränderung der zuvor gelebten Unternehmenskultur, daher muss diese Entscheidung von der Unternehmensleitung getragen und kommuniziert werden.
Praxistipp: Inhalte einer internen Einkaufsrichtlinie für einen zentralen Einkauf
Es gilt das Prinzip „wer bestellt bezahlt“.
Alle Bestellungen bei Lieferanten werden über den Einkauf getätigt.
Lieferanten müssen ihren Besuch vorher im Einkauf anmelden.
Neue Produkte müssen zunächst im Einkauf vorgestellt werden.
Verhandlungen werden gemeinsam mit dem Einkauf geführt.
Welche organisatorischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit ein zentraler Einkauf funktioniert? Es gibt keine pauschale Antwort, sondern die Organisationsstruktur muss zu eurem Krankenhaus passen.
Wir haben uns anfangs für die Trennung in einen strategischen und einen operativen Einkauf entschieden und die Aufteilung in Sachgebiete aufgelöst. Die Mitarbeiter im operativen Einkauf können so unabhängig von Sachgebieten eine optimale Kundenorientierung erreichen. Im strategischen Einkauf sind die Kompetenzen vorhanden, um komplexe Fragestellungen und Ausschreibungen zu bearbeiten.
Der
Vorteil
dieser Organisation ist, dass es Arbeitsplätze gibt, für die ein deutlich niedrigeres Qualifikationsniveau erforderlich ist.
Der
Nachteil
ist, dass der strategische Einkauf ggf. Verträge verhandelt, die dann operativ nicht umsetzbar sind oder nur mit viel Aufwand.
Eine andere Möglichkeit wäre eine Aufteilung im Sinne eines Category Managements/Portfolio-Managements (siehe hierzu Kapitel 3.6). Category Management ist der englische Begriff für Warengruppenmanagement, darunter versteht man die gezielte Strukturierung von Produkten nach Warengruppen. Das Hauptaugenmerk beim Category Management liegt darauf, aus Sicht des Bedarfsträgers und an dessen Bedürfnissen orientiert, Warengruppen zu bilden. Strategische und operative Aufgaben werden im selben Team bearbeitet.
Vorteil:
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Verträge so geschlossen werden, dass sie operativ problemlos umsetzbar sind.
Nachteil:
Es besteht die Gefahr, dass sich die Mitarbeiter im operativen Geschäft verlieren und strategische Aufgaben vernachlässigt werden.
Denkbar ist auch die Einrichtung eines First-Level-Supports oder Service Desk. Die Mitarbeiter sind dann ausschließlich für die Bearbeitung der Fragen zuständig, die jeden Tag anfallen: Wo ist meine Ware? Ich möchte reklamieren! Gibt es auch eine Alternative für ein bestimmtes Produkt? usw.
Letztendlich muss die Organisation zum Reifegrad des Einkaufs passen, wenn ein Einkauf digitalisiert, in eine Einkaufsgemeinschaft integriert oder zu einem Krankenhausverbund gehört, fallen weniger operative und mehr strategische Tätigkeiten an. Die Mitarbeiter, die Verantwortung für strategische Aufgaben haben, müssen hierfür die notwendige Zeit haben und dürfen nicht durch das Tagesgeschäft zu sehr abgelenkt werden. Sie sind verantwortlich für die Steuerung von Projekten. Die Akzeptanz eines zentralen Einkaufs steht und fällt mit der Kompetenz dieser Mitarbeiter.
Hier die Checkliste für Baustein 4:
Prüft den Reifegrad eures Einkaufs:
Je höher der Reifegrade des Einkaufs, desto weniger operative Tätigkeiten fallen an.
Stellt sicher, dass alle operativen und strategischen Aufgaben klar verteilt sind und erledigt werden.
Stellt sicher, dass alle relevanten Regeln für die Beschaffung in internen Einkaufsrichtlinien verankert sind.
1.2.5 Baustein 5: Projekte
Gelingt es, durch den Einkauf Projekte zu initiieren und erfolgreich umzusetzen, dann ist der Einkauf auf dem besten Weg, ein echter Partner für Kliniken und Institute zu werden. Was ist ein Projekt? Ein Projekt ist eine „sachlich und zeitlich begrenzte Aufgabe, die interdisziplinär angegangen wird.“ (Möller u. Dörrenberg 2010, S. 22)
In Einkaufsprojekten geht es darum, gemeinsam mit den Bedarfsträgern komplexe Prozesse bis ins Detail zu analysieren, Lösungen zu finden und diese mit der Industrie zu verhandeln.
Mögliche Themenfelder sind: Optimierung der Laborkosten, Standardisierung von Produkten, Realisierung von Ersteinrichtungsprojekten, Standardisierung von Endgeräten wie Computer, Handy, Druckern, Laptops usw.
Die Komplexität dieser Themenfelder schreckt viele Mitarbeiter ab und so werden bestenfalls Teilprozesse optimiert. Umfassende, dringende Veränderungen werden nur sehr selten angestoßen. Häufig verlaufen die Veränderungen im Sande.
Ursachen hierfür sind:
Der Rückhalt der Unternehmensleitung für laterale Führung (Führen ohne Vorgesetztenfunktion) fehlt.
Mitarbeiter sind nicht im Projektmanagement geschult.
Mitarbeiter haben nicht die erforderliche persönliche Kompetenz.
Es fehlt an Daten, um Sachverhalte detailliert zu analysieren.
Projektverantwortlichkeiten sind unklar.
Krankenhäuser sind hierarchisch organisierte. Dies macht laterale Führung besonders schwer.
Die laterale Führung (lat. latus „Seite“) ist Führen ohne direkte disziplinarische Weisungsbefugnis. Die Einflussnahme auf die Willensbildung und das Handeln innerhalb einer Organisation geschieht ohne direkte Hierarchiebeziehung. Laterale Führung basiert auf Vertrauen und Verständigung durch die Schaffung eines gemeinsamen Denkrahmens, um die möglichen unterschiedlichen Interessen der Beteiligten tragfähig zu verbinden. (Vgl. Wikipedia 2022 Laterale Führung, letzter Zugriff April 2023)
In der Praxis kommt es häufig vor, dass ein Projekt angestoßen wird und die damit verbundenen Veränderungen zum Beispiel „Einführung neuer Produkte“ zu Widerständen führen. Der Chefarzt sucht ein Gespräch mit dem Geschäftsführer, erläutert, warum das alles nicht geht und die Patientenversorgung gefährdet wird. Der Geschäftsführer ruft im Einkauf an – ohne vorherige Rücksprache – und sagt, dass alles bleibt wie immer, weil die Patientensicherheit an oberster Stelle steht. In Wahrheit möchte er dem Konflikt mit dem Chefarzt aus dem Wege gehen. Vielleicht, weil er dringend auf die medizinische Kompetenz angewiesen ist und Angst hat, dass der Chefarzt mit einer Kündigung droht.
Wie können Projekte gelingen? An erster Stelle steht die Qualifikation der Mitarbeiter (vgl. Kapitel 1.2.2 und Bereich 2). Die Unternehmensleitung muss klar kommunizieren, welche Projekte umgesetzt werden und wie die Verantwortlichkeiten festgelegt sind. Der Einkauf verpflichtet sich zu einer engen, vertrauensvollen und transparenten Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern. Dies bedeutet, dass alle Projektbeteiligten den Zugang zu den gleichen Daten haben. Es gibt keine Geheimniskrämerei. Die Geschäftsführung macht sich regelmäßig ein Bild vom aktuellen Projektstand, sodass allen Beteiligten klar ist, dass die Veränderung wirklich gewollt wird und alle wissen, dass zeitnah konkrete Ergebnisse erwartet werden. Typische Beispiele für Projekte sind die Optimierung der Laborkosten (siehe hierzu Kapitel 7.5.3) oder die Optimierung der Beschaffung von Prothesen in der Orthopädie siehe hierzu Kapitel 3.7.2).
Die Checkliste für Baustein 5:
Sind die Einkäufer im Projektmanagement geschult?
Wird laterale Führung akzeptiert und gelebt?
Unterstützt die Geschäftsleitung/der Vorstand den Einkauf, wenn der Einkauf interdisziplinäre Prozesse verändert?
Gibt es ein Projektcontrolling?
1.2.6 Baustein 6: Standardisierung
Die Kultur im Krankenhaus ist traditionell geprägt von der Auffassung, dass individuelle Lösungen grundsätzlich die Besten sind. Diese Auffassung wird durch die Therapiefreiheit (vgl. Kapitel 1.4.1) der Ärzte gestärkt. Fängt man mit der Standardisierung von Prozessen und Produkten an, hat dies Widerstände zu Folge. Die Bedarfsträger geben nur ungern ihre Freiheiten auf, wehren sich gegen die „Ökonomisierung“ und kämpfen um vertraute und lieb gewonnene Prozesse und Produkte. Damit Projekte zur Standardisierung erfolgreich sind, muss eine professionelle Projektbegleitung erfolgen und der Prozess muss durch die Unternehmensleitung unterstützt werden (siehe Baustein 5).
Die Standardisierung von Produkten und Prozessen ist eine Kernaufgabe des Einkaufs, denn nur so können nachhaltige Kostensenkungspotenziale erschlossen werden.
Die Standardisierung von Produkten meint, dass die Artikelund Lieferantenvielfalt reduziert wird.
Die Standardisierung von Prozessen meint, dass operative Einkaufs- und Logistikprozesse im Krankenhaus vereinheitlicht werden und die Beschaffung so schlank wie möglich erfolgt.
→ Merke: Es gilt so viel Standardisierung wie möglich und so viel Individualität wie nötig.
Standardisierung von Produkten
Preise können umso besser verhandelt werden, je größer die Mengen sind, die einem Lieferanten verbindlich zugesagt werden können (vgl. Kapitel 3.7). Voraussetzung hierfür ist die Standardisierung in eurem Krankenhaus und die Abstimmung dieser Mengen mit der Einkaufsgemeinschaft oder dem Klinikverbund. Es gibt nur selten eine gute Begründung, warum Handschuhe oder Kittel von unterschiedlichsten Herstellern verwendet werden. Gemeinsam mit dem Anwender muss die Artikelvielfalt Schritt für Schritt reduziert werden.
Klassische Projekte im Investitionsgüterbereich sind die Standardisierung von Ultraschallgeräten, EKG-Geräten, Krankenhausbetten etc.
Aufgabe des Einkaufs ist es, die Anforderungen der Bedarfsträger zu objektivieren und einen Konsens zu moderieren (siehe hierzu Kapitel 2.3). Häufig sind es individuelle Vorlieben oder Traditionen, die dazu führen, dass bestimmte Produkte bevorzugt werden. Hat man sich auf ein Produktsortiment geeinigt, muss der Einkauf sicherstellen, dass dieses beibehalten wird und Wildwuchs zukünftig vermieden wird. Die Industrie wird immer versuchen, neue Produkte zu platzieren. Die Entscheidung, ob ein neues Produkt in das Sortiment aufgenommen wird, muss systematisch erfolgen.
Ein weiteres Instrument ist das Lieferantenmanagement: Je weniger Lieferanten gemanagt werden müssen, desto einfacher für den Einkauf. Siehe hierzu ausführlich Kapitel 3.5.
Standardisierung von Beschaffungsund Logistikprozessen
Es gibt viele Möglichkeiten, Beschaffungs- und Logistikprozesse zu standardisieren. Grundsätzlich zielen alle Bemühungen darauf ab, Beschaffungen so kostengünstig und schnell wie möglich zu erledigen und die Anforderung von Produkten und Dienstleistungen für die Bedarfsträger so einfach wie möglich zu gestalten.
Mit der Standardisierung solltet ihr dort ansetzen, wo Prozesse besonders fehleranfällig sind und/oder besonders viel Zeit gespart werden kann.
Drei Beispiele für Prozessverbesserungen:
Beispiel 1: Folgekosten im Blick haben.
Ein häufiges Problem sind bei der Beschaffung von Geräten, dass Kostentreiber und Folgekosten nicht richtig eingeschätzt werden. Hier kann beispielsweise ein strukturierter Fragebogen für den Einkauf von Medizingeräten (siehe auch TCO-Analysen Kapitel 3.7.2) zum Einsatz kommen, um sicherzustellen, dass alle Kosten bei der Erstbeschaffung berücksichtigt werden. Der Lieferant muss so bereits vor der Auftragserteilung Angaben machen, welche Kosten in den Bereichen Instandhaltung, Wartung, Chemikalien und Reagenzien, Verbrauchsmaterialien, Baumaßnahmen, Anschlüsse/Medien, Arbeitssicherheit/Brandschutz und Wärmelast anfallen. So ist sichergestellt, dass die unterschiedlichen Bereiche von Anfang an in die Beschaffung einbezogen werden und der Einkäufer in die Lage versetzt wird, tatsächlich über den Gesamtpreis inkl. aller Folgekosten zu verhandeln.
Beispiel 2: Digitalisierung
Die Standardisierung von Einkaufs- und Logistikprozessen steht und fällt mit der Digitalisierung des Einkaufs (siehe hierzu ausführlich Kapitel 6). Die Beschaffung von C-Artikeln wie Büromaterial sollte weitgehend automatisch erfolgen. Hier gilt es Rahmenverträge zu schließen und zum Beispiel OCI-Kataloge anzubinden.
Beispiel 3: Modulversorgung
Eine weitere Möglichkeit ist die Einführung einer modularen Versorgung. Artikel, die täglich für die Versorgung von Patienten benötigt werden, werden automatisch nachgeliefert. Die Pflegekräfte müssen so keine Anforderungen mehr auslösen und es ist sichergestellt, dass immer genügend Artikel verfügbar sind. Gleichzeitig wird eine „wilde“ Vorratshaltung auf den Stationen vermieden. Mehr zu Logistikprozessen im Bereich 5.
Hier die Checkliste für Baustein 6:
Liege ich mit der Anzahl von Produkten und Lieferanten im Benchmark mit vergleichbaren Krankenhäusern?
Gibt es Checklisten, die sicherstellen, dass alle Informationen vor der Bestellung systematisch abgefragt werden?
Wie ist der Reifegrad der IT?
Sind moderne Versorgungskonzepte wie just in time Lieferung, Modulversorgung etc. etabliert?
1.2.7 Baustein 7: Investitionsplanung
Eine Bündelung von Mengen ist im Investitionsgütereinkauf nur dann zu realisieren, wenn eine Investitionsplanung implementiert ist. Der Aufbau einer Investitionsplanung ist ein umfassendes Projekt. Ein adäquater Planungszeitraum ist drei bis fünf Jahre. Die Investitionsplanung zeigt, welche investiven Maßnahmen für euer Krankenhaus getätigt werden müssen. Auch die Reduktion von Sachkosten kann so sinnvoll gesteuert werden, da eine Verringerung der Sachkosten häufig auch die Investition in neue Geräte bedingt. Wie eine Investitionsplanung aufgebaut wird, erfahrt ihr in Kapitel 3.2.
Die Checkliste für Baustein 7 ist kurz:
Stelle sicher, dass es eine Investitionsplanung gibt.
1.2.8 Baustein 8: Einkaufsgemeinschaft
Eine Einkaufsgemeinschaft stellt sicher, dass gemeinsam mit anderen Krankenhäusern bestmögliche Konditionen erzielt werden. Die Mitgliedschaft in einer Einkaufsgemeinschaft darf nicht dazu verleiten, interne Ressourcen zu reduzieren. Ganz im Gegenteil nur ein professionelles Projektmanagement durch die strategischen Einkäufer stellt sicher, dass die Konditionen der Einkaufsgemeinschaft nachhaltig im eigenen Krankenhaus implementiert werden können. Aus diesem Grund befindet sich der Baustein auch nahe der Spitz der Pyramide. Die Kooperation zwischen Einkaufsgemeinschaft und Krankenhaus wird im Kapitel 4.3 vertieft.
Die Checkliste für Baustein 8 ist ebenfalls kurz:
Stelle sicher, dass ihr die Vorteile einer Einkaufsgemeinschaft nutzt, aber in keinem Fall eure internen strategischen und operativen Aufgaben vernachlässigt.
1.2.9 Baustein 9: Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Bedarfsträgern
Hat man die Bausteine zuvor etabliert, dann wird die enge Zusammenarbeit mit Anwendern zur Routine. Die Bedarfsträger wissen, welche Aufgaben der Einkauf hat und verlassen sich darauf, dass der Einkauf sich um schwierige Lieferanten oder die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen kümmert. Sie können sich darauf verlassen, dass der Einkauf ihre Klinik kennt und darauf hinweist, wenn es zu Entwicklungen kommt, die beispielsweise zu Mehrkosten führen.
Aus den Einkaufs- und Standardisierungsprojekten heraus entwickelt sich eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern. Der Einkauf sorgt z. B. dafür, dass die Bedarfsträger ein regelmäßiges Berichtswesen zu den Projekten (siehe hierzu Kapitel 3.8) erhalten und es nicht bei einem einmaligen Projekterfolg bleibt, sondern eine kontinuierliche Verbesserung erzielt wird.
Der Einkauf ist in Gremien/Kommissionen vertreten. Im Gegensatz zu Projekten tagen Kommissionen regelmäßig und stellen sicher, dass die Prozessoptimierung und die Standardisierung kontinuierlich vorangetrieben werden. Typische Kommissionen, in denen der Einkauf beteiligt sein sollte: Laborkommission, Investitionskommission, Artikelkommission etc. Ebenfalls regelmäßig werden Sachkostengespräche zur Ergebnissteuerung geführt. In diesen Gesprächen werden mit den Kliniken und Instituten die Top Produkte der Materialanforderungen diskutiert und gleichzeitig besprochen, ob die Ausgaben über die Erlöse gedeckt sind. In diesen Gesprächen sind das Medizincontrolling, der Einkauf, die Apotheke, die Pflege, die Finanzabteilung sowie die Patientenabrechnung einzubinden. Mit diesen Gesprächen wird sichergestellt, dass frühzeitig korrigierend eingegriffen wird und dass das gegenseitige Verständnis wächst (siehe Kapitel 3.8).
Die Checkliste für Baustein 9:
Verlassen sich die Anwender auf den Einkauf?
Ist der Einkauf in die relevanten Gremien und Kommissionen eingebunden?
Gibt es ein Berichtswesen für die Anwender?
Gibt es eine Gesprächsroutine z. B. Sachkostengespräch mit entsprechenden dokumentierten Ergebnissen?





























