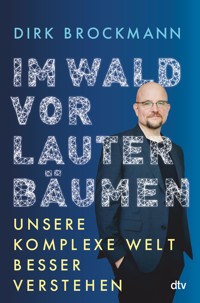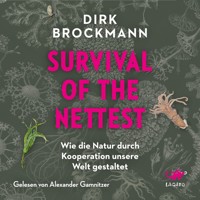
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lagato Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was wir von der Natur lernen können Kooperation gestaltet die Welt. In ihr liegt unsere Zukunft. Davon ist der renommierte Naturwissenschaftler Dirk Brockmann überzeugt. Er entwirft ein beeindruckendes Panorama über die Wirkmacht der Natur: was sie in Jahrmilliarden alles erfunden hat und was sie über die Kunst der Zusammenarbeit weiß. Wir erfahren: Wie Bakterien unser Nervensystem beeinflussen. Wie Moleküle verhandeln, die Photosynthese erfunden haben und das größte Massenaussterben aller Zeiten auslösten. Wie Tiere, Pflanzen, Pilze und auch Bakterien miteinander kommunizieren. Hören von netten Viren und von tierischen Solaranlagen. Und staunen, dass jeder Einzelne von uns »viele« ist. Symbiosen und kooperative Verbindungen zwischen Lebewesen bilden das Fundament des Lebens. Kein Tier, keine Pflanze kommt ohne sie aus. Dabei sind Konkurrenz, »Survival of the Fittest«, und Kooperation keine gegensätzlichen Kräfte, sondern sie ergänzen sich. Doch während Konkurrenz und Wettbewerb für schrittweise Optimierung sorgen, bringt Kooperation ganz Neues hervor. Dirk Brockmann beschreibt revolutionäre Innovationen der Erdgeschichte, die alle auf Kooperationen zurückgehen. Und er zieht den Vergleich zu gesellschaftlichen Prozessen. Sein Plädoyer: »Wenn wir die Natur als Lehrmeisterin akzeptieren, müssen wir auf Kooperation und Diversität setzen.«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Dirk Brockmann entwirft ein beeindruckendes Panorama über die Wirkmacht der Natur: was sie in Jahrmilliarden alles erfunden hat und was sie über die Kunst der Zusammenarbeit weiß. Wir erfahren, wieso es ohne Viren keine Säugetiere gäbe und wir uns an nichts erinnern könnten. Hören von tierischen Solaranlagen, und warum Pilze große Erfinder und Netzwerker sind. Und staunen, dass jeder Einzelne von uns »viele« ist. Symbiosen und kooperative Verbindungen zwischen Lebewesen bilden das Fundament des Lebens. Kein Tier, keine Pflanze kommt ohne sie aus. Dabei sind Konkurrenz, »Survival of the Fittest«, und Kooperation keine gegensätzlichen Kräfte, sondern sie ergänzen sich. Doch während Konkurrenz und Wettbewerb für schrittweise Optimierung sorgen, bringt Kooperation ganz Neues hervor. Dirk Brockmann beschreibt revolutionäre Innovationen der Erdgeschichte, die alle auf Kooperationen zurückgehen. Und er zieht den Vergleich zu gesellschaftlichen Prozessen und plädiert dafür, auf Kooperation und Diversität zu setzen.
Dirk Brockmann
Survival of the Nesttest
Wie die Natur durch Kooperation unsere Welt gestaltet
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Zitat
Inhalt
Außerirdische Perspektiven
Wer Yin sieht, muss auch Yang sehen
Darwins Dilemmas
Was in der schwarzen Kiste versteckt ist
Die Naturalisten
Darwins drei Säulen
And then a miracle occurs
Modern Synthesis
Die schwarze Kiste
Wandel und Konservierung
Rebellion
Kleine Helfer
Sie sind sie, nicht Sie
Der Koch
Prokaryoten und Eukaryoten
Realitätscheck
Überalleskönner
Neue Habitate
Holobionten
Fitnesstrainer
Am Steuer
Holobiontische Vererbung
Horizontaler Gentransfer
Nette Viren
Wieso es ohne Viren keine Säuger gäbe und wir uns an nichts erinnern könnten
Die Plagen
Imagewandel
Viren und Zellen
Eine Frage der Perspektive
Dr. Jekyll und Mr Hyde
Teamplayer
Global Player
Die Erfinder
Wir sind Viren
Freak Show
Im Zirkus der Symbiosen
Geklaute Solaranlagen und kollektiver Tod
Molchige Starthilfe
Pflanzentiere
Tarnkappensymbiose
Das Wesen mit der paradoxen Frisur
Matroschka
Der Wurm aus der Hölle
Fauler grüner Dreifinger-Holobiont
Die Doppelgärtner
Asgard
Wie die Heimat der Asen zur Wiege allen komplexen Lebens wurde
Tiere, Pflanzen, Pilze und Protisten
Wo kommen die Öfen und Photovoltaikanlagen her?
Das Skelett-Vesikel-Transportproblem
Die Lösung aus dem Schlamm
Prometheus
Verliebt, verlobt, verheiratet oder doch nur gefressen?
Verschmelzung
Paulinella
Wenn die Natur sich verschluckt, spuckt sie was anderes aus
Netzwerk statt Baum
Sex
Die Erfindung der schönsten Sache der Welt
Das skandalöse Rädertierchen
Doppelt hält besser
Sex knackt Mullers Ratsche
Männchen und Weibchen
Überall Regenbögen
Zwitter
Der Gemeine Spaltblättling
Prokaryoten
Rädertierchen revisited
Bakterien als Aphrodisiakum
Die Insektenmacher
Großes Schaffen
Die Erfindung der Tiere
Verschleimt
Verschwammt
Tierisch gut
Wer hat’s erfunden?
Warum der ganze Aufwand?
Nacktmulle und Knallkrebse
Der Staat bin ich
Die Netzwerker
Die kooperative Subkultur der Pilze
Eine uralte Freundschaft
Vernetzt
Verflochten
Die Landnahme der Pflanzen
Verwurzelt
Das Ligninproblem
Die zwei Gesichter mancher Pilze
Reine Nervensache
Neuronale Symbiosen und andere Gespräche
Quorum
Nervenzellen
Abdrücke und Echos
Sprache
Theory of Mind
Eine neuronale Symbiose zwischen Dirk Brockmann und ChatGPT
Fortschritt im Kreislauf
Eine persönliche Endnotiz
Anmerkungen
Hier geht es weiter und tiefer
Register
Für Buchsen und Suse
Das Einzige, das die Menschheit retten wird, ist Kooperation.
Bertrand Russell (1872–1970)
Außerirdische Perspektiven
Wer Yin sieht, muss auch Yang sehen
Unendliche Vielfalt in unendlichen Kombinationen.
Mr Spock, Erster Offizier – USS Enterprise
Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitglied einer außerirdischen Intelligenz. Ihre extraterrestrische Kultur ist fortgeschritten und technologisch in der Lage, weit entfernte Sonnensysteme zu besuchen und zu erforschen. Sie sind Teil eines Expeditionsteams, das unser Sonnensystem erreicht und aus sicherer Distanz inspiziert. Einer der Planeten weckt Ihre Neugier: die Erde, die anders als die anderen mit einer Biosphäre ausgestattet ist. Sie lebt. Sie justieren Ihre Teleskope, Messgeräte und Sensoren und protokollieren, dass sehr viele, außerordentlich unterschiedliche Lebensformen zu beobachten sind. Sie werden schnell zu dem Schluss kommen, dass sich alles Leben grob in drei Kategorien einteilen lässt: Der überwältigende Teil, ca. 80 Prozent der sichtbaren Biomasse an Land, ist grün. Als hoch entwickelter Alien werden Sie sofort auf photosynthetische Aktivität schließen, also die Nutzung des Sonnenlichts als Energiequelle. Sie werden auch notieren, dass diese Lebensformen meist tief im Boden verankert sind. Bei genauerer Untersuchung dieser Wurzeln entdecken Sie die zweite, etwas unscheinbare und rätselhafte Klasse von Lebensformen, die den Boden mit netzwerkartigen, fadenförmigen Strukturen durchziehen. Vereinzelt wachsen aus ihnen stielartige, mit Hüten versehene Organe, die aus den Böden ausbrechen und kleinste Partikel an ihr Umfeld abgeben. Auch diese Klasse von Organismen scheint extrem divers. Offenbar betreiben diese Lebensformen keine Photosynthese. Sie verstehen zunächst nicht, wie diese Organismen sich ernähren, und so beschäftigen Sie sich lieber mit der dritten Kategorie von Lebewesen. Vertreter dieser Gattungen sind agil, sie bewegen sich und kommen in fantastischen Formen und Größen vor. Sie reagieren schnell auf Reize, und einige Spezies besitzen Extremitäten zur Fortbewegung, andere können sogar fliegen, viele leben an Land, aber noch viel mehr in den Meeren, die einen Großteil der Erdoberfläche ausmachen.
Als Außerirdischer werden Sie das irdische Leben in diese drei Reiche – Pflanzen, Pilze und Tiere – aufteilen. Wir nehmen einmal an, dass Ihre Instrumente nicht ausreichen, um aus dem All das mikrobiologische Leben der Erde, Bakterien, Archaeen, Viren, Einzeller, zu erfassen. Die Tiere, die so diverse Verhaltensweisen an den Tag legen, haben es Ihnen besonders angetan. Offenbar sind sie, wie die Pilze, nicht in der Lage, Energie aus dem Sonnenlicht zu gewinnen. Um an Energie zu kommen, fressen sie andere Tiere, Pflanzen oder Pilze. Viele Tiere haben zwei Öffnungen, eine zur Nahrungsaufnahme und am anderen Ende eine für Ausscheidungen. Außerdem besitzen die meisten Arten symmetrische Körper, sie haben eine fast identisch gespiegelte linke und rechte Seite. Sie notieren allerdings auch einige Ausnahmen von dieser Regel.
Nach längerer Beobachtung fällt Ihnen eine Tierart besonders auf. Vertreter dieser Art kommen in verschiedenen Farbnuancen vor (hell, dunkel, bräunlich, rötlich, ocker, gelblich etc.), haben in etwa die gleichen Proportionen und ein ähnliches Erscheinungsbild. Die Art lebt offenbar nur an Land, sie kommt außerordentlich zahlreich überall auf dem Planeten vor und hat unterschiedliche, hochkomplexe Sozialstrukturen, Kolonien und Gemeinschaften entwickelt. Sie beobachten, wie sich zwei Individuen gegenüberstehen und Informationen austauschen, Kommunikation scheint bei dieser Art hoch entwickelt und ein elementarer Teil des sozialen Gefüges zu sein. Sie kommen zu der Erkenntnis, dass diese Lebensform eine Art Zivilisation ausgebildet hat. Hier und da leben diese Tiere in kleineren Gruppen von einigen Hundert oder Tausend, aber auch in sehr großen Kolonien mit vielen Millionen Individuen auf engstem Raum. Alle gehen eilig ihrem Tagesgeschäft nach. Die Art hat Staatsstrukturen, die sich oft über große Distanzen ausdehnen und viele Kolonien vereinen. Es wird Ihnen klar, dass innerhalb der Kollektive einzelne Gruppen oder Individuen unterschiedliche Aufgaben lösen und verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Gerade in besonders großen Kolonien scheint die Aufgabenteilung hochdifferenziert, verschiedene Rollen und stark ausgeprägte soziale Hierarchien halten eine Ordnung aufrecht. Auch technologisch ist die Art viel weiter als andere Lebensformen. Komplexe Gebäudestrukturen, Straßen und Transportsysteme sind zu erkennen. Es gibt eine organisierte Müllabfuhr, Friedhöfe für die Verstorbenen, Kranke werden versorgt und gesund gepflegt. Um Heranwachsende kümmern sich nicht nur die leiblichen Eltern, sondern auch andere, speziell dafür ausgebildete Individuen. Besonders fasziniert Sie die Wechselwirkung dieser Spezies mit anderen Lebensformen des Planeten. Die Spezies pflegt aufwändige Gärten, betreibt Landwirtschaft und Viehzucht, sie hält sogar Haustiere, die spazieren geführt oder herumgetragen werden, wie Sie amüsiert beobachten.
Praktisch in allen Gesellschaften und Staaten dieser Lebensform spielt das Militär eine wichtige Rolle. Sie sind entsetzt, als Sie feststellen müssen, dass die Art trotz der bisher notierten zivilisatorischen Errungenschaften außerordentlich aggressiv ist und Krieg führt. In Feldzügen zwischen verschiedenen Kolonien werden oft keine Gefangenen gemacht, sondern die feindlichen Truppen niedergemetzelt. Kriege gegen die eigenen Artgenossen hatten Sie bisher bei keiner anderen Tierart beobachtet. Oft geht es bei diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen um die Erweiterung des eigenen Territoriums und Invasion in benachbarte Staaten. Überfallartig dringen riesige Heere von Zehn- bis Hunderttausenden Individuen in andere Gebiete ein und zerstören alles, was ihnen im Wege steht. Oft wird bei diesen Überfällen die Brut der Opferkolonie entführt, vereinzelt beobachten Sie Sklaverei, und sogar Selbstmordattentäter entdecken Sie, die sich in feindlichem Territorium in die Luft sprengen. Allerdings registrieren Sie auch, wie gesunde Krieger Verletzte der eigenen Armee zurück in ihr eigenes Terrain bringen, um sie dort zu versorgen. Das alles würden Sie, die außerirdische Intelligenz, bei der Rückkehr zu Ihrem Heimatplaneten von der Erde, dem Planeten der Ameisen, berichten.
Ich hoffe inständig, dass Sie beim Lesen in meine kleine Falle getappt sind. Obwohl die Beschreibung sicher auch auf uns Menschen als Spezies passt, ist sie nicht weniger treffend für diverse Ameisenarten. Wanderameisen führen brutalste Invasionskriege, Blattschneiderameisen pflegen riesige Pilzgärten, die sie mit Pflanzenfutter (sogar mit Antibiotika) versorgen, andere stehlen die Brut konkurrierender Arten und versklaven sie, viele Ameisen kümmern sich um ihre Kranken, halten Haustiere und ja, sogar explodierende Selbstmordattentäterinnen gibt es. Zu viel will ich an dieser Stelle noch nicht verraten, doch es lohnt sich weiterzulesen.
Die Expedition des Außerirdischen soll zweierlei verdeutlichen. Zum einen, dass es aufschlussreich ist, neue Perspektiven einzunehmen, zum anderen, dass wir dabei unsere anthropozentrische Brille absetzen sollten, damit kein verzerrtes Bild entsteht und wir neutral beobachten können.
Meines Erachtens haben wir neue Perspektiven bitter nötig. Wir sind gut beraten, wenn wir uns als Individuen wie in Gruppen mehr Mühe geben, die Sichtweisen anderer nachzuvollziehen. Wir leben in einer krisenbehafteten Zeit, in der Bevölkerung wächst die Angst vor den Folgen der Klimakatastrophe, vor weiteren Kriegen und massiven Migrationsprozessen, vor der Destabilisierung westlicher Demokratien, vor dem zunehmenden Einfluss von Autokraten und dem scheinbar unaufhaltsamen Rechtsruck. Wie kann es gelingen, angemessen auf diese Krisen zu reagieren, neue Antworten zu formulieren oder innovative Lösungen zu entwickeln? Vermutlich nicht durch die Optimierung alter Rezepte und in der Vergangenheit bewährter Methoden. Es ist mitunter frustrierend, dass in der Politik immer wieder die gleichen, dabei gegensätzlichen Lösungsstrategien vorgeschlagen werden: Individualismus gegen Kollektivismus, freier Markt gegen staatliche Regulation, das Recht des Einzelnen gegen das Recht der Gemeinschaft.
Interessanterweise kann man dabei immer wieder beobachten, wie Gesellschaftsformen und politische Richtungen sowie Lösungsvorschläge durch vermeintlich fundamentale und erfolgreiche Prozesse der Natur begründet werden. Wettbewerb ist ein gutes Beispiel. Wettstreit ist ohne Zweifel ein wichtiges Prinzip der Natur – Survival of the Fittest, Struggle for Life, Wettbewerb belebt das Geschäft. Wettkampf ist die treibende Kraft natürlicher Auslese, so weiß man seit Darwin. Durch Wettbewerb werden erfolgreiche Prozesse, Konzepte und Ideen selektiert, sie setzen sich durch, weil sie besser funktionieren, agiler adaptieren und die Gesamtsituation verbessern. Durch Wettbewerb werden die besten Lösungen gefunden, Innovation wird durch Wettbewerb erzeugt.
Das ist im Grundsatz zwar nicht falsch, aber unvollständig. Es fehlt die Hälfte. Vielleicht sogar etwas mehr. Natürlich sind die Schlüsselmechanismen der Darwin’schen Evolutionstheorie in der Natur wirksam und zentral: der Wettstreit um Ressourcen, die fantastischen Optimierungen verschiedener Arten auf ihre Umgebung, die ihren Erhalt gewährleisten. Allgegenwärtig ist Darwins »Struggle for Life« – der Kampf ums Überleben. Ohne ihn hätte sich Leben auf der Erde nicht entwickelt.
Evolution entsteht an den Schnittstellen zwischen Konkurrenz und Kooperation.
Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Wenn man natürliche Evolutionsprozesse genauer unter die Lupe nimmt (besser funktioniert ein Mikroskop), ergibt sich ein vollständigeres Bild der fundamentalen Prozesse und Eigenschaften der Natur. Neue Erkenntnisse, Technologien und Messmethoden insbesondere in der Mikrobiologie, der Ökologie, der Biodiversitätsforschung und der Virologie haben dazu beigetragen. Zum einen wird klar, dass die Biosphäre neben der fortschreitenden Evolution, dem ewigen Kommen und Gehen einzelner Spezies, durch sehr stabile »Design«-Prinzipien gekennzeichnet ist. Diese Designs veränderten die Biosphärenachhaltig und irreversibel. Fast ausnahmslos sind diese natürlichen Innovationen außerordentlich resilient und robust, sie überdauerten Jahrmilliarden und existieren heute noch. Viele dieser »Erfindungen«[1] der Evolution werden wir in den nächsten Kapiteln kennenlernen, die meisten haben diverse Eis- und Heißzeiten der Erdgeschichte, verschiedenste Atmosphären, Weltklimazustände und Biosphären überlebt.
Außerdem liefert die Wissenschaft immer mehr Evidenz, dass neben den klassischen Mechanismen der Darwin’schen Evolutionslehre – Konkurrenz und Survival of the Fittest – enge Symbiosen unter den Lebewesen die Biosphäre dominieren. Kooperative Symbiosen sind zwar den meisten geläufig, wir kennen sie zwischen Bienen und Blütenpflanzen und haben Bilder von Vögeln vor Augen, die in geöffneten Mäulern von Krokodilen sitzen und sie von Parasiten befreien. Für gewöhnlich werden diese Symbiosen allerdings als biologisches Nischenphänomen betrachtet, als Spielerei und Ausnahme von der Regel bezüglich Konkurrenz und Wettstreit.
Immer mehr verfestigt sich jedoch ein anderes Bild biologischer und ökologischer Systeme: Kooperative Symbiosen sind die Regel, nicht die Ausnahme. Kein Tier, keine Pflanze kommt ohne sie aus. Und das war schon immer so. Alle komplexen Lebewesen stehen in engen, kooperativen Symbiosen mit Hunderten, manchmal Tausenden Arten von Mikroorganismen. Kooperative Verbindungen zwischen Lebewesen sind tiefgreifend, elementar und allgegenwärtig, sie bilden das Fundament des Lebens, wie mittlerweile erkannt wird. Typischerweise haben neue, symbiotische Beziehungen in der Erdgeschichte zu Innovationen geführt und neue Designs hervorgebracht. Konkurrenz und Kooperation sind in diesem erweiterten Bild keine antagonistischen Kräfte in der Evolution. Vielmehr ergänzen sie sich. Während Konkurrenz und Wettbewerb zwischen ähnlichen Akteuren graduell optimieren, liefert Kooperation unterschiedlichster Organismen Innovationen, ganz neue Strukturen und oftmals rapide, irreversible Veränderungen.
Weil wir in unserem Denken aber immer noch stark durch die klassischen Elemente der Darwin’schen Evolutionslehre geprägt sind und dazu neigen, Konkurrenz und Wettbewerb als primäre Mechanismen zu verstehen, die auf die Schnelle dringend notwendige Lösungsansätze für die drängenden Fragen unserer Zeit liefern, liegt der Fokus hier auf der anderen, eher unbekannten Seite der Medaille. Survival of the Nettest ist ein Buch über die kooperativen Innovationskräfte der Natur. Es dient dem Ziel, die Wahrnehmung grundlegender Prozesse der Natur zu erweitern und in der Folge besser zu verstehen, wie die Natur Neues hervorbringt. Kooperation wird dabei nicht als wichtigstes Naturgesetz postuliert und in Opposition zu Darwin und zur Konkurrenz gestellt. Vielmehr wird in den folgenden Kapiteln anhand vieler Beispiele und hoffentlich unbekannter Perspektiven erklärt, wie diese beiden Kräfte ineinandergreifen und unterschiedliche Beiträge zu evolutionären Prozessen liefern.
Die Probleme und Krisen unserer Zeit lassen sich nicht mehr durch graduelle Optimierung oder mit etablierten Rezepten lösen. Wir brauchen Innovation. Aber diese lässt sich nicht durch das klassische Mantra »Innovation durch Wettbewerb« herbeiorakeln. Wenn wir die Natur als Lehrmeisterin akzeptieren, müssen wir auf Kooperation und Diversität setzen.
Darwins Dilemmas
Was in der schwarzen Kiste versteckt ist
Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution.
Theodosius Dobzhansky, Evolutionsbiologe (1900–1975)
Einer der besten Zeitungscartoons, wie ich finde, stammt von Sidney Harris und wurde vor Jahren im New Yorker publiziert. Zwei ältere Wissenschaftler, leicht zu erkennen an der etwas gebückten Haltung, stehen tief konzentriert vor einer Kreidetafel. Es müssen theoretische Physiker sein. Die Tafel ist mit komplizierten mathematischen Gleichungen gefüllt, Zahlen, Brüchen und griechischen Symbolen. Offenbar versuchen die beiden ein epochales wissenschaftliches Problem zu knacken. Im Mittelpunkt der Herleitung steht allerdings in großen Buchstaben der Satz »Then a miracle occurs«, »Dann geschieht ein Wunder«. Einer der Wissenschaftler zeigt ruhig auf den zentralen »Herleitungsschritt« und kommentiert: »I think you should be more explicit here in step two«, »Ich glaube, Sie müssen hier im zweiten Schritt etwas expliziter sein.« Vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist der Cartoon aus Tagungsvorträgen bekannt. Insbesondere in der theoretischen Physik, die wie keine andere Disziplin auf mathematischen Gerüsten fußt, ist die Zeichnung sehr populär. Der Cartoon zeigt humorvoll, dass bei der Konstruktion wissenschaftlicher Theorien oftmals Lücken entstehen, weil zum Beispiel die experimentellen Befunde fehlen, die notwendige Technologie noch nicht entwickelt ist und man sich auf die Intuition verlässt, Annahmen macht oder im Extremfall einfach Teile der Gesamttheorie auslässt. Selbst exzellente Wissenschaftler nehmen in tiefer Überzeugung auch mal eine Lücke in ihrer Theorie in Kauf.
Cartoon aus dem New Yorker von Sidney Harris.
So wie die beiden Cartoon-Wissenschaftler mag sich Charles Darwin (1809–1882) in den letzten Jahren seines Lebens gefühlt haben. Darwin gilt als Begründer der Evolutionstheorie, der wissenschaftlichen Erklärung der Entstehung der Arten durch Variation und natürliche Auslese. Sein 1859 erschienenes Hauptwerk On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life,[2] kurz auch The Origin of Species, Die Entstehung der Arten, ist wahrscheinlich das einflussreichste naturwissenschaftliche Werk aller Zeiten. Darwins Evolutionstheorie gehört zu den größten intellektuellen Leistungen der Neuzeit. Ihr Einfluss auf Biologie, Sozialwissenschaften, gesellschaftliche Veränderungen, Grundüberzeugungen und Entwicklungen ist immens. Nicht selten landet Charles Darwin in Rankings der größten Wissenschaftler auf dem ersten Platz.
Die Darwin’sche Evolutionslehre ist außerordentlich plausibel, sie ist heutzutage ebenso Bestandteil des Biologieunterrichts wie Vererbung. Alle Lebewesen erzeugen Nachkommen. Die genetische Information der Eltern wird an sie weitergegeben. Durch Vermischung der Erbinformationen beider Eltern und Mutationen zeigen die Nachkommen Variabilität in ihren Merkmalen. Sind die neuen Merkmalsvariationen besser an die Umwelt angepasst, werden die Träger dieser Merkmale in der übernächsten Generation mehr Nachkommen erzeugen, damit haben sie einen Wettbewerbsvorteil und eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit. Das Prinzip der natürlichen Auslese. Es passt alles zusammen. Alles ganz rund.
Normalerweise denkt man bei Evolution und Entstehung neuer Arten an Prozesse, von denen wir nichts mitbekommen, weil sie sehr langsam, graduell über Jahrtausende und Jahrmillionen ablaufen. Während der Covid-19-Pandemie konnten wir Evolution allerdings live erleben. Zunächst breitete sich eine »Original«-Virusvariante aus, die Wuhan-Variante. Weil Viren, insbesondere RNA-Viren wie das Coronavirus, schnell mutieren, entstanden umgehend neue Varianten von SARS-CoV-2. Das Infektionsgeschehen übernahmen Varianten, die besser an uns als Wirt angepasst waren. Zunächst kam die Alpha-Variante, dann Beta, beide wurden von Delta verdrängt. Das griechische Alphabet wurde von der Pandemie im Stakkato aufgesagt, bis hin zu Omikron und verschiedenen Subvarianten. Die schlechter angepassten Varianten starben aus. Darwin’sche Evolution live. Survival of the Fittest. Weil Darwins Evolutionstheorie in der beschriebenen Kurzform so viele Beobachtungen erklärt, übersieht man leicht, dass ein paar fundamentale Fragen unbeantwortet bleiben. Er selbst war, wie wir gleich erfahren werden, mit seiner Theorie nie ganz zufrieden. Darwin hielt sie für lückenhaft. Das hat ihn bis zu seinem Tode genervt.
Die Naturalisten
Um einerseits den revolutionären Charakter der Evolutionstheorie und andererseits auch ihre Probleme zu verstehen, müssen wir den Kontext ihrer Entstehung unter die Lupe nehmen. Wir müssen uns die Evolution der Evolution anschauen. Tauchen wir also ein in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Lernen wir Charles Darwin und einige seiner Mitstreiter kennen. Europa, insbesondere Großbritannien, verwandelte sich zu Darwins Zeit rasend schnell. Die industrielle Revolution entfaltete sich besonders stark im Vereinigten Königreich. Von vielen wird dieses Viktorianische Zeitalter auch als Großbritanniens »Imperiales Jahrhundert« bezeichnet. Das Land war die führende Wirtschaftsmacht der Welt, technologischer, gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Fortschritt explodierten. Wohlhabende, gebildete Menschen entwickelten Reisefieber und gingen auf Entdeckungstouren. Der Berliner Naturforscher Alexander von Humboldt (1769–1859) bereiste Südamerika, die USA und Asien und war schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit. Die Wienerin Ida Pfeiffer (1797–1858) legte auf ihren Weltreisen mehr als 200000 Kilometer zurück, ihre Reiseberichte wurden in der gehobenen Gesellschaft zu Bestsellern. Auch für den jungen Charles Darwin sollte seine mehrjährige Weltreise mit der HMSBeagle ein Schlüsselerlebnis werden.
Charles Darwin war wie Humboldt ein Naturalist oder Naturforscher. Der Begriff Naturkunde war Ende des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts sehr weit gefasst, abgesehen von Politik oder kirchlichen Fragen gehörten selbst gesellschaftliche, ökonomische und soziale Themen oft zum Repertoire der Naturalisten. Hauptsächlich beschäftigten sie sich allerdings mit der Natur: Botanik, Zoologie, Geologie, Geografie, Mineralogie. Der Begriff Biologie, der erst 1766 geprägt wurde, war noch nicht in Mode. Anders als Experimentalisten gewannen Naturalisten ihre Erkenntnisse hauptsächlich aus genauen Naturbeobachtungen und nicht im Labor. Für diese Naturbeobachter waren Reisen die wichtigste Informationsquelle, sie machten Notizen, erstellten Zeichnungen, sammelten Pflanzen, Tiere, Mineralien, Fossilien und versuchten Zusammenhänge zu verstehen, aus Ähnlichkeiten Gesetzmäßigkeiten herzuleiten. Noch heute zeugen Museen wie das Natural History Museum in London oder das Naturkundemuseum in Berlin von den Aktivitäten der Naturalisten des 19. Jahrhunderts.[3]
Zu Darwins Zeit erklärte man sich die Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt durch die biblische Schöpfungsgeschichte: Gott schuf alle Tier- und Pflanzenarten praktisch gleichzeitig, wobei die maximale Diversität und Vielfalt erreicht wurde, jede Art füllt ihre Nische und passt genau in das Gesamtgefüge. Dass sich Arten über die Zeit verändern oder aussterben und neue Arten entstehen, war kein Teil der Story. Auch unter Wissenschaftlern war Kreationismus Mainstream. Die Evidenz aber wuchs, dass etwas mit dem etablierten Bild nicht stimmen konnte. Zahlreiche Fossilien zeugten von Arten, die längst ausgestorben waren. Um 1820 wurden die ersten Dinosaurierskelette ausgegraben. Darwin war nicht der einzige Wissenschaftler seiner Zeit, der sich mit dem Problem befasste.
Sichtbare Transmutationen: die Armskelette der Fledermaus (ganz links), des Wals, des Maulwurfs und des Menschen.
Dem französischen Naturalisten Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) wird die Entwicklung der ersten systematischen, durch Naturbeobachtungen entwickelten, in sich konsistenten Evolutionstheorie zuerkannt. Lamarck war der Auffassung, dass sich Arten über die Zeit wandeln können. Er nannte den Prozess Transmutation. Lamarck zufolge versuchen einzelne Tiere, sich an ihre Umwelt anzupassen, und verändern sich dabei individuell und graduell. Wie ein Muskel, der durch Training und physische Arbeit wächst. Diese während eines Lebens stattfindenden Änderungen und Anpassungen, so Lamarck, werden an die Nachkommen weitergegeben, die somit von Anfang an optimierte Merkmale haben. Diese Vererbungerworbener Eigenschaften ist zentraler Bestandteil des später nach ihm benannten Lamarckismus. Lamarcks Theorie war also eher eine Erklärung für die graduelle Verwandlung und Transformation existierender Arten als eine Theorie zur Entstehung neuer Arten. Lamarck publizierte seine Theorie 1809, im Geburtsjahr Darwins.
Darwins drei Säulen
Schon als junger Mensch machte Darwin sich ähnliche Gedanken. Als er 1831 seine Weltreise antrat, war er gerade einmal 22 Jahre alt und entwickelte in dieser Zeit seine eigene Evolutionstheorie. Darwins Wissen über die anatomischen und physiologischen Ähnlichkeiten verschiedener Tier- und Pflanzenarten sowie über Fossilien, seine Kenntnisse über Tier- und Pflanzenzucht waren Basis seiner Theorie, für die er auf seinen Reisen zahllose weitere Belege und Indizien sammelte. Im Kern postulierte Darwin, dass Evolution, die Wandlung und Entstehung neuer Arten, durch das Zusammenspiel von drei universell wirkenden Kräften entsteht.
Zum einen erzeugt jede Art durch Fortpflanzung viele Nachkommen, die in ihrer Erscheinung den Vorfahren ähneln. Erst das macht ja die Definition einer Art sinnvoll. Ein Frosch bekommt keine Esel, auch nicht umgekehrt. Die Merkmale einer Art werden an die nächste Generation weitergegeben und vererbt. Darwin wusste zwar noch nicht, wie das funktioniert, aber die Beobachtungen waren evident. Typischerweise ist die Anzahl der Nachkommen, die pro Individuum und Lebensspanne gezeugt werden, viel größer als eins. Eine ungebremste Fortpflanzung aber würde die Gesamtpopulation einer ausgewählten Art exponentiell explodieren lassen, wie ein kurzes Beispiel illustriert: Eine Fruchtfliege wiegt ungefähr ein Milligramm, ein Weibchen produziert in ihrer Lebensspanne von 20 bis 30 Tagen ca. 500 bis 600 Eier. Würden sich in jeder Generation alle Eier zu erwachsenen Fliegen entwickeln, die wiederum je 500 bis 600 Nachkommen zeugten, ergäbe sich nach nur einem Jahr eine gigantische Fruchtfliegenpopulation mit der Gesamtmasse unseres Planeten. Darwin selbst stellt in seinem Werk einige dieser lustigen Rechnungen an. Folglich existieren begrenzende Faktoren, die den Fruchtfliegen (und allen anderen Arten) Einhalt gebieten. Weil die zur Fortpflanzung notwendigen Ressourcen begrenzt sind oder eine Art selbst Ressource (Futter) für eine andere Art darstellt, entsteht automatisch ein Wettstreit, nicht nur zwischen Individuen einer Art, sondern auch zwischen Arten, die auf dieselben Ressourcen zugreifen. Darwin nannte das den »Struggle for Life«, also den »Kampf ums Überleben«. Nur Individuen, die am besten an ihre Umwelt angepasst sind, überleben und können sich vermehren. Dieses zweite wichtige Konzept war für Darwin so zentral, dass es im Titel seines Hauptwerks auftaucht. Besonderen Einfluss auf Darwin hatte hier der britische Ökonom Thomas Robert Malthus (1766–1834), dessen Arbeiten Darwin bewunderte. Malthus wurde durch sein Bevölkerungsgesetz bekannt, wonach die Bevölkerung eines Landes exponentiell wächst, die notwendigen Ressourcen aber (zum Beispiel aus der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion) nur linear. Somit kommt es zwangsläufig zu Engpässen, diese führen zu gesellschaftlichen Spannungen, Unruhen oder sogar zum Kollaps einer Gesellschaft, was wiederum das Bevölkerungswachstum hemmt. Dieses malthusische Prinzip legte Darwin seiner Theorie zugrunde. Das ist erwähnenswert, weil hier schon früh ein ökonomisches Prinzip einen Fingerabdruck in einer naturwissenschaftlichen Theorie hinterlassen hat.
Drittens postulierte er, dass die Nachkommen einer Art immer ein gewisses Maß an Variation in den vererbten Merkmalen aufweisen. Darwin ging zunächst davon aus, dass diese Variationen klein und zufällig sind. In der Generation der Nachkommen erzeugen Individuen mit besser an die Umwelt angepassten Merkmalsvariationen logischerweise mehr Nachkommen und dominieren nach einigen Generationen das Gesamtgeschehen. Im Wettstreit um dieselben Ressourcen überleben die am besten angepassten Arten, die weniger angepassten werden verdrängt und sterben aus. Der wesentliche Unterschied zu Lamarck ist, dass die Variation Darwin zufolge zufällig ist, also nicht in irgendeiner Weise durch erworbene Erfahrung in die optimierte Richtung zielt. Darwins Zeitgenosse, der Sozialwissenschaftler Herbert Spencer (1820–1903), der Darwins Ideen später auf sozialwissenschaftliche Prozesse übertrug, prägte das Konzept »Survival of the Fittest«, das Darwin in späteren Auflagen seiner Werke übernahm. Darwin verstand unter dem Begriff »fit« »passend«. Im Deutschen wird die Phrase manchmal, und leider komplett falsch, als »Überleben des Stärkeren« aufgefasst, was Darwin nie so meinte. Darwin schrieb explizit: »Bei der Evolution gewinnt nicht der Stärkste, der Größte oder der Schnellste, sondern die Spezies, die sich am schnellsten anpassen kann.«
Für Darwin lag die natürliche Auslese auf der Hand, und sie ist sicher auch das am einfachsten zu verstehende Prinzip. Kleine Variationen in Merkmalen führen zu kleinen Wettbewerbsvorteilen und summieren sich über die Generationen, bis eine evolvierte Art keine Ähnlichkeit mehr mit ihrer ursprünglichen Art hat. Darwin hatte wie Lamarck langsame, graduelle Änderungen existierender Arten im Sinn. Tatsächlich ist in dieser Hinsicht der Titel seines Werks Die Entstehung der Arten etwas irreführend. Darwins Evolutionstheorie beschreibt lediglich die graduelle Änderung bestehender Merkmale und damit den stetigen Wandel und nicht, wie neue Arten mit völlig neuen Merkmalen entstehen. Es kann nur selektiert werden, was schon da ist. Obwohl Darwin überzeugt war, dass alle Lebensformen einen einzigen Ursprung hatten, thematisiert er interessanterweise an keiner Stelle die Herausbildung neuer Arten direkt.
And then a miracle occurs
Darwin irritierten bis zu seinem Lebensende einige Schwachstellen seiner Theorie. Zum einen war da die Frage, nach welchem Mechanismus die notwendigen Variationen entstehen und an die Nachkommen weitergegeben werden. Das war für Darwin der »Dann geschieht ein Wunder«-Zwischenschritt, er hatte noch keine Ahnung von Chromosomen, Genen, DNA und genetischen Mutationen.
Zweitens ließ sich das Prinzip des graduellen Wandels nicht mit wichtigen Befunden zur Artenvielfalt in Einklang bringen. Darwin war geologisch auf der Höhe seiner Zeit, er kannte die Fossilienfunde und wusste so, dass im Laufe der Evolution viele Arten ausgestorben waren. Ihm war auch bekannt, dass vor etwa 540 Millionen Jahren im Kambrium viele Arten ganz plötzlich in erdgeschichtlich relativ kurzer Zeit entstanden sind, während man in tieferen (älteren) Gesteinen keine Fossilien finden konnte. Heute spricht man von der kambrischen Explosion, als in wenigen Millionen Jahren praktisch alle heute existierenden Tierstämme zum ersten Mal auftraten. Darwin war klar, dass dieses Geschehen nicht durch graduelle Evolution erklärbar ist. In seinem Werk schreibt er dazu:
»Wenn meine Theorie richtig, so müssten unbestreitbar schon vor Ablagerung der ältesten silurischen Schichten eben so lange oder noch längere Zeiträume, wie nachher, verflossen, und müsste die Erd-Oberfläche während dieser ganz unbekannten Zeiträume von lebenden Geschöpfen bewohnt gewesen seyn.
Was nun die Frage betrifft, warum wir aus diesen weiten Primordial-Perioden keine Denkmäler mehr finden, so kann ich darauf keine genügende Antwort geben. […]
Diese Thatsache muss fürerst unerklärt bleiben und wird mit Recht als eine wesentliche Einrede gegen die hier entwickelten Ansichten hervorgehoben werden.«[4]
Außerdem war auch Darwin klar, dass komplexe Organe vieler Lebewesen, wie zum Beispiel das Auge, nur schwer durch graduelle Entwicklung und als die Summe zufälliger Variation und Selektion erklärbar sind, weil die notwendigen Zwischenstufen keine Wettbewerbsvorteile böten und folglich nicht selektiert würden. Darwin schrieb dazu:
»Die Annahme, dass sogar das Auge mit allen seinen der Nachahmung unerreichbaren Vorrichtungen, um den Focus den manchfaltigsten Entfernungen anzupassen, verschiedene Licht-Mengen zuzulassen und die sphärische und chromatische Abweichung zu verbessern, nur durch Natürliche Züchtung zu dem geworden seye, was es ist, scheint, ich will es offen gestehen, im höchsten möglichen Grade absurd zu seyn.«[5]
Lag es an diesen offenen Fragen, warum zwischen Darwins Ideen um 1830 und der Veröffentlichung seines Werks mehr als ein Vierteljahrhundert verging? Vielleicht wären sie nie publiziert worden, hätte nicht Alfred Russel Wallace (1823–1913) die wissenschaftliche Bühne betreten. Er war wie Darwin Naturalist. Wallace, so weiß man heute, entwickelte unabhängig von Darwin seine eigene Evolutionstheorie, die auf denselben Annahmen beruht. Und wie Darwin hatte Wallace seinen Heureka-Moment während einer Weltreise. Von Ternate, einer kleinen Insel, die heute zu Indonesien gehört, schickte er 1858 ein Manuskript mit dem Titel »Über die Neigung der Varietäten, sich unbegrenzt vom ursprünglichen Typus zu entfernen« über Umwege an Charles Darwin. Der erkannte die Ähnlichkeit der beiden Abhandlungen, was ihn etwas unter Druck setzte, seine Evolutionstheorie endlich zu veröffentlichen. Letztlich wurden die Schriften zeitgleich publiziert. Wallace und Darwin sind so ebenbürtige Erfinder der Evolutionstheorie. Wallace wurde später zu einem glühenden Verfechter Darwins und prägte selbst den Begriff »Darwinismus« für die Entstehung der Arten durch natürliche Auslese. So hat er vermutlich dazu beigetragen, dass außerhalb von Fachkreisen sein eigener Name im Kontext der Evolutionslehre praktisch unbekannt ist.
Dachten sich die Evolutionstheorie aus: Alfred Russel Wallace (1823–1913) und Charles Robert Darwin (1809–1882).
Auch wenn ihre Theorien deckungsgleich waren, hoben beide unterschiedliche Aspekte hervor. Während Darwin den »Kampf ums Überleben« in den Fokus stellte, betonte Wallace die durch Selektion erwirkte Anpassung an die Umwelt. Wallace gab diesem Umwelteinfluss einen viel höheren Stellenwert. Es sollte jedoch ein ganzes Jahrhundert dauern, bis die wichtige Rolle der Umwelt auf Evolutionsprozesse in den Vordergrund rückte.
Modern Synthesis
Bis zum Ende des 19. und noch in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war der Darwinismus hochumstritten. Dass Evolution stattfindet, war zwar akzeptiert. Als unbewiesen aber galt, dass natürliche Auslese ihr Motor ist.
Ende des 19. Jahrhunderts führte der österreichische Mönch Gregor Mendel (1822–1884) systematische Experimente mit Kreuzungen von Erbsenpflanzen durch. Er entdeckte, dass die Vererbung bestimmter Merkmale, wie zum Beispiel der Blütenfarbe oder der Schotenform, festen Regeln folgt, und schloss daraus, dass sie durch »diskrete Informationspakete« bestimmt wird, die er Faktoren bzw. Elemente nannte. Später wurde der Begriff Gen geprägt, den Mendel noch nicht benutzte.
Mendels Experimente waren reproduzierbar, heute noch sind die nach ihm benannten Regeln Bestandteil des Biologieunterrichts. Mendel gilt als Begründer der Genetik. Seine Ergebnisse publizierte er 1866, allerdings blieben sie lange unbeachtet und waren beispielsweise Darwin und Wallace unbekannt. Erst 1900 wurden sie wiederentdeckt, als der niederländische Biologe Hugo Marie de Vries (1848–1935) ähnliche Experimente durchführte und im Rahmen seiner Forschung auf Mendels Publikation aufmerksam wurde. Dank der frühen Erfolge der Populationsgenetik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts konnte sich der von Darwin und Wallace formulierte Prozess der natürlichen Selektion etablieren. Die Synthese zwischen ihrer Evolutionstheorie und der Vererbungslehre Mendels war so fundamental, dass man den Begriff »Modern Synthesis«, im Deutschen »synthetische Evolutionstheorie«, dafür prägte.
Zur selben Zeit etwa wurde Lamarcks Idee der Vererbung erworbener Eigenschaften verworfen. In bahnbrechenden Experimenten konnte der deutsche Genetiker August Weismann (1834–1914) zeigen, dass nur die Gene in den Keimzellen eines Organismus, also den Samen- und Eizellen, neu gemischt und in verschiedenen Kombinationen an die nächste Generation weitergegeben werden. Aus den Genen entsteht der Organismus, eine Wirkung des Organismus auf die Gene existiert demzufolge nicht. Man sprach vom Genotyp und Phänotyp eines Organismus. Der Genotyp beschreibt die abstrakte genetische Information, den vererbbaren Bauplan. Der Phänotyp steht für den fertigen Organismus, also die Umsetzung des Bauplans. Die vermeintlich finale Vervollständigung der Theorie kam mit der Entdeckung der DNA als Träger der Erbinformation durch Rosalind Franklin, James Watson und Francis Crick1953. Seit dieser Zeit ist klar, dass die Erbinformation aller Lebewesen, vom kleinsten Bakterium bis zum Menschen, auf langen Kettenmolekülen, der DNA, kodiert ist. Einzelne Abschnitte der DNA entsprechen den von Mendel postulierten Elementen, den Genen. Wir wissen, dass Mutationen in unseren Genen zu Variation führen können. Genome verschiedener Arten und Individuen unterscheiden sich auf molekularer Ebene in der Abfolge des genetischen Codes der DNA. Ähnlichkeiten zwischen Genomen führen zu Ähnlichkeiten im Phänotyp. Eineiige Zwillinge sind oft schwer zu unterscheiden, die Verwandtschaft zwischen Eltern und ihren Kindern ist häufig offenkundig. Je unterschiedlicher die DNA, desto unterschiedlicher der Phänotyp eines Organismus. Das menschliche Genom ähnelt dem eines Schimpansen viel mehr als dem einer Heuschrecke oder einer Tulpe.
Der synthetischen Evolutionstheorie zufolge finden Variation und Selektion auf verschiedenen Ebenen statt. Variation wird genetisch erzeugt und führt zu unterschiedlichen Phänotypen, auf deren Ebene die Selektion erfolgt.
Die schwarze Kiste
Die Theorie scheint schlüssig und vollständig. Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings auf, dass etwas Zentrales fehlt, ein Zwischenglied. Ähnlich wie im anfangs erwähnten Cartoon findet »irgendwo in der Mitte« ein Wunder statt, auf das die synthetische Evolutionsbiologie und Populationsgenetik nicht eingehen: Wie genau wird aus dem Bauplan der Organismus? Man sah den Bauplan und einen fertigen Organismus, verstand aber die Sprache nicht, in der dieser Bauplan verfasst war, und wie die Umsetzung, der Bau selbst, stattfand. Heute wissen wir schon etwas mehr, aber längst nicht alles. Aus den Genen der DNA werden nach einem genauen Rezept Proteine synthetisiert. Das menschliche Genom besteht aus etwa 23000 Genen, die ca. 100000 Proteine kodieren. Diese komplexen Biomoleküle sind die biologischen Bausteine und chemischen Arbeitstiere des Lebens. Das Zusammenspiel der Proteine regelt die Entstehung, das Wachstum und das Handeln eines Organismus.
DNA geht durch die schwarze Kiste und es entsteht ein Organismus.
Dass Gene Proteine kodieren, verlagert die zentrale Frage der Formentstehung aber nur. Wie aus einer befruchteten Eizelle ein komplexer Organismus gebaut werden kann, ist weiter unbeantwortet. Dazu müsste man das biochemische Orchester der Proteine genau verstehen und wie sich aus dem Netzwerk und den Kaskaden biochemischer Reaktionen alles entwickelt. Selbst wenn wir genau wüssten, welche 100000 Proteine ein menschliches Genom kodiert, würde kein Mensch dabei rauskommen, wenn wir diese 100000 Zutaten in einem Kessel zusammenrührten.
Die frühen Populationsgenetiker maßen diesem Rätsel keine große Bedeutung bei, es wurde quasi in die Entwicklungsbiologie ausgelagert. Die synthetische Evolutionstheorie beruht auf der Annahme, dass das halt irgendwie passiert – »Then a miracle occurs«. Letztendlich komme es nur darauf an, welche Gene sich in einem Genpool durchsetzen. Diese Schwäche wurde und wird manchmal heute noch von Neodarwinisten etwas leichtfertig abgetan. In ihrer traditionellen Auslegung beinhaltet die synthetische Evolutionsbiologie eine »Black Box«, deren Funktionsweise sie als gegeben hinnimmt.
Die frühen Erfolge der Populationsgenetik verschleierten, dass »Modern Synthesis« und Neodarwinismus immer noch nicht das Problem lösen, das schon Darwin erkannt hatte: Wie findet Innovation in der Evolution statt? Wie entstehen Strukturen wie das Auge, wie kam es zu dem plötzlichen Auftreten neuer, komplexer Tierarten in der kambrischen Explosion? Kleine Änderungen in der DNA durch Mutationen führen zu kleinen Änderungen in den Proteinen und ziehen im Netzwerk biochemischer Reaktionen kleine Änderungen nach sich. Wenn durch die Summe dieser kleinen Änderungen neue Strukturen entstehen, wo sind dann die Überreste der Zwischenstufen in den Fossilien? Diese Fragen, die Darwin noch intensiv beschäftigten, traten leider in den Hintergrund, es entwickelte sich der »gen-zentrische« Blick auf die Evolution. Aus dieser Sicht ist der Organismus selbst nur ein Werkzeug, eine Kapsel, die durch den Bauplan so konzipiert ist, dass ein Gen nicht ausstirbt. Der Organismus ist für das Gen da. Diese Sichtweise trieb zum Beispiel der Evolutionsbiologe und Neodarwinist Richard Dawkins in seinem Bestseller The Selfish Gene,Das egoistische Gen von 1976 auf die Spitze.
Die Natur ist konservativ. Viele ihrer Erfindungen gibt es noch heute.
Wandel und Konservierung
Leben existiert seit ca. 4,28 Milliarden Jahren auf der Erde. Man schätzt, dass in dieser Zeit bis zu vier Milliarden Arten lebten, von denen bis heute mehr als 99 Prozent ausgestorben sind, manchmal durch zeitlich punktuelle Massenaussterben, so etwa vor ca. 60 Millionen Jahren, als die Dinosaurier verschwanden. Alles ist permanenter Wandel. So weit macht das alles Sinn. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Neben dem Wandel, dem Kommen und Gehen der Arten und einzelner Organismen, die geboren werden und sterben, hat die Evolution außerordentlich erfolgreiche Innovationen hervorgebracht, die teilweise über Jahrmilliarden nicht wieder verschwunden sind. Die ersten Lebensformen hatten Ähnlichkeiten mit Bakterien, also einfachen Zellen, deren Erbgut aus DNA bestand und die sich durch Zellteilung vermehrten. Bakterien evolvierten und existieren bis heute (sie dominieren sogar die Biosphäre, wie wir noch erfahren werden). Vor etwa 3,4 bis 2,9 Milliarden Jahren erfand die Evolutionoxygene Photosynthese, den biochemischen Prozess, bei dem aus Sonnenlicht Energie gewonnen und Sauerstoff als Reaktionsprodukt erzeugt wird. Etwas später entwickelte sich »atmendes« Leben, das den Sauerstoff zur Verbrennung organischen Materials als Energiequelle nutzte. Die ersten Einzeller mit komplexer Zellstruktur und Vorläufer der Tiere, Pflanzen und Pilze betraten vor ca. 2,2 Milliarden Jahren die Bühne und existieren seitdem in ungeheurer Artenvielfalt. Die kambrische Explosion brachte eine enorme Biodiversität komplexer Tiere mit hochdifferenzierten Bauplänen. Fast alle der 36 heute existierenden Tierstämme entwickelten sich damals in kürzester Zeit und blieben in ihren zentralen Strukturmerkmalen unverändert. Sogenannte lebende Fossilien haben sich über Hunderte von Millionen Jahren kaum gewandelt, die Krokodile etwa seit 200 Millionen Jahren oder seit 400 Millionen Jahren der Quastenflosser, der als längst ausgestorben galt und 1938 wiederentdeckt wurde. Störe sahen vor 200 Millionen Jahren so aus wie heute. Pfeilschwanzkrebse bevölkern seit 450 Millionen Jahren unseren Planeten. Die Liste ist lang. Neben permanentem Wandel zeichnet sich die Evolution folglich auf allen Ebenen durch erstaunlich robuste Konservierung erfolgreicher Konzepte aus, die auch massive Umweltänderungen überlebten.
Außerdem erklärt die traditionelle Evolutionstheorie nur mit Mühe die enorme Biodiversität. Wieso gibt es so viele Arten? Wieso sind viele außerordentlich unterschiedliche Biotope so artenreich? Seit einem Jahrhundert stellen sich Naturalisten diese Frage. Insbesondere die Artenvielfalt tropischer Regenwälder ist unfassbar. In den Regenwäldern des Amazonas ist die Pflanzenvielfalt gigantisch. Im Durchschnitt findet man auf einem Quadratkilometer nur ein Exemplar einer Pflanzenart. Etliche Evolutionsbiologen erklären Artbildung und Diversität wie Darwin selbst hauptsächlich mit geografischen Grenzen und anderen äußeren Faktoren, die Populationen voneinander trennen, sodass sie eigenständige Evolutionslinien bilden. Aber reicht das aus? Die klassischen Mechanismen der Evolution beinhalten schließlich auch schon das am Beispiel von SARS-CoV-2 beschriebene Konkurrenzausschlussprinzip. Der russische Mikrobiologe Georgi Gause (1910–1986) zeigte, dass zwei verschiedene Arten, die auf dieselbe Ressource angewiesen sind (also beispielsweise ein ähnliches Nahrungsspektrum haben), nie dauerhaft dieselbe ökologische Nische besetzen können.
Werden Populationen räumlich getrennt, müsste man annehmen, dass die einzelnen Gruppen sich zwar voneinander unterscheiden, aber innerhalb einer Population Homogenität herrscht. Das entspricht aber nicht der Realität. Der Biologe und Begründer der modernen Ökologie George Hutchinson (1903–1991) formulierte in diesem Kontext das berühmte Plankton-Paradoxon, wonach in marinen Ökosystemen eine deutlich höhere Diversität des photosynthetischen Planktons beobachtet wird, als man erwarten würde, nachdem ganz viele Arten dort die gleiche ökologische Nische besetzen und nicht räumlich voneinander getrennt sind. Bis heute wird diskutiert, wie diese planktonische Artenvielfalt zustande kommen kann, im Kapitel »Nette Viren« werden wir einen Erklärungsversuch unternehmen.
Rebellion
Trotz all dieser offenen Fragen war die dogmatische Seite der Neodarwinisten bis in die 70er-Jahre etabliert und hat sich neuen Entwicklungen widersetzt. Doch vor allem nach der Jahrtausendwende änderte sich die Lage rapide, als nachgewiesen wurde, dass erst die Wechselwirkung der Gene untereinander die Form eines Organismus bestimmt. Die Forschung der deutschen Entwicklungsbiologin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard an Embryonen der Fruchtfliege zeigte, dass die komplexe Architektur einer Fliege nur durch das wechselseitige An- und Ausschalten verschiedener Gene entstehen kann. Außerdem wurde experimentell immer deutlicher, dass äußere Bedingungen auf dem Weg vom Genom zum ausgewachsenen Organismus eine fundamentale Rolle spielen können. Gerade bei komplexen Lebewesen wie Tieren und Pflanzen modulieren Umwelteinflüsse, welche Gene aktiv und welche inaktiv sind. Es entwickelte sich so die evolutionäre Entwicklungsbiologie, auch kurz »Evo-Devo« genannt. Eine ihrer Pionierinnen ist die amerikanische Evolutionsbiologin und Insektenforscherin Mary Jane West-Eberhard. Sie trat sehr früh für eine »erweiterte synthetische Evolutionstheorie« ein und fasste in ihrem Hauptwerk viele Beispiele zusammen, wie Organismen trotz identischer Genome einen anderen Phänotyp ausbilden und welch starken Einfluss die Umgebung ausübt. Es waren nicht mehr nur die Gene, die den Organismus steuern, der Organismus steuert auch die Gene! Einer der bekanntesten Vertreter dieser Ansicht ist der britische Biologe und Physiologe Denis Noble, der als Begründer der Systembiologie gilt. Systembiologie ist die systemische Betrachtung komplexer biologischer Phänomene, die Rückkopplungs- und Netzwerkstrukturen ins Zentrum stellt. In seinem 2008 erschienenen Buch The Music of Life stellt er den radikalen, gen-zentrierten und engen Blickwinkel der Neodarwinisten infrage. Er kritisiert die anthropozentrische Aufladung der neodarwinistischen Argumentation und die einseitige Betonung von Kontrolle, Macht und Wettstreit. Stattdessen rückt Noble den Organismus in den Vordergrund und sieht die Gene eher als Werkzeugkiste, die einem Organismus zur Verfügung steht.
Neodarwinismus und Systembiologie.
Die größte Verfechterin eines erweiterten Blickwinkels auf Evolutionsprozesse und eine Verlagerung des Fokus von Konkurrenz und Kampf ums Überleben auf Kooperation und Diversität war die Evolutions- und Mikrobiologin Lynn Margulis (1938–2011). Margulis war eine wissenschaftliche Rebellin. 1966 publizierte sie die Theorie der Endosymbiogenese. In Alltagssprache übertragen bedeutet dieser Fachbegriff: »Prozess, bei dem ein Einzeller einen völlig anderen Einzeller verschluckt, beide symbiotisch verschmelzen, ihre Fähigkeiten teilen, kooperieren und fortan eine ganz neue Art bilden.« Innovation durch Kooperation. Klingt etwas verrückt. Aber laut Margulis sollen so vor etwa 2,2 Milliarden Jahren die einzelligen Vorfahren aller Tiere, Pflanzen und Pilze entstanden sein. Endosymbiogenese liegt demnach der Erfindung ganzer Domänen und neuen Evolutionslinien zugrunde. Wir werden im Kapitel »Asgard« noch mehr über diesen wichtigen Schritt in der Evolution erfahren.
Margulis war der Auffassung, dass die Betonung von Konkurrenz in Evolutionsprozessen die Realität verzerrt. Sie schrieb einmal: »Life did not take over the globe by combat, but by networking«, »Das Leben eroberte den Erdball nicht durch Kampf, sondern durch Netzwerken.« Kooperation und Netzwerke werden wir im nächsten Kapitel genauer kennenlernen, wenn wir in die Welt der Bakterien eintauchen. Wir werden erkennen, dass die Rebellin richtiglag.
Kleine Helfer
Sie sind sie, nicht Sie
Wir waren nie Individuen.
Jan Sapp, Wissenschaftshistoriker
Isaac Newton (1643–1727) war ein Arschloch. So jedenfalls der Titel der Biografie Newton – Wie ein Arschloch das Universum neu erfand von Florian Freistetter. Als theoretischer Physiker empfehle ich dieses sehr unterhaltsame Buch ausdrücklich. Als ich 1989 an der Duke University in den USA Physik studierte, die Vorlesung »Klassische [also Newton’sche] Mechanik« hörte, beschrieb mein damaliger Professor Larry Evans die Charaktereigenschaften Newtons diplomatischer: »Newton wasn’t the kind of guy you’d want to go out and have a beer with«, »Newton war nicht der Typ, mit dem man ein Bier trinken geht.«
Isaac Newton war kein angenehmer Zeitgenosse, er konnte nicht mit Kritik umgehen, war missgünstig, hinterhältig, intransparent, geizig, hartherzig, hasserfüllt und brutal. Er lieferte sich Fehden mit berühmten Zeitgenossen wie Robert Hooke (1635–1703). Ihm klaute Newton zum Beispiel die Idee, dass die Gravitationskraft mit dem inversen Abstandsquadrat zweier Körper abnimmt, um damit (ohne Hooke zu erwähnen) die Kepler’schen Gesetze der planetaren Bewegung zu erklären. Mit seinem deutschen Mathematiker-Rivalen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) lieferte er sich einen erbitterten Streit, wer von beiden die Infinitesimalrechnung erfunden hatte. Dabei nutzte Newton seine Stellung als Präsident der Royal Society, um Leibniz im Vereinigten Königreich zu diskreditieren. Die Infinitesimalrechnung war einer der größten konzeptionellen Fortschritte in der Mathematik und erlaubte Rechnungen, die davor unmöglich waren. Heute wissen wir, dass Newton deutlich früher als Leibniz darauf gekommen war. Sein Wissen hielt er aber geheim, um es als Einziger nutzen zu können. Dennoch war Isaac Newton ein Genie, das die Welt veränderte. Albert Einsteins Büro schmückte ein Newton-Porträt. Einstein hielt Newtons Entwicklung der Infinitesimalrechnung, seine Theorie zur Gravitation und sein Fundament zur Mechanik für den größten intellektuellen Fortschritt, der auf eine einzige Person zurückgeht. Wir kennen das Klischee von Genie und Wahnsinn. Genie und Arschloch ist weniger geläufig, scheint aber auch in regelmäßigen Abständen aufzutreten.
Der Koch
Ein anderes prominentes Beispiel ist Robert Koch (1843–1910). Was Newton für die Physik ist, ist Koch für die Infektionsforschung, die medizinische Mikrobiologie oder sogar für die Medizin allgemein. Koch gilt neben Louis Pasteur (1822–1895) und Ferdinand Julius Cohn (1828–1898) als Begründer der Mikrobiologie. Koch und Pasteur waren maßgeblich für die Entwicklung der Bakteriologie Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Koch war wie Newton ein Genie und Multitalent. Zu Kochs Zeit setzte sich langsam, gegen die Widerstände des wissenschaftlichen Establishments, die Keimtheorie durch. Diese besagt, dass viele Krankheiten bei Mensch und Tier durch Mikroorganismen verursacht werden. Was heutzutage jedem Kind bekannt ist, war damals eine revolutionäre Ansicht, die zum Beispiel Louis Pasteur vertrat. Robert Koch allerdings gelang es als Erstem, einen bakteriellen Krankheitserreger zu isolieren und in glasklaren, reproduzierbaren Experimenten nachzuweisen, dass bestimmte Bakterien eine bestimmte Krankheit auslösen. 1867 isolierte er Bacillus anthracis, den Erreger von Anthrax, auch Milzbrand genannt. Auf Nährmedien konnte er diese Bakterien kultivieren und zeigen, dass damit infizierte Tiere Milzbrand entwickelten. Es gelang ihm, aus den erkrankten Tieren den Erreger wieder zu isolieren. Neben seinen Entdeckungen verbesserte er die Mikroskopietechnik seiner Zeit substanziell. Er war 1877 auch der Erste, der einen Krankheitserreger fotografierte.[1]
Das erste Foto bakterieller Krankheitserreger hat Koch geschossen. Die Stäbchen zeigen den Erreger Bacillus anthracis.
Seine Methode, Bakterien in kleinen Schälchen auf festen Nährböden zu kultivieren, wurde von seinem Assistenten Julius Petri verfeinert, die nach ihm benannten Petrischalen werden noch heute, 150 Jahre später, praktisch unverändert in biologischen und medizinischen Laboren verwendet. Kurze Zeit nach der Entdeckung von Anthrax widmete sich Koch der Tuberkulose und stellte die Entdeckung des verantwortlichen Erregers Mycobacterium tuberculosis1882 auf einem Kongress in Berlin vor.
Petrischale mit Nährsubstrat – auch heute noch sehr beliebt.
Diese Präsentation gilt bis heute als eine der einflussreichsten in der gesamten Medizingeschichte. An Tuberkulose starben Ende des 19. Jahrhunderts etwa 15 Prozent aller Menschen in Europa. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Kochs Entdeckung ihn schlagartig weltweit berühmt machte. Er stellte die Koch’schen Postulate zum Nachweis von bakteriellen Krankheitserregern auf. Sie sind für die medizinische Bakteriologie, was die Newton’schen Gesetze für die klassische Physik sind. Koch läutete die »goldene Ära« der Mikrobiologie ein. In den letzten drei Jahrzehnten seines Lebens identifizierten er und viele seiner später gleichfalls erfolgreichen Schüler etwa 20 Erreger von damals schlimm wütenden Infektionskrankheiten. Unbestritten hat Kochs Wissenschaft viele Millionen Menschenleben gerettet. Dennoch war auch er ein schwieriger Zeitgenosse. Besonders der Konflikt mit dem ebenso berühmten Louis Pasteur ist legendär. Letzterem warf er zweifelhafte wissenschaftliche Expertise vor und prangerte seine Ergebnisse an, schließlich sei Pasteur kein Mediziner und habe keine Ahnung. Koch versuchte gegen Tuberkulose ein Medikament zu entwickeln, das Tuberkulin, und probierte es an seiner zweiten Frau Hedwig Koch aus (als sie noch seine Geliebte war). In ihrer Autobiografie berichtet sie, dass ihr Gatte sie sinngemäß aufforderte: »Nimm das mal, es wird sehr schmerzhaft. Sterben wirst du daran aber wahrscheinlich nicht.« Obwohl Tuberkulin nicht wie erhofft funktionierte, die ersten Behandelten sogar starben, war das Interesse daran groß. Koch aber wollte die Rezeptur zunächst geheim halten, um als Einziger davon finanziell zu profitieren. Erst unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit gab er sie preis. Das alles wurde zum Tuberkulinskandal. Kochs Intoleranz gegenüber abweichenden Ansichten war besonders ausgeprägt. Für ihn waren Bakterien Krankheitserreger, die es abzutöten galt. Andere Forschungen zum Thema, breitere, vielschichtigere Perspektiven? Davon wollte Koch nichts wissen. Bis heute sind wir durch seine Sicht auf Mikroben geprägt.
Parallel zum Koch’schen Dogma »Bakterien = Krankheitserreger« entwickelte sich aber in den Niederlanden die Delfter Schule, die eine ganz andere Position vertrat. Unter der Leitung des russischen Mikrobiologen Sergei Winogradski (1856–1953) und des Niederländers Martinus Beijerinck (1851–1931) interessierte man sich dort viel stärker für ökologische Funktionen und die Rolle, die Mikroben bei der Umsetzung organischen Materials spielen und somit das Fundament allen Lebens bilden. Sie erforschten, wie Bakterien beim Gärungs- und Fäulnisprozess aus totem organischem Material wieder Nährboden herstellen. Winogradski und Beijerinck betonten also die wichtigen kooperativen Funktionen der Mikroorganismen für funktionierende, vernetzte Ökosysteme.
Die enormen Erfolge Kochs bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten führten aber dazu, dass seine Schüler als Mikrobiologen die einflussreichen akademischen Positionen besetzten, Fördergelder bekamen, Editoren und Herausgeber der wissenschaftlichen Zeitschriften wurden, sodass sich letztendlich ihre Sichtweise als wissenschaftlicher Mainstream durchsetzte: Bakterien verursachen Krankheiten, sie müssen durch Hygiene und Antibiotika bekämpft und am besten ausgerottet werden. Noch heute haben Bakterien gesellschaftlich einen schweren Stand, die meisten Menschen halten sie für unsympathische Organismen und Krankheitserreger.
Glücklicherweise hat sich diese Einschätzung seit der Jahrtausendwende verändert. Kochs Dogma zerbröselt und wird teilweise ins Gegenteil verkehrt. Um diese Revolution gänzlich nachvollziehen zu können, müssen wir diese kleinen faszinierenden Lebewesen näher kennenlernen.
Prokaryoten und Eukaryoten
Im Biologieunterricht lernt man, dass alle Lebewesen aus biologischen Zellen bestehen. Vom Einzeller bis zum Menschen. Sie und ich bestehen aus etwa 37 Billionen Zellen, gewachsen aus einer einzigen befruchteten Eizelle. Das sind 37000000000000 Zellen, also eine beträchtliche Anzahl.
Tiere, Pflanzen und Pilze klassifiziert man aufgrund ihrer Zellstruktur als Eukaryoten, was übersetzt so viel heißt wie »richtiger Kern«. Zu den Eukaryoten gehört auch die außerordentlich artenreiche Gruppe der Protisten, diverse Einzeller mit komplexer Zellstruktur, die einen wesentlichen Teil der eukaryotischen Artenvielfalt ausmachen.
Eukaryotische Zellen besitzen einen Zellkern, quasi eine Zelle in der Zelle, die das Erbgut, die DNA, in Form von Chromosomen gut verpackt enthält. Zellen sind in der Regel klein. Eine pflanzliche Zelle hat typischerweise einen Durchmesser von 0,01 bis 0,1 Millimeter. Gewöhnliche tierische Zellen sind noch kleiner.
Prokaryotische und eukaryotische Zellen.
Im Vergleich zu den Eukaryoten sind die Bakterien einfacher strukturiert. Sie haben keinen Zellkern und gehören deshalb zu den Prokaryoten, übersetzt »Vor«-Kern. Sie sind in der Regel auch noch viel kleiner, 0,001 bis 0,01 Millimeter. Damit Sie sich diese Zahlen nicht merken müssen: Die Größenverhältnisse zwischen Pflanzenzellen, tierischen Zellen und Bakterien sind wie Einfamilienhaus, PKW und Suppenkelle.
Bakterielle DNA schwimmt lose als langes, zu einem Ring geschlossenes Kettenmolekül im Zellinneren umher. Aufgrund ihres vergleichsweise simplen Bauplans postulierte man ganz richtig, dass die Prokaryoten zu den ersten Lebensformen gehörten, also »vor« den Eukaryoten unsere Erde bewohnten. Außerdem vermehren sie sich ganz anders. Während bei Eukaryoten sexuelle Fortpflanzung populär ist (zwei Keimzellen vereinen ihr Erbgut und schaffen so Nachkommen), teilen sich Bakterien einfach in zwei genetisch identische Kopien. Und das geht oft viel schneller als bei Eukaryoten. Ein Bakterium der Art Escherichia coli, kurz E. coli, das zum Beispiel in Ihrem Darm lebt, teilt sich unter optimalen Bedingungen alle 20 Minuten.
Aus den Prokaryoten hat sich im Laufe der Evolution alles andere Leben entwickelt. Heute geht man davon aus, dass die ersten biologischen Zellen, die vor etwas mehr als vier Milliarden Jahren entstanden, strukturell den modernen Bakterien stark ähnelten. Da Eukaryoten erst seit 2,2 Milliarden Jahren existieren, regierten Bakterien die Biosphäre also etwa zwei Milliarden Jahre ganz allein. Die Hälfte der biologischen Erdzeitalter bevölkerten ausschließlich Prokaryoten die Erde und formten die Biosphäre.
Trotz der starken Unterschiede teilen Pro- und Eukaryoten eine universelle Eigenschaft: den genetischen Code, die DNA. Obwohl dieser Code natürlich bei jedem Lebewesen anders ist, ist die Art und Weise, wie aus dem genetischen Bauplan ein Lebewesen entsteht, gleich. Die DNA einer Zelle besteht aus einem oder mehreren sehr langen Kettenmolekülen. Die Kettenglieder sind chemische Bausteine, die Nukleotide Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin bilden sozusagen ein Alphabet aus vier Buchstaben A, T, G und C. Diese Nukleotide können in beliebiger Reihenfolge aneinandergekettet werden und bestimmen den genetischen Code. Beim Menschen umfasst dieser Code 3,2 Milliarden »Buchstaben«. Klingt viel? Das entspricht nur etwa 800 Megabyte an Speicherplatz auf einem elektronischen Gerät. Auf dem neuesten iPhone wäre Platz für das Genom von 1250 Menschen. Das Erbgut eines durchschnittlichen Bakteriums wie E. coli hat etwa 4,6 Millionen Buchstaben, ist also rund 700-mal kleiner als das eines Menschen. Tatsächlich besteht jedes DNA-Kettenmolekül aus zwei Einzelsträngen, die wie ein Reißverschluss ineinander verzahnt sind, wobei jeweils passende Zähne ineinandergreifen, A mit T und G mit C, sodass zum Beispiel die Folge AAGCGTA des einen Strangs mit TTCGCAT zusammenpasst. Das Ganze bildet dann die DNA-Doppelhelix, weil die Kette um ihre eigene Achse verdreht ist.
Die Doppelhelix der DNA mit genetischem Code. Das Alphabet besteht aus den Buchstaben A, C, G, T.
Bei allen Lebewesen enthält dieser Code die Instruktionen für die Herstellung der Proteine. Dabei wird zunächst aus einem Abschnitt der DNA, einem Gen, ein verwandtes Kettenmolekül, die RNA, synthetisiert. Den Prozess nennt man Transkription. Kleine biochemische Maschinen, die Ribosomen (bitte auf Spickzettel notieren oder auswendig lernen, das Wissen wird später noch benötigt), lesen dann den RNA-Codeschnipsel und synthetisieren daraus ein passendes Protein. Diesen Prozess bezeichnet man als Translation. Zellen sind zu einem großen Anteil aus Proteinen aufgebaut. Diese biochemisch aktiven Moleküle steuern und regulieren alle Abläufe in den Zellen. In einer Zelle gibt es extrem viele Ribosomen. In einem einzigen Bakterium sind bis zu 10000 Ribosomen aktiv, in menschlichen Zellen bis zu einer Million permanent damit beschäftigt, aus den RNA-Ketten Proteine zu bilden. Dieser Prozess »DNA wird zu RNA wird zu Protein« ist universell und für alle Lebewesen gleich. Deshalb besitzen alle Lebewesen, ohne Ausnahme, Ribosomen.
Realitätscheck
Die Aufteilung aller Lebewesen in die zwei fundamentalen Domänen Pro- und Eukaryoten wurde 1962 etabliert. Jedes Lebewesen konnte man hübsch in die eine oder andere Kategorie einsortieren. Zu dieser Zeit kannte man allerdings viel mehr Spezies der Eukaryoten, weil man Tiere, Pflanzen und Pilze auch ohne Mikroskop sehen kann. Schon über 150 Jahre hatte man versucht, die zahlreichen Arten zu klassifizieren, in Abstammungslinien, Verwandtschaftsverhältnissen, evolutionären Stammbäumen festzuhalten und zu erklären, welche Art wohl aus welcher entstanden war. Diese Bäume wurden durch genaue Vergleiche der Phänotypen erstellt, des Körperbaus und anderer sichtbarer Merkmale. Über die Evolution der Bakterien wusste man eigentlich nichts, man kannte vergleichsweise wenige Arten und die meisten davon waren Krankheitserreger. Um sie genauer zu untersuchen, mussten Wissenschaftler sie zunächst auf passenden Nährmedien kultivieren, was aber bei vielen Prokaryoten schwierig, bei manchen sogar unmöglich war.
Das änderte sich nach der Entdeckung der DNA und dem technischen Fortschritt, der folgte, schlagartig. Es wurde möglich, die DNA zu isolieren, chemisch zu vervielfältigen, den Code zu lesen und zu dokumentieren. Jetzt konnte man auf genetischer Ebene Lebewesen und Spezies vergleichen und über die Ähnlichkeit des Erbguts Abstammungslinien und Verwandtschaftsverhältnisse bestimmen.
Die drei Domänen des Lebens.
1977 kam dann der große Knall.[2] Der Biochemiker Carl Woese (1928–2012) analysierte und verglich mit der neuen Technik RNA-Ketten verschiedenster Spezies von Prokaryoten und Eukaryoten. Dabei bemerkte er, dass die ausgewählten Spezies sich nicht in zwei, sondern in drei klar voneinander unterschiedene Gruppen aufteilen ließen. Die Prokaryoten setzten sich nämlich aus zwei Untergruppen zusammen, die sich voneinander so stark unterschieden wie jede einzelne von den Eukaryoten! Genetisch gab es also nicht zwei, sondern drei Hauptdomänen des Lebens.
Eine der von Woese identifizierten Prokaryotenklassen bestand ausnahmslos aus methanogenen Prokaryoten, die sich unter extremen Bedingungen entwickeln, ohne Sauerstoff in heißen Quellen oder im Darm von Kühen, wo sie als Stoffwechselprodukt Methan, ein leicht brennbares Gas, produzieren. Woese war der Auffassung, dass diese extremen Habitate, in denen sie gedeihen, denen der Erde vor drei bis vier Milliarden Jahren glichen, und taufte sie deshalb Archaebacteria, heute werden sie als Archaeen bezeichnet. Woeses Entdeckung wurde zunächst nicht ernst genommen, einige prominente Mikrobiologen und Evolutionsbiologen seiner Zeit nannten ihn »crank«, »verrückt« – auch weil seine Folgerungen auf der Analyse von sehr »exotischen« Prokaryoten beruhten.
Heute weiß man, dass Woese richtiglag. Tatsächlich trennten sich die Evolutionslinien der Bakterien und Archaeen schon sehr früh, vor etwa 3,5 Milliarden Jahren. Relativ neu ist die Erkenntnis, dass Archaeen nicht nur in unwirtlichen Lebensräumen vorkommen, sondern überall zu finden sind. Sogar in Ihrem Nabel und Ihrer Mundhöhle.
Überalleskönner
Die zweite große Revolution kam mit einer neuen Technik, der Metagenomik. Bis zur Jahrtausendwende konnte DNA nur untersucht werden, wenn man viel davon herstellte. Man extrahierte DNA aus einem Organismus, stellte aufwändig viele Kopien her und sequenzierte diese. Das war teuer und dauerte lange. Mit metagenomischen Methoden wurde es möglich, DNA einfach aus Umweltproben herauszufiltern, sie zu sequenzieren und aus einzelnen Molekülen die Spuren der dort lebenden Spezies zu rekonstruieren. Auf einen Schlag erhielt man so genetische Fingerabdrücke aller in der Probe vorkommenden Arten. Die ersten metagenomischen Analysen waren überraschend. Nahezu jede Umweltprobe zeigte eine unfassbar hohe Diversität an Mikroben, die Bakterien- und Archaeenvielfalt war überall viel größer als ursprünglich angenommen. Praktisch jede Probe enthielt einen substanziellen Anteil von Mikroben, die noch gar nicht katalogisiert waren. Man kennt mittlerweile etwa eine Million verschiedene Bakterienarten. Schätzungsweise liegt diese Anzahl allerdings weit unter der tatsächlich existierenden Diversität, eine 2016 durchgeführte Studie deutet darauf hin, dass es bis zu einer Billion Bakterienarten geben könnte.[3] Zum Vergleich: Von den Insekten, die 80 Prozent der tierischen Biodiversität ausmachen, sind etwa eine Million Spezies katalogisiert, und man schätzt, dass etwa 30 Millionen Insektenarten existieren.
Bakterien haben verschiedene Formen.
Wie aber definiert man »Spezies« überhaupt bei den Prokaryoten? Der berühmte Evolutionsbiologe Ernst Mayr (1904–2005) beschrieb Spezies als Gruppe von Organismen, deren Mitglieder gemeinsam Nachkommen zeugen. Diese Definition ist natürlich aus der Beobachtung von Tieren, Pflanzen und Pilzen abgeleitet, großen, komplexen Organismen, die sich sexuell fortpflanzen. In diesem recht eng begrenzten Anwendungsspektrum klingt das ganz plausibel. Da die Fortpflanzung bei Bakterien und Archaeen allerdings über Teilung und nicht über Paarung stattfindet, kann diese konventionelle Speziesdefinition hier nicht verwendet werden. Also muss man genetische Unterschiede als Vergleichsgröße heranziehen. Aber wie stark müssen zwei bakterielle Erbgüter sich gleichen, um sie als eine Art zu bezeichnen? In der mikrobiologischen Genetik hat man mehr oder weniger willkürlich die »operational taxonomic unit (OTU)« eingeführt, also die operationale taxonomische Einheit, die das Spezieskonzept ersetzt. Zwei Prokaryoten gehören zur selben OTU, wenn ihre Genome zu mehr als 97 Prozent identisch sind. Zum Vergleich, das Genom des Menschen und das des Schimpansen sind zu 98 bis 99 Prozent identisch. Der Speziesbegriff, man merkt schon, wird im prokaryotischen Universum an den Kanten weich, Abgrenzungen können nur willkürlich gezogen werden.
Aus dieser enormen prokaryotischen Diversität kann man einen revolutionären Schluss ziehen. Wir kennen heute etwa 1400 bakterielle Krankheitserreger. Folglich machen nur die allerwenigsten Prokaryoten Menschen oder Tiere krank. Pathogene Bakterien sind die Ausnahme. Bis heute ist übrigens keine einzige pathogene Archaeenart erfasst. Das ist außerordentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Archaeen eine ganze Domäne des Lebens ausmachen.
Die meisten Spezies der Prokaryoten sind keine Krankheitserreger.
Mithilfe von Metagenomik stellte man fest, dass Mikroben überall zu finden sind, auch an den unwirtlichsten Orten. Im Waldboden, in der Tiefsee, in der Antarktis, in superheißen Quellen, in und auf anderen Tieren und Pflanzen. Ein paar Beispiele gefällig? Methanopyrus kandleri ist eine Archaeenart, die sich am liebsten bei Temperaturen bis zu 122 Grad fortpflanzt und das in einer Tiefe von 2000 Metern an hydrothermalen Quellen, einer für »gewöhnliche« Organismen hochtoxischen Umgebung. Bakterien der Gattung Thiobacillus hat man unter kilometerdicken Eisschichten in Seen der Antarktis entdeckt, wo sie seit Millionen von Jahren isoliert in totaler Dunkelheit gedeihen. Die Archaee Sulfolobus acidocaldarius findet man in säurehaltigen, 90 Grad heißen Quellen im Yellowstone Nationalpark in den USA. Selbst in Uranminen und im ehemaligen Reaktor in Tschernobyl oder den Kühlsystemen aktiver Atomkraftwerke stößt man auf Deinococcus radiodurans. Wie der Name schon andeutet, hält dieses recht robuste Bakterium extrem hohe, für andere Lebewesen tödliche Dosen radioaktiver Strahlung aus. Ein Mensch stirbt bei einer Strahlendosis höher als 6 Gray. Deinococcus radiodurans überlebt locker eine Dosis von 10000 Gray, also das 1600-Fache. Radioaktivität ist so schädlich, weil sie die DNA