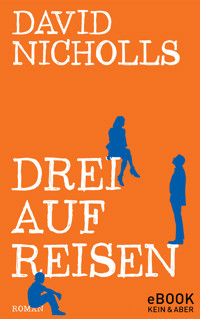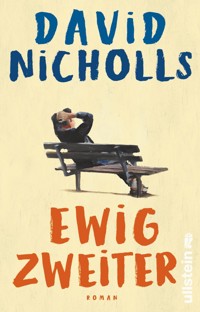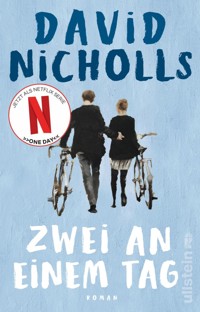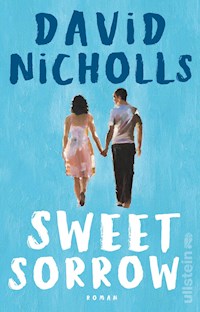
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weil die erste Liebe unvergesslich ist Manches im Leben strahlt so hell, dass es nur aus der Entfernung wirklich gesehen werden kann. Die erste große Liebe ist so eine Sache, die immer noch leuchtet, auch wenn sie längst verglüht ist. Genauso ist es Charlie Lewis ergangen. Nichts an ihm ist besonders. Dann begegnet er Fran Fisher, und seine Welt steht Kopf. In den langen, hellen Nächten eines unvergesslichen Sommers macht Charlie die schönsten, peinlichsten und aufregendsten Erfahrungen seines Lebens. Und steht zwanzig Jahre später vor der Frage, ob er sich traut, seine erste große Liebe wiederzutreffen. »Nicholls schreibt mit ungemein zärtlicher Präzision über die Liebe.« THE TIMES
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sweet Sorrow
Der Autor
David Nicholls, Jahrgang 1966, ist ausgebildeter Schauspieler, hat sich dann aber für das Schreiben entschieden. Mit seinem Roman Zwei an einem Tag gelang ihm der Durchbruch, seine Romane wurden in vierzig Sprachen übersetzt und verkauften sich weltweit über acht Millionen mal. 2014 wurde sein Roman Drei auf Reisen für den Man Booker Prize nominiert. Auch als Drehbuchautor ist David Nicholls überaus erfolgreich und mehrfach preisgekrönt, zuletzt erhielt er den BAFTA und eine Emmy-Nominierung für Patrick Melrose, seine Adaption der Romane von Edward St Aubyn, die als HBO-Serie Furore machte.
Das Buch
Manches im Leben strahlt so hell, dass es nur aus der Entfernung wirklich gesehen werden kann. Die erste große Liebe ist so eine Sache, die immer noch leuchtet, auch wenn sie längst verglüht ist. Genauso ist es Charlie Lewis ergangen. Nichts an ihm ist besonders. Dann begegnet er Fran Fisher, und seine Welt steht kopf. In den langen, hellen Nächten eines unvergesslichen Sommers macht Charlie die schönsten, peinlichsten und aufregendsten Erfahrungen seines Lebens. Und steht zwanzig Jahre später vor der Frage, ob er sich traut, seine erste große Liebe wiederzutreffen.
David Nicholls
Sweet Sorrow
Weil die erste Liebe unvergesslich ist
Roman
Aus dem Englischen von Simone Jakob
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unterdem Titel Sweet Sorrow bei Hodder & Stoughton, London.
Deutsche Erstausgabe© 2019 by David Nicholls© der deutschsprachigen Ausgabe2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: Favoritbüro GbR Lena KleinerTitelabbildung: GettyImages / © ulimi (Gräser), shutterstock / © Cat_arch_angel (Gräser) und shutterstock / © Mrs. Opossum (Schmetterlinge)Autorenfoto: © joSon / Gallery StockE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-2206-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Erster Teil: Juni
Das Ende der Welt
Sägemehl
Zu langsam
Unendlich
Die Wiese
Die Fünf Faden Tief Theatergenossenschaft
Auf den ersten Blick
Mum
Die Abstellkammer
Ecken
Klatschkreis
Romeo
Heimweg
Zweiter Teil: Juli
Hochzeit
Der Reiher
Zimt
Dad
Simson
Lampenfieber
Anfänge
Hobbys und Interessen: neue Leute kennenlernen
Schwerter
Pygmalion
Das Torhaus
Braune Fläschchen
Kultur
Die Jazz-Abteilung
Bühnenlachen
Improvisation
Zukunftsaussichten
Prüfungen
Masken
The Angler’s
The Pines
Frau Mab
Dritter Teil: August
Liebe
Text lernen
Der Fluss
Starry Starry Night
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Ausarbeiten
»Ich kaufte einen Sitz der Liebe mir«
Mr Howard
Narben
Pinzette
Scham
Dorffest
Zu Hause
Ergebnisse
Schaukeln und Rutschen
Kanada, Malaga, Rimini, Brindisi
Kleine Sterne
Letzter Abend
Vierter Teil: Winter
1998
2x, 4x, 8x, 16x
In der Vergangenheit wühlen
Die letzte Liebesgeschichte
Vergnügen
Vorhang
Dank
Anhang
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
Erster Teil: Juni
Widmung
Für Hannah, Max und Romy
Motto
Was wir, oder zumindest ich, überzeugt als Erinnerung ausgeben – womit wir einen Augenblick, eine Begebenheit, einen Sachverhalt meinen, die einem Fixierbad ausgesetzt und so vor dem Vergessen bewahrt wurden – , ist in Wirklichkeit eine Form des Geschichtenerzählens, die sich unaufhörlich in unserem Geiste vollzieht und sich noch während des Erzählens verändert. Zu viele widerstreitende Gefühlsinteressen stehen auf dem Spiel, als dass das Leben jemals ganz und gar annehmbar sein könnte, und möglicherweise ist es das Werk des Geschichtenerzählers, die Dinge so umzuordnen, dass sie sich diesem Zweck fügen. Wie dem auch sei, wenn wir über die Vergangenheit reden, lügen wir mit jedem Atemzug.
William Maxwell, Also dann bis morgen
Erster Teil: Juni
Es war der Sommer, als sie ganz allein war. Sie gehörte zu keinem Klub noch zu sonst was auf der Welt. Frankie gehörte zu niemandem, trieb sich in der Stadt herum und fürchtete sich.Carson McCullers, FrankieUnendlich
Früher litt ich oft unter einem Albtraum – vermutlich, weil ich viel zu jung 2001: Odyssee im Weltraum gesehen hatte –, in dem ich, losgelöst und ohne Halt, durch die unendlichen Weiten des Weltraums schwebe. Dieser Traum macht mir heute noch zu schaffen, weniger aus Angst vor dem Ersticken, sondern wegen der absoluten Hilflosigkeit: nichts, woran man sich festhalten könnte, nur Leere, Panik und die Gewissheit, dass sich nie etwas ändern wird.
Und genauso fühlte ich mich in diesem Sommer. Wie konnte ich hoffen, die unzähligen, sich endlos hinziehenden Tage auszufüllen? Kurz vor den Prüfungen hatten wir zwar Pläne geschmiedet, nach London zu fahren und die Oxford Street (und nur die Oxford Street) unsicher zu machen oder mit Rucksäcken voller Bierdosen Tom-Sawyer-artige Ausflüge in den New Forest oder auf die Isle of Wight zu machen, etwas, das wir »Koma-Campen« nannten. Aber Harper und Fox hatten einen Vollzeitjob gefunden, arbeiteten schwarz für Harpers Dad, einen Bauunternehmer, und die Pläne waren im Sande verlaufen. Lloyd und ich hatten ständig Zoff, wenn Harper nicht dabei war, und ich arbeitete – ebenfalls schwarz – in einem Teilzeitjob als Kassierer in einer örtlichen Tankstelle.
Aber auch damit konnte ich nur zwölf Stunden die Woche totschlagen. Die restliche Zeit stand mir zur freien Verfügung – aber was sollte ich damit anfangen? Mitten in der Woche auszuschlafen verlor schon bald seinen Reiz; das Sonnenlicht, das durch die Vorhänge schimmerte, verhieß rastlose Langeweile, ein weiterer endloser, öder, apathischer Tag, der vor mir lag, dann noch einer und noch einer, jeder davon ein aufgeblähter beschissener Bastard von einem Feiertag. Ich wusste, eher aus der Science Fiction als aus dem Physikunterricht, dass die Zeit unterschiedlich schnell vergeht, je nachdem, wo man sich gerade aufhält, und auf dem unteren Etagenbett eines Sechzehnjährigen Ende Juni 1997 schien sie langsamer zu vergehen als irgendwo sonst im Universum.
Wir lebten erst seit Kurzem in diesem Haus. Nach Weihnachten waren wir aus dem »großen Haus« ausgezogen, in dem wir mit der ganzen Familie gewohnt hatten und das mir sehr fehlte: eine Doppelhaushälfte, die ganz aus Quadraten und Dreiecken zusammengesetzt zu sein schien wie eine Kinderzeichnung, mit einem Treppengeländer, das man hinunterrutschen konnte, einem Zimmer für jeden, einem Autostellplatz und Schaukeln im Garten. Ich weiß noch, wie mein Vater, der es in einem deplatzierten Anfall von finanziellem Optimismus erstanden hatte, es uns zum ersten Mal zeigte, an die Ziegelwände klopfte, um zu demonstrieren, wie solide sie waren, und die Hände flach auf die Heizungen legte, um das Wunder der Zentralheizung zu genießen. Es gab dort ein Erkerfenster, in dem ich wie ein junger Lord sitzen und den Verkehr beobachten konnte, und, was mich am meisten beeindruckte, ein kleines viereckiges Buntglasfenster über der Haustür: ein Sonnenaufgang in Gelb, Gold und Rot.
Aber das große Haus gehörte der Vergangenheit an. Heute lebten Dad und ich in einer Siedlung aus den Achtzigerjahren namens The Library, in der die Straßen pädagogisch wertvoll nach großen Schriftstellern benannt waren; die Woolf Road führte zum Tennyson Square, die Mary Shelley Avenue kreuzte die Coleridge Lane. Wir wohnten am Thackeray Crescent, und ohne je eine Zeile von Thackeray gelesen zu haben, wusste ich, dass sein Einfluss dort gleich null war. Die Häuser waren moderne, helle Ziegelgebäude mit Flachdächern und mit der Besonderheit, dass die Wände innen und außen wellig waren, sodass die Häuserreihen aus der Vogelperspektive betrachtet aussehen mussten wie fette gelbe Raupen. »Wie Tatooine, nur in Scheiße«, hatte Lloyd es genannt. Als wir – damals noch zu viert – eingezogen waren, hatte Dad behauptet, die runden Wände zu lieben, die geschwungene, künstlerische Architektur würde doch viel besser zu unserer Familie passen als unser altes Haus. Das war doch fast, wie in einem Leuchtturm zu leben! Und selbst wenn The Library Estate nicht mehr ganz so zukunftsweisend war wie früher, selbst wenn die tischtuchgroßen Gärten ungepflegt waren und hin und wieder ein einsamer Einkaufswagen durch die breiten, stillen Straßen rollte, schlugen wir damit trotzdem ein neues Kapitel in unserer Familiengeschichte auf, das uns den zusätzlichen Seelenfrieden brachte, nicht mehr über unsere Verhältnisse zu leben. Es stimmte, dass meine Schwester und ich uns ein Zimmer teilen mussten, aber Etagenbetten waren doch cool, und es wäre ja nicht für immer.
Sechs Monate später gab es immer noch unausgepackte Kartons, die wegen der runden Wände ständig im Weg standen oder sich auf dem leeren Bett meiner Schwester stapelten. Meine Freunde verirrten sich nur selten hierher, sie hingen lieber in Harpers Haus rum, das dem riesigen Palast eines rumänischen Diktators glich, mit zwei Jukeboxen, einem Rudergerät, Quadbikes, riesigen Fernsehern, einem Samuraischwert und genug Luftgewehren, Pistolen und Springmessern, um eine Zombie-Invasion abzuwehren. In unserem Haus gab es nur meinen durchgeknallten Dad und eine Menge seltener Jazzplatten. Nicht mal ich wollte hierherkommen.
Oder hierbleiben. Mein großes Projekt für diesen Sommer war, Dad aus dem Weg zu gehen. Ich hatte gelernt, seine Stimmung schon anhand der Geräusche einzuschätzen, die er machte, und verfolgte jede seine Bewegungen nach wie ein Jäger. Die Wände waren papierdünn, und solange er sich ruhig verhielt, war es sicher, sich tiefer im Mief unter der Bettdecke zu verkriechen, bis die Luft in meinem Zimmer dem Wasser in einem vernachlässigten Aquarium glich. Wenn sich bis zehn Uhr noch nichts getan hatte, legte Dad einen seiner »Bettruhetage« ein, und ich konnte mich nach unten wagen. In besseren Zeiten, mit Krediten im Überfluss, hatte Dad über eine Zeitungsanzeige einen Heimcomputer erstanden, einen aktenschrankgroßen Kasten, der aus Bakelit zu bestehen schien. Wenn Dad im Bett blieb, konnte ich ein paar angenehme Stunden in den Gängen und Luftschleusen von Doom oder Quake verbringen, solange ich es schaffte, den Bildschirm rechtzeitig auszuschalten, wenn ich ihn auf der Treppe hörte. Tagsüber am Computer zu spielen, erfüllte meinen Vater neuerdings mit einem Zorn, der nichts Rationales mehr an sich hatte, als hätte ich auf ihn persönlich geschossen statt auf virtuelle Gegner.
Aber an den meisten Tagen hörte ich, wie er gegen neun aufstand und ins Bad schlurfte, das sich gleich neben meinem Zimmer befand. Nichts weckte mich zuverlässiger, als meinen Vater direkt neben meinem Kopf pinkeln zu hören; meist sprang ich dann auf, zog mir die Klamotten vom Vortag über und schlich ninjagleich nach unten, um nachzusehen, ob er seine Zigaretten dort liegen gelassen hatte. Wenn noch zehn Kippen oder mehr in der Packung waren, konnte ich eine klauen und in meinem Rucksack verschwinden lassen. Ich schlang im Stehen eine Scheibe Toast hinunter – noch etwas im Haus, das den Reiz des Neuen schnell verloren hatte: an der Frühstückstheke sitzend zu essen – und verließ das Haus, noch bevor er nach unten kam.
Wenn ich zu langsam war, tauchte er irgendwann mit verklebten Augen und Kissenfaltenabdruck im Gesicht auf, und wir zwängten uns zwischen dem Wasserkocher und dem Toaster ungelenk aneinander vorbei und zogen unsere übliche Nummer ab.
»Was soll das sein, Frühstück oder Mittagessen?«
»Ich nenne es Brunch.«
»Witzig. Es ist fast zehn.«
»Wer im Glashaus sitzt …«
»Ich konnte nicht schlafen. Könntest du bitte einen Teller benutzen?«
»Ich benutze einen Teller.«
»Und warum ist dann alles voller Krümel?«
»Weil ich noch keine Zeit hatte, sie …«
»Benutz einfach einen Teller!«
»Hier ist der Teller, in meiner Hand, ein Teller, mein Teller …«
»Und räum das nachher weg.«
»Sobald ich aufgegessen habe.«
»Lass es ja nicht wieder in der Spüle rumstehen.«
»Hatte ich nicht vor.«
»Gut. Dann tu’s auch nicht.«
… und so weiter und so fort, weniger ein Gespräch als ein Schlagabtausch voller banaler Sarkasmen und sinnloser Provokationen. Ich hasste die Art, wie wir miteinander redeten, aber um das zu ändern, hätte es einer Stimme bedurft, die keiner von uns besaß, und so verstummten wir, und Dad schaltete den Fernseher ein. Früher hätte ein solches In-den-Tag-Hineinleben vielleicht den Reiz des Verbotenen gehabt, aber zum Schwänzen gehörte, dass man eigentlich woanders sein sollte, und das war bei uns nicht der Fall. Ich wusste nur, dass Dad nicht gern allein war, und so verließ ich das Haus.
An den meisten Tagen fuhr ich lange Strecken mit dem Rad, aber nicht auf coole, moderne Art. Ich trug Jeans statt Lycra und fuhr ein uraltes Rennrad mit einer klappernden, verrosteten Kette und einem Rahmen, der so schwer und unhandlich war wie ein verschweißtes Baugerüst. Tief über den Rennlenker gebeugt patrouillierte ich durch die Straßen von The Library, fuhr in Sackgassen rein und wieder raus, radelte durch Tennyson, Mary Shelley, Forster, Kipling und Woolf, dann einmal um Hardy herum. Ich suchte die Rutschen und Schaukeln nach bekannten Gesichtern ab, querte Fußgängerwege, fuhr Schlangenlinien auf den breiten, leeren Straßen, die zu einer Ladenzeile führten.
Was suchte ich? Obwohl ich es damals nicht hätte benennen können, suchte ich nach einer großen Veränderung, einer Aufgabe, einem Abenteuer, bei dem man Prüfungen bestehen und Lektionen lernen muss. Aber allein zu einem Abenteuer aufzubrechen ist albern, und heroische Prüfungen findet man in der High Street eher selten. Die Kleinstadt, in der ich lebte, lag im Südosten, zu weit entfernt von London für eine Vorstadt, zu groß für ein Dorf, zu industriell, um ländlich zu sein. Ihr fehlte ein Bahnhof, der sie zu einem Pendler-Knotenpunkt hätte machen können, und auch der legendäre Wohlstand, den man allgemein mit dieser Region verknüpfte. Es gab einen Flughafen, Gewerbegebiete und Leichtindustrie: Fotokopierer, Doppelverglasung, Computerteile und Aggregate – was auch immer das war. An der Hauptstraße – die High Street hieß – gab es ein paar Gebäude, die man als malerisch durchgehen lassen konnte – ein Fachwerkgebäude, das eine Teestube namens The Cottage Loaf beherbergte, einen georgianischen Zeitungskiosk, eine Apotheke aus der Tudor-Zeit, ein mittelalterliches Marktkreuz für die Cider-Trinker – aber alles war vom Staub und den Abgasen der verkehrsreichen Hauptstraße besudelt, deren Bürgersteige so schmal waren, dass die Passanten sich fast an die Bleiglasfenster pressen mussten. »Shoppen gehen« war die Lieblingsbeschäftigung der Stadt, und wenn man auf Secondhandläden stand, kam man hier voll auf seine Kosten. Das einzige Kino beherbergte jetzt ein Teppichkaufhaus, das in einer Zeitschleife ewigen Räumungsverkaufs gefangen war. Das nächste Naturschutzgebiet war zwanzig Minuten mit dem Auto entfernt, die Küste von Sussex weitere dreißig, und die gesamte Stadt war von einer Ringstraße umgeben wie von einem Grenzzaun.
Jahre später, wenn ich Freunde bewegt von ihren Geburtsorten schwärmen hörte, wenn sie erzählten, wie sehr Northumberland, Glasgow, der Lake District oder die Halbinsel The Wirral sie geprägt hatten, ertappte ich mich dabei, dass ich sie selbst um die abgedroschensten, klischeehaftesten Gefühle von »Zugehörigkeit« beneidete. Hier gab es keine regionale Identität, keinen authentischen Dialekt, nur den Cockney-Akzent, den wir uns aus dem Fernsehen abgeschaut hatten und der unser ländliches, gerolltes R überdeckte. Ich hasste unsere Stadt nicht unbedingt, aber es war schwer, nostalgische Gefühle für das Staubecken oder die Einkaufsstraße aufzubringen, von dem verwahrlosten Waldstück mit den unter den Dornenbüschen vergilbenden Pornomagazinen ganz zu schweigen. Unser Naherholungsgebiet war allgemein als Hundescheiße-Park bekannt, eine Kiefernschonung trug den Namen Mörderwald – was, soweit ich weiß, ihr offizieller Name war. Wer würde über einen solchen Ort ein Sonett schreiben?
Und so fuhr ich die High Street hinunter, spähte in die Schaufenster und hoffte, jemanden zu sehen, den ich kannte. Ich kaufte in einem Kiosk Kaugummi und blätterte in den Computerzeitschriften, bis der böse Blick des Besitzers mich in die Flucht schlug. Langeweile war unser natürlicher Zustand, aber Einsamkeit war tabu, und so bemühte ich mich um die Aura eines geheimnisvollen, unangepassten Einzelgängers und Außenseiters, der freihändig durch die Straßen fuhr. Aber es ist anstrengend, nicht einsam zu wirken, wenn man es ist, oder glücklich auszusehen, wenn man es nicht ist. Es ist, als würde man versuchen, einen Stuhl auf Armeslänge von sich zu halten, und wenn es mir nicht mehr gelang, die Illusion von Leichtigkeit aufrechtzuerhalten, radelte ich raus aus der Stadt.
Um etwas wie Landschaft zu Gesicht zu bekommen, musste man eine Autobahnbrücke überqueren, unter der donnernder Verkehr rauschte wie ein gewaltiger Wasserfall, dann an den großen Ebenen mit gelbem Weizen und Raps und den gewellten Folientunnelprärien vorbeifahren, in denen Erdbeeren für die Supermärkte heranreiften, und schließlich die Hügel erklimmen, von denen unsere Stadt umgeben war. Ich war kein Naturliebhaber, Vogelbeobachter, Angler oder Poet, konnte einen Baum nicht mal dann bestimmen, wenn er mir auf den Kopf fiel, und hatte auch keine Lieblingsaussicht, kein sonnendurchflutetes Tal, das ich besonders mochte, aber hier draußen war die Einsamkeit weniger beschämend, fast erträglich, und jeden Tag wagte ich mich ein Stück weiter von zu Hause fort, erweiterte den Kreis des mir Bekannten.
So vergingen die erste, die zweite und die dritte Woche in einer Art sommerlichem Winterschlaf, bis zu jenem Donnerstag Mitte Juli, als ich die Wiese entdeckte.
Die Wiese
Ich war noch nie hier gewesen. Genervt von der steil ansteigenden Straße war ich zu Fuß weitergegangen und hatte einen Trampelpfad zu meiner Rechten entdeckt, der angenehm schattig und flach aussah. Ich hatte mein Fahrrad durch ein Wäldchen geschoben, das bald den Blick auf eine abschüssige gelb-grüne Wiese freigab, mit hüfthohen Grashalmen, gesprenkelt mit roten Mohnblumen und blauen … Weidenröschen? Kornblumen? Wie auch immer, die Wiese war unwiderstehlich, und ich hievte das Fahrrad über den hölzernen Zauntritt und pflügte einen Weg durch das lange Gras. Ein imposantes Herrenhaus mit Fachwerkfassade, das ich schon von der Ringstraße aus gesehen hatte, kam über mir auf dem Hügel in Sicht; die Wiese grenzte am oberen Ende an einen französischen Garten. Plötzlich kam ich mir vor wie ein Eindringling, ließ das Fahrrad fallen und ging weiter, bis ich eine natürliche Vertiefung erreichte, in der ich in aller Ruhe sonnenbaden, rauchen und was Blutrünstiges lesen konnte.
Die endlose Einöde der unausgefüllten Tage bedeutete, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben aufs Lesen verlegte. Ich hatte mit den Thrillern und Horrorbüchern aus Dads Sammlung angefangen, die voller Eselsohren und welliger Seiten von Meer oder Badewanne waren und in denen sich Gewalt und Sex in immer schnellerem Rhythmus abwechselten. Anfangs hatten sich Bücher nur wie zweite Wahl angefühlt – von Sex und Gewalt zu lesen, war, wie sich eine Fußballübertragung im Radio anzuhören –, aber bald verschlang ich ein Buch pro Tag und vergaß die meisten sofort wieder, abgesehen von Das Schweigen der Lämmer und Stephen King. Bald hatte ich mich zu Dads kleinerer, etwas einschüchternder Science-Fiction-Abteilung vorgearbeitet; abgewetzte Ausgaben von Asimov, Ballard und Philip K. Dick. Obwohl ich nicht genau sagen konnte, warum, waren diese Romane ein ganz anderes Kaliber als die über Riesenratten. Das Buch in meiner Tasche war ein Schutz vor Langeweile, ein Alibi für die Einsamkeit. Es hatte zwar immer noch etwas Verstohlenes an sich – vor meinen Kumpels zu lesen, wäre, als würde ich plötzlich Flöte spielen oder Volkstanz lernen –, aber hier würde mich niemand erwischen, und so nahm ich Kurt Vonneguts Schlachthof 5 aus der Tasche, das ich ausgesucht hatte, weil das Wort »Schlachthof« im Titel vorkam.
In meiner Erdkuhle fühlte ich mich wie in einem Schützengraben, der weder vom Herrenhaus noch von der Stadt aus sichtbar war. Um eine melancholische Aura bemüht, genoss ich den Ausblick: eine Art Modelleisenbahnlandschaft, in der alles etwas zu künstlich wirkte – Schonungen statt Wälder, Staubecken statt Seen, Ställe, Katzenpensionen und Hundezüchter statt Bauernhöfen und freilaufenden Schafen. Das Vogelgezwitscher ging fast im Rauschen der Autobahn und dem tinnitusartigen Summen der Leitungsmasten unter, aber aus der Ferne sah die Stadt eigentlich ganz nett aus. Zumindest immer noch besser als aus der Nähe.
Ich zog mein T-Shirt aus, legte mich hin und übte mit der geklauten Kippe rauchen, benutzte das Buch als Sonnenschutz, begann zu lesen und hielt nur hin und wieder inne, um mir Asche von der Brust zu wischen. Hoch über mir kreisten Flugzeuge aus Spanien, Italien, der Türkei und Griechenland, warteten ungeduldig auf eine freie Landebahn. Ich schloss die Augen und beobachtete die durchscheinenden Punkte, die über die Innenseite meiner Augenlider zu tanzen schienen, und versuchte sie bis zum Rand meines Blickfelds zu verfolgen, während sie davonhuschten wie Fische in einem Strom.
Als ich mit dickem Kopf wieder aufwachte, stand die Sonne hoch am Himmel. Ich geriet kurz in Panik, als ich über mir auf dem Hügel hörte, wie sich eine Gruppe von johlenden, schreienden Menschen näherte. Waren sie hinter mir her? Dann ein Rascheln im Gras, ein panisches Keuchen, als jemand den Abhang hinunter auf mich zurannte. Unauffällig spähte ich durch das hohe Gras: ein Mädchen in einem gelben T-Shirt und einem kurzen Jeansrock, der sie beim Rennen behinderte. Ich sah, wie sie ihn mit beiden Händen ein Stück hochzog, einen Blick über die Schulter warf und sich ins Gras hockte und die Stirn auf die verschrammten Knie legte, um zu verschnaufen. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, hatte jedoch plötzlich die verrückte Idee, der Landsitz sei womöglich eine finstere Institution wie ein Irrenhaus oder ein geheimes Labor, und ich müsse ihr zur Flucht verhelfen. Mehr Schreien und Rufen, und sie schaute zum Haus zurück, dann richtete sie sich auf, zog den Rock noch weiter über ihre blassen Beine hoch und rannte direkt auf mich zu. Ich ließ mich wieder in die Kuhle sinken, sah jedoch gerade noch, wie sie wieder zurückschaute, plötzlich stolperte und der Länge nach ins Gras fiel.
Ich muss gestehen, dass ich mir die Hand vor den Mund schlug, um nicht laut loszulachen. Ein kurzer Moment der Stille, dann hörte ich, wie sie aufstöhnte und gleichzeitig kicherte. »Au! Au-au-au, du Idiot! Auuuuuu!« Sie war nur noch drei, vier Meter von mir entfernt, keuchte und lachte abwechselnd, und ich wurde mir plötzlich meiner mageren, nackten Brust bewusst, die jetzt lachsfarben und mit klebrigem Schweiß und Zigarettenasche bedeckt war. Unter diversen Verrenkungen versuchte ich, mich im Liegen anzuziehen.
Vom Haus auf dem Hügel rief jemand: »He! Wir geben auf! Du hast gewonnen! Komm zurück!« – und ich dachte: Glaub ihnen nicht, das ist eine Falle.
Das Mädchen stöhnte. »Moment!«
Eine weibliche Stimme rief: »Gut gemacht! Mittagspause! Komm zurück!«
»Geht nicht«, sagte sie und setzte sich auf. »Aua – Scheiße!«, entfuhr es ihr, und ich ließ mich tiefer ins Gras sinken, als sie aufzustehen versuchte, ihren Knöchel untersuchte und vor Schmerz aufschrie. Ich würde mich bemerkbar machen müssen, aber es schien keine coole Art zu geben, jemandem auf einer Wiese mitten im Nirgendwo aufzulauern. Ich leckte mir die Lippen und sagte mit fremd klingender Stimme:
»Hör zu, flipp jetzt nicht gleich aus, aber …«
»Wer war das?!«
»Nur, damit du weißt, dass ich da bin …«
»Wer? Wo …?«
»Hier drüben, im langen Gras …«
»Aber wer zur Hölle bist du? Wo bist du?«
Ich zog schnell mein T-Shirt runter, stand geduckt auf, als würde ich unter Beschuss stehen, und ging zu ihr hinüber. »Ich wollte dich nicht erschrecken.«
»Tja, da bist du spektakulär gescheitert, du Psycho!«
»He, ich war zuerst da!«
»Was machst du überhaupt hier?«
»Nichts! Ich lese! Warum sind die Leute da hinter dir her?«
Sie sah mich von der Seite an. »Wer?«
»Na, die Leute da hinten, warum sind die hinter dir her?«
»Gehörst du nicht zur Truppe?«
»Welche Truppe?«
»Die Truppe, gehörst du nicht dazu?«
Die Truppe, das klang ziemlich ominös, und ich fragte mich, ob ich ihr wirklich helfen sollte. Wenn du überleben willst, folge mir. »Nein, ich …«
»Was machst du dann hier?«
»Nichts, ich war nur mit dem Rad unterwegs und …«
»Wo ist dein Rad?«
»Da drüben. Ich hab gelesen, und dann bin ich eingeschlafen, und ich wollte mich nur bemerkbar machen, ohne dir Angst einzujagen.«
Sie untersuchte wieder ihren Knöchel. »Tja, hat ja super geklappt.«
»Das hier ist ein öffentlicher Weg. Ich habe jedes Recht, mich hier aufzuhalten …«
»Schön und gut, aber ich hab wenigstens einen echten Grund dafür.«
»Und warum haben die dich jetzt verfolgt?«
»Was? Ach, irgendein blödes Spiel. Frag nicht.« Sie betastete ihren Knöchel mit den Daumen. »Au!«
»Tut’s sehr weh?«
»Ja, das tut scheiße weh! Diese Wiese ist praktisch ’ne Todesfalle. Ich bin mit dem rechten Fuß in ein Kaninchenloch geraten und aufs Gesicht gefallen.«
»Ja, hab ich gesehen.«
»Echt? Tja, danke, dass du nicht gelacht hast.«
»Ich hab gelacht.«
Sie sah mich mit zusammengekniffenen Augen an.
Um sie zu beschwichtigen, fragte ich: »Und – kann ich dir irgendwie helfen?«
Sie musterte mich, buchstäblich einmal von Kopf bis Fuß, mit einem so durchdringenden Blick, dass ich merkte, wie ich meine Hände in die Taschen zu schieben versuchte. »Erklär mir noch mal, warum du hier rumlungerst wie ein Spanner?«
»Ich wollte nur … hier, ich lese! Siehst du?« Ich stolperte zurück zu meiner Mulde, um das Taschenbuch zu holen, und zeigte es ihr. Sie schaute erst das Cover, dann wieder mich an, als würde sie mein Gesicht mit einem Pass vergleichen. Dann versuchte sie, aufzustehen, verzog das Gesicht und ließ sich wieder auf den Boden sinken. Sollte ich ihr die Hand hinhalten? Nein, lieber nicht. Stattdessen kniete ich mich vor sie und nahm ihren Fuß in beide Hände, als wollte ich ihr helfen, einen gläsernen Pantoffel anzuprobieren – eine kaum weniger absurde Geste. Sie trug Adidas-Sneakers mit Gummikappe und blauen Streifen ohne Socken, ihre Schienbeine waren blass und fleckig. Ich spürte das leichte Prickeln frischer Stoppeln, schwarz wie Eisenspäne.
»Alles in Ordnung da unten?«, sagte sie, den Blick gen Himmel gerichtet.
»Ja, ich frage mich nur …« Mit fachmännischer Miene tastete ich vorsichtig ihren Knöchel mit den Daumen ab.
»Au!«
»Sorry!«
»Sagen Sie, Herr Doktor, wonach suchen Sie da eigentlich?«
»Ich guck, wo’s wehtut, dann taste ich die Stelle ab, um zu prüfen, ob gebrochene Knochen zu spüren sind.«
»Und?«
»Alles in Ordnung. Ist wohl nur eine Verstauchung.«
»Und? Werde ich je wieder tanzen können?«
»Klar, falls du das wirklich willst«, sagte ich.
Sie lachte zum Himmel auf, und ich kam mir so charmant und lässig vor, dass ich mitlachte. »Geschieht mir recht, weil ich unbedingt den hier tragen musste«, sagte sie und zog den Jeansrock über ihre Knie. »Blöde Eitelkeit. Selbst schuld. Ich geh besser zurück zu den anderen. Du kannst meinen Knöchel jetzt übrigens loslassen.« Ich ließ ihren Fuß abrupt fallen und stand dumm rum, während sie aufzustehen versuchte.
»Könntest du mir eventuell …?«
Ich half ihr auf die Beine und hielt ihre Hand, während sie aufzutreten versuchte, das Gesicht verzog und es gleich noch mal versuchte, und ich schaute in die andere Richtung und musterte sie aus dem Augenwinkel. Sie war kleiner als ich, aber nicht viel, und hatte blasse Haut und kurze schwarze Haare mit einem längeren Pony, den sie sich jetzt hinter die Ohren strich; im Nacken waren sie sorgfältig ausrasiert, was die Wölbung ihres Hinterkopfs betonte und streng und glamourös zugleich aussah – Johanna von Orléans, frisch vom Friseur. Ich glaube nicht, dass ich vorher schon mal auf Hinterköpfe geachtet hatte. Winzige schwarze Ohrstecker in jedem Ohr, mit je zwei Extralöchern für besondere Anlässe. Und weil ich sechzehn war, ließ ich meinen Blick unfokussiert werden, um die Tatsache zu verschleiern, dass ich auf ihre Brüste schielte, und war mir sicher, dass kein Mädchen diesen Trick je durchschaut hatte. Sie trug ein hellgelbes T-Shirt mit der Aufschrift »Adidas«, dessen Ärmel so kurz waren, dass ich in dem weichen Fleisch ihres Oberarms die runde Tuberkulose-Impfnarbe ausmachen konnte, gekräuselt wie die Oberfläche einer römischen Münze.
»Hallo? Ich brauche deine Hilfe.«
»Kannst du laufen?«
»Ich könnte hüpfen, aber so komme ich nicht weit.«
»Soll ich dich huckepack nehmen?«, fragte ich und bereute es noch im selben Moment. Es musste doch ein cooleres Wort geben als »huckepack«. »Oder, du weißt schon, den Feuerwehrtragegriff anwenden, dich über die Schulter legen?« Sie musterte mich erneut kritisch, und ich stellte mich gerade hin.
»Bist du denn Feuerwehrmann?«
»Zumindest bin ich größer als du!«
»Aber ich bin …« Sie zog ihren Rock nach unten. »… kompakter. Kannst du dein eigenes Gewicht tragen?«
»Klar!«, sagte ich, drehte mich um und deutete mit Anhalter-Daumen auf meinen verschwitzten Rücken.
»Nein, lieber nicht, das wäre schräg. Aber wenn du nichts dagegen hast, dass ich mich auf dich stütze …«
Mit einer weiteren Geste, die ich noch nie gemacht hatte und auch nie wieder machen würde, bot ich ihr meinen Ellbogen an und nickte ihr auffordernd zu, die Hand in die Hüfte gestützt wie bei einem Westerntanz.
»Howdy, Partner, danke dir«, sagte sie, und wir gingen los.
Das lange Gras um uns herum schien unnatürlich laut zu rascheln, als wir uns einen Weg hindurchbahnten, und ich konnte sie genauer in Augenschein nehmen, was sich fast wie ein Zwang anfühlte. Sie hielt beim Gehen den Blick auf den Boden gerichtet, und ihr Pony verdeckte ihre Augen, aber ich konnte sehen, dass sie blau waren, geradezu lächerlich blau – war mir je die Augenfarbe eines anderen Menschen aufgefallen? –, und die Haut drum herum war ebenfalls leicht bläulich, wie Überreste von Make-up, das sich in den Fältchen gesammelt hatte, wenn sie lachte oder das Gesicht verzog …
»Au! Au, au, au.«
»Bist du sicher, dass ich dich nicht doch tragen soll?«
»Du bist ja ganz schön scharf darauf, mich zu tragen …«
Sie hatte ein paar Pickel auf der Stirn und auf dem Kinn, die aussahen, als hätte sie versucht, sie auszudrücken, und ihr Mund war sehr breit und rot, mit einer kleinen Schramme an der Unterlippe. Sie hatte die Lippen aufeinandergepresst, als wäre sie kurz davor, zu lachen, zu fluchen oder beides, so wie sie es jetzt tat, als sie mit dem Fuß umknickte.
»Ich könnte dich tragen, ehrlich.«
»Glaub ich dir.« Das Tor zum Garten kam in Sicht, und das absurde Haus sah jetzt noch imposanter und einschüchternder aus, und ich fragte sie: »Wohnst du hier?«
»Hier?« Sie lachte, unbefangen und aus vollem Hals. Ich war Menschen mit zu perfekten Zähnen gegenüber misstrauisch, so viel Gesundheit und Vitalität wirkte angeberisch. Die Zähne dieses Mädchens wurden, wie mir jetzt auffiel, dadurch vor der Perfektion bewahrt, dass ein kleines Stück von ihrem linken Vorderzahn fehlte, was mich an eine umgeknickte Buchseite erinnerte.
»Nein, ich wohne nicht hier.«
»Ich dachte, die Leute, die hinter dir her waren, wären Verwandte von dir …«
»Klar, so was machen meine Eltern ständig, kaum sehen wir ein offenes Feld …«
»Na ja, woher soll ich das wissen …«
»Es war nur ein albernes Spiel. Vergiss es.« Sie wechselte das Thema. »Was genau hast du hier noch gleich gemacht?«
»Gelesen. Ist ein schöner Ort zum Lesen.«
Sie nickte mit skeptischem Blick. »Du bist mir ja ein Naturbursche.«
Ich zuckte die Achseln. »Besser, als zu Hause rumzuhocken.«
»Und wie ist Schlachthof 5 so?«
»Ganz nett. Nicht ganz so blutig, wie ich gehofft hatte.«
Sie lachte, obwohl ich nur halb scherzte. »Ich hab schon davon gehört, hab’s aber noch nicht gelesen. Ohne Vorurteile zu schüren, ich glaube, es ist eher ein Jungs-Buch. Stimmt das?«
Wieder zuckte ich die Achseln.
»Ich meine, verglichen mit Atwood oder Le Guin.«
Wenn wir jetzt Gespräche über Literatur führten, konnte ich sie genauso gut ins Gebüsch schubsen und wegrennen.
»Also. Worum geht’s?«
Charlie, könntest du diesen Abschnitt kurz für uns zusammenfassen? In deinen eigenen Worten, bitte.
»Es geht um einen Mann, einen Kriegsveteranen, der von Außerirdischen entführt wird und in einem Außerirdischen-Zoo landet, aber er hat immer wieder Flashbacks aus der Zeit, als er in Kriegsgefangenschaft war …«
Ja, sehr schön, aber was ist die Intention des Autors? Bitte etwas genauer, Charlie.
»Na ja, es geht auch um Krieg, um die Bombardierung von Dresden, und um eine Art Fatalität – äh, oder eher Fatalismus? –, darum, ob das Leben eine Rolle spielt und ob der freie Wille eine Täuschung, eine Selbsttäuschung ist, also, es ist ziemlich grausam, es geht um Tod und Krieg, aber es ist auch witzig.«
»O-kay. Klingt wirklich nach Jungs-Buch.«
Wie könnte man es sonst noch ausdrücken? »Surreal! Das ist es. Und ziemlich gut.« Danke, Charlie, du darfst dich wieder setzen.
»O-kay«, sagte sie. »Na schön. Normalerweise schalte ich ab, wenn Außerirdischen-Zoos erwähnt werden, aber vielleicht lese ich es ja doch mal. Kennst du …«
»Nein, aber ich kenn den Film«, sagte ich. Sie warf mir einen Seitenblick zu. »War nur ein Witz. Ich lese nur nicht viel.«
»Macht doch nichts«, sagte sie, dann, als würde da eine Verbindung bestehen: »Und auf welche Schule gehst du?«
Eine langweilige Frage, aber sie war nun mal obligatorisch, also brachte ich es hinter mich: »Ich hab gerade den Abschluss an der Merton Grange gemacht«, sagte ich und wartete auf die übliche Reaktion: den Blick, den man für Leute reservierte, die gerade aus dem Knast entlassen worden waren, und obwohl ich keine Spur davon in ihrem Gesicht entdeckte, verspürte ich trotzdem einen Anflug von Gereiztheit. »Du bist sicher von der Chatsborne, hm?«
Sie strich sich den Pony hinter die Ohren und lachte. »Wie hast du das erraten?«
Weil Chatsborne-Schüler reiche, pseudokünstlerische, kiffende Hippies waren. Chatsborne-Schüler trugen ihre eigenen Klamotten zur Schule – hauptsächlich altmodische Blümchenkleider und ironische T-Shirts, die sie per Siebdruckverfahren eigenhändig bedruckt hatten. Chatsborne-Schüler waren intelligent, waren Weicheier, weil sie intelligent waren, eine ganze Schule voller Schülersprecher und Schülersprecherinnen, die mittags vegetarische Tajines aus selbst geschnitzten Schüsseln aßen, die auf selbst gebauten Tischen aus recyceltem Holz serviert wurden. Grundstücksmakler im Chatsborne-Einzugsgebiet prahlten mit Inklusion, noch bevor sie die Anzahl der Zimmer erwähnten, und die Schule war von Kreisen des Wohlstands, des Selbstvertrauens und der Coolness umgeben wie eine Strahlungszone. Wenn man dort an einem Sommerabend herumschlenderte, hörte man überall Violinen, Cellos und klassische Gitarren auf fortgeschrittenem Niveau. Von all unseren instinktiven Zugehörigkeitsgefühlen, sei es zu einem Team, einer Partei oder sonstigen Gruppe, war die Loyalität der Schule gegenüber am stärksten, und selbst wenn wir unsere Schule hassten, blieb das Band bestehen, unauslöschlich wie ein Tattoo. Trotzdem wünschte ich mir die kurze Zeit zurück, in der ich noch kein Merton-Grange-Junge und sie noch kein Chatsborne-Mädchen gewesen war.
Wir gingen schweigend weiter.
»Keine Sorge, ich klau dir schon nicht dein Essensgeld«, sagte ich, und sie lächelte stirnrunzelnd.
»Hab ich das behauptet?«
»Nein.« Meine Stimme klang bitter. Ich versuchte es noch einmal. »Ich hab dich hier noch nie gesehen«, sagte ich, als würde ich ständig auf der Suche nach Mädchen durch die Straßen streifen.
»Ah. Ich wohne …« Sie deutete vage auf die Bäume.
Wir gingen weiter.
»Zwischen deiner und meiner Schule gab’s öfter mal Zoff«, sagte sie.
»Ja, an der Stadtgrenze, vor dem Chinarestaurant. Ich weiß. Ich war auch mal dabei.«
»Um zu kämpfen?«
»Nein, nur als Zuschauer. Es war auch keine richtige Schlägerei. Alle haben immer von Messern geredet, jemand würde abgestochen werden, aber die einzigen Waffen, die ich gesehen habe, waren Geodreiecke. Meistens haben sich die Leute nur mit Wasser und Chips beworfen.«
»Tja, leg dich nie mit Mathematikern an.«
»Merton Grange hat jedenfalls immer gewonnen.«
»Mag sein«, sagte sie, »aber gibt es bei so etwas überhaupt Gewinner?«
»Krieg ist die Hölle.«
»Schlägereien an der Stadtgrenze, hat ein bisschen was von Sharks und Jets, hm? Ich hasse diesen ganzen Scheiß. Zum Glück ist das vorbei. Ich mein, sieh dir uns beide nur mal an, wir unterhalten uns ganz friedlich …«
»Ungezwungen …«
»Verstehen uns gut, überwinden Grenzen …«
»Echt rührend.«
»Und, wie waren deine Prüfungen?«
Zum Glück hatten wir das verrostete Metalltor erreicht, das die Außengrenze des Landsitzes markierte und zu einem braunfleckigen Rasen führte; der Fachwerkbau dahinter war beeindruckend genug, um als Ablenkung zu dienen.
»Darf ich da überhaupt rein?«
»Als Nicht-Adeliger, meinst du? Na klar.« Ich hielt ihr das Tor auf, und sie zögerte. »Ohne dich komm ich den Hügel nicht rauf. Du bist buchstäblich meine Stütze.«
Wir gingen weiter, überwanden einen tiefen Graben, einen sogenannten Ha-Ha, der seit dem 18. Jahrhundert als Quelle für und Reaktion auf schlechte Witze diente. Aus der Nähe betrachtet wirkte der Ziergarten vernachlässigt und vertrocknet: verdorrte Rosen und eine dürre Ligusterhecke. »Siehst du das da hinten? Das ist das berühmte Labyrinth.«
»Warum hast du dich nicht da drin versteckt?«
»Seh ich aus wie eine Amateurin?«
»Was für ein Haus hat ein Labyrinth?«
»Ein Bonzenhaus. Komm schon, ich stell dich den Besitzern vor.«
»Ich sollte besser zurückgehen, mein Rad ist immer noch …«
»Hier klaut dir niemand dein Rad. Komm schon, sie sind echt nett. Außerdem sind auch Leute von deiner Schule da, du kannst Hallo sagen …«
Wir gingen über den Rasen auf einen Innenhof zu. Man hörte Stimmen. »Ich muss jetzt echt nach Hause.«
»Sag einfach nur Hallo, dauert keine Minute.« Mir fiel auf, dass sie sich bei mir untergehakt hatte, um einen besseren Halt zu haben oder um mich daran zu hindern abzuhauen, und im nächsten Moment hatten wir den Innenhof erreicht, wo zwei Tapeziertische mit Essen standen, um die sich ungefähr zehn Leute scharten, die uns den Rücken zuwandten: die finsteren, geheimnisvollen Rituale der ominösen Truppe.
»Da ist sie ja!«, rief ein rotgesichtiger junger Mann, der ein kragenloses Hemd trug, das ihm über die Hose hing. Er warf seinen überlangen Pony zurück. »Die Siegerin ist zurückgekehrt!« Er kam mir irgendwie bekannt vor, aber jetzt drehte sich der Rest der Sekte jubelnd und applaudierend um, als das Mädchen auf sie zuhumpelte. »Du meine Güte, was ist denn mit dir passiert?«, fragte der junge Mann, nahm ihren Arm, und eine ältere Frau mit kurz geschorenen weißen Haaren sah mich stirnrunzelnd an und schnalzte missbilligend mit der Zunge, als wäre es meine Schuld.
»Ich bin hingefallen«, erklärte das Mädchen. »Der Junge hier hat mir geholfen. Tut mir leid, ich weiß nicht mal deinen Namen.«
»Er heißt Charlie Lewis«, sagte Lucy Tran, ein Mädchen von der Merton Grange mit vietnamesischen Wurzeln, und presste mit sichtlicher Abneigung die Lippen aufeinander.
»Ach du Scheiße, es ist Lewis«, rief jemand. Helen Beavis lachte und schlug sich sofort die Hand vor den Mund, damit der Salat nicht rausfiel. »Was machst du hier, du Freak?«
»Ich war mit dem Rad unterwegs, hab mich auf einer Wiese ausgeruht und …« Mir gingen die Erklärungen aus, und ich stand verlegen herum.
»Hi, Charlie, willkommen an Bord!«, sagte der kleine Colin Smart, das einzige männliche Mitglied der Theater-AG, und jetzt kam der junge Mann mit dem langen Pony mit ausgestreckten Armen, dunklen Schweißflecken unter den Achseln und so entschlossenem Gesicht auf mich zu, dass ich instinktiv einen Schritt zurücktrat und gegen eine Mauer prallte.
»Hallo, Charlie, du bist also dabei? Ich hoffe es! Wir brauchen dich, Charlie!« Und er umschloss meine Hand mit seiner und schwenkte sie kräftig auf und ab. »Nimm dir was vom Büfett, und dann schauen wir mal, wo wir dich einsetzen können«, sagte er, und plötzlich wusste ich, woher ich ihn kannte und wofür er stand und dass es höchste Zeit war, mich zu verdrücken.
Die Fünf Faden Tief Theatergenossenschaft
In den letzten Wochen unseres letzten Halbjahrs hatte man uns zu einer wichtigen Versammlung in die Aula gerufen. Normalerweise bedeutete das, dass es irgendwas Reißerisches zu sehen gab, vielleicht einen Vortrag über Verkehrssicherheit mit drastischen Illustrationen. Ein Jahr zuvor hatte ein Polizist mit einem Vorschlaghammer einen Blumenkohl zertrümmert, um die Wirkung von Ecstasy auf das Gehirn zu demonstrieren, und eine Woche später war eine nette, nervös aussehende junge Frau vorbeigekommen, um mit uns über Sex im Rahmen einer gesunden, liebevollen Beziehung zu sprechen. Die Türen schlossen sich unheilvoll hinter uns, und das Licht wurde gedimmt. »Könntet ihr bitte leise sein?«, bat sie. Dann zeigte sie unter Gelächter, Kreischen und entsetzten Aufschreien rosafarbene und violette Dias. Ich dachte über das Thema Berufswahl nach und fragte mich, welche seltsame, kranke Karrierelaufbahn diese Frau dazu gebracht hatte, nervös von Schule zu Schule zu reisen, im Gepäck einen Karton voller Dias von Penissen in allen möglichen Formen und Größen. »Mit Abstand die miesesten Urlaubsfotos aller Zeiten«, sagte Harper, und wir lachten, als ginge uns das alles nichts an. Klick, klick, machten die Dias. »Genau wie bei Schneeflocken gibt es auch keine zwei Penisse, die sich vollkommen gleichen«, sagte sie, und ich fragte mich – woher wussten die das?
»Woher wissen die das?«
»Sie benutzen ein Mikroskop«, sagte Lloyd und boxte mich zwischen die Beine.
Und so machte sich, als wir an diesem Tag unsere Plätze eingenommen hatten, eine gewisse Enttäuschung im Saal breit, als ein rotgesichtiger, grinsender junger Mann mit einem voluminösen Pony über den Augen und eine hagere, etwa gleichaltrige Frau, deren schwarzes Haar zu einem strengen Zopf zurückgebunden war, das Podium betraten. Vor ihnen stand, dunkel und bedrohlich, ein Ghettoblaster.
Mr Pascoe klatschte zweimal in die Hände. »So, jetzt seid mal alle ruhig. Lloyd, fühlst du dich mit ›alle‹ nicht angesprochen, oder hast du irgendwelche wundersamen Eigenschaften, die dich von allen anderen unterscheiden? Dann setz dich. Sofort. Also, ich möchte euch heute gern ein paar ganz besondere Gäste vorstellen, mit besonderen Talenten, besonderen Ambitionen …«
»… besonderem Förderbedarf«, sagte Harper, und ich lachte.
»Lewis! Charles Lewis, was soll das?«
»Tut mir leid, Sir!«, sagte ich, senkte den Blick, und als ich wieder aufsah, entdeckte ich, dass der junge Mann auf der Bühne mich angrinste und mir verschwörerisch zuzwinkerte; ich hasste dieses Zwinkern.
»Unsere Gäste kommen von der Universität Oxford! Sie sind hier, um euch von einem aufregenden Projekt zu erzählen, also bitte begrüßt mit einem herzlichen Applaus … einen Moment Geduld bitte …« Er warf einen Blick auf seine Notizen. »Ivor und Alina von …« Noch ein Blick auf die Notizen. »… der Fünf Faden Tief Theatergenossenschaft!«
Ivor und Alina sprangen so schwungvoll von ihren Stühlen, dass sie quietschend über das Parkett rutschten. »Wie geht’s euch, alles klar?«, rief Ivor, der mit seiner dicklichen Figur und den großen Augen wie ein verwöhnter Cavalier King Charles Spaniel aussah. Gut, gut, murmelten wir, aber Ivor hatte die gleiche übereifrige, schleimige Art wie die Moderatoren aus dem Kinderfernsehen. Er legte die Hand ans Ohr und rief: »Ich kann euch nicht hören!«
»Klar kann er uns hören«, sagte Lloyd. »Der verarscht uns.«
»Es ist ein Trick«, sagte Fox, »ein ganz raffinierter Trick.«
»Okay, noch mal von vorne! Alles klar?« Wir schwiegen hartnäckig.
»Ooooh, seid ihr etwa traurig?«, sagte Alina, zog die Mundwinkel nach unten und legte den Kopf schief.
»Scheiße, zwei von der Sorte«, sagte Lloyd, aber Alina hatte einen osteuropäischen Akzent, vielleicht tschechisch oder ungarisch, was sie in unseren Augen sexy und interessant machte.
»Wir sind hier, um euch von einem fantastischen Projekt zu erzählen«, sagte Ivor, »einem Projekt, das diesen Sommer beginnen soll und auf das wir uns sehr freuen. Und – wer von euch hat schon mal von Mr William Shakespeare gehört? Mehr nicht? Meine Güte, seid ihr schüchtern. Okay, versuchen wir es mal andersrum: Wer hat noch nie von Mr. William Shakespeare gehört? Dem Schwan von Avon! Dem Barden! Dem größten literarischen Genie aller Zeiten! Seht ihr – ihr habt alle schon von ihm gehört.«
»Und wer von euch kennt ein Zitat von Shakespeare?«, fragte Alina.
Eine Hand schoss in die Höhe. Suki Jewell, stellvertretende Schülersprecherin.
»Sein oder Nichtsein«, flüsterte Harper.
»Sein oder Nichtsein!«, rief Suki.
»Das ist hier die Frage! Sehr gut! Hamlet! Noch jemand?« In der ersten Reihe meldeten sich die Büchergutschein-Leute:
»Ach, armer Yorick!«
»Ist das ein Dolch?«
»Nun ward der Winter unseres Missvergnügens!«
»Es ist besser, geliebt und verloren zu haben«, rief Suki Jewell, »als nie geliebt zu haben.«
Ivor runzelte tröstend die Stirn. »Also, genau genommen ist das Tennyson.«
»Ja, das ist Tennyson, Dumpfbacke«, sagte Lloyd.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.