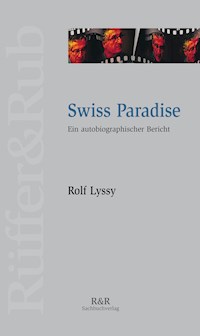
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rüffer & Rub
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Das Lächerlichste auf der Welt: Hörer abheben, Nummer wählen, warten, bis sich am anderen Ende der Leitung eine Stimme meldet. Es ging nicht. Es ging einfach nicht." Unvermittelt, an einem Tag wie jeder andere, muß Rolf Lyssy, der Generationen mit seiner Komödie "Die Schweizermacher" zum Lachen gebracht hatte, erkennen, daß nichts mehr funktioniert in seinem Leben. Er befindet sich in einer schweren Depression. Der Meister der hellen Ironie und der lächelnden Kritik beginnt nach seiner Krankheit eine Reise in sein Innerstes, die ihn von der Emigration seiner jüdischen Großeltern aus Osteuropa nach Frankfurt und schließlich in die Schweiz führt. Aus Aufzeichnungen, die ihm die Mutter hinterlassen hat, erfährt er, daß seine schweizerische Geburt ihr Überleben bedeutete - während den Großeltern und den anderen Verwandten der rettende Paß verwehrt blieb. Sie wurden deportiert und ermordet. Das vorliegende Buch ist Rolf Lyssys literarische Verarbeitung seiner Depression, seiner Regisseurenlaufbahn und der Geschichte seiner Vorfahren. Pressestimmen "Ein berührendes und mutiges Buch ..." Urs Widmer "Mit ›Swiss Paradise‹ ist Lyssy ein vielschichtiges Buch gelungen." Die Zeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Swiss Paradise
Ein autobiographischer Bericht
Rolf Lyssy
eBook-Version 1.0
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012 by rüffer&rub Sachbuchverlag, Zürich
Erstellt auf der Grundlage:
Zweite Auflage Hardcover Frühling 2001
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2001 by rüffer&rub Sachbuchverlag, Zürich
ISBN 978-3-907625-58-3
Für Elia, Michael, Dominique
und meine Freundinnen und Freunde
Vorwort
Rolf Lyssy hat ein berührendes und mutiges Buch geschrieben, das ich allen Leserinnen und Lesern ans Herz legen möchte. Er erzählt uns die Geschichte einer Depression, seiner Depression, und beschreibt ebenso genau wie unsentimental einen ihn überrumpelnden Bruch in der eigenen, eben noch so erfolgreichen und auch glücklichen Geschichte. Swiss Paradise ist der Bericht einer Reise ins Herz der eigenen Finsternis. Rolf Lyssy stürzte jäh in ein schwarzes, schier bodenloses Loch und entkam ihm ein halbes Jahr nicht mehr.
Die Depression ist eine alle Lebenskräfte so sehr lähmende Erkrankung, eine Art Tod bei lebendigem Leibe, daß sie in der Regel keine klare Beschreibung durch den Kranken erfahren kann. Hier ist das Seltene gelungen. Rolf Lyssy gesundet, hat die Kraft und den Mut, sich den vergangenen Horror nochmals zu vergegenwärtigen. Er beschreibt, mit beteiligter Nüchternheit, seine Symptome und die Versuche der Ärzte, ihn von diesen zu befreien. Es gelingt ihm, neugierig und wohl immer noch erschrocken, von einer Zeit zu sprechen, die nicht weit zurückliegt und in der er weder zu Schrecken noch Neugier fähig war.
Allein dies würde das Buch wertvoll und lesenswert machen. Es ist aber mehr als eine Kranken- und Gesundungsgeschichte, weit mehr. Vor allem enthält (und kommentiert) es einen autobiographischen Bericht der Mutter Rolf Lyssys, den dieser in ihrem Nachlaß fand. Wir lesen die vitale Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin mit russischen Wurzeln, die es in jungen Jahren in die Schweiz verschlug. Durch ihren Bericht gewinnt das Buch ein gewaltiges Stück Welthaltigkeit hinzu. Seine eigene Geschichte wird unversehens ein Teil der Zeitgeschichte und natürlich, in erster Linie, ein Teil der Geschichte der Juden in diesem für sie besonders unseligen vergangenen Jahrhundert. Die Geschichte der Mutter, voller Lebenskraft und mit Witz geschrieben, ruft ein weiteres Mal und dennoch in neuer Beleuchtung die Leiden der Juden in Deutschland (und anderswo) in Erinnerung. Der (affektive, nicht materielle) Reichtum ihrer weitverzweigten Familie wird wunderbar deutlich, auch deren Macken und Defizite. Ihr Sohn, sagt die Mutter, habe ihr das Leben gerettet: Ohne ihre Schwangerschaft und die Heirat mit Lyssys Vater im Jahre 1936 wäre sie nach Deutschland ausgewiesen worden und hätte wohl das Schicksal ihrer Familie erlitten, das in diesem Fall Minsk hieß und genauso den Tod bedeutete wie für andere Auschwitz oder Birkenau. Und so wird Rolf Lyssy für uns, während wir sein Buch lesen, mehr und mehr auch ein jüdischer Künstler, und wir erinnern uns mit aller Deutlichkeit, daß ihn immer wieder jüdische Themen bewegt haben: 1974 ein erstes Mal deutlich, als er in Konfrontation die Geschichte David Frankfurters erzählte, jene Rabbinersohns aus Kroatien, der 1936 den Landesgruppenleiter der NSDAP in Davos, Wilhelm Gustloff, erschossen hatte und dafür von einem Gericht in Chur zu achtzehn Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Oder dann, vor wenigen Jahren erst, als er das einfühlsame Porträt seines Bruders drehte (Ein Trommler in der Wüste, 1991) und es unversehens zur Studie eines Lebens in Israel werden ließ.
Ja, Rolf Lyssy ist ein Filmemacher (sein bekanntester Film, ein regelrechter Knüller, ist Die Schweizermacher, 1978; Leo Sonnyboy, 1989, und vor allem Teddy Bär, 1983, mein Lieblingsfilm unter Lyssys Filmen, stehen diesem in nichts nach), und darum ist sein Buch auch eines über das Filmemachen. Das Filmemachen in der Schweiz. Der Auslöser seines Sturzes in den Abgrund war ja, Hand in Hand mit der Trennung von seiner Frau, das Scheitern eines Films. »Swiss Paradise« hätte er heißen sollen; nun hat das Buch seinen Titel geerbt. Daß, wie und warum »Swiss Paradise« scheiterte, ist eine spannende Ebene dieses Buchs. Hier, beim Thema Film, wird Rolf Lyssy durchaus polemisch und aggressiv, gottseidank. Auch wenn er – beinahe hätte ich gesagt: in gut protestantisch- zürcherischer Tradition – die Schuld auch bei sich sucht, so zeigt er doch, daß diese Schuld mindestens sosehr im Zustand der helvetischen Filmförderung liegt. Es ist in der Tat schwer nachzuvollziehen, wie es möglich war, daß die zuständigen Gremien immer erneut die Drehbücher zurückwiesen, die Lyssy ihnen vorlegte; auch wenn sie dann zusehen konnten, wie diese, dennoch realisiert, erfolgreich wurden. (Auch das Drehbuch der Schweizermacher war abgelehnt worden.) Ein Filmemacher in der Schweiz muß offenkundig sehr robust sein, und er muß Kränkungen noch besser aushalten können als andere Künstler in diesem Land, in dem viele auch in den Künsten das Pädagogische und den Konsens suchen. Rolf Lyssy ist ja denn auch nicht der einzige Filmemacher, der in und an der Schweiz schier verzweifelt. Kurt Gloor ist nur der, meines Wissens, letzte in einer langen Reihe von Filmkünstlern, die sich umbrachten oder sonstwie elend untergingen.
Es ist ein Jammer, daß »Swiss Paradise« nicht gedreht worden ist und wohl, weil inzwischen zu vieles geschehen ist, tatsächlich nicht mehr gedreht werden wird. »Swiss Paradise« hätte eine Art Schweizermacher zwanzig Jahre danach werden können, mit den gleichen Helden an einem anderen Ort, in einer veränderten Zeit. Rolf Lyssys Filme haben mir immer besonders gut gefallen, weil sie sehr genau ihren Ort und ihre Zeit definieren. Rolf Lyssy hat stets Ungenauigkeiten abgelehnt, nur weil dann ein größeres Publikum erreicht werden könnte. So sprechen die Menschen eben, wenn ein Film in der Schweiz spielt, ihren Dialekt, kein allgemein verbindliches Bühnendeutsch. »Swiss Paradise«, der zu einem guten Teil in den USA hätte spielen sollen, wäre also ein schweizerdeutsch- englischer Film geworden, in dem die Indianer – ein von Indianern betriebenes Spielkasino spielt eine Rolle – gewiß auch hie und da ihr eigenes Idiom gesprochen hätten. Rolf Lyssy hat nie nach dem größtmöglichen Vielfachen geschielt, und genau deshalb sind ihm einige Filme gelungen, die die große Menge sehr wohl erreicht haben.
C.G. Jung hat die Depression »eine Dame in Schwarz« genannt, die man nicht wegweisen solle. »Nein, die Depression ist keine Dame in Schwarz«, sagt dagegen Rolf Lyssy mit guten Gründen. »Sie ist vielmehr ein Krake, der plötzlich aus den Tiefen hervorsteigt, die Seele von Körper und Geist abkoppelt, alle Gefühlszugänge blockiert, sich mit seinen Fangarmen festsaugt, einen umschlingt und zu ersticken droht. Man schnappt hilflos nach Luft, zappelt, will reden, aber es geht nicht. Gelingt es einem, sich irgendwo festzuhalten, bevor man von diesem Monster in die Tiefe gezogen wird, dann besteht Hoffnung auf Rettung. Mir war es in der Tat gelungen, mich festzuhalten, obwohl ich nicht sagen könnte, wie und wo. Vielleicht hatte ich einfach nur unfaßbares, unbeschreibliches Glück gehabt.«
Urs Widmer
1
Ich hätte mich ohrfeigen können. Freiwillig war ich in die Klinik eingetreten, auf Anraten meines Psychiaters Dr. K. Zuvor hatten wir es drei Monate lang mit ambulanter Gesprächstherapie und Psychopharmaka versucht. Vergeblich.
Am Donnerstag hatte sich mein Zustand massiv verschlechtert: Die Angst und das zwanghafte Grübeln waren kaum mehr zu ertragen. Ich tigerte in der Wohnung herum, schlug zwischendurch immer wieder verzweifelt den Kopf an einen Türrahmen, um das wahnsinnige Rotieren der wirren, unkontrollierten Gedanken zu stoppen. Ich machte das täglich, schon seit Wochen. Ein Wunder, daß mein Schädel noch keinen Schaden genommen hatte. Mir graute vor den bevorstehenden Pfingstfeiertagen: leere Tage, Alleinseinstage.
In einem Anflug von Klarheit beschloß ich, mich selbst einzuliefern, in die Klinik, die ich zwei Wochen vorher schon einmal vorsorglich begutachtet hatte. Wenn schon Klinik, dann wollte ich zuerst sehen, was mich erwarten würde. Die wohlgemeinten Ratschläge meiner Freunde hatten mich zusätzlich verunsichert. Die einen plädierten für einen sofortigen Klinikaufenthalt, andere sprachen sich mit Vehemenz dagegen aus. Einmal der Klinikpsychiatrie ausgeliefert, würde ich für immer stigmatisiert sein, sagten die einen. Und die anderen gaben mir zu bedenken, daß nur geschultes Fachpersonal mir helfen konnte. Ich fühlte mich nach wie vor nicht krank. Ich hatte ein Arbeitsproblem, aber ich war nicht krank. Oder doch? Seit beinahe drei Monaten quälte ich mich durch die Tage. Ich konnte die Klinikfrage nicht länger hinausschieben und ich wußte, niemand würde mir einen Entscheid abnehmen, auch wenn ich mir das noch so wünschte. Ich fühlte mich wie das Kind in Brechts Kaukasischem Kreidekreis, das von den zwei Müttern beinahe auseinandergerissen wird. Was mir aber, so absurd es klingen mag, am meisten zu schaffen machte, waren tonnenschwere Schuldgefühle gegenüber meinen Freunden. Mich für oder gegen einen Klinikaufenthalt zu entscheiden, empfand ich den einen oder den anderen gegenüber als unloyal. Dies alleine zeigte schon, wie sich mein Gefühlshaushalt völlig jenseits eines normalen Empfindens bewegte. Aber wie immer ich mich entscheiden würde, ohne mir selber ein Bild von der Situation in der Klinik gemacht zu haben, glaubte ich nicht fähig zu sein, überhaupt zu einem Schluß zu kommen. Und so hatte mich Oberarzt Dr. B., von Dr. K. über meinen Zustand informiert, durch die Station geführt, mir die Zimmer und Aufenthaltsräume gezeigt und mit ernster Miene zu verstehen gegeben, daß ich unter einer sehr schweren Depression litt. Er empfehle mir, so rasch als möglich in die Klinik einzutreten. Ich wunderte mich. Wie konnte er wissen, daß ich eine schwere Depression hatte? Ich wußte, daß ihn mein Arzt über meinen Zustand aufgeklärt hatte, aber er hatte doch kaum mit mir gesprochen. Sah man mir das an? Sah er in mich hinein? War er wirklich der kompetente Seelenarzt, den man mir empfohlen hatte? Vielleicht würde er mir helfen können. Seinem Mienenspiel war deutlich anzusehen, wie ungern er mich wieder gehen ließ. Doch prompt machten sich erneut Widerstände in mir bemerkbar. Was würde er mit mir alles anstellen? Ich war ja schon lange nicht mehr in der Lage zu argumentieren. Ich wußte, ich konnte seinem Willen und seiner Erfahrung nichts entgegensetzen. Ich würde ihm ausgeliefert sein, und meine Widerstände verwandelten sich in Angst. Ich verabschiedete mich von Dr. B. und versprach ihm, daß ich mit Dr. K. über einen möglichen Klinikaufenthalt nochmals reden würde. In meinem Innern aber dachte ich, daß es unter keinen Umständen in Frage kam. Jetzt nicht und auch später nicht. Nie. Nicht für mich.
2
Begonnen hatte alles drei Monate zuvor, Mitte Februar 1998. Eines Tages schoß ein Kugelblitz mit ungeheurer Gewalt durch meinen Kopf und durchtrennte mit einem Schlag alle Kommunikationswege im Gehirn. Zerstückelt, zerrissen, verbrannt, lahmgelegt – die dramatische Folge einer fatalen Fehlgeburt. Ich hatte einsehen müssen, daß die auf den Sommer des gleichen Jahres geplante Produktion meines neuen Spielfilms, einer Komödie mit dem Titel »Swiss Paradise«, nicht zustande kommen würde. Es gab verschiedene Gründe: Zum einen war es dem Produzenten nicht gelungen, die Finanzierung sicherzustellen, zum andern entdeckte ich bei der letzten Drehbuchüberarbeitung derart gravierende Mängel, die mir früher nie aufgefallen waren, so daß an eine Realisierung des Films zum vorgesehenen Termin nicht mehr zu denken war.
Über drei Jahre hatte ich mich in dieses Projekt geradezu verbissen, wollte mit dem Kopf durch die Wand, auch aus Gewohnheit, weil man in diesem Land, will man einen Film realisieren, gezwungen wird, diesen Weg zu gehen: straight through the wall. Nur diesmal war es anders. Alle Mühen, alle Hoffnungen waren vergeblich gewesen: Das Buch, an dem ich mit Christa M., Autorin und Filmemacherin aus Berlin, und Georg J., Cutter und Regieassistent dreier meiner früheren Spielfilme, geschrieben hatte, war in dieser Form unbrauchbar. Ich ahnte, nein, ich hatte tief in mir die Gewißheit, daß der Film das Licht der Leinwand wohl nie erblicken würde. Trotzdem machte ich mit Christoph S., dem vorgesehenen Produktionsleiter, in der ersten Märzwoche eine Rekognoszierungsreise nach New Glarus, America’s Little Switzerland, wie sich der Ort im US-Bundesstaat Wisconsin nennt. In diesem idyllischen amerikanischen ›Schweizerdorf‹ sollte der Film spielen. Dadurch, daß ich nicht alleine reiste, wurde ich zwar etwas abgelenkt, blieb aber innerlich hin- und hergerissen zwischen der Gewißheit, daß der Film nicht zustande kommen würde, und einer illusorischen Hoffnung, daß es vielleicht doch noch klappen könnte, obwohl aus meiner Sicht nichts mehr dafür sprach. Absolut gar nichts.
Eine Woche wollten wir in New Glarus bleiben. Anschließend sollte Christoph nach Hause zurückfliegen, während ich noch einige Tage bei meinem Sohn Elia, der in New York lebt und arbeitet, verbringen wollte. Als ich am Tag nach unserer Ankunft mit Christoph durch den Ort spazierte, um ihm mögliche Drehortezu zeigen, sank meine Stimmung auf einen absoluten Tiefpunkt. Plötzlich schien alles so sinnlos. Ich glaubte an nichts mehr und fühlte nichts mehr. Ich hatte nur den einen Wunsch, so rasch als möglich wieder abzureisen. Gleichzeitig war mir bewußt, daß ich das Christoph nicht antun konnte und dem Besitzer des Hotels, das eine wichtige Rolle im Film haben sollte, schon gar nicht, denn dieser bemühte sich, uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Ich hatte nicht den Mut, ihnen zu gestehen, daß ich nicht mehr an das Projekt glaubte. Ihr Engagement und ihr Optimismus konnten meine unaufhaltsame verzweifelte Fahrt ins Nirgendwohin nicht aufhalten.
Ich kam mir vor wie auf einer Folterbank, gefesselt, hilflos Schuldgefühlen, Gewissensbissen und abgrundtiefen Ängsten ausgeliefert. Ich haderte mit mir, weil ich unfähig gewesen war, das Steuer dieses langjährigen, mühseligen, verfahrenen Filmprojekts rechtzeitig herumzureißen. Christoph konnte nicht wissen, wie es in mir aussah. Ohne in Einzelheiten zu gehen, versuchte ich ihm verständlich zu machen, daß ich nicht in der Lage sein würde, im Hinblick auf die Realisierung Entscheide zu fällen. Er nahm es relativ gelassen, sagte, daß er genug zu erledigen hätte, ohne daß ich mich daran beteiligen müßte. Das war zwar gut gemeint, änderte jedoch an meiner seelischen Verfassung nichts. Christoph erklärte sich außerdem bereit, mit mir das Drehbuch im Hinblick auf Verbesserungen nochmals durchzugehen, und ich willigte ein. Vielleicht, mit seiner Hilfe, die Schwachstellen eliminieren und dann doch…?
Das Hotel, in dem wir wohnten, bestand aus zwei sehr großen Chalets. In der Filmgeschichte waren die beiden Häuser sozusagen das Objekt der Begierde und die Handlung war folgende: Max Bodmer, der Kantonspolizist aus meinem Film Die Schweizermacher, erbt zur Hälfte von seiner im Alter von neunzig Jahren verstorbenen Tante das Hotel Landhaus in New Glarus. Als Dank für die gute Arbeit hat die Besitzerin die andere Hälfte ihrem Hotelmanager Norbert Hagmann vererbt. Hagmann war zehn Jahre zuvor aus der Schweiz nach New Glarus eingewandert. Nun lernt er eines Tages seinen Erbpartner Bodmer kennen, der mit einer Reisegruppe aus der Schweiz im Hotel abgestiegen ist, um sich zuerst einmal inkognito ein Bild zu machen. Verärgert stellt Bodmer fest, daß sich in diesem ›Schweizer‹ Hotel mehr indianische als schweizerische Einrichtungsgegenstände befinden. Zudem ist Hagmann, ein großer Indianerfan, mit einer Indianerin verlobt, deren Bruder in der Nähe von New Glarus ein Spielkasino führt. Hagmann sieht sich bald mit unerhörten Forderungen Bodmers konfrontiert. Und damit beginnt der ›Leidensweg‹ der beiden ungleichen Erben. Hier der bodenständige frustrierte Ex-Polizist und dort der aufgeschlossene, modern denkende Manager. Daß das auf die Dauer nicht gutgehen kann, versteht sich von selbst. Und als sich dann im Laufe der Handlung eine reiche amerikanische Witwe, mit einer offensichtlichen Schwäche für gestandene Schweizermänner, in Bodmer verliebt, läuft erst recht nicht mehr alles so, wie es einmal ursprünglich geplant war. Das war der Ausgangspunkt zu einer Komödie, bei der es mittlerweile nichts mehr zu lachen gab. Wir setzten uns zusammen, überlegten, diskutierten, schrieben auf und verwarfen wieder, noch einmal von vorne … Es half nichts. Das Handlungsgefüge der Geschichte und damit deren Glaubwürdigkeit waren nach meinem Empfinden auseinandergebrochen. Der Karren mit der Szenenfolge, den Figuren und ihren Dialogen war zu tief im Schlamm eingesunken, als daß er sich noch hätte herausziehen lassen. Ich sehnte das Ende der Woche herbei.
Am Samstag war es soweit. Christoph verabschiedete sich am Morgen und fuhr mit dem Mietwagen nach Chicago, von wo er gleichentags zurück in die Schweiz flog. Rechtzeitig, denn im Laufe des Nachmittags wurde das Land von einer riesigen Ladung Vorfrühlingsschnee zugedeckt.
Tags darauf kam Elia, der in der gleichen Woche in Milwaukee einen Werbespot für Miller’s Beer gedreht hatte. Am Abend saßen wir in der Pizzeria des Hotels und ich berichtete ihm ausführlich über die vergangenen Tage. Ich mußte davon reden, das war ich ihm schuldig, denn schließlich hatten wir geplant, daß er bei meinem Film hinter der Kamera stehen würde. Ich erzählte ihm von meiner Verzweiflung, vom sinnlosen Umherirren in New Glarus, von den vergeblichen Bemühungen, mit Christoph Verbesserungen am Buch anzubringen. Er sprach mir Mut zu und war überzeugt, daß es trotz aller momentanen Schwierigkeiten sicher noch Möglichkeiten gäbe, den Film zu retten. Ich wollte ihn nicht enttäuschen und widersprach ihm nicht. Ich hatte auch nicht die Kraft dazu. Ich fühlte mich leer. Im Kopf und im ganzen Körper.
Am andern Tag – der Winter hatte die Gegend weiterhin eisig im Griff – fuhr uns der Hotelbesitzer frühmorgens zum Flughafen von Madison. Es sollte eine Reise voller Tücken werden. Da der Flughafen von Chicago geschlossen war, waren wir gezwungen, mit einer andern Fluggesellschaft als der ursprünglichen über Detroit nach New York zu fliegen. Elia mußte seine ganze Überzeugungskraft bei der Dame am Check-in einsetzen, um zwei Plätze für die nächste Maschine zu bekommen. In Detroit verpassten wir den Anschlußflug, weil wir beide vergessen hatten, daß wir über eine Zeitzone geflogen waren – eine Folge der intensiven Gespräche darüber, was in den letzten Monaten geschehen war: die Trennung von Dominique, meiner Frau, im Herbst 97, die für Außenstehende, auch wenn sie uns noch so gut kannten, völlig überraschend kam und nur schwer nachvollziehbar war. Ich sprach von meiner über Jahre dauernden Unlust und Gleichgültigkeit, die sich in unserer Ehe fast unbemerkt eingeschlichen hatte, von der Unfähigkeit, darüber zu reden, aus falscher Angst, dem Partner zu nahe zu treten, ihn womöglich unbeabsichtigt zu verletzen. Das fatale Festhalten an der trügerischen Hoffnung, es würde sich alles von selber regeln. Unsere Ehe war nicht gescheitert, weil wir den Respekt zueinander verloren hatten, sondern weil wir uns, so paradox es klingen mag, mit zuviel Respekt begegneten. Zuviel Respekt als Deckmantel vor dem eigenen Unvermögen, Konflikte offen und ehrlich auszutragen. Trotz meines lamentablen Zustandes drängte es mich, Elia über den Sachverhalt so gut ich konnte aufzuklären. Ich wollte nicht, daß Dominique in seinen Augen als Alleinschuldige dastand. Das wäre mir zu simpel gewesen. Es war ja nicht nur die unbefriedigende Situation in unserer Ehe, die mich zunehmend belastet und schließlich in diese geistig-seelische Totalblockade, genannt Depression, getrieben hatte. Unbefriedigend und zermürbend im höchsten Maß war auch das über Jahre dauernde Hin und Her um »Swiss Paradise«. Einerseits hatte die zweimalige Rückweisung des Projektes durch den Begutachtungsausschuß der Eidgenössischen Filmkommission die Suche nach zusätzlichen Finanzierungsquellen immer wieder hinausgezögert, anderseits war das Drehbuch aber auch von zwei deutschen Fernsehstationen zurückgewiesen worden, mit der Begründung, für diese bilinguale (Dialekt und Englisch) Schweizer Komödie würde sich kein deutsches Publikum finden. Dieses fragwürdige Argument kannte ich seit Jahrzehnten. Jedes meiner Drehbücher, von Konfrontation über Die Schweizermacher und Teddy Bär bis zu Leo Sonnyboy, war jeweils von deutschen Fernsehanstalten genau aus diesem Grund abgelehnt worden. Waren dann allerdings die Filme produziert, konnten sie nicht schnell genug angekauft werden. Durch die deutschen Absagen war die Finanzierung des »Swiss Paradise«- Projekts in Frage gestellt.
Doch die Geldsuche war nur das eine Problem, das andere war der Produzent selbst. Seine rosarot gefärbten Versprechungen, trotz belastender Hypotheken aus seinen früheren Produktionen die Restfinanzierung in absehbarer Frist auf die Beine zu stellen, blieben, was sie von Anfang an waren: Seifenblasen. Ich mußte mich aber auch selbst an der Nase nehmen, hatte ich doch meine Bedenken über seine Fähigkeiten als Produzent fahrlässig zur Seite gewischt und ihm nie klar gesagt, daß er ohne Zweifel in der Lage sei, die Arbeit eines Produktionsleiters zu bewältigen, als Produzent jedoch zuwenig Know-how besitze, um sich auf dem Kampffeld der nationalen und internationalen Filmszene erfolgreich zu behaupten. Ich hätte mich längst von ihm trennen müssen, denn seine Selbstüberschätzung war mir schon nach ein paar Monaten Zusammenarbeit bewußt geworden. Aber, so wie in der Beziehung zu meiner Frau, überließ ich auch in der Beziehung zu meinem Produzenten das Boot, in dem wir beide saßen, dem Zufall des Wellenspiels und wartete auf irgendeine Entscheidung, die wer immer auch treffen würde, nur nicht ich. Was war es denn, das mich hinderte, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen? Vorsicht? Rücksicht? Unentschlossenheit? Unsicherheit? Ich denke, es war nichts anderes als Angst. Angst um die Beziehung, Angst um den Film, Angst um die Zukunft, Angst um mich selber. Falsche Angst. Gefährliche Angst.
Auch wenn es alles andere als erfreuliche Gedanken waren, mit denen ich Elia konfrontierte, so zeigte er viel Verständnis und versuchte mir, trotz aller Schwierigkeiten, ein Gefühl von Hoffnung zu geben. Er konnte nicht wissen, daß meine Verzweiflung jede Form von Hoffnung im Keim erstickte.
Als wir schließlich abends um sechs wohlbehalten auf dem regnerischen New Yorker La Guardia Airport landeten, sandte ich ein Dankgebet zum Himmel, daß ich diese Reise nicht alleine hatte machen müssen. Meine innere Auflösung war so weit fortgeschritten, daß ich mich wie ein verängstigter, zittriger Greis fühlte. Die Angst war mittlerweile meine ständige Begleiterin. Die vier Tage in New York ertrug ich trotz meines angeschlagenen Zustandes wider Erwarten gut. Elia hatte eine interessante Kameraarbeit hinter sich und wir diskutierten stundenlang über gestalterische Fragen. Ich freute mich mit ihm und mein Vaterstolz verdrängte für kurze Zeit meine Verzweiflung.
Er hatte in die Tat umgesetzt, wovon ich vor fast vierzig Jahren kurz geträumt hatte, nämlich mit einer farbigen Frau in Amerika zusammenzuleben und Filme zu realisieren. Ich hätte es in der Hand gehabt. Die Frau stammte zwar nicht aus Trinidad, wie Elias Freundin, sondern aus Jamaica und sie hatte tatsächlich auf mich gewartet, aber … doch davon später.
Elia versuchte zu retten, was zu retten war, und machte unbeirrt Verbesserungsvorschläge zum Drehbuch. Ich versprach, darüber nachzudenken, mehr war nicht möglich. Und im Grunde nicht einmal das. Wir besuchten zwei Besetzungsbüros, um Informationen über amerikanische Schauspieler zu bekommen und sprachen mit einer befreundeten Produktionsleiterin, die das Drehbuch gelesen hatte. Die Geschichte gefiel ihr gut. Kritisch äußerte sie sich zu jenem Teil der Handlung, in dem die Indianer ins Spiel kamen, die im Bundesstaat Wisconsin als einzige berechtigt sind, ein Spielkasino zu betreiben. Man kann diese außergewöhnliche Vereinbarung als eine Art Wiedergutmachungsversuch gegenüber Amerikas Ureinwohnern betrachten, eine Folge des schlechten Gewissens der Regierung, aufgrund der mehr als hundertjährigen Verfolgung und Diskriminierung der indianischen Bevölkerung. Die Produktionsleiterin machte einige konstruktive Vorschläge, wie die bestehenden Mängel behoben werden könnten. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich würde es doch noch schaffen, den Film im Sommer zu drehen. Der Abschied fiel mir darum nicht so schwer, denn ich dachte, wir würden uns bald wiedersehen. Spätestens dann, wenn ich für die Vorarbeiten zum Dreh wiederkommen würde. Daß die vier Tage in New York lediglich ein letztes Aufflackern meiner Willenskraft bewirkt und die Höllenfahrt in den endlosen, schwarzen Tunnel nur um kurze Zeit hinausgezögert hatten, ahnte ich nicht.
*
Meine Rückkehr fiel in zweierlei Hinsicht auf ein bedeutungsvolles Datum. Es war der 13. März 1998, ein Freitag, notabene. Und es war der Tag der Premiere von Fredi M.s neuem Spielfilm Vollmond. Über zwölf Jahre waren vergangen, seit er mit seinem Höhenfeuer große Erfolge feiern konnte. Uns verband eine jahrzehntelange Freundschaft und ich wollte die Uraufführung seines neuen Werks unter keinen Umständen verpassen. Am Vormittag war ich in Zürich gelandet und Dominique hatte mich abgeholt. Ich fühlte mich nicht gut. Während des Flugs hatte ich nur kurze Zeit geschlafen und ich hoffte, während der Filmvorführung nicht einzunicken. Tagsüber erledigte ich das Nötigste und war sehr gespannt auf den Abend. Dominique begleitete mich, doch schon beim Eintreffen im Kino fühlte ich mich inmitten der vielen Gäste auf eigenartige Weise wie entrückt. Ich nahm zwar alle und alles wahr, gleichzeitig hatte ich den Eindruck, als ob ich gar nicht dazugehörte, als ob unsichtbare Wände zwischen mir und den Menschen bestehen würden. Dieses Gefühl verstärkte sich während der Vorführung zunehmend und beunruhigte mich so stark, daß ich kaum in der Lage war, der Handlung zu folgen. Die Geschichte, die Schauspieler, die stimmungsvollen Bilder lösten null Emotionen in mir aus. Ich blickte zwar mit offenen Augen auf die Leinwand, hörte Stimmen, Geräusche und Musik, aber das alles zusammen bewirkte absolut nichts in mir. Und gleichzeitig war ich von einer bohrenden Wachheit, so als ob ich irgendein hochgradiges Aufputschmittel geschluckt hätte. Das änderte sich auch nicht an der anschließenden Premierenfeier in einem nahen Zunfthaus. Ich beobachtete die Leute, sah zufriedene, aber auch enttäuschte Gesichter und solche, die nichts von dem verrieten, was sie dachten. Ich wußte, daß innerhalb der Filmszene die Erwartungen an Fredis Film überaus hoch waren. Was gibt es Schwierigeres, als an einen vorangegangenen Erfolg anzuknüpfen? Ich erinnerte mich an die Premiere meines Films Kassettenliebe im Herbst 1981.
*
Auch damals, drei Jahre nach dem überwältigenden Erfolg von Die Schweizermacher, waren die Erwartungen in bezug auf meinen nächsten Film mindestens so gigantisch. Um so mehr als Emil ein weiteres Mal in einer Hauptrolle zu sehen war. Ich weiß bis heute nicht, mit welchem Film ich diesen Erwartungen gerecht geworden wäre. Ich sehe die Gesichter von damals noch vor mir, freundliches, aber auch mitleidvolles Lächeln, tröstende Worte von Freunden, die ihre Enttäuschung trotz allem Bemühen nicht ganz verbergen konnten. Und dann die andern, denen die Häme, die Schadenfreude, die arrogante Genugtuung aus allen Poren schoß. Und das zählte doppelt, denn gleichentags, nach der morgendlichen Pressevorführung, hatte ich den Filmjournalisten Rede und Antwort gestanden und dabei sozusagen meine eigene ›Hinrichtung‹ erlebt. Kassettenliebe, eine Komödie zum Thema Partnerwahl mittels Video, wurde von der Kritikerzunft gnadenlos verrissen, war in den Kinos aber trotzdem ein großer Publikumserfolg. Ich hätte eigentlich zufrieden sein können. War es aber nicht. Meine Kränkung über die Art und Weise, wie die Kritiker mit meinem Film umgesprungen waren, hatte einen tieferen Grund. Es war mein eigenes gebrochenes Verhältnis zu Kassettenliebe. Innerhalb von zwei Jahren hatte ich sieben Drehbuchfassungen geschrieben, bis schließlich Produzent und Hauptdarsteller ihr Einverständnis zur Realisierung gaben. Ich war mir nicht sicher, ob die letzte Fassung wirklich die bestmögliche von allen war, aber als den Dreharbeiten dank der gesicherten Finanzierung nichts mehr im Wege stand, schob ich meine Bedenken zur Seite und war froh, den Film machen zu können. Später wurde mir bewußt, daß die dritte Drehbuchversion die richtige gewesen wäre. Aber im Nachhinein ist man bekanntlich immer klüger. Vielleicht hätte ich ja vieles, was von der Kritik moniert wurde, akzeptieren können, aber die – wie ich damals empfand – respektlose Abqualifizierung meiner und unserer Arbeit bewirkte in mir Trotz, gleichzeitig machten sich aber massive Zweifel, Lustlosigkeit und Resignation in mir breit. Waren das etwa die ersten Warnsignale einer Störung in meinem Seelenleben, die sich siebzehn Jahre später zum Vollbrand entwickeln sollte? Jedenfalls war ich nach dem unbeschreiblichen Höhenflug, den Die Schweizermacher uns allen, die wir daran beteiligt gewesen waren, beschert hatte, hart und schmerzvoll wieder auf dem Boden helvetischer Filmrealität gelandet. Damals wie heute bringe ich es nicht fertig, Kritiken über meine Filme einfach zu ignorieren, wenn sie unberechtigt sind. Ich war und bin zu neugierig, um nicht wissen zu wollen, wie meine Arbeit rezipiert wird. Aber im geheimen bewundere ich Filmkollegen und andere Künstler, die sich einen Teufel um die Kritiker scheren. George Steiner hat es in seinem Buch Von realer Gegenwart provozierend, aber durchaus vernunftvoll vorgeschlagen: »Ich stelle mir eine gegen-platonische Republik vor, aus der die Rezensenten und Kritiker verbannt wurden; eine Republik für Schriftsteller und Leser.« Oder eben für Filmer und Zuschauer. Und an anderer Stelle schreibt Steiner, daß die kompetentesten Kritiker die Künstler selber sind. Wie recht er hat. Leider haben viele Künstler Mühe damit, scheuen Kritik der Kollegen – nicht das Lob – und überlassen die kritische Auseinandersetzung mit ihrem Werk lieber den Rezensenten als vermeintlich objektiven Begutachtern.
*
Ich war nicht in der Lage, mir ein Urteil über Fredis Film zu bilden. Mein Verstand hatte sich bereits von meinen Gefühlen und meiner Seele abgespalten. Irgendwie spürte ich aber doch, daß er sich in einer ähnlichen Situation wie ich im November 1981 befand, und hoffte für ihn, daß er es besser verkraften würde als ich. Reden konnte ich nicht darüber. Zu sehr war ich absorbiert vom eigenen Seelenstreß. Beim Abschied umarmte ich ihn und drückte ihm meine Anerkennung für seine Arbeit aus. Dominique brachte mich gegen zwei Uhr morgens nach Hause. Ich empfand nicht die geringste Spur von Müdigkeit und war doch – bis auf die zwei Stunden, die ich im Flugzeug geschlafen hatte – seit fast vierzig Stunden wach. Eine ungeheure Angst, nicht mehr schlafen zu können, kroch in mir hoch. In der ersten Nacht schrieb ich das noch dem Jetlag zu, als ich jedoch auch die folgenden zwei Nächte wach im Bett lag, mit zunehmendem Herzklopfen, während sich in meinem Kopf die Gedanken immer schneller zu drehen begannen, beschlich mich ein unheimliches Angstgefühl, das sich zunehmend in Panik verwandelte. Irgendwas mußte doch in meinem Hirn passiert sein. Kopfschmerzen hatte ich keine, aber ich hatte das Gefühl, als ob meine Hirnchemie völlig außer Rand und Band geraten sei. Wenn Panik die Steigerung von Angst war, was würde wohl die Steigerung von Panik sein?
Ich merkte im Laufe der nächsten Tage, wie ich mir zunehmend abhanden kam, entfremdet, immer stärker abgeschnitten vom Leben um mich herum. Es war, als ob ich ständig über die eigene Schulter schauen und jede Sekunde von neuem über mich selbst erschrecken würde. Ich konnte einfach nicht aufhören zu grübeln. Eine ärztliche Konsultation war unumgänglich. Jürg A., ein enger Freund, beruflich mit Depressionen unterschiedlichster Art bestens vertraut, vermittelte mir einen Psychiater, der bereit war, mich notfallmäßig zu behandeln, denn zu einem Notfall hatte sich mein Zustand mittlerweile zweifellos entwickelt. Bei der ersten Konsultation heulte ich wie ein kleines Kind und brachte kaum ein Wort über die Lippen. Es sollte für viele Monate das letzte Mal gewesen sein, daß ich in der Lage war, einem Gefühl Ausdruck zu geben, auch wenn es sich um ein schmerzliches und doch irgendwie wohltuendes Weinen handelte. Die Diagnose von Dr. K. lautete auf schwere Depression. Das Wort kannte ich, im landläufigen Sinn. Man sagt es rasch einmal, wenn jemand niedergeschlagen und verstimmt ist. Ich war doch nur enttäuscht, verzweifelt, traurig, weil ein Film, der mir viel bedeutet hätte, nicht zustande gekommen war, aber nicht depressiv! Und schon gar nicht suizidgefährdet! Wenn das nun eine Depression sein sollte, okay, in Gottes Namen, dann würde sie so schnell, wie sie aufgetaucht war, wieder verschwinden. Wenn nicht in ein paar Tagen, dann sicher in ein, zwei Wochen.
Wie sehr ich mich täuschte, merkte ich in aller Deutlichkeit, als ich drei Wochen später zu meinem Freund Xavier K. nach Los Angeles flog. Er hatte mir vorgeschlagen, gemeinsam das Drehbuch nochmals zu überarbeiten. Selber Autor und Regisseur, waren ihm meine Probleme bewußt. Dankbar nahm ich sein Hilfsangebot an. Ein letzter Rest Hoffnung war ja noch entgegen aller Einsicht in mir vorhanden. Aber mein Zustand hatte sich in keiner Weise gebessert, im Gegenteil, es kam mir vor, als ob ich unaufhaltsam immer tiefer in eine raumlose Dunkelheit stürzen würde. Ins Nichts. Dominique brachte mich zum Flughafen und plötzlich überfiel mich ein Gefühl, als ob sich mein Inneres in zwei Teile spalten würde. Ich hatte mich entschieden zu fliegen und jetzt, kurz vor dem Abflug, sträubten sich meine Nervenfasern, von Kopf bis Fuß, mit aller Gewalt gegen die Reise. Es war, wie wenn eine unter Strom stehende Eisenklammer meinen Magen umschließen würde. Ich wollte nicht gehen, weil ich spürte, daß die Reise zu Xavier im Grunde genommen sinnlos war, aber ich getraute mich nicht, es ihr zu sagen. Ich wußte, daß Dominique mich verstanden hätte, aber ich brachte die Worte nicht über die Lippen. Es ging nicht. In meinem Hirn brodelte ein hochexplosives Gemisch aus Panik, Angst und Verzweiflung, und meine Stimmbänder waren lahmgelegt. Ich hatte nur noch einen Gedanken, der sich in mein Bewußtsein schob und wie eine Drehorgel vor sich hin leierte: Ich will hierbleiben, ich will nicht abreisen, ich will hierbleiben, ich will nicht abreisen… aber ich konnte es nicht aussprechen. Während des Check-in nicht, auf dem Weg zur Paßabfertigung nicht und als ich mich von Dominique verabschiedete auch nicht. Mein Körper bewegte sich vorwärts zum Abfluggate. Mein Geist und meine Seele bewegten sich rückwärts, dorthin, wo ich am liebsten geblieben wäre.
Im Flugzeug nach Los Angeles war ich unfähig, mir den Film anzusehen, geschweige zu lesen, von Schreiben war nicht zu reden und schlafen konnte ich auch nicht. So saß ich zwölf Stunden bewegungslos auf meinem Platz und hatte nur den einen Wunsch, das Flugzeug möge abstürzen. Es stürzte nicht ab, sondern landete sicher auf dem Boden des Flughafens von Los Angeles. Ich dagegen war schon längstens abgestürzt – von Boden unter den Füßen keine Spur.
Es hätten zehn wunderbare Tage bei Xavier, seiner Frau Sabina und ihrem zweijährigen Töchterchen werden können. Sie umsorgten mich und halfen mir, wo sie nur konnten. Wir unterhielten uns über meinen Zustand und versuchten zu arbeiten. Es war aussichtslos. Ich brachte keinen klaren Gedanken zu Papier, und die Ideen, die Xavier in phantasievoller Fülle vortrug und aufschrieb, konnte ich nirgends einordnen. Einige Male stand ich auf der Dachterrasse der wunderschönen Wohnung, blickte zu den unweit entfernten Palmen, die den Weg zum Ozean säumten, beugte mich über die Brüstung und überlegte, ob ich nicht hinunterspringen sollte. Ich suchte nach einer Lücke in der Reihe der geparkten Autos, sah den harten Betonboden und sprang nicht. Es blieb ein immer wiederkehrender Wunsch, aber ich erfüllte ihn mir nicht.
Und dann, eines Morgens, auf dem Weg zum Santa Monica Boulevard, wo ich einige Einkäufe machen wollte, begann in mir zunehmender Widerstand gegen das Antidepressivum hochzusteigen, das mir mein Arzt verschrieben hatte. Seit über einem Monat schluckte ich die Pillen und in meinem Kopf herrschte nach wie vor das totale Chaos. Ich hatte schon immer eine sehr kritische Meinung über den Einsatz von chemischen Mitteln, wann und warum immer sie zur Anwendung gelangten. Natürlich war mir bewußt, daß es in der Medizin Situationen gab, in denen die Chemie die letzte Möglichkeit war, ein Leben zu retten. Aber als erstes, davon war ich überzeugt und bin es immer noch, galt es doch, auf die Selbstheilungskräfte des Körpers zu vertrauen. Und so fragte ich mich: War vielleicht die Chemie daran schuld, daß es zu keiner Besserung kam? Das wäre doch auch denkbar. Bis jetzt hatten die Medikamente jedenfalls keine Wirkung gezeigt. Und wie war das mit der Psyche? Würde da die Selbstheilung auch funktionieren? Ich wollte es wissen und setzte das Antidepressivum noch am gleichen Tag ab. Ich hoffte sehr, die Wärme und die Sonne Kaliforniens allein würden heilend wirken. Irrtum. Beim Abschied von Sabina und Xavier dachte ich, ich würde sie nie wiedersehen. Der Gedanke verursachte mir Übelkeit.
Ich machte einen Zwischenhalt von drei Tagen in New York, denn ich brachte es nicht übers Herz, den Kontinent zu verlassen, ohne Elia zu sehen. Als wir uns unter der Wohnungstüre umarmten, merkte ich, daß auch er nicht in bester Verfassung war. Ich kannte den Grund, er hatte am Telefon davon gesprochen. Die Ende Juli auslaufende Frist seiner Aufenthaltsbewilligung hing wie ein Damoklesschwert über ihm. Würde sein Antrag für das neue Visum, eine Vorstufe zur Greencard, von der Einwanderungsbehörde nicht bewilligt, so müßte er das Land definitiv verlassen. Seit seiner Studienzeit an der NYU hatte er jedes Jahr an der US-Greencard-Lotterie teilgenommen und gefiebert, aber das Glück war ihm nicht hold gewesen. So war er gezwungen, den beschwerlichen und teuren Weg zu einer definitiven Aufenthaltsbewilligung mit einem Anwalt zu gehen. Der Gedanke, alles aufgeben und unfreiwillig wieder in die Schweiz zurückkehren zu müssen, war für ihn unerträglich. In New York hatte er studiert, seinen Arbeits- und Freundeskreis aufgebaut und sich als freier Kameramann im Laufe der Jahre einen guten Namen geschaffen. Daß alles mit einem Federstrich zunichte gemacht werden könnte und er keine Möglichkeit hätte, einen negativen Entscheid der Behörde anzufechten, brachte ihn fast an den Rand der Verzweiflung. Und ich litt mit ihm.
Es wurden die längsten drei Tage meines Lebens und sicher auch im Leben von Elia. Wir hatten kaum etwas zu reden miteinander. Nicht, weil wir uns nichts zu sagen gehabt hätten, nein, jeder von uns war seinen eigenen Ängsten, Verzweiflungen und sich im Kreis drehenden Gedanken derart ausgeliefert, daß wir verstummten. Die Gegenwart war so unerträglich, daß ich mich mit meinen Gedanken in die Vergangenheit flüchtete.
Ich hatte in dieser Stadt auch Erfreuliches erlebt: im März 1976 die erfolgreiche Premiere meines Films Konfrontation in einem Kino in Manhattan und die darauffolgende beachtlich gute Kritik in der New York Times und, vierzehn Jahre später, im März 1990, die ebenso erfolgreiche Vorführung von Leo Sonnyboy am New York Film Festival. Jetzt aber war es nicht mehr die pulsierende, kurzweilige, aufregende Stadt, die mich immer wieder von neuem fasziniert hatte. Das New York, wie ich es aus den Filmen von Sidney Lumet, Martin Scorsese und ganz besonders Woody Allen kannte und liebte. Diesmal war Big Apple nur noch bedrohlich, abweisend und kalt. Als ob wir dagegen ankämpfen wollten, marschierten wir am ersten Tag wortlos Seite an Seite, Stunden um Stunden durch Straßen und Pärke, ungeachtet des launischen Aprilwetters, das uns zeitweise einen bissigen Wind ins Gesicht blies. Wenn schon unsere Gehirne zermartert wurden, die Beine ließen uns nicht im Stich. Wer Downtown Manhattan kennt, der kann sich die Distanz vom Astor Place hinunter zum Battery Park sicher vorstellen. Es kam mir vor, als ob wir um unser Leben laufen würden. Die Menschen in den Straßen interessierten uns nicht, eigentlich interessierte uns überhaupt nichts mehr. Wir wußten, daß wir einander nicht helfen konnten, daß niemand uns helfen konnte. Wir waren uns ganz nah und gleichzeitig weit voneinander entfernt. Wäre ich dazu in der Lage gewesen, ich hätte nur noch geweint.
Am zweiten Tag regnete es. An einen längeren Marsch war nicht zu denken. Wir studierten die Kinoinserate. Welcher Film würde sich wohl für unsere Stimmung am ehesten eignen? Eigentlich keiner. Meiner Depression und seiner Ungewissheit war auch die Neugier zum Opfer gefallen. An der Second Avenue, wenige Minuten von Elias Wohnung entfernt, lief Titanic. Ein Film, der uns in keiner Weise interessierte. Aber jetzt, in dieser Situation, war es für uns die einzige Alternative. Für knapp drei Stunden im dunklen Saal sitzen und sich irgendwelchen filmtechnischen Kapriolen, sentimentalen Gefühlsduseleien und dramaturgischen Unwahrscheinlichkeiten aussetzen – das war im Vergleich zur Nässe und Kälte draußen immer noch die bessere Lösung.
Nach der Vorführung gingen wir noch was essen. Zu reden gab es nicht viel. Über die Schwächen des Films waren wir uns einig. Was die technischen Aspekte betraf, so war er zweifellos hervorragend gemacht, der Schiffsuntergang spielte sich über weite Strecken glaubwürdig ab. Weniger glaubwürdig waren jedoch die Figuren, die zu sehr an der Oberfläche blieben, trotz ihrer Gefühlsausbrüche wenig Mitgefühl erweckten und auf die Dauer langweilig wurden.
Das konnte man in einem gewissen Sinn auch von mir sagen. Ich war langweilig und uninteressant für andere geworden. Mit einem Unterschied: Ich befand mich nicht als Passagier auf besagtem Schiff, das einen Eisberg gerammt hatte. Ich selber war das Schiff und im Begriff zu sinken. Hilflos dem einstürzenden Wasser ausgeliefert, unfähig, das einzige Rettungsboot auszusetzen, um wenigstens Elia zu helfen, der sich verzweifelt an die Reling klammerte und keine Chance sah, die ihn bedrohende Ausweisung aktiv abzuwenden. Ich bewunderte, wie er sich trotz seiner Angst gelassen seinem Schicksal stellte. Den darauffolgenden Tag verbrachten wir mit einem letzten Fußmarsch durch Manhattans Straßenschluchten und am späten Nachmittag fuhr uns ein Taxi zur Grand Central Station, von wo ich den Bus zum JFK-Flughafen nahm. Beim Abschied sprachen wir uns gegenseitig Mut zu. Es folgte eine kurze Umarmung, dann stieg ich ein. Der Chauffeur startete den Motor und fuhr ab. Traurig und mit schmerzender Seele blickte ich Elia durchs Fenster nach, wie er winkend und mit einem wehmütigen Lächeln in der Menge verschwand.
Der Flug über den Atlantik unterschied sich von den vorangegangenen Flügen in keiner Weise. Der Wunsch, die Maschine möge ins Meer stürzen, erfüllte sich auch diesmal nicht. Ich saß wie paralysiert in meinem Sitz, unfähig, mich abzulenken. Dank einer Schlaftablette war ich wenigstens in der Lage, etwas zu dösen. Die Ungewißheit, wie es mit mir weitergehen würde, zermarterte mein Hirn, und die Gewißheit, daß die Reise in bezug auf das Drehbuch nicht das von mir erhoffte Resultat gebracht hatte, ließ die Marter zur Folter werden.
*
Dr. K. zeigte sich besorgt, als ich mich zurückmeldete. Ich sagte ihm, daß ich das Medikament in Los Angeles abgesetzt hätte und mich seither nicht schlechter fühlte. Er war der Meinung, daß es auf Grund meines Zustands unverantwortlich wäre, die Therapie ohne Medikation fortzusetzen und verschrieb mir ein neues Antidepressivum. Ich schöpfte ein wenig Zuversicht, hoffte, das neue Medikament würde besser wirken. Das Gegenteil war der Fall. Die letzten Reste meiner Urteils- und Entscheidungsfähigkeit wurden aus Kopf und Seele gespült. Am deutlichsten bekam ich es zu spüren, als ich mit Christa C., die als Scriptdoctor beste Referenzen mitbrachte, einen weiteren Anlauf nahm, das Drehbuch zu überarbeiten.





























