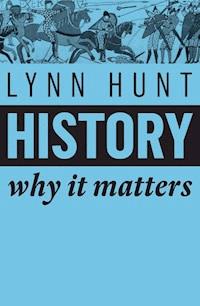14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Für Lynn Hunt ist die Französische Revolution nicht nur Zeichen sich wandelnder ökonomischer und sozialer Strukturen, noch lediglich ein singuläres politisches Ereignis; sie ist vielmehr die Geburtsstunde der »politischen Kultur« in Europa und der »Kaste der Politiker«. ln einer ebenso differenzierten wie ungewöhnlichen Analyse der genuin revolutionären Symbole (Kleider, Feste usw.) erschließt Lynn Hunt die »Sprachen der Macht« und damit das politische Selbstverständnis, das sich in diesen Symbolen bekundet. Es wird dargestellt, wie sich die Symbole im Laufe der Französischen Revolution veränderten; daß sie bald nicht mehr Ausdruck eines Aufbruchs waren, sondern selber zum Instrument der Disziplinierung wurden. Mit der Entstehung der »revolutionären Symbolwelt« und einer »revolutionären Rhetorik« bildete sich eine politische Kultur heraus, die bis auf den heutigen Tag wirksam geblieben ist. Im zweiten Teil wird untersucht, wer diejenigen waren, die diese neue Rhetorik und Symbolik entwarfen, sich durch sie definierten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Ähnliche
Lynn Hunt
Symbole der Macht – Macht der Symbole
Die Französische Revolution und der Entwurf einer politischen Kultur
Aus dem Amerikanischen von Michael Bischoff
FISCHER Digital
Inhalt
Für J., S. und P.
Danksagung
Als ich 1976 die Forschungen zu diesem Buch begann, hatte ich eigentlich ein anderes Projekt im Sinn. Damals wollte ich über die lokalen Strukturen der politischen Macht in vier Städten während der Französischen Revolution schreiben. Während der Arbeit aber verschob sich mein Interesse, teils unter dem Einfluß meiner Freunde und Kollegen in Berkeley, teils aufgrund neuer Arbeiten französischer Geschichtswissenschaftler wie François Furet, Mona Ozouf und Maurice Agulhon. Meine ursprünglich geplante Sozialgeschichte der revolutionären Politik verschob sich zunehmend hin zu einer kulturwissenschaftlichen Analyse, in der die politischen Strukturen der vier Städte nur noch einen Teil ausmachten. Dennoch ist die Macht der zentrale Gegenstand meiner Studie geblieben, denn ich glaube, daß die Macht das zentrale Anliegen der französischen Revolutionäre war, ob sie nun in Paris, in den großen Städten der Provinz oder in Dörfern wirkten, die weitab vom politischen Hauptstrom lagen.
Ich habe in diesen Jahren die Hilfe zahlreicher Institutionen und Einzelpersonen erhalten. Meine Forschungsarbeit wurde von der University of Michigan Society of Fellows, dem American Council of Learned Societies und in letzter Zeit von der Guggenheim Foundation mit Stipendien unterstützt. Dank der finanziellen Unterstützung durch das Committee on Research of the University of California, Berkeley, und das Institute of International Studies in Berkeley konnte ich mir die Hilfe talentierter Graduate-Studenten als Forschungsassistenten sichern. Auf mehreren Reisen nach Frankreich wurde mir die Gastfreundschaft zahlreicher Bibliotheken und Archive zuteil. Ich danke dem Personal der Archives nationales; den Archives départementales der Departements Gironde, Haute-Garonne, Meurthe und Somme; den Archives municipales von Amiens, Bordeaux, Nancy und Toulouse; der Bibliothèque nationale in Paris; dem Musée Carnavalet in Paris; der Stadtbibliothek von Bordeaux sowie den Universitätsbibliotheken in Amiens und Toulouse. In London arbeitete ich im Public Record Office.
Meine Freunde, Kollegen und Studenten haben mich in vielfältiger Weise unterstützt. Die Graduate-Studenten, die mit mir zusammengearbeitet haben, gaben häufig Anregungen, die sich als fruchtbar erwiesen. In Frankreich hatte ich das Glück, daß zwei Freunde mir halfen: Leslie Martin arbeitete 1976 in lokalen Archiven, als ich Heiratsverträge und Steuerlisten durchsah, und Lizabeth Cohen beschaffte mir 1980 Daten aus Toulouse. Die beiden Karten hat Adrienne Morgan gezeichnet. Kollegen in Berkeley und anderswo lasen Teile des Manuskripts in frühen Fassungen; für ihre Kommentare bin ich ihnen sehr dankbar. Ganz besonders danken möchte ich Randolph Starn, Reginald Zelnik, Thomas Laqueur, Jack Censer und Victoria Bonnell, die das gesamte Manuskript lasen und mir wertvolle Anregungen für Verbesserungen gaben. Joyce McCann las das ganze Buch dankenswerterweise sehr aufmerksam durch und machte mir Vorschläge, die der Lesbarkeit des Textes zugute gekommen sind. Mehr als ich selbst es vielleicht wahrzunehmen vermag, haben meine Freunde mich zu einem breiteren und klareren Denken bewegt; dieses Buch trägt in vielem die Zeichen ihres Einflusses. Zum Schluß möchte ich noch den weniger spezifischen, aber darum nicht minder realen Beitrag würdigen, den die University of Berkeley beim Zustandekommen dieses Buches geleistet hat. Neben Geld und Zeit steuerte sie die unschätzbare Umgebung bei, die aus der ständigen Gesellschaft anregender Kollegen und Studenten erwächst.
Einführung Zur Deutung der Französischen Revolution
»J’avais vu que tout tenoit radicalement à la politique, et que, de quelque façon qu’on s’y prit, aucun peuple ne seroit jamais que ce que la nature de son Gouvernement le feroit être; ainsi cette grande question du meilleur Gouvernement possible me paroissoit se reduire à celle-ci. Quelle est la nature de Gouvernement propre à former un Peuple le plus vertueux, le plus éclairé, le plus sage, le meilleur enfin à prendre ce mot dans son plus grand sens.«
»Ich hatte gesehen, daß alles im letzten Grunde auf die Politik ankäme und daß, wie man es auch anstellte, jedes Volk stets nur das würde, was die Natur seiner Regierung aus ihm machen würde. So schien mir die große Frage nach der bestmöglichen Regierung sich auf jene zurückzuführen: Welche Regierungsform ist dazu geeignet, das tugendhafteste, aufgeklärteste, verständigste, kurz das beste Volk im weitesten Sinne des Wortes zu bilden?«
Jean-Jacques Rousseau[1]
Als Rousseau die Behauptung aufstellte, »daß alles im letzten Grunde auf die Politik ankäme«, da traf er eine provozierende und durchaus mehrdeutige Feststellung. In seinen Augen bildete die Politik – und nicht Brauch, Moral oder Religion – die Grundlage des sozialen Lebens. Der Charakter eines Volkes hing von der Natur seiner Regierung ab. Und als er die »große Frage nach der bestmöglichen Regierung« aufwarf, da machte er damit zugleich deutlich, daß die Regierung auch anders beschaffen sein könnte, als sie es tatsächlich war, und vor allem, daß sie besser sein könnte. Doch woher sollte diese Regierung kommen? Wie sollte je ein Sterblicher entscheiden, was denn ein Volk zum »tugendhaftesten, aufgeklärtesten, verständigsten und besten« macht? Wie konnte eine Regierung aufgeklärter sein als das Volk, das sie formen sollte? Vor eben diesen Fragen standen die französischen Revolutionäre. Sie wählten sich Rousseau zu ihrem geistigen Führer, aber gerade dort, wo klare Entscheidungen anstanden, blieb Rousseau unscharf. Wenn die einmalige Chance bestand, den Gesellschaftsvertrag neu auszuhandeln, wie sollte er dann gestaltet werden? Wie war der allgemeine Wille Frankreichs in den neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts beschaffen? Welches war die bestmögliche Regierung »im weitesten Sinne des Wortes«, wie Rousseau sagt?
Die Revolution zeigte, wie sehr alles auf die Politik ankam, aber sie tat es auf eine Weise, die Rousseau sehr überrascht hätte, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, fünfzehn Jahre länger zu leben. Die Revolutionäre debattierten nicht allein über die klassischen Fragen der Regierung, über die jeweiligen Vor- und Nachteile von Monarchie und Republik, Aristokratie und Demokratie. Sie schritten auch zur Tat und schlugen dabei überraschende Wege ein. In der Hitze der Debatten und der politischen Auseinandersetzungen erfuhr der Begriff des »Politischen« eine Veränderung und Erweiterung. Die Struktur der Politik veränderte sich unter dem Einfluß der wachsenden politischen Partizipation und der Mobilisierung des Volkes; die politische Sprache, das politische Ritual und die politische Organisation nahmen neue Formen und Bedeutungen an. Auf eine Weise, die Rousseau zwar vorausgesagt hatte, von der er selbst jedoch nur eine verschwommene Vorstellung besaß, wurde aus der Regierung ein Instrument zur Formung des Volkes. So verkündete der Abgeordnete Grégoire im Januar 1784: »Das französische Volk hat alle anderen Völker überflügelt, aber das verachtungswürdige Regime, dessen Überreste wir gerade abschütteln, sorgt immer noch dafür, daß wir weit von der Natur entfernt sind; immer noch besteht eine tiefe Kluft zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir sein könnten. Laßt uns diese Kluft schließen, so schnell es geht. Laßt uns die menschliche Natur wiederherstellen und ihr ein neues Gepräge geben.«[2]
Die bemerkenswerten Erfahrungen, die man mit diesem Wunsch nach Wiederherstellung und Regeneration machte, speisen die meisten unserer politischen Ideen und Praktiken. Am Ende des Revolutionsjahrzehnts hatte das französische Volk (und der Westen allgemein) ein neues politisches Repertoire erworben; das Konzept der Ideologie entstand, und konkurrierende Ideologien stellten die überkommene europäische Kosmologie von Ordnung und Harmonie in Frage; die Propaganda verband sich mit politischen Zielsetzungen; die Jakobinerclubs zeigten, welches Potential in politischen Massenparteien steckt; und Napoleon errichtete den ersten weltlichen Polizeistaat mit seinem Anspruch, über den Parteien zu stehen.
Die Franzosen haben weder die Politik noch das Konzept des Politischen erfunden, doch aus Gründen, die wir noch nicht ganz durchschauen, brachten sie es fertig, beides mit außerordentlicher emotionaler und symbolischer Bedeutung aufzuladen. Schritt für Schritt und oft ohne zu wissen, was da vor sich ging, begründeten sie eine revolutionäre Tradition, die bis in unsere Tage fortdauert. Paradoxerweise handelten gerade die radikalsten französischen Revolutionäre aus einem tiefen Mißtrauen gegen alles explizit Politische heraus, während sie doch zugleich die Formen und Bedeutungen von Politik vervielfältigten. Die führenden politischen Gestalten nannten sich nie selbst Politiker; sie dienten »der öffentlichen Sache« (la chose publique) und keinem engstirnigen »Parteiengeist« (esprit de parti). Politik und politisches Handeln wurden durchgängig mit Engstirnigkeit, Niedertracht, Zwistigkeit, Parteienkämpfen, Opportunismus, Egoismus und Eigennutz identifiziert. Während die Revolutionäre all diese Pervertierungen des alten Ideals vom homo politicus anprangerten, traten sie in die Moderne ein: Sie eröffneten eine neue, innere Front und ernteten die unerwarteten Früchte von Demokratie und autoritärer Herrschaft, von Sozialismus und Terror, von revolutionärer Diktatur und Guillotine. Die überraschende Erfindung der revolutionären Politik ist der Gegenstand dieses Buches.
Wir können heute nur schwer nachvollziehen, wie überraschend revolutionäre Politik in den neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts war. Jedes Lehrbuch bezeichnet das Jahr 1789 als die Wasserscheide zur Moderne, und die Französische Revolution gehört zu den Ereignissen der westlichen Geschichte, über die am meisten geschrieben worden ist. Doch eben weil dies zum Gemeinplatz geworden ist, ist die Neuheit verlorengegangen. Im Rückblick scheint die Wende nur allzu offensichtlich zu sein. Was wäre unsere Welt ohne Parteien, Ideologien, Diktatoren, Massenbewegungen und selbst noch ohne eine antipolitische politische Rhetorik? Auch in den neueren wissenschaftlichen Auseinandersetzungen um die Französische Revolution gilt die Sache selbst als gesichert. Die Kontroversen betreffen nicht den Charakter der Erfahrung, sondern lediglich deren langfristige Ursprünge und Folgen. Die Revolution dient allenfalls als Vehikel zwischen langfristigen Ursachen und Wirkungen; die Entstehung einer revolutionären Politik wird damit zur bloßen Selbstverständlichkeit. So beschäftigen sich alle drei wichtigen Forschungsansätze zur Französischen Revolution entweder mit den Ursprüngen oder mit den Folgen der Revolution.
Die marxistische Deutung der Französischen Revolution ist in den letzten Jahren unter heftigen Beschuß geraten, zum Teil weil sie die theoretisch anspruchsvollste Interpretation ist.[3] Marx selbst hat sich leidenschaftlich für die Geschichte der Französischen Revolution interessiert. Mitte der vierziger Jahre sammelte er Dokumente und las sehr viel, weil er eine Geschichte des Nationalkonvents schreiben wollte.[4] Unmittelbar politische Interessen und später dann seine allgemeineren Studien zum Kapitalismus hielten ihn davon ab, dieses Projekt zu Ende zu führen. Doch in all seinen historischen Schriften diente die Französische Revolution als Prüfstein; sie förderte die Entwicklung des Kapitalismus, indem sie den feudalen Würgegriff sprengte, der die Produktion umklammert hielt; und sie brachte die Bourgeoisie als Klasse an die Macht. Diese beiden untrennbar miteinander verbundenen Elemente – die Schaffung eines geeigneten rechtlichen Rahmens für die Entwicklung des Kapitalismus und der Sieg der Bourgeoisie im Klassenkampf – sind seither kennzeichnend für die historische Darstellung der Französischen Revolution in marxistischer Sicht. Der jüngste Verfechter der »klassischen Historiographie der Französischen Revolution«, Albert Soboul, meint, die Revolution markiere »Geburt, Aufstieg und Triumph der Bourgeoisie«.[5]
In marxistischen Darstellungen war die Französische Revolution ihrem Wesen nach bürgerlich, weil ihre Ursprünge und ihre Ergebnisse bürgerlichen Charakters waren. Marxistische Historiker führen die Revolution auf die aggressive Selbstbehauptung der Bourgeoisie angesichts der aristokratischen Reaktion in den achtziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts zurück, und als Ergebnis gilt ihnen der ausschließlich bürgerliche Triumph der kapitalistischen Produktionsweise.[6] Die intervenierende Variable – die revolutionäre Erfahrung – wird als Beitrag zu diesem Szenario verstanden. Die Bourgeoisie mußte sich mit den Volksklassen verbünden, um der Feudalaristokratie das Rückgrat zu brechen; und sie mußte mit den Volksklassen brechen, als das System der Schreckensherrschaft außer Kontrolle zu geraten drohte; schließlich mußte sie sich mit Napoleon verbünden, um die bürgerlichen Errungenschaften im Bereich des Eigentums und der Rechtsreform zu sichern. Die Ergebnisse (die ökonomische und soziale Hegemonie der Bourgeoisie) folgten scheinbar zwangsläufig aus den Ursachen (dem Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Aristokratie).
Die »revisionistische« Position stellt die marxistische Interpretation in nahezu allen Punkten in Frage, doch die meisten Revisionisten teilen stillschweigend die zentrale Prämisse der marxistischen Argumentation, wonach eine Interpretation der Französischen Revolution in der Analyse sozialer Ursachen und Folgen bestehen muß. In einem ersten weitreichenden Angriff auf die marxistische Orthodoxie stellte Alfred Cobban die These auf, die Französische Revolution sei nicht von der Bourgeoisie im Interesse der kapitalistischen Entwicklung gemacht worden, sondern von korrupten Beamten und Angehörigen der freien Berufe, die ihre Einkünfte schwinden sahen. Am Ende nutze ihr Tun den Landbesitzern allgemein; in Wirklichkeit aber verzögere die Erfahrung der Revolution die Entwicklung des Kapitalismus in Frankreich.[7] Der marxistische Ansatz oder die »soziale Interpretation«, wie Cobban sagt, täuscht sich sowohl hinsichtlich der Ursprünge als auch hinsichtlich der Folgen des Revolutionsjahrzehnts.
Im selben Sinne haben andere Kritiker eingewendet, es habe vor der Revolution gar keinen bewußten Klassenkonflikt zwischen Bourgeoisie und Aristokratie gegeben. Die Aristokraten seien der Bourgeoisie nicht im Wege gestanden; vielmehr hätten sie mit ihr zahlreiche ökonomische, soziale und politische Interessen geteilt.[8] Nicht eine frustrierte Bourgeoisie, sondern die liberale Aristokratie setze die Revolution gegen die despotische Monarchie ins Werk.[9] Wenn die Revisionisten dann selbst eine alternative Version anbieten, stützen sie ihre Analyse mit Cobban gleichfalls auf soziale Ursachen und Folgen. François Furet und Colin Lucas haben die revisionistische Position in zwei Aufsätzen sehr überzeugend zusammengefaßt.[10] Beide argumentieren, die Ursachen der Revolution lägen in einer Krise der sozialen Mobilität und in Statusängsten innerhalb einer amalgamierten Elite, die aus Angehörigen des Adels und des Bürgertums bestände. Das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Prosperität im achtzehnten Jahrhundert hätten keine entsprechende Erweiterung der Kanäle sozialen Aufstiegs gefunden; die Folge wäre eine wachsende Reibung in diversen »Spannungszonen« innerhalb der Elite gewesen. Diese Spannung sei zur Revolution eskaliert, als das Pariser Parlament hartnäckig darauf bestanden habe, daß die einberufenen Generalstände sich an die 1614 festgelegten Verfahrensvorschriften halten sollten. Die schicksalhafte Entscheidung hätte zu einem verständlichen, aber unnötigen Bruch zwischen den adligen und den bürgerlichen Teilen der Elite geführt.[11]
In diesem Argument bezüglich der Ursachen ist unausgesprochen die These enthalten, wonach das wesentliche Ergebnis der Revolution nicht der Kapitalismus war, sondern die Schaffung einer einheitlicheren Elite von Notablen, die sich in ihrer Selbstdefinition vor allem auf Landbesitz stützte:[12] Als Adelige und Bürgerliche den Preis für ihre Mißverständnisse und Fehleinschätzungen erkannt hatten, waren sie in der Lage, sich auf der Basis ihrer zentralen gemeinsamen Interessen in einer für Reichtum und Dienst offenen Gesellschaft zu verbünden. In der revisionistischen Darstellung verliert die Revolution ihren prädeterminierten Charakter, denn sie erscheint gleichsam als Irrtum. Ihre Bedeutung beurteilt man allerdings auch dort nach ihrem Beitrag zu langfristigen sozialen und politischen Folgen; die Revolutionserfahrung dient lediglich als Korrektiv für frühere Fehleinschätzungen sozialer und politischer Natur und als Lernprozeß, der auf Versuch und (zumeist) Irrtum basiert. So lernte die Bourgeoisie, daß es eine Gefahr für ihre Rechtsreformen und überhaupt für ihre Fähigkeit bedeutete, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, wenn sie die Unterstützung der unteren Volksschichten suchte.[13] In dieser Perspektive war die Revolution eine dramatische, aber ephemere Abweichung vom Trend der Entwicklung hin zu einer liberalen Eliteherrschaft.
Am Rande der Debatte über die soziale Interpretation stehen Alexis de Tocqueville und die Modernisierungsthese. Tocqueville leugnete nicht die Bedeutung sozialer Spannungen, aber er stellte den sozialen Konflikt in einen wesentlich politischen Rahmen; für ihn bedeutete die Revolution eher eine Stärkung der Staatsmacht und des Zentralismus als den Triumph des Kapitalismus. Keine Klasse ging siegreich aus diesem Kampf hervor. Die Franzosen erlangten lediglich mehr Gleichheit in ihrer unbeabsichtigten Versklavung durch eine autoritäre Regierung. Tocqueville führte die Revolution (und die Spannungen während des achtzehnten Jahrhunderts) auf die Praktiken der absoluten Monarchie zurück. Um die Macht des Staates zu stärken, zerstörte die Monarchie die politischen Rechte des Adels und machte damit die sozialen Ansprüche der Aristokratie für andere soziale Gruppen unerträglich.[14] Die Revolutionäre glaubten zwar die monarchistische Regierung zu bekämpfen, aber am Ende schufen sie einen noch mächtigeren Staat, der nach dem Modell eben dieser absoluten Monarchie gebildet war. So war denn die Revolution auch für Tocqueville nur ein Glied in der Kette zwischen Ursachen und Folgen; die Revolutionserfahrung erleichterte unbeabsichtigt den Übergang von Ludwig XIV. zu Napoleon.
In einer kürzlich erschienenen vergleichenden Studie hat Theda Skocpol das Tocquevillesche Thema der wachsenden Staatsmacht wieder aufgegriffen.[15] Zwar teilt sie Tocquevilles Auffassung, wonach die wichtigste Folge der Französischen Revolution in einem stärker zentralisierten und bürokratisierten Staat bestand, aber in der Analyse der Ursachen kommt sie zu etwas anderen Ergebnissen: Wie später der russische und der chinesische Staat, so brach auch der französische Staat deshalb zusammen, weil er den militärischen Anforderungen des modernen internationalen Wettbewerbs nicht gerecht werden konnte. Die strukturelle Schwäche der »agrarischen Monarchien« machte sie überdies anfällig für Bauernaufstände, die im Zusammenhang mit der Revolution alte agrarische Klassenbeziehungen zerstörten. Der Krieg (also wieder die internationale Konkurrenz) begünstigte die Entstehung revolutionärer Eliten, die auf Zentralisierung und Bürokratisierung drängten und das »moderne Staatsgebäude« errichteten. Trotz der Betonung sozialstruktureller Voraussetzungen und der Rolle von Bauernaufständen ähnelt Skocpols Argumentation der Tocquevilleschen in der Art und Weise, wie sie die Revolutionserfahrung zwischen deren langfristigen Ursachen und Folgen einschließt; das eigentliche Ereignis Revolution taucht nur in den Lücken des Schemas auf. Wie in Tocquevilles klassischer Analyse erscheint die Revolution als Vehikel für die Modernisierung des Staates.[16]
Da die Debatten über die Interpretation der Französischen Revolution vornehmlich um die Analyse der Ursachen und Folgen kreisen, überrascht es nicht, wenn sich die Forschungsanstrengungen zunehmend auf die Zeiten vor und nach dem Revolutionsjahrzehnt konzentrierten.[17] Die meisten Forscher haben sich um eine Überprüfung der marxistischen Darstellung bemüht. Armeeoffiziere, Beamte und kulturelle Eliteeinrichtungen des Ancien régime wurden daraufhin untersucht, ob in der vorrevolutionären Zeit tatsächlich eine Klassenspaltung festzustellen war.[18] Auch napoleonische und nachnapoleonische Eliten erforschte man, weil deren soziale Zusammensetzung bedeutsam für eine Analyse der Folgen der Revolution ist.[19] Zwar haben diese Untersuchungen zur Ausarbeitung einer revisionistischen Position beigetragen, doch sie vermochten die marxistischen Historiker nicht dazu zu zwingen, ihre Grundanschauung aufzugeben. Die Marxisten reagierten mit dem Argument, die Realität von Klasse und Kapitalismus sei an einem anderen Ort oder auf eine andere Weise zu suchen.[20]
Obwohl marxistische und revisionistische Historiker sich auch mit den Revolutionären und ihren Aktivitäten befaßt haben, blieben diese Studien ohne großen Einfluß auf das an Ursachen und Folgen ausgerichtete Gesamtschema. Die Revisionisten vertraten die Auffassung, die Konflikte während der Revolution hätten keine spezifisch soziale Bedeutung besessen oder allenfalls eine sehr undifferenzierte und mehrdeutige (reich und arm, Stadt und Land, Paris und die Provinz).[21] Als Einzelheiten des marxistischen Ansatzes immer heftiger unter Beschuß gerieten, zogen die marxistischen Historiker sich auf stärker strukturell orientierte Positionen zurück: Welchen Unterschied macht es schon, wer die Revolution initiierte oder wer zu einem bestimmten Zeitpunkt die Macht hatte, wenn man die Ursachen und Folgen nur weit genug in die jeweilige Richtung verfolgen kann, um den Einfluß des Klassenkampfes und die Entwicklung des Kapitalismus zu belegen?[22]
Die Tocquevillesche Deutung hat dagegen fast keine empirische Forschung angeregt. Zwar ähnelt sie der marxistischen und der revisionistischen Darstellung in der Betonung von Ursachen und Folgen, aber sie faßt diese Zusammenhänge derart weit, daß eine empirische Überprüfung sich als schwierig erwiesen hat. So verband Tocqueville selbst die Entwicklung der Staatsmacht nicht mit einer bestimmten sozialen Gruppe; »Demokratie« und »Gleichheit« galten ihm als universelle strukturelle Trends, und obwohl sie wie ein »gewaltiger Besen« gewirkt haben mögen, ist niemand auszumachen, der diesen Besen geführt hat. Deshalb kommt der Identität und den Absichten der Revolutionäre in Tocquevilles Darstellung wenig Bedeutung zu: Sie hatten »keine bestimmte Vorstellung davon«; sie taten dies, »ohne es zu wissen«, sie bewerkstelligten jenes, »ohne es zu wollen«; der »vorbestimmte Lauf« der Revolution hatte nichts mit dem zu tun, was die Revolutionäre zu bewirken glaubten.[23]
Alle drei Ansätze teilen dieses Desinteresse hinsichtlich der Absichten der Revolutionäre. Tocqueville und die Historiker, die sich von seiner Analyse haben leiten lassen, bestreiten, daß es wesentlich sei, wer die Revolutionäre waren oder was sie wollten, und zwar weil sie unbewußt in ihrem Traum von der absoluten Macht gefangen waren, der letztlich den Gang der Revolution bestimmte. Marxisten und Revisionisten dagegen scheinen die Bedeutung der sozialen Identität anzuerkennen, doch trotz ihrer unterschiedlichen Analysen gelangen sie am Ende gleichfalls beide zum Tocquevilleschen Mißtrauen gegenüber den Absichten und Zielen der Revolutionäre. Weil die Identität der Revolutionäre weder ins marxistische noch ins revisionistische Konzept paßt (die Revolutionäre waren weder Kapitalisten noch – nach 1791 – Angehörige des liberalen Adels oder der bürgerlichen Elite), leugnen beide letztlich die Bedeutung der Frage, wer die Revolutionäre waren und was sie zu tun glaubten. Nach der marxistischen Interpretation erleichterten die Revolutionäre den Triumph des Kapitalismus, selbst wenn sie aus ihrer Feindseligkeit gegenüber dem Kapital keinen Hehl machten; und in revisionistischer Sicht verhinderten sie unbeabsichtigt den Prozeß der Herausbildung einer liberalen Notablenherrschaft. Da die Absichten der Revolutionäre nicht mit den Folgen der Revolution übereinstimmen, zählen sie wenig. Und da der Schwerpunkt des Interesses auf den Ursprüngen und Folgen liegt, erscheint die revolutionäre Erfahrung selbst als irrelevant.
So entsteht vielfach der Eindruck, revolutionäre Neuerungen in den Formen und Bedeutungen von Politik seien entweder vorausbestimmt oder aber rein akzidentieller Natur. In der marxistischen Darstellung erscheinen liberales Verfassungsdenken, Demokratie, Schreckensherrschaft und autoritäre Herrschaft sämtlich als Mägde im Dienste der Festigung bürgerlicher Hegemonie. Nach Tocquevilles Analyse dienen sie der Erweiterung zentralisierter Macht. Die revisionistischen Ansätze zeigen in diesem Punkte weniger Einheitlichkeit, weil die Revisionisten nicht auf einen gemeinsamen Urtext wie die Werke von Marx oder Tocqueville zurückgreifen. Nach Richard Cobb zum Beispiel ist die revolutionäre Politik Ausdruck des Ressentiments und der Frustration einer militanten Minderheit; hinter ihrem Tun steht keine zwingende historische Logik. So wurden Menschen denn zu Anhängern der »Schreckensherrschaft«, weil sie Groll und Mißgunst gegenüber ihren Nachbarn empfanden.[24] Während die Politik der Revolution bei Marxisten und Tocqueville-Anhängern durch den notwendigen Entwicklungsgang von den Ursprüngen zu den Folgen bestimmt ist, scheint sie nach dem revisionistischen Ansatz vom Zufall beherrscht zu sein, denn sie paßt nicht in das Schema von Ursprüngen und Folgen. Das Endresultat ist in allen Fällen dasselbe; die Politik verliert ihre Bedeutung als Forschungsgegenstand.
Dieses Buch möchte die Politik der Revolution rehabilitieren. Dennoch ist es keine politische Geschichte der Revolution. Ich werde keine Darstellung der revolutionären Ereignisse geben, sondern den Versuch machen, die Regeln des politischen Verhaltens aufzudecken. Um zu verstehen, was die handelnden Individuen damals zu tun glaubten, können Historiker nicht einfach alle Äußerungen der Beteiligten über ihre Absichten zusammenfassen. Wenn es überhaupt Kohärenz und Einheit in der revolutionären Erfahrung gab, dann speiste sie sich aus gemeinsamen Werten und Verhaltenserwartungen. Die Werte und Erwartungen stehen im Mittelpunkt meiner Darstellung. Die Werte, Erwartungen und unausgesprochenen Regeln, die den kollektiven Absichten und Aktivitäten Ausdruck und Form verliehen, bilden das, was ich die politische Kultur der Revolution nennen möchte; diese politische Kultur lieferte die Logik des revolutionären politischen Handelns.
Die meisten Historiker, die sich bei der Erforschung der Französischen Revolution auf die »Politik« konzentrieren, tun dies aus einer antimarxistischen Perspektive heraus. In einem einflußreichen Aufsatz über »nichtkapitalistischen Reichtum und die Ursprünge der Französischen Revolution« kommt George V. Taylor zu dem Schluß, daß es sich »wesentlich um eine politische Revolution mit sozialen Auswirkungen und nicht um eine soziale Revolution mit politischen Auswirkungen« gehandelt habe.[25] François Furet glaubte die Unterscheidung zwischen »sozial« und »politisch« sogar zur Erklärung der Schreckensherrschaft heranziehen zu können; es gehe darum, schreibt er, »[…] wieweit das Gesellschaftliche einen Freiraum gegenüber dem Politischen gewinnt«.[26] Der Terror war die logische Folge aus der revolutionären Pervertierung des normalen Verhältnisses zwischen Gesellschaft und Politik; die Politik war nicht mehr die Arena für die Repräsentation konkurrierender sozialer Interessen, sondern ein terroristisches Instrument zur Umgestaltung der Gesellschaft. Beide Kritiker stellen die marxistische Auffassung vom Verhältnis zwischen Politik und Gesellschaft in Frage. Sie behaupten, die revolutionäre Politik sei nicht Ausfluß der sozialstrukturellen Bedingungen gewesen; vielmehr habe die Politik zumindest in einigen Momenten die Gesellschaft geformt.
Furets kürzlich erschienenes Buch Penser la Révolution française hat das Verdienst, die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des »Politischen« zu lenken. In dem Versuch, den marxistischen »Katechismus« zu unterminieren, hat Furet die Notwendigkeit herausgestellt, das Politische in einem umfassenderen Sinne zu begreifen, nicht nur im Sinne einzelner politischer Bestrebungen, Entscheidungen und Organisationen, sondern als Quelle und Ursprung neuer Formen des Handelns in dieser Welt. Seine eigene Diskussion der revolutionären Politik bleibt allerdings vollkommen abstrakt. Seiner Ansicht zufolge waren die politischen Neuerungen des Revolutionsjahrzehnts deshalb revolutionär, weil sie zur Umgestaltung der Gesellschaft eingesetzt wurden; aber er verwendet nur wenig Aufmerksamkeit auf die Frage, wie das geschah und wer sich an diesen Bemühungen beteiligte. So gelingt es ihm zwar auf bewundernswerte Weise, die mechanische Ableitung der Politik aus der Sozialstruktur in Frage zu stellen, aber die revolutionäre Politik erscheint bei ihm dann doch losgelöst von jeglichem Kontext. Die neue politische Kultur hat als Triebkraft nur die eigene innere Logik der Demokratie.[27]
Die Schwierigkeiten, die sich bei der Analyse des Verhältnisses zwischen Politik und Gesellschaft einstellen, resultieren zu einem Gutteil daraus, daß die Sprache der sozialen Analyse heute stark durch Gemeinplätze geprägt ist. Bei der Diskussion des »Politischen« verfallen wir nur allzuleicht auf Metaphern, die mit Strukturen und insbesondere mit der Hierarchie räumlicher Beziehungen zu tun haben: Ebenen, Reihen, Grundlagen, Fundamente. Die Politik scheint ganz selbstverständlich auf einer sozialen Grundlage oder einem Unterbau zu basieren, ganz gleich, ob man nun eine im engeren Sinne marxistische Theorie vertritt oder nicht. Man geht davon aus, daß sowohl für die bleibenden Muster als auch für die Veränderungspotentiale von Politik soziale Beziehungsgeflechte, Gruppen, Klassen oder soziale Strukturen verantwortlich zeichnen. So kommt es, daß die Debatte, im allgemeinen wie speziell bezüglich der Französischen Revolution, hauptsächlich das Verhältnis zwischen einer früheren sozialen Basis und dem spezifisch politischen Arrangement betrifft, das auf dieser Grundlage entstanden sein soll. Der Charakter der Politik wird durch den Bezug auf die Gesellschaft erklärt; Veränderungen der politischen Ordnung werden auf vorausgegangene Veränderungen in den sozialen Beziehungen zurückgeführt. Fast alle Diskussionen gehen von der Annahme aus, die wesentlichen Merkmale der Politik könnten nur durch deren Verhältnis zu einer sozialen Grundlage erklärt werden. Selbst die wenigen, die dieser Denkweise entfliehen möchten, bestätigen sie am Ende dennoch unwillentlich. So bezeichnet Furet die revolutionäre Regierung als in gewisser Weise pathologisch, und zwar deshalb, weil ihre Politik nicht im normalen oder erwartbaren Sinne den sozialen Interessen entspricht. Wenn die Politik an erster Stelle steht, ist die Situation per definitionem anormal.
Ich habe mich in meiner Analyse bemüht, die Metapher der Ebenen zu vermeiden. Die politische Kultur der Revolution läßt sich nicht aus sozialen Strukturen, sozialen Konflikten oder der sozialen Identität der Revolutionäre deduzieren. Die politische Praxis war nicht einfach Ausdruck der »zugrundeliegenden« ökonomischen und sozialen Interessen. Durch ihre Sprache, ihre Bilder und ihre alltäglichen politischen Aktivitäten arbeiteten die Revolutionäre an der Neugestaltung der Gesellschaft und der sozialen Beziehungen. Sie versuchten bewußt, mit der Vergangenheit Frankreichs zu brechen und die Grundlagen für eine neue nationale Gemeinschaft zu legen. Dabei schufen sie neue soziale und politische Verhältnisse und neue Formen sozialer und politischer Teilung. Die Erfahrung des politischen und sozialen Kampfes zwang sie, die Welt neu zu sehen.
Zu den schicksalhaftesten Konsequenzen des revolutionären Versuchs, mit der Vergangenheit zu brechen, gehört die Erfindung der Ideologie. Zögernd und sogar widerstrebend gelangten die Revolutionäre und ihre Gegner zu der Einsicht, daß die Beziehung zwischen Politik und Gesellschaft zutiefst problematisch war. Die Tradition verlor ihre Fraglosigkeit, und das französische Volk erkannte, daß es nach Rousseaus Überzeugung handelte, wonach das Verhältnis zwischen dem Sozialen und dem Politischen (der Gesellschaftsvertrag) revidiert werden konnte. Als deutlich wurde, daß die Auffassungen über den Charakter dieser Revision auseinandergingen, erfand man die Ideologien, um diese Entwicklung zu erklären. Sozialismus, Konservatismus, Autoritarismus und demokratisches Republikanertum waren sämtlich praktische Antworten auf die theoretische Frage, die Rousseau aufgeworfen hatte. Die revolutionäre Politik war nicht Ausdruck einer Ideologie, sondern sie brachte Ideologie vielmehr erst hervor. Im Prozeß der Revolution verliehen die Franzosen den Kategorien des sozialen Denkens und des politischen Handelns eine neue Gestalt.
Das heißt jedoch nicht, daß die Revolution lediglich intellektueller Natur gewesen wäre oder die Politik den Primat über die Gesellschaft besessen hätte, oder auch umgekehrt. Die Revolution in der Politik war eine explosive Wechselwirkung zwischen Ideen und Realität, zwischen Absichten und Umständen, zwischen kollektiver Praxis und gesellschaftlichem Kontext. Die revolutionäre Politik läßt sich zwar nicht auf die soziale Identität der Revolutionäre zurückführen, sie kann aber auch nicht davon getrennt werden: Die Revolution wurde von Menschen gemacht, und manche Menschen ließen sich von der Politik der Revolution stärker anziehen als andere. Ein besseres Bild für das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Politik ist der Knoten oder der Möbiusstreifen, denn beide Seiten sind unauflösbar ineinander verflochten, ohne daß ein konstantes »oben« und »unten« auszumachen wäre. Die Politik der Revolution zog manche Individuen und Gruppen an, die ihrerseits die revolutionäre Politik bestimmten. Die neue politische Klasse (wobei »Klasse« in einem weiten Sinne zu verstehen ist) wurde geradeso durch ihr Verhältnis zur revolutionären Politik geprägt, wie sie selbst diese Politik prägte.
Wenn wir die Logik revolutionären Handelns und revolutionärer Innovation rekonstruieren wollen, kommen wir daher nicht umhin, sowohl die Politik der Revolution zu untersuchen als auch die Menschen zu betrachten, die diese Politik gemacht haben. Ich behaupte nun, daß zwischen beiden Seiten wohl eine gewisse Affinität bestand, daß die eine sich aus der anderen jedoch nicht gänzlich erklären läßt. Die politische Kultur der Revolution bestand aus einer symbolischen Praxis, aus Sprache, bildhaften Vorstellungen und Gesten. Diese symbolische Praxis fand in einigen Regionen und bei manchen Gruppen größere Zustimmung als in anderen Regionen und bei anderen Gruppen. In mancherlei Hinsicht brachte die symbolische Praxis – die Verwendung einer bestimmten Rhetorik, die Ausbreitung bestimmter Symbole und Rituale – die neue politische Klasse hervor; die Rede von der nationalen Erneuerung und die Bundesfeste zum Beispiel gaben der neuen politischen Elite einen Sinn für Einheit und Zielsetzung. Andererseits hatten die Unterschiede in der Aufnahme der neuen Praxis durchaus auch Einfluß auf die Wirkungsweise revolutionärer Politik und insbesondere auf deren Erfolge und Fehlschläge. Die Rhetorik des Universalismus gefiel nicht jedermann, aber sie gefiel genügend Menschen, um ihr einen tiefgreifenden und nachhaltigen Einfluß zu sichern.
Aus analytischen Gründen habe ich die Politik und die Menschen, die sie betrieben, voneinander getrennt. In den drei Kapiteln des ersten Teils untersuche ich die Logik politischen Handelns in ihrem symbolischen Ausdruck: in der Art und Weise, wie die Menschen sprachen und wie sie die Revolution und sich selbst als Revolutionäre in Bildern und Gesten darstellten. Der zweite Teil befaßt sich mit dem gesellschaftlichen Kontext der revolutionären Erfahrung und insbesondere mit den Unterschieden innerhalb dieser Erfahrung. Welche geographischen und sozialen Trennungslinien lassen sich im revolutionären Frankreich ausmachen, und wo wurde die politische Kultur der Revolution am besten aufgenommen? In beiden Teilen steht die Frage nach der Schaffung einer neuen politischen Kultur, d.h. die Frage, wie »die Revolution« als kohärente Erfahrung Gestalt annahm, im Vordergrund. Es herrscht kein Mangel an wissenschaftlichen Arbeiten, die aufzeigen, daß die Revolution für verschiedene Menschen verschiedene Bedeutung hatte.[28] Ich habe dagegen zu zeigen versucht, wie es kam, daß sie bei aller Vielfalt dennoch eine gewisse Einheit besaß. Kohärenz und Einheit flossen aus mehreren Quellen, die hier unter zwei allgemeinen Rubriken abgehandelt werden, der symbolischen und der sozialen. Zu den symbolischen Quellen der Einheit gehörten die beständige Wiederholung von Schlüsselworten und Grundsätzen sowie gemeinsame Einstellungen gegenüber der Politik als Aktivität und die Verwendung gemeinsamer Symbole wie des Freiheitsbaumes oder der Darstellung der Republik als Frau. Zu den sozialen Quellen der Kohärenz gehörte der Umstand, daß Führergestalten ähnlicher Art als Speerspitzen revolutionären Handelns getrennt an verschiedenen Orten oder gemeinsam am selben Ort auftraten.
Obwohl dieses Buch sich mit Politik befaßt, ist darin wenig von einzelnen politischen Bestrebungen, Politikern, Parteikonflikten, formalen Institutionen oder Organisationen die Rede. Das Schwergewicht liegt statt dessen auf den zugrundeliegenden Mustern politischer Kultur, welche die Entstehung bestimmter politischer Bestrebungen und das Auftreten neuartiger Politikergestalten, Konflikte und Organisationen ermöglicht haben. Statt auf den Höchstpreis für Getreide etwa oder auf Robespierre und die Jakobinerklubs wird die Aufmerksamkeit hier auf die allgemeinen Prinzipien der revolutionären Sprache gelenkt und auf die Wirkungsweise revolutionärer Symbole sowie das verbreitete Interesse an Ritual und Geste. Die Aufladung symbolischen Handelns mit politischer Bedeutung verlieh einzelnen politischen Richtungen, Personen und Organisationen größeren Einfluß, als sie ihn in nichtrevolutionären Zeiten gehabt hätten.
Meine Vorgehensweise stützt sich auf die Arbeit dreier französischer Historiker, die in der Erforschung der politischen Kultur Pionierarbeit geleistet haben (sie benützen den Ausdruck »politische Kultur« nicht unbedingt selbst). Der erste ist François Furet, der mehr als jeder andere für die Wiederbelebung der geschichtswissenschaftlichen Debatte getan und sie in neue Richtungen gelenkt hat. Auf einem eng umgrenzteren Gebiet hat Maurice Agulhon aufgezeigt, in welcher Weise Darstellungen von der Republik auf Siegeln und als Statuen aktiv zur Gestaltung der politischen Wahrnehmung in Frankreich beigetragen haben.[29] Und Mona Ozouf hat dargelegt, auf welche Weise Revolutionsfeste dazu eingesetzt wurden, einen neuen nationalen Konsens zu schaffen.[30] Die Arbeiten von Agulhon und Ozouf zeigen, daß kulturelle Manifestationen integraler Bestandteil der revolutionären Politik waren, und insbesondere bei Ozouf wird deutlich, daß es eine Logik des revolutionären Rituals gab. Die Historiker können nicht länger so tun, als existierte die Politik in einem von der Kultur klar abgegrenzten Bereich.
Die wichtigste Leistung der Französischen Revolution war die Schaffung einer gänzlich neuen politischen Kultur. Die Revolution beeindruckte ihre Zeitgenossen nicht deshalb, weil sie die Grundlagen für die kapitalistische Entwicklung oder die politische Modernisierung legte. Die Engländer fanden wirkungsvollere Mittel, den Kapitalismus zu fördern, und die Preußen bewiesen, daß ein Land sich auch ohne Demokratie oder Revolution an die Modernisierung des Staates machen konnte. Die Revolution in Frankreich trug wenig zum wirtschaftlichen Wachstum oder zur politischen Stabilisierung bei. Was sie indessen hervorbrachte, das war die mobilisierende Kraft des Gedankens einer demokratischen Republik und die mitreißende Intensität revolutionären Wandels. Die Sprache nationaler Erneuerung, die Gesten von Gleichheit und Brüderlichkeit und die Rituale der Republik gerieten nicht so schnell in Vergessenheit. Demokratie, Terror, Jakobinismus und Polizeistaat gehörten von nun an zum festen Repertoire politischen Lebens.
Die Ursprünge der neuen politischen Kultur in den Jahren oder Jahrzehnten vor 1789 blieben vorerst genauso undeutlich wie die Folgen der politischen Kultur: Napoleon und nach ihm die Bourbonen bemühten sich nach Kräften, alle Überreste dieser Kultur zu beseitigen, und in vielerlei Hinsicht schien es ihnen zu gelingen. Doch die neue Tradition der Revolution mit ihren Werten und Erwartungen verschwand nicht. Selbst außerhalb Frankreichs lebte sie kraftvoll im Untergrund fort, und als Schreckgespenst geisterte sie durch die Gedanken und Schriften der Verfechter jener neuen Ideologie, die wir Konservatismus nennen. Selbst in den neuen Polizeistaaten, die zur Eindämmung der Revolution geschaffen wurden, wirkte ihr Gedächtnis fort. Seit die Protagonisten der Französischen Revolution nach der Rousseauschen Überzeugung gehandelt hatten, die Regierung könne ein neues Volk hervorbringen, war der Westen nie mehr so, wie er einmal gewesen war.
Erster Teil Die Poetik der Macht
Erstes Kapitel Die Rhetorik der Revolution
»Worte und Dinge waren Monstrositäten.«
Nach dem Sturz Robespierres veröffentlichte der angesehene Literaturkritiker und Schriftsteller Jean-François La Harpe eine umfangreiche Betrachtung über den Fanatismus in der revolutionären Sprache.[1] La Harpes Argumentation war nicht in sich überraschend: Er führte die Perversionen der Revolution auf die Zivilkonstitution des Klerus zurück und die Raserei dieses »abscheulichen revolutionären Geistes« auf eine amoklaufende Philosophie. Aufschlußreicher ist dagegen La Harpes Überzeugung, wonach der Schlüssel zu den Verirrungen der Revolution in deren Sprache liege. Tatsächlich hat La Harpe diese Sprache kaum untersucht; ihm lag mehr daran, ihre Folgen aufzuzeigen, als ihre Ursachen und Funktionsweise zu untersuchen. Dennoch ist sein ätzendes Pamphlet wichtig, denn es zeigt, daß die Revolutionäre selbst erkannten, welche Bedeutung die Sprache in der Revolution besaß.
Der Zusammenbruch des französischen Staates nach 1786 führte zu einer wahren Inflation des Wortes, im Druck, in Gesprächen und in politischen Zusammenkünften. Während der achtziger Jahre waren in Paris ein paar Dutzend Zeitschriften auf dem Markt gewesen – von denen kaum eine so etwas wie »Nachrichten« verbreitete; zwischen dem 14. Juli 1789 und dem 10. August 1792 erschienen mehr als 500 Zeitschriften.[2] Eine ähnliche Entwicklung erlebte das Theater; während es vor der Revolution jährlich nur eine Handvoll Premieren gab, wurden zwischen 1789 und 1799 insgesamt 1500 neue Theaterstücke herausgebracht, viele davon zu Revolutionsthemen, und allein von 1792 bis 1794 kamen 750 auf die Bühne.[3] Auf allen Ebenen entstanden zahllose politische Klubs, und in den ersten hitzigen Jahren der Revolution scheinen fast ständig Wahlversammlungen getagt zu haben. Hinzu kamen die unzähligen Feste, die überall im Land zur Erinnerung an vielfältige Anlässe gefeiert wurden.[4] Kurzum, das Reden war allenthalben die Losung des Tages.
Worte ergossen sich wie eine wahre Flut, aber wichtiger noch war ihre einzigartige Magie. Von Anfang an waren die Worte in der Revolution mit großer Leidenschaft aufgeladen. Schon im Herbst 1789 war Êtes-vous de la Nation? das Kennwort bei den Patrouillen der Nationalgarde geworden.[5] Als die sakrosankte Position des Königs in der Gesellschaft dahinschwand, lud sich die politische Sprache zunehmend mit einer emotionalen Bedeutung auf, die vielfach auf Fragen von Leben und Tod zugespitzt wurde. Worte, die mit dem Ancien régime assoziiert wurden, und Namen, die nach Royalismus, Aristokratie oder Privileg klangen, waren tabu. Procureurs und avocats (Rechtsberufe im Ancien régime) wurden zu hommes de loi (zu »Männern des Gesetzes«), wenn sie ihre juristische Arbeit fortsetzen wollten; impôts (Steuern) wurde durch contributions ersetzt, weil das ein wenig mehr nach Freiwilligkeit klang. Namen, die in irgendeiner Weise mit dem Ancien régime identifiziert wurden, ersetzte man durch neue revolutionäre Bezeichnungen (die vielfach durch griechische oder römische Vorbilder geprägt waren). Kinder wurden nach klassischen Helden benannt; an die Stelle der historischen Provinzen traten geographisch bestimmte Departements, und rebellische Städte erhielten neue Namen, wenn man sie wiedererobert hatte. Auf dem Höhepunkt dieses euphorischen Interesses für Namen, im Jahre 1793, brachte eine Abordnung aus einer der Pariser Sektionen im Nationalkonvent den Vorschlag ein, Straßen und öffentliche Plätze systematisch umzutaufen und sie nach »allen Tugenden, die für die Republik notwendig sind« zu benennen. So könne man dem Volk eine »stillschweigende Lektion in Moral« erteilen.[6]
Manche Schlüsselworte dienten als revolutionäre Beschwörungsformeln. »Nation« war wohl das geheiligteste darunter, aber auch »Vaterland«, »Verfassung«, »Gesetz« und, stärker auf die Radikalen beschränkt, »Erneuerung«, »Tugend« und »Wachsamkeit« sind hier zu nennen. In einem bestimmten Kontext geäußert oder in bald schon vertraute formelhafte Wendungen eingebunden, beschworen diese Worte nichts Geringeres als die Treue zur revolutionären Gemeinschaft. Die Revolutionäre schätzten die rituelle Verwendung von Worten deshalb so sehr, weil sie nach einem Ersatz für das Charisma des Königs suchten. An erster Stelle unter den rituellen Worten steht der Revolutionseid; La Harpe spricht hier abschätzig von »einer unheilbaren Manie für Eide«.[7] Wie Jean Starobinski ausführt, wurde der revolutionäre Treueeid zu einem wichtigen Ritual, weil er den Gegensatz zwischen nationaler Souveränität und königlicher Autorität so deutlich hervorhob. Die Könige empfingen bei der Krönung »die übernatürlichen Insignien [ihrer] Macht« im Namen eines transzendenten Gottes, während der Treueeid auf die Revolution eine Souveränität begründete, die aus der Gemeinschaft hervorging.[8]
Die Interpretationen der revolutionären Sprache decken sich nicht genau mit den drei Schulen, die ich in der Einführung kurz charakterisiert habe. Es gibt marxistische und Tocquevillesche Positionen in dieser Frage, eine revisionistische Position ist bislang noch nicht entwickelt worden. Das Interesse der Marxisten an der Sprache der Revolution ist relativ jung, und revisionistische Historiker halten sich bislang an die Grundzüge der Tocquevilleschen Analyse, wenn sie überhaupt Interesse an der Sprache zeigen. Ein dritter Ansatz in der Behandlung der revolutionären Sprache könnte als Durkheimsche Position bezeichnet werden, weil er die kulturellen und insbesondere die integrativen Funktionen der revolutionären Sprache betont. Alle drei Positionen gehen davon aus, daß die »wahre« Bedeutung der Sprache in gewisser Weise verborgen ist; deshalb weist man der Analyse zumeist die Aufgabe zu, diese Bedeutung zu enthüllen.
Für die Marxisten ist die politische Sprache Ausdruck einer Ideologie. Die revolutionäre Rhetorik verbirgt danach irgendwelche wahren Interessen, insbesondere die Ansprüche der Bourgeoisie als Klasse. Marx selbst hat nachdrücklich auf das falsche Bewußtsein der Protagonisten der Französischen Revolution hingewiesen: »[…] ihre Gladiatoren [die der bürgerlichen Gesellschaft] fanden in den klassisch strengen Überlieferungen der römischen Republik die Ideale und die Kunstformen, die Selbsttäuschungen, deren sie bedurften, um den bürgerlich beschränkten Inhalt ihrer Kämpfe sich selbst zu verbergen und ihre Leidenschaft auf der Höhe der großen geschichtlichen Tragödie zu halten«.[9] Nicos Poulantzas bewegt sich im selben Rahmen, wenn er bemerkt, der »bürgerliche Charakter des Jakobinertums« werde »verschleiert, weil er sich nicht einer politischen, sondern einer moralischen Sprache bedient«.[10] Und in einem ähnlichen Sinne sagt Jacques Guilhaumou von der revolutionären Rhetorik eines Père Duchesne, hier kleide sich ein bürgerliches Demokratieverständnis in »eine Form, die sansculotte sein möchte«.[11] Nach all diesen Auffassungen gibt der bürgerliche Diskurs lediglich vor, etwas anderes zu sein, als er in Wirklichkeit ist: ein ideologisches Instrument der politischen und sozialen Vorherrschaft des Bürgertums.
In letzter Zeit sind einige marxistische Historiker ein wenig von dieser reduktionistischen Auffassung der Sprache abgerückt. Guilhaumou selbst hat geschrieben, der jakobinische Diskurs könne nicht auf Verbergen und Mystifizieren reduziert werden. Doch auch wenn er und Régine Robin zugestehen, daß die Sprache mehr ist als ein Abbild sozialer Realität oder ein Mechanismus zu deren Reproduktion, so arbeiten sie doch weiterhin mit einem relativ unflexiblen analytischen Rahmen. Sie sehen den Diskurs in einer spezifischen »Konstellation« von Umständen begründet, und sie definieren diese Konstellation als »die Einheit der Widersprüche einer sozialen Struktur zu einer bestimmten Zeit, eine Einheit, die auf politischer Ebene überdeterminiert ist«.[12] Diese Auffassung mag der marxistischen Analyse der Revolutionssprache größere Komplexität verleihen, aber sie stützt sich weiterhin implizit auf das Bild von Basis und Überbau; die soziale Struktur liegt unter den Ebenen von Politik und Sprache, und die Sprache bringt diese zugrundeliegenden sozialen Widersprüche zum Ausdruck. Politischen Diskursen läßt sich nur dann Sinn abgewinnen, wenn man sie auf eine »außersprachliche« Ebene bezieht.[13]
Die Tocquevillesche Position sieht in der Sprache kein ideologisches Instrument der Klassenauseinandersetzungen, aber auch sie stellt das Moment der Selbsttäuschung besonders heraus. Tocqueville zufolge waren die Revolutionäre in dem Irrtum befangen, »die totale, plötzliche Umbildung einer so komplizierten und so alten Gesellschaft könnte sich ohne Erschütterung nur mit Hilfe der Vernunft und durch ihre alleinige Kraft vollziehen«. Ihr »Geschmack an allgemeinen Theorien, vollständigen Systemen der Gesetzgebung und genauer Symmetrie in den Gesetzen« machte sie blind für die Tatsache, daß sie in Wirklichkeit die absolute Macht des verhaßten Ancien régime reproduzierten.[14] In seinem Buch Penser la Révolution française greift François Furet die Tocquevillesche Position auf und gibt ihr eine semiologische Wendung. Für Furet verbirgt der Schleier der Sprache nicht nur die tatsächliche politische Kontinuität; die Sprache wird zugleich auch zum Ersatz für die Realitäten politischen Wettbewerbs: Das Reden tritt an die Stelle der Macht, und es entsteht eine Welt, »[…] in der das semiotische Kraftfeld absoluter Herr über die Politik ist«.[15] Da die gewohnten Beziehungen zwischen Gesellschaft und Politik zerstört sind, wird Politik zum Kampf um das Recht, für die Nation zu sprechen. Sprache ist dann Ausdruck von Macht, und Macht äußert sich in dem Recht, für das Volk zu sprechen. Die ungewöhnliche Bedeutung, die der Sprache in der Französischen Revolution zukam, zeigt, wie sehr die französische Gesellschaft aus dem Gleis geraten war.
Eine alternative Position hat Mona Ozouf in ihrer Untersuchung der Revolutionsfeste vorgetragen. Statt den sozialen Gehalt der Feste oder die darin enthaltene politische Täuschung zu enthüllen, untersucht sie in Durkheimscher Manier deren rituelle Funktionen. Durkheim selbst hatte auf das Buch von Albert Mathiez über Revolutionskulte zurückgegriffen, und oft führte er Beispiele aus der Französischen Revolution an, um seine Thesen über die Religion zu illustrieren.[16] Nach Ozoufs Auffassung zeigen die zahlreichen, scheinbar im Gegensatz zueinander stehenden Feste eine tiefgreifend »identische Konzeptualisierung«, »ein identisches kollektives Bedürfnis«. Die Feste verliehen der neuen revolutionären Gemeinschaft »sakrale Würde«. In der Institution des Festes machte »der Diskurs, den die Revolution über sich selbst hält«, den Versuch, eine neue Nation auf der Grundlage eines neuen Konsens zu formen.[17] Die Sprache des Rituals und die ritualisierte Sprache dienten der nationalen Integration und brachten das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Solidarität zum Ausdruck.[18]
Die historische Sprachanalyse geht davon aus, daß Sprache sich in verschiedene Schichten unterteilen läßt; schließlich geht man gewöhnlich davon aus, daß die Sprache etwas zum Ausdruck bringt, das »wirklicher« ist als die Worte. Die Lektüre revolutionärer Sprache stützt sich gewöhnlich auf irgendeine vorgängige Annahme: daß Sprache ein Instrument des sozialen Konflikts sei – die marxistische Position –; daß Sprache ein Vehikel politischer Selbsttäuschung sei – die Tocquevillesche Position –; daß Sprache ein Mittel kultureller Integration bilde – die Durkheimsche Position –. Jede dieser Auffassungen hat ihre Vorzüge, und sie sind auch nicht unbedingt unvereinbar. Wir möchten jedoch einen anderen Ausgangspunkt vorschlagen: die Rhetorik der Revolutionäre selbst nämlich. Statt Schichten von oben nach unten abzutragen, um herauszufinden, was die Sprache der Revolution wirklich »bedeutete«, schlage ich vor, die Sprache eher horizontal zu betrachten, also nach ihren internen Mustern und ihren Verbindungen zu anderen Aspekten der politischen Kultur zu fragen. Statt unter den Worten oder jenseits davon nach der Bedeutung des politischen Diskurses zu suchen, möchte ich mich zunächst einmal bemühen, ihren rhetorischen Kontext zu klären.
Die Sprache der Revolution war kein bloßes Spiegelbild der tatsächlichen revolutionären Veränderungen und Konflikte; sie wurde vielmehr selbst zu einem Instrument politischen und sozialen Wandels. In diesem Sinne war die politische Sprache nicht bloß Ausdruck einer ideologischen Position, die durch darunterliegende soziale oder politische Interessen bestimmt gewesen wäre. Die Sprache trug selbst dazu bei, die Wahrnehmung der Interessen zu formen, und damit trug sie auch zur Entwicklung der Ideologien bei. Anders gesagt, der politische Diskurs der Revolution war rhetorischer Natur; er war ein Mittel der Überredung, ein Instrument zur Rekonstruktion der sozialen und politischen Welt.
La Harpe wußte um die rhetorische Kraft der revolutionären Sprache, als er seine Absicht verkündete, die Revolution durch die »Untersuchung ihrer Sprache« zu charakterisieren, da die Sprache »ihr wichtigstes und überraschendstes Instrument« gewesen sei. Er wollte zeigen, daß »die Etablierung und gesetzliche Absicherung dieser Sprache ein einzigartiges Ereignis darstellte, einen Skandal, wie die Welt ihn noch nicht gesehen hatte und für den es nur eine Erklärung gibt: die Rache Gottes.«[19]
Göttliche Rache gehört heute nicht mehr zum Standardrepertoire historischer Erklärungen. Wenn wir verstehen wollen, auf welche Weise die politische Rhetorik zu einem Skandal werden konnte, »wie die Welt ihn noch nicht gesehen hatte«, und zum »wichtigsten Instrument« der Revolution, sollten wir, so meine ich, die Rhetorik der Revolution als einen Text im Sinne der Literaturwissenschaft behandeln. Nun gibt es, unnötig zu sagen, gar keine einheitliche Literaturwissenschaft. Die Literaturwissenschaftler sind untereinander in ihren Methoden mindestens ebenso uneins wie die Historiker. Strukturalisten, Poststrukturalisten, Rezeptionstheoretiker, um nur einige zu nennen, sind in nahezu jeder Frage unterschiedlicher Meinung.[20] Der Streit innerhalb der Literaturwissenschaft vermag den Historikern dennoch manche Einsicht zu vermitteln. Wenn wir die Äußerungen der Revolutionspolitiker als einen zusammenhängenden Text begreifen, so erhalten die Kontroversen um das Wesen des Textes und um die Methoden seiner Deutung unmittelbare Relevanz.
Ihrem Wesen nach warf die Rhetorik der Revolution in vielem dieselben Fragen auf, wie sie heute in der Literaturwissenschaft üblich sind. Die Maßstäbe politischer Interpretation waren im Revolutionsjahrzehnt geradeso strittig, wie die Maßstäbe literarischer Interpretation es heute sind. Und wie die Literaturwissenschaftler heute nach Autorschaft, Publikum, Erzählstrukturen und narrativen Funktionen fragen, so befaßte sich damals der politische Redner mit Autorität, Publikum und der richtigen Deutung der Revolutionsgeschichte. Als die Abgeordneten des Dritten Standes beschlossen, sich und alle, die sich ihnen anschließen mochten, zur »Nationalversammlung« auszurufen, stellten sie die überkommene Grundlage der Monarchie in Frage, und sie warfen Fragen allgemeiner Art nach dem Ort von Autorität auf. Die Abgeordneten forderten Souveränität für die Nation, doch in den Jahren, die nun folgten, sollte die Frage, wer für die Nation sprach, niemals endgültig geklärt werden.[21]
Anders gesagt, die Autorität – also die Autorenschaft für den revolutionären Text – blieb ungewiß. Das Charisma des Königs, des traditionellen geheiligten Mittelpunktes der Gesellschaft, schwand unablässig dahin, doch kein Mensch, keine Institution, kein Dokument vermochte seinen Platz einzunehmen. Wo sollte das geheiligte Zentrum der Nation wiedererstehen? Bevor Napoleon an die Macht kam, gab es keine einzelnen charismatischen Führer; Frankreich besaß keinen George Washington, obwohl so mancher die Rolle gern übernommen hätte, und die neue Nation mochte keine Gründungsväter anerkennen. Die Revolution hatte weder einen Vater noch eine klare Abstammung. Keine der vielen Verfassungen und Nationalversammlungen vermochte sich zum festen Bezugspunkt für die Nation zu entwickeln. Dieser beständigen Verlagerung der politischen Autorität ist es zuzuschreiben, wenn das Charisma seinen konkretesten Ort schließlich in den Worten fand, also in der Fähigkeit, für die Nation zu sprechen. Die Sprache der Revolution war »fanatisch« im Sinne La Harpes, weil sie mit sakraler Autorität aufgeladen war.
Obwohl der »Text« der Revolution heilig war, befand er sich doch in beständigem Wandel. Die Französische Revolution hatte keine Bibel, die als Quelle der Bestätigung und Absicherung revolutionärer Praxis dienen konnte. Die französische Rhetorik der Revolution mußte ihre eigene Hermeneutik schaffen; in der Praxis der Politik und des politischen Diskurses lag der Kanon, lagen die Prinzipien, an denen diese Praxis gemessen werden konnte. Die neue Rhetorik entstand nicht auf einen Schlag, und ihre Prinzipien wurden niemals endgültig festgelegt. Die Sache wird noch schwieriger, wenn man bedenkt, daß diese rhetorischen Prinzipien trotz oder gerade wegen ihres Anspruchs auf Neuheit zum größten Teil nicht überprüft wurden. Die Revolutionäre bildeten ihre Rhetorik nach 1789 schubweise aus; die Klärung ihrer Prinzipien erfolgte allein in der Hitze des politischen Kampfes.
Die Rhetorik der Französischen Revolution bezog ihre textliche Einheit aus der Überzeugung, daß die Franzosen im Begriffe waren, eine neue Nation zu gründen. Die Nation und die Revolution wurden beständig als Bezugspunkte angeführt, aber sie hatten keine Geschichte. Ein Revolutionär aus der Provinz sagte in einer Rede:
»Eine Revolution kann man nicht halb machen; entweder sie ist total, oder sie wird zum Fehlschlag. Alle Revolutionen, welche die Geschichte uns überliefert hat, und all jene, die in unserer Zeit versucht worden sind, sind fehlgeschlagen, weil man neue Gesetze mit alten Bräuchen verbinden und neue Institutionen mit den alten Menschen lenken wollte. […] Revolutionär, das heißt: außerhalb aller Formen und Regeln; revolutionär ist alles, was die Revolution bestätigt und stärkt, was jegliches Hindernis aus dem Weg räumt, das sich ihrem Fortschritt entgegenstellt.«[22]
Der Wille, mit der nationalen Vergangenheit zu brechen, unterschied die Französische Revolution von früheren revolutionären Bewegungen. Die neue Gemeinschaft der amerikanischen Radikalen war eine lebendige Tradition; die Amerikaner hatten immer in einer »neuen Welt« gelebt, die weit von all dem entfernt war, worin man die Verderbtheit der englischen Politik erblickte. Die englischen Radikalen bezogen sich auf das reinere Gemeinwesen der vornormannischen Vergangenheit und auf ihre Tradition der Abweichung. Die revolutionäre Rhetorik der Franzosen konnte auf Vergleichbares nicht zurückgreifen: In Frankreich gab es im Volk keine fest etablierte, auf religiöser Abweichung fußende Lesekultur, und es gab kein anerkanntes Geburtsrecht des »frei geborenen« Franzosen, das die revolutionäre Rhetorik hätte stützen und beflügeln können.[23] Statt dessen konzentrierten die Franzosen sich auf eine »mythische Gegenwart«, wie ich es nennen möchte, auf den Augenblick, da die neue Gemeinschaft geschaffen wurde, auf den geheiligten Moment des neuen Konsenses. Der rituelle Treueeid, der bei einem Freiheitsbaum oder in Massen auf den zahlreichen Revolutionsfesten abgelegt wurde, erinnerte an den Augenblick, da der Gesellschaftsvertrag abgeschlossen wurde, und ließ ihn gleichsam neu erstehen; die rituellen Worte ließen die mythische Gegenwart wieder und wieder lebendig werden.[24]
Die mythische Gegenwart war ihrem Wesen nach zeitlos, die Geschichte der Revolution daher ständig im Fluß. Die häufigen Veränderungen in den Revolutionsfesten zeugen von dieser zeitlichen Unschärfe; jedes Regime und jede Partei schuf eine eigene Interpretation der historischen Logik der Revolution, indem sie sich für bestimmte Daten entschied, die sie durch Feiern würdigte.[25] Der Tag des Sturms auf die Bastille (der 14. Juli) hatte stets die besten Chancen, als Gründungstag der neuen Gemeinschaft zu gelten, weil er allen übrigen Daten voranging; doch als die Revolution voranschritt, kamen neue Daten hinzu und beanspruchten eine ähnliche oder sogar höhere Bedeutung: die Abschaffung der Monarchie am 10. August (1792), die Hinrichtung des Königs am 21. Januar (1793) und der Sturz Robespierres am 9. Thermidor (des Jahres II). Doch trotz all ihrer Unterschiede hatten die Revolutionsfeste eines gemeinsam: sie sollten den Augenblick des neuen Konsenses wiederholen und wiederbeleben. Die Feste erinnerten die Teilnehmer daran, daß sie die mythischen Heroen ihres eigenen Revolutionsepos waren.
Die Sprache der Revolution wurde zwar mit religiöser Inbrunst vorgetragen, doch ihr Inhalt war entschieden weltlich. Als die Fronten zur Kirche klarer zutage traten – und das geschah schon sehr bald –, entfernten die Revolutionäre die meisten positiven Bezüge auf das Christentum aus ihrem Wortschatz. Mit dieser Abkehr von christlichen beziehungsweise katholischen Bezügen verdeutlichten sie ein weiteres Mal den revolutionären Bruch mit der französischen und europäischen Vergangenheit. Der neue Gesellschaftsvertrag bedurfte keiner Entsprechung zum Alten oder Neuen Bund der Bibel; er gründete in der Vernunft und in den natürlichen Rechten des Menschen. Die Revolutionäre griffen über die nationale Vergangenheit Frankreichs hinaus und wandten sich römischen und griechischen Vorbildern zu. Jeder gebildete Mensch des achtzehnten Jahrhunderts wußte ein wenig von der klassischen Antike, doch die radikalen Revolutionäre, Männer wie Camille Desmoulins, Saint-Just und Robespierre, fanden darin Lektionen für die Einrichtung einer neuen Ordnung; sie »utopisierten« die Geschichte der klassischen Antike zum Modell einer neuen, unschuldigen Gesellschaft, einer idealen Republik.[26]
Nach der Geschichtsauffassung der Revolutionäre hatten die Republikaner in Griechenland und Rom die Freiheit erfunden, und Frankreichs Aufgabe war es, diese gute Nachricht allen Menschen zu verkünden. Der konservative Herausgeber der Gazette de Paris erkannte die Implikationen dieser Auffassung bereits im Juli 1790. In einem Kommentar zum Föderationsfest erklärte er: Das Fest »wird mit denen in Griechenland und Rom verglichen. Dabei wird übersehen, daß hier beständig Republiken als Vorbild angeführt werden […]. Wir aber sind eine Monarchie […]. Seid weder Römer noch Griechen; seid Franzosen.« Und am folgenden Tag legte er die konservative Geschichtsauffassung auseinander:
»Laßt uns nicht von unseren alten Formeln abgehen [Vive le Roi und Vive la Reine verloren an Boden gegenüber Vive la Nation]. Als Söhne der Franken, die ihre eigene Größe an der noch überragenderen Größe ihrer Führer maßen, wollen wir kämpfen, lieben, leben und sterben wie sie – getreu den Grundsätzen unserer Väter […]; wir waren eine große Familie, versammelt unter den Augen ihres Oberhaupts […]. Da wir geschworen haben, Brüder zu sein, haben wir alle einen gemeinsamen Vater.«[27]
Die konservative Position verband Monarchie, Tradition und väterliche Autorität mit dem historischen Vorbild der Franken – lange ein bevorzugter Anknüpfungspunkt für all jene, die adlige Vorrechte gegen absolutistische Übergriffe verteidigten. Und der Konservative bestand ausdrücklich darauf, an der traditionellen Rhetorik – »unseren alten Formeln« – festzuhalten. Die Schriften der Konservativen verwandten viel Raum auf Parallelen mit der Vergangenheit Frankreichs, und in der Nationalversammlung beriefen konservative Redner sich auf Beispiele aus der Geschichte, um ihre Argumente zu bekräftigen.[28]
Die Radikalen dagegen verbanden den Ruf nach Freiheit und den Bruch mit der Vergangenheit mit antiken Vorbildern, in denen die Vergangenheit nicht so sehr als Vorbild für eine zukünftige Gesellschaft fungierte. In einem Dokument aus dem Jahre 1793, das aus den Reihen der Radikalen stammt, heißt es: »Um wirklich Republikaner zu sein, muß jeder Bürger in sich selbst eine Revolution durchmachen, eine Revolution gleich der, die das Antlitz Frankreichs umgestaltet hat. Es gibt nichts, aber auch gar nichts Gemeinsames zwischen dem Sklaven eines Tyrannen und dem Bewohner eines freien Staates; die Gewohnheiten, Grundsätze, Gefühle, die Taten des letzteren, alles muß etwas ganz Neues sein.«[29] Der Nachdruck, mit dem man sich dem Neuen zuwandte, ging manchmal so weit, daß man sogar die Autorität der Antike bestritt. In Condorcets bahnbrechenden »Bericht und Projekt eines Erlasses über die allgemeine Organisation des öffentlichen Erziehungswesens« vom April 1792 heißt es:
»Da alles gesagt werden muß und kein Vorurteil Bestand haben darf, [bin ich der Ansicht] daß das lange sorgfältige Studium der alten Sprachen […] möglicherweise eher schädlich als nützlich wäre. Wir suchen nach einer Erziehung, die die Wahrheit bekannt macht, und diese Bücher sind voll von Irrtümern. Wir wollen die Vernunft lehren, und diese Bücher können auf den falschen Weg führen. Wir sind so weit von den Alten entfernt, sind ihnen auf dem Wege zur Wahrheit so weit voraus, daß die Vernunft eines Menschen schon wohlgerüstet sein muß, damit sie von diesen kostbaren Relikten bereichert und nicht korrumpiert wird.«[30]
1 Das Fest der Freiheit, Oktober 1792Die Freiheitsstatue stand auf dem Sockel, der zuvor das Denkmal Ludwig XV. getragen hatte
Dem radikalen Bruch mit der Tradition und mit der Legitimation von Autorität durch den Bezug auf geschichtliche Ursprünge entsprach auch die Abkehr von paternalistischen oder patriarchalischen Autoritätsmodellen. Auf dem Staatssiegel, in den Stichen und Drucken mit Darstellungen der neuen Republik und in den lebenden Bildern der Feste traten weibliche Allegorisierungen antiker Herkunft an die Stelle der Abbildungen des Königs (siehe Abbildung 1). Diese weiblichen Figuren – lebende Frauen oder Statuen – saßen oder standen stets allein und waren zumeist von abstrakten Emblemen der Autorität und der Macht umgeben. Die Republik mochte ihre Kinder und selbst ihre männlichen Verteidiger haben, einen Vater indessen sah man nie.[31]