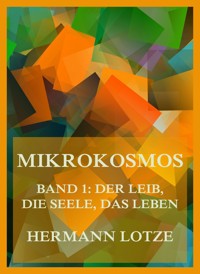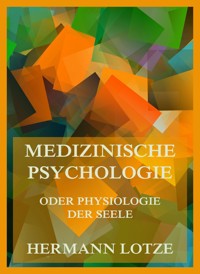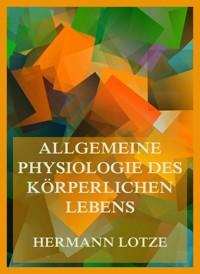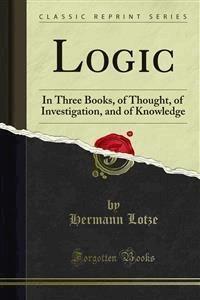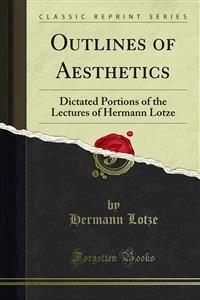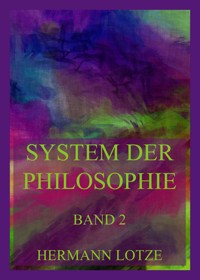
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band ist der zweite Teil des Werkes "System der Philosophie", dessen erster Teil, ebenfalls im selben Verlag erschienen, sich mit der Logik beschäftigt. Das erste Teil dieses Buchs, "Ontologie", befasst sich mit der Existenz und den Qualitäten der Dinge, mit der Realität, der Schöpfung und Variation, den Arten der Aktion und der Einheit der Dinge. Der zweite Teil (Kosmologie) diskutiert die Subjektivität der Raum-Wahrnehmungen, die Beziehungen von Raum, Zeit und Bewegung, die Struktur der Materie, die elementaren Bestandteile oder Atome der Materie, die Gesetze der Aktion, und die verschiedenen Linien der Aktion in der Natur. Der dritte Teil (Psychologie) befasst sich mit der metaphysischen Konzeption der Seele, den Empfindungen, der Bildung von Raum-Konzeptionen, und der körperlichen Grundlage geistiger Aktionen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 911
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
System der Philosophie
Zweiter Teil: Drei Bücher der Metaphysik
Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie
HERMANN LOTZE
System der Philosophie, Zweiter Teil, Hermann Lotze
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680037
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort des Herausgebers. 1
Erstes Buch: Vom Zusammenhang der Dinge (Ontologie) 2
Erstes Kapitel. Vom Sein der Dinge. 21
Zweites Kapitel. Von der Qualität der Dinge. 35
Drittes Kapitel. Von dem Realen und der Realität. 49
Viertes Kapitel. Vom Werden und der Veränderung. 65
Fünftes Kapitel. Von der Natur des Wirkens. 79
Sechstes Kapitel. Die Einheit der Dinge. 104
Siebtes Kapitel. Abschluss. 123
Zweites Buch. Vom Lauf der Natur.(Kosmologie.) 148
Erstes Kapitel. Von der Subjektivität der Raumanschauung. 148
Zweites Kapitel. Deduktionen des Raumes. 174
Drittes Kapitel. Von der Zeit. 206
Viertes Kapitel. Von der Bewegung. 234
Fünftes Kapitel. Die Konstruktion der Materialität. 258
Sechstes Kapitel. Die einfachen Bestandteile der Materie. 281
Siebtes Kapitel. Die Gesetze der Wirkungen. 299
Achtes Kapitel. Die Formen des Naturlaufs. 328
Drittes Buch. Vom geistigen Dasein.(Psychologie.) 365
Erstes Kapitel. Der metaphysische Begriff der Seele. 365
Zweites Kapitel. Die Empfindungen und der Vorstellungsverlauf. 389
Drittes Kapitel. Von dem beziehenden Vorstellen. 411
Viertes Kapitel. Von der Bildung der Raumvorstellungen. 420
Fünftes Kapitel. Die leibliche Begründung geistiger Tätigkeit. 445
Schluss. 468
Vorwort des Herausgebers
Sehr geehrter Leser,
wir, der Herausgeber dieses Buches, halten Hermann Lotzes Werke, die lange Zeit nur kaum, schwer oder gar nicht erhältlich waren, für unverzichtbar für das kulturelle Erbe Deutschlands und der Welt.
Aus diesem Grund haben wir unter anderem dieses Ihnen hier vorliegende Werk zusammengesetzt aus Scans des in den 1870er Jahren erschienen Originals –– eine spannende, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe, da selbst den allerbesten Adleraugen der eine oder andere Druck- oder grammatikalische Fehler entgeht.
Deswegen geschätzter Leser, seien Sie nachsichtig, wenn Sie über etwas stolpern, das so ganz offensichtlich dort nicht hingehört. Teilen Sie uns auch gerne Ihre Funde mit, wir werden die entsprechenden Stellen schnellstens berichtigen.
In diesem Sinne, sehr viel Freude beim Lesen,
Ihr Jazzybee Verlag
(Jürgen Beck)
Erstes Buch: Vom Zusammenhang der Dinge (Ontologie)
I. Wirklich nennen wir die Dinge, welche sind, im Gegensage zu denen, welche nicht sind; wirklich die Ereignisse, die geschehen, im Unterschied von denen, die nicht geschehen; wirklich auch die Verhältnisse, welche bestehen, im Vergleich mit denen, welche nicht bestehen. Auf diesen Sprachgebrauch hatte ich früher Veranlassung, mich zu berufen; ich erinnere jetzt an ihn, um kurz den Gegenstand der folgenden Untersuchungen zu bezeichnen. Nicht die Welt des Denkbaren mit der unerschöpfbaren Mannigfaltigkeit ihrer ewig gültigen inneren Beziehungen beschäftigt uns hier; unsere Überlegungen gelten ausdrücklich diesem anderen Gebiet, dessen tieferer Zusammenhang mit jenem Reich der Ideen, seitdem er zuerst die Aufmerksamkeit Platons gefesselt, die stets wieder aufgenommene Frage der Philosophie geblieben ist. Welt des Scheines oder der bloßen Erscheinung nannten dies Gebiet nicht ohne Geringschätzung diejenigen, welche die wandelbare Mannigfaltigkeit seines Inhalts mit der unverrückbaren Ruhe und Klarheit der Ideenwelt verglichen; als die wahre Wirklichkeit erschien es anderen, die in seiner unablässigen Bewegung und in den zahllosen Wirksamkeiten, von denen es durchkreuzt wird, mehr zu besitzen glaubten, als ihnen die feierliche Schattenwelt unveränderlicher Ideen zu gewähren vermochte. Diese Verschiedenheit der Ausdrucksweisen beruht auf einem tiefen Gegensatz der Auffassung, welcher uns in aller Philosophie bemerklich werden wird; hier erwähne ich sein nur deswegen, weil beide Ansichten, mit völlig verschiedener Wertschätzung, doch den Mittelpunkt gleich deutlich machen, um welchen sich metaphysische Untersuchungen im Wesentlichen immer bewegen werden: die Tatsache der Veränderung. Von allem bloß denkbaren Inhalte nur bildlich aussagbar, beherrscht die Veränderung den Umfang der Wirklichkeit vollständig; ihre verschiedenen Formen, Werden und Vergehen, Wirken und Leiden, Bewegung und Entwicklung, sind geschichtlich und fachlich die steten Veranlassungen der Untersuchungen, welche ein altes Herkommen, als Lehre von dem Laufe der Dinge im Gegensatz zu dem Bestande der Ideenwelt, unter dem Namen der Metaphysik vereinigt hat.
II. Untersuchung widmen wir nicht dem Selbstverständlichen, sondern dem Rätselhaften. Auch die Metaphysik entstand nur, weil der Verlauf der Begebenheiten in derjenigen Gestalt, in welcher die unmittelbare Wahrnehmung ihn vorführte, in Widerspruch mit Erwartungen stand, deren Erfüllung man von allem, was wahrhaft sein und geschehen sollte, glaubte verlangen zu dürfen. Diese Erwartungen konnten von verschiedenem Ursprung sein. Sie waren vielleicht dem erkennenden Geiste eingeboren: als denknotwendige Annahmen über Art und Zusammenhang jegliches Seins und Geschehens mussten sie dann die Beurteilung jedes Ereignisses leiten, welches die Beobachtung vorführte; sie konnten ebenso in Forderungen bestehen, welche dem Gemüte aus seinen Bedürfnissen, Wünschen und Hoffnungen entsprungen waren: von der äußeren Wirklichkeit verlangten sie dann nicht minder dringend ihre Erfüllung, sobald zu ihr die Aufmerksamkeit sich zurückwandte; sie mochten endlich, nicht denknotwendig an sich selbst, aus dem tatsächlichen Inhalt der Erfahrung als befestigte Gewohnheiten der Auffassung entstanden sein, die nun in jeder späteren Wahrnehmung wiederzufinden vermuteten, was die früheren ihnen dargeboten hatten. Die Geschichte der menschlichen Weltansichten überzeugt uns von der gleich großen Lebhaftigkeit und Selbstgewissheit, mit welcher diese verschiedenen Ansichten sich gelten machten; die Neigung der Gegenwart aber geht dahin, den Besitz angeborener Erkenntnis zu verneinen, den Forderungen des Gemütes jede Berechtigung zur Mitbestimmung der Wahrheit zu versagen, in der Erfahrung allein die Quelle des sicheren Wissens zu suchen, welches wir über den Zusammenhang der Dinge erwerben möchten.
III. Wie nun die Vernachlässigung der Erfahrung sich rächt, darüber ist die Philosophie durch den Verlauf ihrer Geschichte zu schmerzlich belehrt worden, als dass erneuerte Hinweisung auf die Unentbehrlichkeit derselben noch einmal Not täte; für sich allein aber und ohne jede Voraussetzung, die nicht ihr selbst angehörte, ist Erfahrung dennoch nicht im Stande, die Erkenntnis hervorzubringen, welche wir begehren. Denn nicht bloß erzählen und beschreiben wollen wir, was geschehen ist oder geschieht; auch voraussagen zu können verlangen wir, was unter bestimmten Umständen geschehen wird. Zukünftiges aber kann die Erfahrung uns nicht zeigen; auch erraten kann sie es uns nur helfen, wenn wir im Voraus den Weltlauf verpflichtet wissen, über die Grenzen der bisherigen Beobachtung hinaus folgerecht das Muster fortzusetzen, dessen Anfang er uns innerhalb dieser Grenzen sehen lässt. Die Zuversicht nun zu der Gültigkeit dieser Voraussetzung kann uns die Erfahrung nicht gewähren. Möge immerhin die Beobachtung in ihrer unablässigen Fortsetzung bis zu irgend einem Augenblicke nur auf Befolgungen der Regeln gestoßen sein, welche wir aus sorgfältiger Benutzung früherer Wahrnehmungen gewonnen hatten; dass aber diese bisher ausnahmslos gewachsene Anzahl der Bestätigungen die Wahrscheinlichkeit gleicher Bestätigung für die Zukunft vergrößert habe, lässt sich nur unter der stillschweigend bereits zugestandenen Annahme behaupten, dieselbe Ordnung, welche die Vergangenheit des Weltlaufs beherrschte, werde auch für die Gestaltung seiner Zukunft maßgebend sein. Diese eine Voraussetzung mithin, die eines allgemeinen inneren Zusammenhanges aller Wirklichkeit überhaupt, der es erst möglich macht, aus der Gestalt eines ihrer Abschnitte auf die der übrigen zu schließen, liegt jedem Versuche, durch Erfahrung zur Erkenntnis zu kommen, und unableitbar aus dieser selbst, zu Grunde; wer sie bezweifelt, verliert nicht nur die Aussicht, Zukünftiges mit Gewissheit berechnen zu können, sondern beraubt sich zugleich des einzigen Grundes zu der bescheideneren Hoffnung, unter bestimmten Umständen den Eintritt eines Ereignisses für wahrscheinlicher halten zu dürfen, als den eines anderen.
IV. Skeptische Richtungen der Philosophie sind sich dessen wohl bewusst gewesen. Nachdem sie einmal sich den Besitz einer angeborenen Wahrheit abgesprochen, die auch die Dinge binde, haben sie folgerecht darauf verzichtet, jemals aus gegebener Wirklichkeit auf die nicht gegebene Fortsetzung derselben zu schließen; Nichts schien ihnen in der Tat übrig zu bleiben, als in reiner Mathematik Vorstellungen zu verknüpfen, die keine Geltung in Bezug auf Wirkliches beanspruchen, oder in Geschichte und Beschreibung zu schildern, was ist oder gewesen ist; aber eine Naturwissenschaft fanden sie unmöglich, die aus gegebenen Tatsachen der Gegenwart die Notwendigkeit eines Erfolgs in der Zukunft vorauszusagen unternähme; nur im Leben freilich vertrauten die, die so dachten, mit nicht minderer Gewissheit als ihre Gegner, auf die Zuverlässigkeit der physikalischen Grundsätze, deren völlige Rechtlosigkeit sie innerhalb der Schule behaupteten. Die naturwissenschaftliche Praxis der Gegenwart, deren geräuschvolle Verherrlichung der Erfahrung jede beginnende Metaphysik zu dieser vorläufigen Selbstverteidigung nötigt, scheint vor gleicher Entsagung nur durch eine glückliche Unfolgerichtigkeit behütet. Sie zweifelt mit löblicher Bescheidenheit in vielen einzelnen Fällen, ob sie bereits das wahre Gesetz entdeckt habe, dem ein untersuchter Kreis von Vorgängen gehorche; aber sie bezweifelt nicht im Allgemeinen das Vorhandensein von Gesetzen, welche alle Teile des Weltlaufs so verknüpfen, dass von dem einen zum anderen einer vollkommenen Erkenntnis, wenn wir sie erreicht hätten, untrügliche Schlussfolgerungen möglich würden. Die Erfahrung, auch wenn sie ihrer Natur nach den Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme liefern könnte, hätte ihn jedenfalls bisher noch nicht geliefert; denn noch immer liegen große Gebiete der Natur vor uns, deren innere gesetzliche Verknüpfung uns unbekannt ist, und für welche mithin die Behauptung, auch durch sie hindurch erstrecke sich eine lückenlose Gesetzlichkeit, nicht auf dem Zeugnis der Erfahrung beruhen kann, sondern nur auf Grund eines Glaubens gewagt wird, für welchen der durchgehende Zusammenhang aller Wirklichkeit eine ursprüngliche Gewissheit ist.
V. Man kann auf verschiedene Weise sich hiermit abzufinden suchen. Zuweilen hört man einräumen, allerdings sei die Naturwissenschaft nur ein Versuch, wie weit sich mit der willkürlich gemachten Annahme einer Gesetzlichkeit im Laufe der Dinge kommen lasse; erst der erfahrungsmäßig günstige Erfolg überzeuge von der Triftigkeit der gemachten Voraussetzung. Aber hierüber kann in der Tat nur das Gesagte wiederholt werden, und es ist vielleicht nicht unnütz, es wirklich zu wiederholen. Wenn es sich nach dem Zusammenhange zweier Vorgänge fragt, deren gegenseitige Verknüpfung aus keiner bereits bekannten Wahrheit ableitbar ist, dann pflegt man allerdings das gesuchte Gesetz durch eine Hypothese zu ermitteln, deren Beweis in der Ausnahmslosigkeit ihres Zutreffens liegt. Aber in Wahrheit ist doch an sich selbst eine so beglaubigte Hypothese noch immer nichts als eine Gedankenformel, in der uns ein kurzer Ausdruck für das gemeinsame Verhalten gelungen ist, welches in allen bisher beobachteten Beispielen des fraglichen Zusammenhanges anzutreffen gewesen. ist; zum Gesetz wird dieser Ausdruck doch nur durch einen Nebengedanken, den nicht die Erfahrung hinzufügen kann, sondern den wir hinzufügen, durch den Gedanken nämlich, dass auch in den künftigen Gliedern dieser ins Unendliche fortgehenden Reihe von Fällen dieselbe Beziehung gelten werde, die wir erfahrungsmäßig nur zwischen den bereits verlaufenen Gliedern der Reihe gefunden haben. Auch was man weiter hinzufügt, nötigt uns nur zu einer Wiederholung. Wir geben gern zu, dass die unablässig ohne Gegenbeispiel wiederholte Beobachtung desselben Zusammenhangs zweier Vorgänge uns eine gesetzliche Verknüpfung beider immer wahrscheinlicher macht und ihre Koinzidenz nur unter dieser Annahme überhaupt erklärlich werden lässt; aber worauf beruht doch die zunehmende Gewalt dieser Vermutung? Ließen wir im Anfange dahingestellt, ob überhaupt gesetzlicher Zusammenhang im Laufe der Dinge bestehe, so hätten wir gar kein Recht mehr, eine Aufeinanderfolge von Ereignissen erklärlich finden zu wollen und deshalb diejenige Annahme zu begünstigen, welche sie erklärlich macht. Denn alle Erklärung ist doch zuletzt Nichts anderes, als die Zurückführung eines bloßen Zusammenseins zweier Tatsachen auf eine innere Zusammengehörigkeit nach einem allgemeinen Gesetz; alles Bedürfnis einer Erklärung, und das Recht sie zu verlangen, beruht daher auf der anfänglich gewissen Überzeugung, in Wahrheit sein und geschehen könne nur das, wofür sich in einem allgemeinen Zusammenhange der Dinge der Grund seiner Möglichkeit und in besonderen Tatsachen dieses Zusammenhanges der Grund seiner notwendigen Verwirklichung in bestimmtem Ort und Augenblicke finde. Lassen wir diese ursprüngliche Überzeugung fallen, so bedarf Nichts mehr der Erklärung und Nichts lässt sie zu; denn eben der Zusammenhang würde nicht mehr da sein, in dessen Nachweis sie bestehen müsste. Oder anders ausgedrückt: eben dann, wenn wir von einer gesetzlichen Verkettung im Laufe der Dinge nicht ausgingen, eben dann würde eine immer gleiche und dennoch ganz zufällige Verknüpfung derselben Vorgänge durchaus nicht unwahrscheinlicher sein, als die bunteste Abwechselung der mannigfaltigsten Kombinationen gewesen sein würde, und eben deswegen kann die bloße Tatsache jener beständig wiederholten Koinzidenz kein Beweisgrund für das Vorhandensein eines allgemeinen Gesetzes sein, mit dessen Hilfe nun auch ein sicheres Vorurteil über die noch nicht beobachteten Fälle der Zukunft möglich würde. Erst dann, wenn im Allgemeinen gesetzliche Verknüpfung eines Mannigfachen bereits feststeht, erst dann kann es einen Maßstab geben, nach welchem sich Mögliches von Unmöglichem, Wahrscheinliches von Unwahrscheinlichem scheidet; erst dann kann das ausschließlich beobachtete Vorkommen eines Einzelfalls aus der Menge gleichmöglicher uns berechtigen, die beständige Gültigkeit eines besonderen Zusammenhanges anzunehmen, welcher jener allgemeinen Gesetzlichkeit immer nur dieses eine Ergebnis abgewinnt und andere an sich gleichfalls mögliche ausschließt. Alle Erfahrung mithin, soweit sie gesetzlichen Zusammenhang der Dinge zu finden glaubt, bestätigt hierdurch nur die an sich schon für richtig zugestandene Voraussetzung eines solchen, niemals aber kann sie die noch zweifelhaft gelassene beweisen. Und hiermit ist die Handlungsweise der Naturforschung völlig im Einklang; selbst da, wo die beobachteten Vorgänge jedem Gedanken an einen gesetzlichen Verband zu widersprechen scheinen, glaubt sie doch durch diese Erfahrungen niemals einen Gegenbeweis jener Voraussetzung erhalten zu haben, der ihre ferneren Bemühungen nutzlos machte; sie bedauert bloß den Mangel einer Bestätigung, welche durch erneuerte Forschung dennoch zu erreichen sie niemals verzweifelt.
VI. Fragt man daher nicht so sehr nach den ostensiblen Grundsätzen, welche zum Zweck der Disputation geformt zu werden pflegen, als vielmehr nach denen, welche unausgesprochen fortwährend durch die Tat bekräftigt werden, so darf man wohl als die herrschende Meinung der Naturwissenschaften das Zugeständnis ansehen, die Gewissheit eines gesetzlichen Zusammenhanges im Laufe der Dinge stehe vor aller Erfahrung fest; pflegen doch eben grade diese Wissenschaften jenen Zusammenhang unter der bestimmten Form eines allgemeingesetzlichen mit größerer Ausschließlichkeit für selbstverständlich auszugeben, als es ohne mancherlei Bedenken von der Philosophie zugestanden werden könnte. Allein mit dieser Einräumung glaubt die Naturforschung doch nur einen allgemeinen Gesichtspunkt zugegeben zu haben; welches dagegen die Gesetze der Wirklichkeit sind, und damit freilich Alles, was Gegenstand weiterer Wissbegier sein kann, behält sie ausschließlich ihrer Bearbeitung der Erfahrung vor und verneint Notwendigkeit und Möglichkeit jeder metaphysischen Untersuchung, die hierüber der Erfahrung etwas hinzufügen zu können glaubte. Gegen solche Ansprüche könnte die Metaphysik sich nur durch die vollständige Ausführung ihrer Absichten hinlänglich verteidigen; denn nur im Einzelnen würde sie verständlich zeigen können, dass eben jene Bearbeitung, deren die Erfahrung bedarf, um fruchtbar zu werden, nicht ohne die Hinzunahme von mancherlei bestimmten Zwischengedanken ausführbar ist, deren Inhalt noch nicht durch den bloßen Allgemeinbegriff einer Gesetzlichkeit überhaupt gegeben ist, und deren Gewissheit anderseits nicht wieder auf empirische Belege gegründet werden kann. Für den Augenblick mag diese kurze Hindeutung umso mehr genügen, als wir zunächst mit ihr ein umfassendes Zugeständnis an unsere Gegner verknüpfen wollen. Denn eben jenen Versuch soll nach unserer Absicht die Metaphysik nicht wiederholen, durch dessen notwendiges Scheitern sie ihr Ansehen hat sinken sehen: sie soll nicht unternehmen, die speziellen Gesetze aufzustellen, nach denen sich in seinen verschiedenen Richtungen der Lauf der Dinge tatsächlich bewegt. Indem sie vielmehr nur die allgemeinen Bedingungen aufsucht, deren Erfüllung sie von allem verlangen zu müssen glaubt, was überhaupt sein oder geschehen soll, muss sie ja zugestehen, nicht von selbst zu wissen, sondern nur durch Erfahrung kennen lernen zu können, was denn in Wirklichkeit ist und geschieht; nur aus dieser letzten Kenntnis aber könnten jene bestimmten Gesetze des Verhaltens fließen, durch welche eben diese Wirklichkeit den allgemeinsten Anforderungen an jede denkbare Wirklichkeit genügt. So wird daher die Metaphysik nur gewisse, ich möchte sagen ideale Formen entwickeln können, denen die Beziehungen zwischen den Elementen jeder Wirklichkeit entsprechen müssen; aber es fehlt ihr an allen den bestimmten konstanten oder selbst veränderlichen Maßen, durch deren Einsetzen sie jenen Formen die speziellen mathematischen Gestalten geben könnte, in welchen sie doch allein von einer nach Art Größe Zahl und Ordnung durchaus bestimmten Wirklichkeit gelten können. Dies alles überlässt die Metaphysik der Erfahrung; aber freilich wird sie fortfahren zu verlangen, die von dieser gefundenen Ergebnisse dann auch so interpretieren zu dürfen, dass sie zu diesen idealen Formen passen und als Anwendungsfälle derselben begreiflich werden, als Fiktionen aber oder als unaufgeklärte Tatsachen diejenigen zu behandeln, die mit denselben in Widerspruch bleiben.
VII. Nichts würde daher verbieten, die Metaphysik für die Letzte Bearbeitung der Tatsachen anzusehen, welche die Erfahrungswissenschaften zu ihrer Kenntnis gebracht haben, für eine Bearbeitung, die nur andere Zwecke verfolgt, als die rühmliche und unablässige Anstrengung jener. Auf die eigentümliche Natur der Elemente und Kräfte einzugehen, deren Begriffe sie in sicherster Weise zur Gewinnung ihrer Erkenntnisse zu benutzen weiß, vermeidet die Naturwissenschaft; in nicht seltenen Fällen hat sie wichtige Entdeckungen, denen rascher Fortschritt weiterer Einsicht folgte, durch Anwendung der Rechnung auf die Annahme gewisser Verhältnisse gemacht, deren mögliches Bestehen ihr selbst unkonstruierbar blieb. Wir tun ihr deshalb nicht Unrecht, wenn wir als ihren Zweck die praktische Herrschaft über die Erscheinungen ansehen; ich meine damit die irgendwie erworbene Fähigkeit, aus gegebenen Bedingungen der Gegenwart auf das zu schließen, was ihnen entweder folgen wird, oder ihnen vorausgegangen sein oder in den der Beobachtung unzugänglichen Teilen des Weltlaufs gleichzeitig stattfinden muss. Dass nun zur Gewinnung solcher Herrschaft, unter einziger Voraussetzung eines gesetzlichen Zusammenhanges überhaupt, die sorgsame Vergleichung der Erscheinungen, auch ohne Kenntnis der wahren Natur ihrer Träger, in großem Umfang ausreiche, ist an sich verständlich und durch die Geschichte der Wissenschaft bestätigt; dass sie immer ausreichen werde, ist nicht ebenso glaublich; wahrscheinlich vielmehr, dass nach Erlangung einer gewissen Größe ihres Umfangs und ihrer Vertiefung die Naturwissenschaft das Bedürfnis empfinden werde, zur Ermöglichung weiterer Fortschritte auch die erschöpfende Definition jener Beziehungspunkte nachzuholen, an deren unbestimmt gelassene Natur sie bisher ihre Berechnungen knüpfen konnte. Dann wird sie entweder eine neue Metaphysik aus sich selbst erzeugen oder an eine bestehende sich anschließen; es scheint mir, dass sie jetzt sehr lebhaft daran ist, das erste zu tun; Bestrebungen, die wir mit großem Interesse, aber mit gemischten Gefühlen betrachten. Der beneidenswerte Vorteil, durch vielseitige wirkliche Untersuchungsarbeit eine Sachkenntnis zu besitzen, die durch keine äußerliche Kenntnisnahme vollständig ersetzt werden kann, unterhält ein günstiges Vorurteil für diese Versuche der Naturforscher umso mehr, als der philosophische Sinn, der ihr Gelingen sichern kann, nicht das Sondereigentum einer Kaste, sondern ein Trieb des menschlichen Geistes ist, der innerhalb jedes wissenschaftlichen und praktischen Berufs mit gleich großer Intensität und Erfindungskraft sich zu äußern weiß. Dennoch droht ein Nachteil auch hier: die unwillkürliche Beschränkung des Gedankenganges auf den Gesichtskreis der gewohnten Beschäftigung, die äußere Natur, und die unbefangene Übertragung der methodischen Verfahrungsweisen, die den nächsten Zwecken richtig dienten, auf die Behandlung von Fragen, welche sich auf die auswärtigen Beziehungen des beherrschten Gebietes und auf seine tiefere Abhängigkeit von den Gründen beziehen, deren Berücksichtigung man bei der inneren Bearbeitung desselben geflissentlich abgelehnt hatte. Es kann nicht meine Absicht sein, hier schon die einzelnen Punkte nachzuweisen, in denen mir diese Gefahren nicht vermieden zu sein scheinen; ich begnüge mich zu erinnern, einerseits an die unverantwortliche Gewohnheit, das ganze geistige Leben nicht bloß denselben höchsten Gesichtspunkten sondern auch den speziellen Analogien zu unterwerfen, die für die Vorgänge der äußern Natur maßgebend sind, anderseits an die Neigung, jede beliebige Hypothese, deren Inhalt sich überhaupt nur vorstellen, ja selbst wenn er sich eigentlich nicht vorstellen, sondern nur durch Worte bezeichnen lässt, für gut genug zu halten, um auf sie das Gebäude einer ganzen neuen und paradoxen Weltansicht zu gründen. Ich verkenne gar nicht, dass auch dieser Beweglichkeit der Phantasie viel Schätzenswertes verdankt wird, denn ich weiß, dass der Mensch vielerlei Gedanken versuchen muss, um zur Wahrheit zu kommen, und dass ein glücklicher Einfall uns meist rascher weiterbringt, als der langsame Schritt einer methodischen Überlegung; dennoch kann es Nichts helfen, Versuche zu machen, deren innere Unmöglichkeit und Ungereimtheit einleuchten würde, wenn man von der einzelnen Aufgabe, zu deren Lösung man sie unternimmt, den Blick auf den Zusammenhang aller der Fragen richtete, zu deren Beantwortung siegleichfalls verwendbar sein müsste. Ich leugne daher nicht, dass mir manche metaphysischen Bestrebungen der neueren Naturforschung bei all dem großen Interesse, das sie unstreitig in Anspruch nehmen, ungefähr denselben Eindruck nur mit anderer Färbung machen, den die Naturphilosophie einer noch nicht lange vergangenen Zeit auf die Verehrer der exakten Wissenschaft gemacht hat. Aber es handelt sich nicht um solche individuelle Stimmungen; ich gab ihnen flüchtigen. Ausdruck nur, um die Absichten meiner künftigen Auseinandersetzungen deutlich zu machen. Den Beisaß, nach naturwissenschaftlicher Methode behandelt zu sein, durch welchen sich jetzt jede Untersuchung zu empfehlen pflegt, gebe ich absichtlich meiner Darstellung nicht; allerdings ist es ihr Vorsatz, auch zur Lösung der schwierigen Aufgabe einer philosophischen Grundlage der Naturwissenschaft beizutragen, was in ihren Kräften stehen wird; aber es ist nicht ihr einziger Vorsatz. Sie soll vielmehr dem Interesse dienen, welches der denkende Geist daran nimmt, nicht nur berechnend aus Erscheinungen neue Erscheinungen vorauszusagen, sondern den inneren realen Grund kennen zu lernen, der sie alle erst möglich und ihre Verkettung notwendig macht. Dieses Interesse, hinausreichend über das Gebiet, dem die Naturwissenschaft ihre Bemühung widmet, muss notwendig von anderen Gesichtspunkten als den dort üblichen ausgehen, und es wird zunächst auch, wie ich keineswegs verhehle, zu anderen höchsten Gesichtspunkten hinführen, die mit den Gewohnheiten der naturwissenschaftlichen Ansichten sich in unmittelbarer Übereinstimmung nicht befinden.
VIII. Indem wir jedoch so die Aufgabe der Metaphysik bestimmen, droht uns ein Einwurf. Man hat nicht nur die Erfahrung als die einzige tatsächliche Quelle unserer sicheren Erkenntnis gerühmt; an sich vielmehr völlig unerkennbar sei das, was eben sie nicht zu lehren vermöge: Alles, was wir im Gegensatz zu der beobachtbaren Folge der Erscheinungen unter dem weitfaltigen Ausdruck des Wesens der Dinge zusammenzufassen gewohnt sind. Man wird daher die Bestrebungen, denen wir uns widmen wollen, nur mit dem ablehnenden Bedauern begleiten, das man für jeden Versuch an sich wünschenswerter aber unausführbarer Unternehmungen hat; außer jener allgemeinen Zuversicht zu der gesetzlichen Verknüpfung der Dinge überhaupt besitze der menschliche Geist keine Quelle der Erkenntnis, welche die Erfahrung zu ergänzen oder zu berichtigen vermöge. Es würde nur sonderbar sein, nicht einräumen zu wollen, dass zu dem Geständnis der Unerforschlichkeit des Wesens der Dinge zuletzt jede Philosophie in gewissem Sinne zurückkommen muss; aber wie, wenn eben die genauere Feststellung dieses Sinnes und die Begründung der ganzen Behauptung die Aufgabe der Metaphysik wäre, die doch nur zu untersuchen verspricht, nicht aber die Grenzen ihres Gelingens im Voraus festsetzt? Und gewiss ist doch jene Behauptung, im Anfange aller Betrachtung hingestellt, eine sich selbst einigermaßen widersprechende Versicherung. So lange sie von einem Wesen der Dinge spricht, spricht sie von demjenigen und setzt seine Wirklichkeit voraus, von dessen Dasein nach ihrem eigenen Zeugnis die Erfahrung Nichts lehren kann; sobald sie die Unerkennbarkeit dieses Wesens behauptet, schließt sie eine Überzeugung über das Verhältnis des denkenden Geistes zu ihm ein, welche, da sie aus Erfahrung nicht entstanden sein kann, aus vorher anerkannter Gewissheit über das entstanden sein muss, was eben die Natur unsers Denkens der Reihe der Erscheinungen als das Wesen der Dinge gegenüber zu setzen nötigt. Aber eben diese stillen Voraussetzungen, die uns auch während der Bestreitung unserer Erkenntnisfähigkeit nicht verlassen, bedürfen jener Aufklärung Prüfung und Begrenzung, welche die Metaphysik als ihr Geschäft betrachtet. Und man hat kein Recht zu der Annahme, dies Geschäft sei sehr leicht und lasse sich durch einige der gewöhnlichen Meinung glaubliche Bemerkungen abtun, die man einleitungsweise der allein fruchtbaren Bearbeitung der Erfahrung voranschicke. Wenn man Nichts als Gesetzlichkeit im Laufe der Dinge voraussetzt, so scheint dieser einfache Ausdruck Einfaches zu bedeuten; aber was man mit ihm meint, zeigt sich doch mannigfaltig und weitläufig genug, sobald eben in der Ausführung jener Bearbeitung Gebrauch von ihm gemacht werden soll. Ich will nicht weitläufig darüber sein, dass jede naturwissenschaftliche Untersuchung die logischen Sätze der Identität und des ausgeschlossenen Dritten zur Gewinnung ihrer Ergebnisse benutzt; beide rechnet man unbefangen zu den selbstverständlichen Methoden jeder Forschung. Aber man vergisst dabei doch, dass sie für den Zusammenhang der Erscheinungen nicht gültig sein könnten, ohne auch von dem völlig unbekannten Grunde zu gelten, aus welchem die Erscheinungen hervorgehen, und doch geben manche Tatsachen Anlass genug zu der Vermutung, dass von den Dingen selbst und ihren Zuständen beide Grundsäge in einer anderen Bedeutung gelten als in Bezug auf die Urteile, welche wir denkend über diese Zustände fällen. Mit gleicher Arglosigkeit bedient man sich der mathematischen Wahrheiten, um von Folgerung zu Folgerung fortzuschreiten; man setzt stillschweigend voraus, das unbekannte Wesen der Dinge, für dessen eine Erscheinung wir der Erfahrung einen bestimmten Größenwert entlehnen, werde niemals aus seiner übrigen unbekannt gebliebenen Natur heraus dem zu erwartenden Erfolge einer Bedingung einen unberechenbaren Koeffizienten mitgeben, welcher die Übereinstimmung unserer mathematischen Voraussicht mit dem wirklichen Laufe der Begebenheiten verhinderte. Außer diesen noch immer allgemeinen Voraussetzungen aber, die sich hier schon erwähnen ließen, schließt die wirkliche Bearbeitung der Erfahrung noch manche spezielleren Vorurteile ein, deren nur die spätere Darstellung gedenken
Denn logische Gesetze gelten nur von dem denkbaren Inhalt der Begriffe, mathematische nur von reinen Größen unmittelbar; sollen beide auf das bezogen werden, was in Raum und Zeit sich bewegt und ändert, leidet und wirkt, so bedürfen sie allemal neuer Vorstellungen über die Natur des Wirklichen, die als vermittelnde Zwischenglieder die Unterordnung dieses neuen Anwendungsgebietes unter ihre Bestimmungen ermöglichen. Vergeblich sprächen wir daher von einer völlig vorurteilslosen Wissenschaft der Erfahrung; indem diese Wissenschaft jede metaphysische Anlehnung verschmäht und auf die Erkenntnis des Wesens der Dinge verzichtet, ist sie überall von ungeordneten Annahmen über eben dieses Wesen durchzogen und pflegt sich aus dem Stegreif für jede Einzelfrage die Beurteilungsgründe zu ergänzen, deren zusammenhängende Überlegung sie geringschätzt.
IX. Ich beabsichtige durch diese Bemerkungen Nichts als was Einleitungen leisten können: ich möchte dem natürlichen Wahrscheinlichkeitsgefühle, das doch an letzter Stelle über alle unsere philosophischen Unternehmungen richtet, ein günstiges Vorurteil über das Vorhaben einer Zusammenfassung dessen abgewinnen, was wir unabhängig von der Erfahrung, und als Antwort auf ihre an uns gerichteten Fragen, über Natur und Zusammenhang des Wirklichen glauben behaupten zu müssen. Ausdrücklich vermeide ich es jedoch, das Recht zu diesem Glauben, dessen wir uns tatsächlich doch alle nicht erwehren, durch eine vorgängige erkenntnistheoretische Untersuchung begründen zu wollen. Zuviel, bin ich überzeugt, wird gegenwärtig in dieser Richtung, und zwar ebenso fruchtlos als mit unbegründeten Ansprüchen, gearbeitet. Es ist verführerisch und bequem, von aller Lösung bestimmter Fragen abzusehen und allgemeinen Betrachtungen über Erkenntnisfähigkeiten nachzuhängen, deren man sich bedienen könnte, wenn man Ernst machen wollte; in der Tat lehrt jedoch die Geschichte der Wissenschaft, dass denen, welche sich entschlossen an die Bewältigung der Aufgaben machten, nebenher sich auch das Bewusstsein über die anwendbaren Hilfsmittel und über die Grenzen ihrer Benutzbarkeit zu schärfen pflegte; die anspruchsvolle Beschäftigung mit Theorien der Erkenntnis dagegen hat sehr selten zu einem sachlichen Gewinn geführt, und auch die Methoden gar nicht selbst hervorgebracht, mit deren tatenloser Schaustellung sie sich unterhält; im Gegenteil: die Aufgaben haben die Methoden der Lösung zu finden. gezwungen; das beständige Wetzen der Messer aber ist langweilig, wenn man Nichts zu schneiden vorhat. Ich weiß, wie unerhört diese Äußerung gegenüber der Richtung unserer Zeit ist; ich konnte indessen die Überzeugung von der inneren Ungesundheit der Bestrebungen nicht unterdrücken, welche von einer psychologischen Zergliederung unseres Erkennens eine Grundlegung der Metaphysik hoffen; die häufigen Darstellungen dieser Art erscheinen mir zwar ähnlich dem Stimmen der Instrumente vor dem Concert, aber nicht gleich notwendig und nützlich; denn dort kennt man die Harmonie, die man hervorbringen will, hier vergleicht man die einzelnen Leistungen, die man entdeckt zu haben glaubt, mit einem Kanon, den man erst finden will. Zuletzt gibt doch Jeder zu, dass wir über die Wahrheit und Wahrheitsfähigkeit unserer Erkenntnis keinen von ihr selbst unabhängigen Urteilsspruch einholen können; sie selbst muss die Grenzen ihrer Kompetenz bestimmen. Um dies zu können, um namentlich zu entscheiden, wie weit sie sich getrauen darf über die Natur des Wirklichen zu urteilen, muss sie zuerst sich darüber klar werden, was sie denn eigentlich, mit sich selbst in durchgängiger Übereinstimmung, von diesem Wirklichen behaupten muss. Nur der Inhalt dieser der Vernunft nun einmal notwendigen Voraussetzungen, durch welche eben der Begriff des Wirklichen erst bestimmt wird, von dem die Frage sein soll, kann sie dann berechtigen, über ihr eigenes weiteres Verhältnis zu diesem ihren Gegenstande zu urteilen, entweder die Unerkennbarkeit seiner konkreten Natur zu behaupten oder auch, im Zusammenhange aller ihrer Gedanken, die völlige Gegenstandlosigkeit des von ihr erzeugten Begriffes der Dinge nachzuweisen, oder endlich an ihm mit einem Glauben, der dann weiteren Beweis weder bedarf noch zulässt, in dem von ihr selbst bestimmten Sinne festzuhalten. Ganz ungerechtfertigt dagegen erscheint es mir, den unerforschlichsten Punkt, die psychologische Entstehungsweise unserer Erkenntnis und das Spiel der zu ihr zusammenwirkenden Bedingungen als eine leicht zu erledigende Vorfrage zu betrachten, nach deren Ausfall über Gültigkeit oder Ungültigkeit entweder aller oder einzelner Aussagen der Vernunft von Grund aus entschieden werden könnte; im Gegenteil, die psychologische Entstehungsgeschichte eines Irrtums schließt den Beweis, dass er ein Irrtum sei, immer erst dann ein, wenn man die Wahrheit schon kennt, von der die Bedingungen seiner Entstehung notwendig ablenken mussten.. Was ich daher vorbringen will, beruht nicht auf einer vorher zuzugestehenden Überzeugung über die psychologischen Wurzeln unserer Erkenntnis, sondern lediglich auf einer leicht erkennbaren Tatsache, die man selbst durch ihre Bestreitung zugesteht. Jeder, wie er sich auch drehen und wenden mag, muss in letzter Instanz jede ihm vorgelegte Behauptung und jede ihm von der Erfahrung vorgeführte Tatsache nach Gründen beurteilen, deren zwingende Kraft sich seinem Denken mit unmittelbarer Gewissheit aufdrängt; in letzter Instanz: denn selbst dann, wenn er die Berechtigung dieser Evidenz zu prüfen unternimmt, muss seine endliche Bejahung oder Verneinung derselben immer wieder auf der gleichen Evidenz seiner dafür gesammelten Entscheidungsgründe beruhen. Über das, was diese auf sich selbst beruhende Vernunft behaupten muss, lässt sich, nachdem sie Jahrhunderte hindurch, den Erfahrungen folgend, sich auf sich selbst besonnen hat, ein zusammenfassendes Bewusstsein gewinnen oder doch versuchen; wie aber dies alles in uns geschehe, und wie es dazu komme, dass die Evidenz der uns denknotwendigen Grundwahrheiten entstehe, darüber ist Aufklärung, so weit sie zu hoffen ist, erst von ferner Zukunft zu erwarten. Zuhoffen aber ist sie überhaupt erst nach Beantwortung der ersten Frage; den Vorgang unsers Erkennens und seine Beziehungen zu den Objekten müssen wir, mögen wir wollen oder nicht, eben denjenigen Behauptungen unterordnen, welche unsere Vernunft, als ihr denknotwendig, über jeden wirklichen Vorgang und über die Wirkung jedes Elementes der Wirklichkeit auf jedes andere aufstellt. Diese Äußerungen fechten nicht im Geringsten das hohe Interesse an, welches wir an der Psychologie als einem eigenen Gebiet der Untersuchung nehmen; sie wiederholen nur die Behauptung, die jede spekulative Philosophie aufrechterhalten muss: nicht Psychologie kann Grundlage der Metaphysik, sondern nur diese die Grundlage jener sein.
X. Ich wende mich zu einigen näheren Bestimmungen über den Gang unseres Unternehmens. Als ich die Voraussetzung eines allgemeinen Zusammenhangs aller Wirklichkeit als die gemeinsame Grundlage aller Forschung bezeichnete, habe ich zugleich mein Bedenken. gegen die Ausschließlichkeit angedeutet, mit welcher die naturwissenschaftliche Bildung diesen Zusammenhang unter die Form der Allgemeingesetzlichkeit bringt. Diese Form ist weder die einzige, noch die älteste von denen, unter welchen sich der menschliche Geist die Verknüpfung der Dinge vorgestellt hat. Durchaus nicht als Beispiele eines Allgemeinen, sondern als Teile eines Ganzen dachte zuerst der Mensch sich die Dinge, nicht zunächst durch gleichbleibende Gesetze aufeinander bezogen, sondern durch den unveränderlichen Sinn eines Planes, dessen Verwirklichung von den einzelnen Elementen nicht überall und immer ein gleiches, sondern ein veränderliches Verhalten erforderte. Aus dieser Überzeugung entstanden jene blendenden Gebilde idealistischer Weltkonstruktionen, die von dem Sinne einer höchsten Idee aus, in deren Tiefe sie durch unmittelbare Anschauung eingedrungen zu sein glaubten, die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen in der Ordnung abzuleiten dachten, in welcher sie der Verwirklichung jenes Planes zu dienen hatten; nicht auf Gesetze wandten sich diese Unternehmungen, sondern auf die Feststellung der einzelnen Zielpunkte, welche die Entwicklung der Dinge nach und nach zu erreichen hatte und deren jeder dann alle Gewohnheiten des Daseins und Benehmens in dem Umfange des von ihm beherrschten Weltabschnittes bestimmte. Die Ursachen der Fruchtlosigkeit dieser Unternehmungen sind deutlich; es misslang ihnen, was Menschen immer misslingen wird: die genaue und erschöpfende Bestimmung jenes höchsten Gedankens, den sie verehrten; jede Unvollständigkeit dieses Anfangs aber musste der zum Einzelnen herabsteigenden Entwicklung zu einer immer wachsenden Fehlerquelle werden; wo sie glücklichem Geschmacke dennoch annehmbare Ergebnisse verdankten, haben doch diese Versuche immer nur eine ästhetische Befriedigung, aber keine Gewissheit erzeugt, die dem Zweifel durch Beweis hätte widerstehen können. Aber die allgemeine Überzeugung, von der sie ausgingen, steht doch in keiner Weise, weder als minder gewiss noch als minder zulässig, gegen die Voraussetzung der allgemeinen Gesetzlichkeit zurück, die unserer Zeit allein annehmbar erscheint. Ich lasse daher keine Ungewissheit darüber, dass auch mir diese Weltansicht, wenn sie ausführbar wäre, als die Vollendung der Philosophie gelten würde, und dass ich, nachdem ich sie für unausführbar halten muss, dennoch nicht anstehe, der Überzeugung von der sachlichen Richtigkeit ihres Grundgedankens allen ihren noch möglichen Einfluss auf die Gestaltung meiner Auffassungen zu lassen. Aber aus den Gegenständen der bevorstehenden Untersuchung bleibt diese Ansicht, als unmittelbare Gewissheit wenigstens, ausgeschlossen. Denn eben nicht die Ideenwelt selbst mit der stets gültigen und stets vollständigen Gliederung ihres Inhalts soll uns beschäftigen, sondern die gegebene Welt, in welcher man den Vorgang der Verwirklichung der Ideen zu sehen glaubt. Nun aber nicht nur einmal und nicht in systematischer Ordnung entfaltet diese Wirklichkeit Abbilder der Ideen; würde doch dann kaum zu sagen sein, wodurch die Reihe der Abbilder von der ihrer Urbilder sich unterschiede; zahllose in Raum und Zeit verteilte Dinge und Begebenheiten bietet sie dar, durch deren wandelbare Beziehungen der Inhalt der Ideen in vielen Beispielen und mit verschiedenen Graden der Abweichung und Annäherung verwirklicht und wieder aufgehoben wird. Wie man nun auch immer das dunkle Verhältnis der Ideen zu der Erscheinungswelt und ihre Herrschaft über diese sich denken mag: sobald die Verwirklichung der Ideen dem veränderlichen Verkehr einer Vielheit von Beziehungspunkten übertragen ist, wird es allemal einen Kreis allgemeiner Gesetze geben müssen, nach denen in allen gleichen Wiederholungsfällen der gleiche und in ungleichen ein ungleicher Erfolg nötig wird, ein bestimmtes Ziel entweder erreicht oder verfehlt werden muss. Auch jene idealistische Weltansicht mithin, welche die Wirklichkeit durch bedeutungsvolle Zwecke beherrscht glaubt, muss doch, um den Vorgang der Verwirklichung derselben zu begreifen, den Gedanken einer allgemeingesetzlichen Verbindung der Dinge als ein abgeleitetes Prinzip von selbst hervorbringen, wenn sie ihm die Würde eines letzten Prinzips nicht zugestehen will. Sie wird ferner leicht einräumen können, dass der menschliche Geist eine unmittelbare Offenbarung über Ziel und Richtung der gesamten Weltbewegung nicht besitze, in welcher er nach ihrer eigenen Voraussetzung ein verschwindender Punkt ist; aber dazu bestimmt, an seinem beschränkten Orte im Dienste des Ganzen nach den gleichen allgemeinen Gesetzen zu wirken, die allen einzelnen Elementen desselben gelten, wird er leichter ein unmittelbares Bewusstsein dieser auch ihn bestimmenden Notwendigkeit haben. Überlegungen dieser Art entscheiden fachlich Nichts; aber sie reichen hin, die formelle Beschränkung unserer jetzigen Aufgabe zu begründen. Die Metaphysik soll nur zeigen, welchen allgemeinen Bedingungen das genügen müsse, von dem wir einstimmig mit uns selbst sagen dürfen, dass es sei oder geschehe; es bleibt dahingestellt, ob diese Gesetze, deren wir uns zu bemächtigen. hoffen, das Letzte bilden, was unsere Erkenntnis erreichen kann, oder ob es gelingen mag, sie von einem höchsten Gedanken abzuleiten, als Vorbedingungen, die dieser sich selbst für seine Verwirklichung gibt.
XI. Wünschenswert würde nun zur Auffindung der gesuchten Wahrheiten der Besitz eines sicheren Leitfadens sein. Die eben gemachten Bemerkungen berauben uns zunächst eines Hilfsmittels, auf welches eine noch nicht lange vergangene Zeit unserer Philosophie vertraute. Die idealistischen Systeme, von denen ich zuletzt sprach, meinten die Bürgschaft für die Vollständigkeit und Sicherheit ihrer Entwicklungen des wahrhaften Weltinhaltes in ihrer dialektischen Methode zu besitzen. Sie hatten nur wenig an bestimmte Rätsel der Erfahrung ihre Überlegungen angeknüpft; weit mehr hatten sie den vereinigten Eindruck aller Unvollkommenheiten auf sich wirken lassen, durch welche die Welt gleichzeitig unsere Erkenntnis, unsere sittliche Beurteilung und die Wünsche unsers Herzens beleidigt; dem gegenüber entstand ihnen mit großer Lebendigkeit aber zugestandener völligen Unklarheit die Ahnung eines wahrhaften Seins, das von diesen Mängeln frei sein und zugleich die schwierige Aufgabe lösen sollte, das Vorhandensein derselben begreiflich zu machen. Diese Ahnung, in welche sie alle Bedürfnisse des menschlichen Geistes und alle seine Sehnsucht verdichtet hatten, suchten sie durch die Anwendung ihrer Methode in ihren vollständigen Inhalt zu entwickeln, oder, wie sie sagten, zum Begriff zu erheben, was zuerst nur in der unvollkommenen Gestalt einer Vorstellung gefasst worden war. Ich will nicht auf die Beurteilung dieser Methode zurückkommen, über deren logische Eigentümlichkeit ich anderswo ausführlich gewesen bin; es reicht hin, hier zu bemerken, dass sie nach dem Geiste der Ansichten, die sich ihrer bedienten, immer nur zur Aufstellung allgemeiner Erscheinungsformen geführt hat, welche in einer Welt nicht fehlen dürfen, die ein vollständiges Abbild der höchsten Idee sein soll; aber sie hat keine Grundsätze aufgefunden, nach denen sich Fragen in Bezug auf die Wechselbedingtheit der einzelnen Elemente lösen lassen, durch welche in jedem Falle die Verwirklichung jener Formen vollkommen oder unvollkommen erreicht wird. Es wäre denkbar, zu diesem anderen Zwecke die Methode umzuformen; denn ihre wesentliche Tendenz, Aufklärung unklarer Begriffe, wird allenthalben Gelegenheit zu ihrem Gebrauch geben; allein sie würde in dieser Umformung den wirksamsten Teil der Eigentümlichkeit verlieren, durch welche sie einst bezauberte. Ihr Reiz bestand darin, dass sie in einer Reihenfolge von Anschauungen, die sie auseinander entwickelte, uns unmittelbar der eigenen inneren Bewegung des Weltinhaltes zusehen lassen wollte und jene Arbeit des diskursiven Denkens ausschloss, die durch Benutzung der mannigfachsten Hilfsmittel des Beweises sich auf Umwegen eine Gewissheit zu verschaffen sucht. Mit solchen Ansprüchen kann im Grunde die Methode nur eine Form des darstellenden Verfahrens sein, welches bereits gefundene Wahrheiten in derjenigen Reihenfolge entwickelt, die man nach vieler anderweitigen Denkarbeit als ihre eigene und natürliche Systematik erkannt zu haben glaubt; soll sie dennoch zugleich als eine Form der ersten Auffindung der Wahrheit angewandt werden, so ist dies bedenkliche Verfahren in der Tat nur in Bezug auf jene allgemeinen und stabilen Formen der Ereignisse und der Erscheinungen einigermaßen ausführbar, in denen wir eine objektive Entwicklung des Weltinhaltes oder seiner Idee zu sehen Grund haben. Von den allgemeinen Gesetzen aber, welche die Verwirklichung aller dieser Formen gleichmäßig beherrschen, können wir nicht wohl annehmen, dass sie auch für sich selbst ein System bilden, in welchem ein zweifelloser Anfangspunkt eine stetig fortschreitende Entwicklungsreihe eröffnete; nicht der Sache können wir hier eine objektive, sondern nur unsern Gedanken über die Sache eine subjektive Entwicklung zuschreiben. Die dialektische Methode würde sich daher in jene einfachere Dialektik, sagen wir noch einfacher: in jene Überlegung überhaupt umwandeln müssen, welche beständig die anfänglichen Gedanken, die wir über Natur und Zusammenhang des Wirklichen hegen, untereinander und mit allen den Bedingungen vergleicht, welche über ihre Richtigkeit zu urteilen erlauben, und welche die dann bemerkten Widersprüche oder Unvollkommenheiten durch bessere Bestimmungen zu ersetzen sucht. Nichts ist natürlicher und bekannter als diese Verfahrungsweise; aber es ist auch offenbar, dass sie weder den Ausgangspunkt der Betrachtungen noch im Einzelnen die Art des Fortschrittes von selbst vorausbestimmt.
XII. Andere Versuche zur Auffindung eines Leitfadens sind von einem klassifikatorischen Gedanken ausgegangen. Es liegt ein natürlicher Reiz in der Annahme, nicht nur der Weltinhalt werde ein in irgendwelcher Weise der Symmetrie geordnetes und abgeschlossenes Ganze bilden, sondern auch die Vernunft, welche zu seiner Erkenntnis bestimmt ist, besitze eine gegliederte und abgeschlossene Anzahl von angeborenen Auffassungsweisen, deren sie sich zur Erfüllung dieses Zweckes bediene. Auf dem letzten Teil dieses Gedankens wenigstens beruhte der Versuch Kants, durch Vervollständigung der Aristotelischen Kategorienlehre die Summe der uns denknotwendigen Wahrheit zu finden. So wie Aristoteles selbst seine Kategorien hinstellte, als Sammlung der allgemeinsten Prädikate, unter welche alles subsummierbar sei, was wir von denkbarem Inhalt aussagen können, haben sie niemals irgend einen ernsthaften philosophischen Gebrauch zugelassen; sie haben höchstens daran erinnert, nach welchen Gesichtspunkten sich über vorkommende Gegenstände der Untersuchung Fragen aufstellen lassen; die Antworten lagen immer anderswo; sie konnten auch natürlich nicht in Begriffen, sondern nur in Grundsätzen liegen, welche diese Begriffe so oder anders anzuwenden geboten. Die vervollständigte Kategorientafel Kants unterliegt zunächst demselben Mangel; aber er hat ihn zu beseitigen gesucht, indem er wirklich von ihnen zu den Verstandesgrundsägen überging, die er in den Kategorien nur zu einem begrifflichen Ausdruck zusammengezogen und daher aus ihnen wieder herstellbar glaubte. Gegen Begründung und Erfolg dieses geistreichen Versuchs schweben mancherlei Bedenken. Kant tadelte, dass Aristoteles seine Kategorien ohne ein Prinzip aufgestellt habe, das für ihre Vollständigkeit bürge; es hat anderseits nicht an Nachweisen für die Vortrefflichkeit der Einteilungsgründe gefehlt, denen Aristoteles gefolgt sei. Ich glaube nicht, dass Streit hierüber ein Ergebnis haben könne. Wenn man eine Mannigfaltigkeit von noch unbekanntem Umfang nicht bloß dichotomisch in M und Non-M, sondern endlich doch in lauter positive Glieder M N O P Q auflösen will, so gibt es niemals eine methodische Bürgschaft für die Vollständigkeit dieser Disjunktion; man muss eigentlich immer ein Restglied R hinzudenken, von dem man nur weiß, es sei verschieden von allen vorigen; wer die Vollständigkeit der Disjunktion rühmt, sagt bloß, er wisse seinerseits kein neues Glied R hinzuzufügen; wer sie leugnet, behauptet, ihm sei noch ein R eingefallen, welches mit gleichem Recht hierher gehöre. Aristoteles mag daher immerhin schöne Einteilungsgründe gehabt haben; sie beweisen aber nicht, dass er alle Glieder bemerkt habe, die unter sie gehören. Dasselbe gilt aber gegen Kant auch. Man mag ihm zugeben, dass wir nur in der Form des Urteils die Denkhandlungen vollziehen, durch welche wir irgend Etwas von dem Wirklichen behaupten; gibt man noch weiter zu, es werde mithin ebenso viele verschiedene Urbehauptungen dieser Art geben, als es wesentlich verschiedene logische Formen des Urteils gibt, so lässt sich eigentlich nie methodologisch die Anerkennung erzwingen, diese verschiedenen Urteilsformen seien vollständig gefunden worden. Man wird es zugeben, sobald man sich befriedigt fühlt und Nichts weiter hinzuzufügen weiß; und wenn diese Zustimmung allgemein wäre, so wäre ja die Sache praktisch erledigt: denn jedes Inventar muss für vollständig gelten, wenn die, die an seiner Vollständigkeit Interesse haben, durchaus Nichts mehr entdecken, was hinzuzufügen wäre; nur jene Art theoretischer Bürgschaft, welche Kant für unbedingte Vollständigkeit suchte, ist etwas an sich Unmögliches. Doch dies sind logische Bedenken, die hier nicht viel entscheiden; wichtiger ist mir, dass man eben das Zugeständnis gar nicht machen darf, von welchem wir eben ausgingen. Die logischen Formen des Urteils werden auf jeglichen Inhalt, auf das bloß Denkbare wie auf das Wirkliche, auf Zweifelhaftes und Unmögliches ebenso wie auf Gewisses und Mögliches angewandt; man hat daher gar keine Sicherheit dafür, dass alle die verschiedenen Formen, die dem Denken zu diesem weitläufigen Gebrauche unentbehrlich sind, auch gleich bedeutungsvoll für seine beschränktere Anwendung auf das Wirkliche sein müssten; so weit aber ihre Bedeutung sich in der Tat auch auf dieses Gebiet erstreckt, könnte sie doch nicht in ihrer ganzen Bestimmtheit aus jener allgemeinen Form herausgelesen werden, in welcher sie sich auch auf das Nichtwirkliche bezog. Die kategorische Urteilsform lässt völlig unentschieden, ob ihr Subjekt, dem sie sein Prädikat hinzufügt, ein mit sich identischer einfacher Denkinhalt oder ein Ganzes ist, das jeden seiner Teile besitzt, oder eine Substanz, die Zustände zu erfahren fähig ist; die hypothetische unterscheidet nicht, ob die Bedingung, welche ihr Vordersatz enthält, Grund einer Folge, oder Ursache einer Wirkung oder der bestimmende Zweck ist, aus welchem der Inhalt des Nachsatzes als notwendige Vorbedingung der Erfüllung fließt. Aber eben diese verschiedenen Begriffe, die hier in gleicher Form auftreten, sind für die Behandlung des Wirklichen von verschiedener Wichtigkeit; die metaphysische Bedeutung der Kategorien ist daher auch für Kant doch eigentlich nur der Gegenstand eines glücklichen Erratens und beruht auf sachlichen Nebenerwägungen, zu denen die systematische Aufstellung jener logischen Formen nur äußerliche Veranlassungen gegeben hat. Nur diese Nebengedanken haben unter Kants Händen den Kategorien einen Anschein der Wichtigkeit und Fruchtbarkeit gegeben, die diesem oft hervorgesuchten philosophischen Spielzeug nicht gebührt. Auch dieser methodische Umweg gibt mithin keine größere Sicherheit, als wenn wir uns unmittelbar in den Kampf mit der Sache einlassen.
XIII. Dies zu tun ermutigt uns nun die Erinnerung, dass es ja nicht gilt, ein unbekanntes Land zum ersten Male in Besitz zu nehmen; eifrige Bestrebungen von Jahrhunderten haben längst die Gegenstände unserer Betrachtung auseinandergestellt und die Fragen über sie gesammelt, die der Beantwortung bedürfen; in Bezug auf die großen Einteilungen unserer Arbeit hatten auch sie kaum etwas zu tun als zu wiederholen, was Jeden von Neuem seine eigene Welterfahrung lehrt. Natur und Geist sind die beiden Gebiete, deren für den ersten Anblick unvergleichbare Verschiedenheit zwei gesonderte Betrachtungen verlangt, jede den wesentlichen Charakteren gewidmet, durch welche beide sich in sich zusammenschließen und voneinander abheben; aber dennoch zu beständiger Wechselwirkung als Teile einer Weltordnung bestimmt, nötigen uns beide Reiche, zugleich die allgemeinen Formen eines Zusammenhanges der Dinge zu suchen, denen beide in sich selbst und in ihrer gegenseitigen Verknüpfung zu genügen haben. Es kann scheinen, als müsste die beginnende Wissenschaft auf diesen letztgenannten Teil ihrer Untersuchungen auch zuletzt geführt werden; geschichtlich hat sie dennoch ihn nicht später als jene in Angriff genommen und sich ihm lange mit größerer Ausführlichkeit gewidmet, als bei dem geringen Fortschritt, den sie in jenen machte, ihrem Erfolg förderlich sein konnte. Wie dem auch sei, indem wir zu überlegen suchen, was nach so langen Bemühungen haltbares erarbeitet ist, dürfen wir mit dem beginnen, was der Sache nach das Erste ist, obgleich nicht das Erste im Gange unserer Erkenntnis, mit der Ontologie, welche als eine Lehre vom Sein und Zusammenhange alles Wirklichen der Kosmologie und der Psychologie vorangestellt wurde, den beiden Betrachtungen, die das Wirkliche in seine entgegengesetzten Eigentümlichkeiten verfolgen. Auf diese Gliederung ist, mit wenigen und unbedeutenden Zusätzen oder Weglassungen, aber mit sehr verschiedener Wahl der Benennungen, veranlasst durch die Eigentümlichkeit voreingenommener Standpunkte, jede Bearbeitung der Metaphysik im Wesentlichen zurückgekommen. Dieser Verschiedenheiten schon hier, vor dem Beginn der Sache, weiter zu gedenken, scheint mir ebenso nutzlos, als der Versuch, genauer diejenige Begrenzung unserer Aufgaben zu bestimmen, welche die Metaphysik im Sinne hatte, als sie nur rationale Kosmologie und Psychologie, in leicht begreiflichem Gegensatz zu dem versprach, was nur die Erfahrung hinzufügen zu können schien.
XIV. Es ist kein Zeitraum denkbar, in welchem der Mensch gelebt hätte, noch ohne sich im Gegensatz zu einer umgebenden Außenwelt zu fühlen. Über sich selbst am längsten unklar, fand er dagegen in dieser eine anschaulich eingeteilte Mannigfaltigkeit, über deren Natur und Zusammenhang der Lauf des Lebens ihm bald mancherlei Vorstellungen aufdrängen musste. Denn keine der alltäglichen Unternehmungen zur Befriedigung der Bedürfnisse war ohne die stille Gewissheit möglich, dass freilich unsere Wünsche und Gedanken für sich allein nicht die Macht haben, in dem Bestande der Außenwelt etwas zu ändern, dass aber diese Welt ein Reich durcheinander bestimmbarer Sachen bilde, in welchem die gelungene Änderung des einen Teils einer bestimmten Fortwirkung auf andere sicher sei; keine war ferner ausführbar, ohne auf irgend einen Widerstand zu treffen und durch diesen die Anerkennung einer dunklen Selbständigkeit zu veranlassen, mit welcher die Dinge der Veränderung ihrer Zustände widerstreben. Alle diese Gedanken, so wie diejenigen, welche eine leichte Fortsetzung dieser Überlegungen hinzufügen könnte, waren zunächst nur in Gestalt unbewusster Bestimmungsgründe vorhanden, nach denen sich im Leben Erwartungen und Handlungen richteten; in dieser Form entstehen sie, in fast völlig gleicher Wiederholung, noch jetzt in jedem Einzelnen wieder und bilden die selbstwüchsige Ontologie, mit welcher wir alle im Leben unsere Beurteilung der Ereignisse bestreiten. Zu bewussten Grundsätzen versuchte erst dann das Nachsinnen diese Voraussetzungen zu gestalten, als zugleich das Bedürfnis bemerkbar wurde, Widersprüchen zu entgehen, in welche ihre sorglos fortgesetzte Anwendung auf den erweiterten Inhalt der Weltkenntnis verwickelt hatte. So entstand Philosophie, und in ihr die ontologischen Untersuchungen. In ihrer Reihenfolge nicht unabhängig von der natürlichen Ordnung der aus einander fließenden Fragen, sind diese Untersuchungen doch auch durch zufällige Umstände auf mancherlei Umwege verschlagen worden und haben sehr verschiedene Richtungen genommen und wieder aufgegeben; aber eine Darstellung, welche den Ertrag dieser Bemühungen zu umfassen strebt, braucht nicht diese wandelbare Geschichte zu wiederholen; sie kann unmittelbar an die natürliche Weltauffassung anknüpfen, deren wir eben gedachten, und welche den Lauf der Welt nur verständlich findet unter Voraussetzung einer Vielheit von beständigen Dingen, von veränderlichen Verhältnissen zwischen ihnen, und von Ereignissen, die aus diesen ihren wechselnden gegenseitigen Beziehungen entspringen. Denn eben diese Weltansicht, deren wesentlichen Inhalt wir so zusammenfassen können, erneuert sich, immer sich selbst gleich, zu allen Zeiten und wir alle bequemen uns ihr außerhalb der Schule; wie uns, so hat sie auch allen philosophischen Bestrebungen der Vorzeit als Ausgangspunkt, als Gegenstand der Bestätigung oder Bestreitung vorgelegen; ungleich den auseinanderstrebenden Ansichten der Spekulation verdient sie deshalb, selbst als eine von den Naturerscheinungen zu gelten, die als regelmäßige Bestandteile der Weltordnung die Aufmerksamkeit der Philosophie fesseln. Der Geschichte aber brauchen wir für den Augenblick nur die allgemeine Überzeugung zu entlehnen, dass von den einfachen Gedanken, welche diese Ansicht zusammensetzen, keiner der wissenschaftlichen Feststellung dessen unbedürftig ist, was er meint und meinen darf, um mit allen übrigen zu einem haltbaren Ganzen zusammenzustimmen. Weitläufige Vorbereitungen erfordert die Bestimmung des Ganges nicht, den wir hierzu einzuschlagen haben. Man kann von Verhältnissen und Ereignissen nicht sprechen, ohne die Dinge voranzudenken, zwischen denen sie bestehen oder geschehen sollen; von den Dingen aber, vielen und ungleichen, wie wir meinen, behaupten wir zugleich mit einem Unterschied dessen, was jedes ist, Gleichheit derjenigen Form der Wirklichkeit, die sie zu Dingen macht; von dem einfachen Begriffe dieses Seins haben wir zu beginnen. Dem Fortgang lassen wir seine Freiheit; nicht Alles lässt sich auf einmal sagen; der scheinbar einfache Inhalt der natürlichen Weltansicht, von der wir ausgehen, enthält dennoch verschiedene in einander verwickelte Fäden, von denen der eine nicht verfolgt werden kann, ohne zugleich andere zu rühren, deren eigner Verlauf vorläufig dahin gestellt bleiben muss; deshalb bittet der Anfang unserer Überlegungen, nicht durch Einwürfe gestört zu werden, deren Berücksichtigung die Fortsetzung nicht versäumen soll.
Erstes Kapitel. Vom Sein der Dinge.
1. Einer der ältesten philosophischen Gedanken ist der Gegensatz eines wahrhaften und eines unwahrhaften Seins. Täuschungen der Sinne, welche Unwirkliches für Wirkliches zu nehmen verführten, ließen den Unterschied wahrnehmen zwischen dem, was nur uns erscheint, und dem, was unabhängig von uns ist; Beobachtungen der Dinge lehrten als bedingtes Dasein oder als Folge der Zusammensetzung kennen, was vorher einfach und auf sich beruhend schien; sie fanden unablässiges Werden da, wo man ruhiges sich selbst gleiches Beharren zu sehen gemeint. Bei diesen Gelegenheiten kam zu deutlichem Bewusstsein, was man unter jenem wahrhaften Sein verstanden hatte und nun in den Gegenständen dieser Beobachtungen vermisste: Unabhängigkeit nicht nur von uns sondern auch von allem Anderen, Einfachheit und veränderungsloses Bestehen in sich selbst galten von jeher für seine Kennzeichen. Aber auch nur für Kennzeichen; denn diese Bestimmungen reichen wohl hin, das, wovon sie nicht gelten, von dem wahren Sein auszuschließen; aber das Sein selbst definieren sie nicht. Unabhängigkeit von unserem Vorstellen schreiben wir jeder Wahrheit zu; auch sie gilt an sich, wenn Niemand sie denkt; Unabhängigkeit von allem Anderen behaupten wir nicht von jeder, aber von vielen Wahrheiten, die eines Beweises weder bedürftig noch fähig sind; zusammensetzungslose Einfachheit kommt jeder Einzelempfindung des Rot oder Süß zu, und ruhiges Bestehen in sich selbst, unzugänglich für jede Veränderung, ist recht eigentlich der Charakter jener Ideenwelt, die wir als ewig gültig aber als nicht seiend der Wirklichkeit entgegensetzen. Es fehlt also in den angeführten Bestimmungen des Seins nicht nur überhaupt etwas, was wir gemeint aber nicht ausgedrückt haben, sondern dies Vermisste ist das Wesentlichste dessen, was wir suchen; wir verlangen noch zu wissen, was denn das Sein eben selbst ist, auf welches jene Bestimmungen angewandt werden konnten, um das wahrhafte von einem scheinbaren zu unterscheiden, oder worin jene Wirklichkeit liegt, durch welche ein unabhängig einfach und beharrlich Seiendes sich vor dem unwirklichen Denkbilde desselben unabhängigen einfachen und beharrlichen Inhalts auszeichnet.
2. Nun kann man auf diese Frage eine sehr einfache Antwort versuchen. Es scheint ganz natürlich, das Denken werde durch keines seiner Hilfsmittel, durch keinen Gedanken also, die wesentliche Eigenheit des wirklichen Seins durchdringen und erschöpfen, worin es ja selbst einen Gegensatz zu allem bloßen Gedachtsein findet. Höchstens erleben lasse sich in anderer Weise das wirkliche Sein, und mit Rücksicht auf solche Erlebnisse lasse sich dann noch ein Erkenntnisgrund aussprechen, welcher uns zwar nicht dazu nötig ist, auf die unmittelbar erlebte Gegenwart des wirklichen Seins erst zu schließen, wohl aber uns berechtigt, die Wahrheit dieser erlebten Gegenwart gegen jeden Zweifel aufrecht zu erhalten. Man verzichtet daher darauf, durch Begriffe den Unterschied des wirklichen Seins von seinem eigenen Begriff klarzumachen; aber in der unmittelbaren sinnlichen Empfindung hat man stets den Erkenntnisgrund gesehen, der uns die Gegenwart des wirklichen Seins verbürgt. Auch nachdem die Gewohnheit des Zutrauens zu Beweisen und glaubhaften Mitteilungen sich gebildet hat, werden wir doch jeden entstandenen Zweifel dadurch zu beseitigen suchen, dass wir uns selbst aufmachen, um zu sehen oder zu hören, ob die Dinge sind und die Ereignisse geschehen, von denen man uns berichtet hat, und jeder Beweis beweist die Wirklichkeit seines Schlusssatzes nur, wenn außer der Richtigkeit seiner logischen Verkettung nicht bloß die Denkwahrheit seiner ersten Prämissen sondern auch die zuletzt nur durch sinnliche Wahrnehmung gegebene Wirklichkeit ihres Inhalts feststeht. Es mag sein, dass auch die Empfindung zuweilen täuscht und Unwirkliches für Wirkliches gibt; dennoch ist für Wirklichkeit kein Zeugnis möglich außer ihr, da wo sie nicht täuscht; es mag ebenso zu bedenken bleiben, ob die Empfindung uns das Wirkliche sehen lässt, so wie es ist; nur dass wirklich Seiendes ihr zu Grunde liegt, davon scheint sie uns zu überzeugen. Ich lasse beide Einwürfe jetzt dahingestellt; aber an den zweiten knüpft sich allerdings eine Schwierigkeit, deren wir sogleich zu gedenken haben.
3. Den Inhalt einfacher Empfindungen können wir von dem Empfinden derselben nicht so trennen, dass von beiden, nach ihrer Trennung, uns gesonderte und in sich vollständige Anschauungen übrigblieben: weder Rot Süß und Warm können wir so vorstellen, wie sie sein würden, wenn sie nicht empfunden würden, noch das Empfinden, wie es sein würde, wenn es keinen dieser einzelnen Inhalte empfände. Die Verschiedenheit der empfindbaren Inhalte und die anschauliche Bestimmtheit jedes einzelnen derselben erleichtern uns indessen doch den Versuch, den wir alle machen, das sachlich Untrennbare in Gedanken zu sondern: was wir empfinden, dies wenigstens erscheint uns unabhängig von unserer Empfindung als ein Etwas, dessen selbständige Natur von dem Empfinden nur anerkannt und aufgefunden wird. Nicht eben so leicht gelingt es, den anderen Bestandteil zu sondern, eben jenes Sein, welches uns von diesem Inhalt die wirkliche Empfindung, im Gegensatz zu der bloßen Erinnerung oder Vorstellung desselben versichern wollte. Es kann nicht schon in eben dieser einfachsten Bejahung oder Setzung liegen, die wir den empfindbaren Inhalten zuschrieben und durch die jeder das ist was er ist und von anderen sich unterscheidet; durch diese Bejahung ist das Bejahte nur gültig als ein Bestandteil der Welt des Deutbaren, aber es ist deshalb noch nicht wirklich, weil es in diesem Sinne Etwas und nicht ein bestimmungsloses Nichts ist; durch sie ist Rot ewig Rot und verwandt dem Gelb, nicht verwandt dem Warm oder Süß; aber diese Identität mit sich selbst und diese Verschiedenheit von Anderem gilt von dem unempfundenen Rot ebenso wie von dem empfundenen, und doch nur von dem letzteren sollte die Empfindung bezeugen, dass es sei. Außer jener einfachsten Bejahung aber ist den verschiedenen Empfindungsinhalten, abgesehen von dem Empfinden, welches sie auffasst, Nichts gemeinsam; versichern wir daher von ihnen, sofern sie empfunden werden, ein Sein, das von dieser Bejahung verschieden ist, so ist dies Sein Nichts, was an der Natur des empfundenen Inhalts haftend von dem Empfinden nur anerkannt und aufgefunden würde; es liegt vielmehr gänzlich in dem Empfundenwerden selbst, dem einzigen Unterschiede zwischen der wirklichen Empfindung des gegenwärtigen und der bloßen Vorstellung des abwesenden Inhalts. Nicht also, wie wir es anfangs dachten, ein bloßer Erkenntnisgrund des wirklichen von ihr selbst noch verschiedenen und in seiner Eigentümlichkeit noch angebbaren Seins wäre die Empfindung, sondern das Sein, das wir auf ihr Zeugnis hin den Dingen zuschreiben, bestände in gar nichts anderem als darin, dass sie empfunden werden.
4. Gleichwohl ist diese Behauptung nur auf Standpunkten fortgeschrittener Überlegung gewagt worden, die wir später erreichen werden; die ursprüngliche Weltauffassung entzieht sich dieser Folgerung entschieden. Empfindung sei allerdings der einzige Erkenntnisgrund, der uns vom Sein überzeuge, und. eben weil sie der einzige sei, entstehe der Irrtum leicht, was sie allein zeigen könne, bestehe auch nur in ihr; in der Tat sei das Sein jedoch unabhängig von seinem Erkanntwerden durch uns, und alle Dinge, von deren Wirklichkeit uns freilich nur die Empfindung belehre, werden fortfahren zu sein, wenn unsere Aufmerksamkeit sich von ihnen abkehrt und sie aus unserem Bewusstsein verschwinden. Nichts scheint nun selbstverständlicher als diese Behauptung, der wir ja alle beipflichten; dennoch muss die Frage sich wiederholen, was wir denn unter dem Sein der Dinge dann noch verstehen, wenn wir die einzige Bedingung aufheben, unter der es uns erkennbar wird? Die Dinge standen vor uns als Gegenstände unserer Empfindung und hierin allein bestand doch zunächst das, was wir ihr Sein nannten; was kann von ihm übrigbleiben, wenn wir von unserem Empfinden absehen? Was meinen wir eigentlich von den Dingen behauptet zu haben, wenn wir von ihnen sagen, dass sie seien ohne empfunden zu werden? oder was tritt dann, für die Dinge selbst, als Beweis Bekräftigung und Bedeutung ihres Seins an die Stelle der Empfindung, welche für uns Beweis Bekräftigung und Bedeutung desselben war? Ich werde die eigentliche Meinung dieser Fragen deutlicher machen, wenn ich zu den Antworten übergehe, welche auf sie die natürliche Weltansicht gibt; denn auch sie sucht allerdings die Ergänzung, welche wir vermissen. Sie findet sie zunächst darin, dass die Empfindung Anderer an die Stelle der hinwegfallenden unsrigen tritt: die Menschen, welche wir verlassen, werden im Verkehr bleiben mit Anderen; Orte und Gegenstände, von denen wir uns entfernen, werden von Anderen gesehen werden, wie bisher von uns; darin besteht ihr Beharren im Sein, während sie aus unserem Empfinden verschwunden sind; ich glaube wenigstens, dass jeder von uns in sich eine Spur dieser ersten Vorstellungsweise finden wird, durch die wir unsere Frage freilich mehr hinausschieben als beantworten. Denn allerdings wiederholt sie sich sogleich: von jedem Bewusstsein eines Empfindenden sollte das Sein unabhängig sein; was ist es nun dann, wenn aus der ganzen Welt das Bewusstsein ausgelöscht und Niemand mehr vorhanden ist, der die Dinge erkennen könnte? Dann, antworten wir, werden sie doch noch immer unter einander in den Verhältnissen stehen, in denen sie standen, als sie Gegenstände der Wahrnehmung waren; jedes wird seinen Ort im Raume haben oder doch ihn wechseln; jedes wird von dem anderen Einflüsse zu erleiden oder auf andere deren auszuüben fortfahren; in diesen Wechselwirkungen wird das bestehen, woran die Dinge ihr von aller Beobachtung unabhängiges Sein besitzen. Über diese Vorstellungsweise kommt die natürliche Ansicht der Dinge kaum jemals hinaus; was an ihr unbefriedigend ist und worin sie Recht hat, versuchen wir jetzt zu überlegen.
5. Mit Unrecht erscheint sie in einem Punkte mangelhaft, über welchen sie nur eine ausschweifende Frage nicht beantworten kann, die wir uns entwöhnen müssen überhaupt aufzuwerfen. Alle jene Verhältnisse nämlich, in denen wir eben die Wirklichkeit der Dinge suchten, lassen sich ebenso wohl als unwirkliche wie als wirkliche vorstellen; aber sie müssen selbst wirklich sein und nicht bloß vorgestellt werden, wenn sie das Sein der Dinge und nicht bloß die Vorstellung dieses Seins ausmachen sollen. Worin besteht nun oder wie entsteht diese Wirklichkeit dessen, was an sich nur denkbar ist? Dass nun diese Frage unbeantwortbar und in sich widersprechend ist, bedarf keines ausführlichen Beweises: worin es eigentlich liegt und wie es zugeht, oder gemacht wird, dass überhaupt etwas ist und nicht lieber Nichts ist und dass überhaupt etwas geschieht und nicht lieber Nichts geschieht, dies wird ewig unsagbar bleiben. Denn in der Tat, in welcher Form der Frage wir auch immer diese Neugier ausdrücken wollten, immer würden wir deutlich die Voraussetzung machen, derjenigen Wirklichkeit zuvor, welche wir erklären wollen, gebe es doch schon eine zusammenhängende Wirklichkeit, in welcher aus bestimmten Gründen bestimmte Folgen und unter ihnen auch diese zu erklärende Wirklichkeit fließen müsse. Und dies keineswegs nur so, wie etwa eine Wahrheit als Folge aus anderen entspringt, mit denen sie doch immer zugleich in ewiger Gültigkeit bestand, sondern ausdrücklich so, dass Wirkliches, vorher selbst unwirklich, aus anderem Wirklichen entstände. Alles mithin, was wir in der gegebenen Wirklichkeit finden, das Geschehen von Ereignissen, die Veränderung bestehender Verhältnisse, das Dasein von Beziehungspunkten, zwischen denen diese stattfänden, Dies alles müssten wir bereits voraussetzen, um die Entstehung der Wirklichkeit begreiflich zu machen. Diesen offenbaren Zirkel hat die gewöhnliche Ansicht vermieden und sie hat ihrerseits keinen anderen dadurch begangen, dass sie die Wirklichkeit des Seins der Dinge auf die Wirklichkeit der Verhältnisse zurückführte, in deren Fortbestand sie den Sinn dieses Seins zu finden glaubte. Denn ihre Absicht konnte nicht sein, diesen allgemeinsten Begriff der Wirklichkeit zu zergliedern, dessen Bedeutung nur in der Empfindung erlebbar ist; sie konnte nur nachweisen wollen, was innerhalb dieses gegebenen Wunders der Wirklichkeit als das Sein der Dinge zu fassen und von anderen Beispielen derselben Wirklichkeit, von dem Bestehen der Verhältnisse selbst und von dem Geschehen der Ereignisse zu unterscheiden sei. Nur ob sie in diesem letzten Bestreben zum Ziel gekommen sei, bleibt die Frage.
6. Die Philosophie ist sehr einmütig in der Verneinung derselben gewesen. Denn wie wollen wir über jene Verhältnisse denken, in deren Bestehen wir das Sein der Dinge finden möchten? Sind sie nur Erzeugnisse willkürlicher Kombinationen, in denen unser Vorstellen die Dinge zusammenbringt, so würden wir unsern Zweck sowohl dann verfehlen, wenn die Dinge sich nach dieser unserer Willführ richteten, als dann, wenn sie es nicht täten. Wir würden im ersten Falle das von uns unabhängige Sein nicht finden, das wir doch suchten; der zweite würde uns noch deutlicher machen, dass in dem Sein der Dinge etwas liegen muss, was unsere Definition dieses Seins noch nicht umfasste: eben das, wodurch sie im Stande find für sich zu sein und durch unsere veränderliche Auffassung ihres Seins nicht mit verändert zu werden. Gewiss verlangen wir daher, dass jene Verhältnisse, die wir voraussetzen, zwischen den Dingen selbst bestehen, auffindbar für unser Vorstellen, aber nicht von ihm erzeugt oder abhängig. Je mehr wir jedoch auf diese objektive Wirklichkeit der Verhältnisse dringen, umso deutlicher machen wir das Sein jedes Dinges abhängig von dem Sein der anderen. Keines kann seinen Ort haben zwischen den übrigen, wenn diese nicht da sind, um es zwischen sich zu nehmen; keines kann wirken oder leiden, ehe die anderen da sind, mit denen es Eindrücke austauschen soll; allgemein: damit irgend ein Verhältnis bestehe, scheinen zuerst die Beziehungspunkte, zwischen denen es stattfinden soll, in unabhängiger Wirklichkeit feststehen zu müssen; ein Sein der Dinge, völlig auf sich beruhend und eben durch diese Selbständigkeit Grund der Möglichkeit anzuknüpfender Verhältnisse, muss jedem als wirklich anzunehmenden Verhältnisse vorausgedacht werden. Dies ist das reine Sein, welches die Philosophie so oft gesucht hat; sie stellt es, von gleicher Bedeutung für alle Dinge, dem empirischen Sein gegenüber, welches, aus den verschiedenen eingegangenen Verhältnissen entsprungen, für jedes zweite Ding ein anderes ist, als für das dritte, und welches sie als eine später kommende Folge aus dem reinen Sein irgendwie abzuleiten hofft.
7. Ich möchte nun zeigen, dass die Hoffnung auf diesen metaphysischen Gebrauch des Begriffes vom reinen Sein eine Täuschung ist, und dass die natürliche Weltansicht, welche nicht von ihm spricht, hier der Wahrheit näher ist als dieser Anfang der Spekulation. Von jedem Begriff, der eine fruchtbare Verwendung zulassen soll, muss man verlangen, dass er das, was mit ihm gemeint ist, deutlich von dem zu unterscheiden erlaube, was mit ihm nicht gemeint ist. Solange wir das Sein der Dinge in der Wirklichkeit von Verhältnissen suchten, in welchen sie zu einander stehen, so lange besaßen wir an diesen Verhältnissen dasjenige, durch dessen Bejahung sich das Sein des Seienden von dem Nichtsein des Nichtseienden unterscheidet; je mehr wir aus dem Begriffe des Seins jeden Gedanken einer Beziehung entfernen, in deren Bejahung es bestände, um so mehr verschwindet die Möglichkeit dieser Unterscheidung. Denn an feinem Orte zu sein und keinen Platz in dem Zusammenhange anderer Dinge zu haben, von keinem eine Einwirkung zu erleiden und an keinem sich durch Ausübung irgendeiner Wirksamkeit zu verraten: diese Beziehungslosigkeit ist genau das, worin wir das Nichtsein eines Dinges finden würden, wenn wir den Vorsatz hätten, es zu definieren. Es kann nicht helfen, einzuwerfen, dass nicht dies Nichtsein, sondern das Sein gemeint war; denn daran zweifeln wir ja gar nicht, dass nur auf das letztere die Absicht unserer Definition ging; erreicht aber ist diese Absicht nicht, solange dieselbe Definition das Gegenteil dessen mit umfasst, was wir durch sie umfassen wollten. Man wird freilich fortfahren, auch diesen Vorwurf zurückweisen zu wollen: wenn man, ausgehend von der Vergleichung des mannigfaltigen empirischen Seins, alle die Verhältnisse weglasse, auf denen die Unterschiede desselben beruhen, so bleibe als reines Sein nicht die bloße Beziehungslosigkeit, sondern dasjenige zurück, dem diese Beziehungslosigkeit selbst nur als Prädikat dient, und das, auf sich beruhend und selbständig, sich durch diesen schwer zu bezeichnenden positiven Zug stets von dem Nichtsein unterscheide. Allerdings pflegen wir von dem Nichtseienden oder dem Nichts diese und ähnliche Ausdrücke nicht zu brauchen, aber eigentlich doch mit Unrecht, so lange wir sie doch auf jenes reine Sein anwenden; verständlichen Sinn haben sie alle nur, weil wir bereits in dem Gedanken an mannigfache Verhältnisse leben, innerhalb deren das Seiende Gelegenheit hat, durch ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, was seine Selbständigkeit und sein Beruhen auf sich selbst bedeutet; lassen wir diesen Nebengedanken fallen, so können alle jene Ausdrücke in der völligen Leere ihrer Bedeutung, der sie dann anheimfallen, unbedenklich auf das Nichts ebenso gut wie auf das Seiende angewandt werden, denn in der Tat, Unabhängigkeit von allem Anderen, Beruhen auf sich selbst und völlige Beziehungslosigkeit gilt von ihm nicht minder als von jenem.
8. Man wird ungeduldig entgegnen, es bleibe doch ewig der Unterschied, dass das beziehungslos Seiende sei und das gleich beziehungslos Nichtseiende nicht sei; unsere spitzfindige Erörterung aber widerspreche bloß dem, was wir selbst bereits zugestanden hatten. Denn was Sein, im Sinne der Wirklichkeit und im Gegensatz zum Nichtsein bedeute, sei eben undefinierbar und nur zu erleben; die so gewonnene Erkenntnis setze den Begriff vom reinen Sein, als den