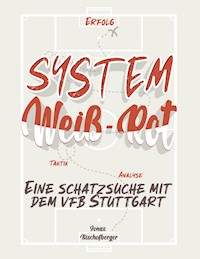
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der VfB Stuttgart hat ein bewegtes Jahrzehnt hinter sich - zwei Abstiege, zwei Aufstiege, 14 Cheftrainer in sieben Jahren. In dieser Zeit war der VfB außergewöhnlich vielschichtigen Einflüssen ausgesetzt. "System Weiß-Rot" arbeitet die taktische Entwicklung des VfB unter diesen Einflüssen auf. Es analysiert die Ideen, Erfolge und Niederlagen seiner Trainer und Spieler: von Bruno Labbadia bis Pellegrino Matarazzo, von Vedad Ibisevic bis Sasa Kalajdzic, von Pressing bis Positionsspiel. Nach einer wendungsreichen, aber keinesfalls beliebigen Reise gehört der VfB inzwischen zu den am besten geführten Fußballvereinen Deutschlands. Seine Entwicklung ist geprägt von tiefgreifenden Prinzipien des Erfolgs und des Lebens. Kommen Sie mit auf eine Schatzsuche, nach der Sie den VfB Stuttgart, den Fußball und vielleicht sogar die Welt mit anderen Augen sehen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
© 2022 Jonas Bischofberger
Cover: Gina Güllich (@gina.letters)
Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt
ISBN: 978-3-7568-3543-0
INHALT
Intro: Auf Schatzsuche
System Rot
Saison 13/14
Bruno Labbadia: Die Grenzen des Wirrwarrs
Thomas Schneider: Ketten, Schere, Sichel
Huub Stevens: Mauern mit Stil
Saison 14/15
Armin Veh: Zurück zu den Blättern
Huub Stevens: Eine komplizierte Rettungsmission
Saison 15/16
Alexander Zorniger: Rasenball-Style
Jürgen Kramny: Schloss aus Glas
System Weiß
Saison 16/17
Jos Luhukay: Das Missverständnis
Olaf Janßen: Umstellungsmagier
Hannes Wolf: Geister und Bauklötze
Saison 17/18
Hannes Wolf: Rote Fäden
Tayfun Korkut: Wann hörst du auf zu fragen?
Saison 18/19
Tayfun Korkut: Kurzsichtig
Markus Weinzierl: Gefangen im Nullsummenspiel
Nico Willig: Bilder sagen mehr
System Weiß-Rot
Saison 19/20
Tim Walter: Revolution durch Rotation
Pellegrino Matarazzo: Vom Prinzip der Prinzipien
Saison 20/21
Pellegrino Matarazzo: Jenseits der Singularität
Outro: Was im Kern übrig bleibt
Zum Ende
Danke!
SPIELERPORTRAITS
Vedad Ibišević: Knipser und Gestalter
Gotoku Sakai: Creative Leader
Christian Gentner: Im Trugbild der Mitte
Daniel Didavi: Wenn alles angerichtet ist
Timo Werner: Ausbrecher
Benjamin Pavard: Im Stile eines Weltmeisters
Emiliano Insúa: Schräg im Mittelpunkt
Santiago Ascacíbar: Ethos
Timo Baumgartl: Der Fels in der Brandung
Marc Oliver Kempf: Lässiger Draufgänger
Wataru Endo: Der Mann aus der Matrix
Saša Kalajdžić: Zwischen den Schubladen
Intro: Auf Schatzsuche
Der VfB Stuttgart ist kein Fußballverein wie jeder andere. Und ich sage das nicht nur, weil ich selbst Fan des VfB bin! Einerseits kann jeder ungefähr sagen, wofür dieser Verein steht: Schlagworte wie Tradition, regionaler Bezug und Jugendarbeit sind schnell in den Ring geworfen. Gleichzeitig scheint der VfB nicht so einfach zu erklären und auf den Punkt zu bringen wie manch anderer Verein.
Vom VfB abgrenzen lassen sich zum einen durchoptimierte Emporkömmlinge mit überschaubarer Kontur wie die TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Dann gibt es die traditionsreichen Topteams, die der übrigen Liga ihre Vorgehensweise aufzwingen. Das macht vor allem der FC Bayern mit seiner „Mia-san-mia“-Transfer- und Ballbesitzstrategie, aber auch Borussia Dortmund seit den Erfolgen unter Jürgen Klopp. Am anderen Ende der Nahrungskette nisten sich die fleißigen, ambitionslosen Underdogs ein: Teams wie Mainz 05 und der SC Freiburg.
Der VfB Stuttgart befand sich schon immer irgendwo zwischen der zweiten und der dritten Kategorie: Nie stark genug, um die Liga zu prägen, aber nie so schwach, um sich von ihr prägen zu lassen. Zwischen den Zwängen gleitet der VfB als freies Radikal durch die deutsche Fußballlandschaft.
Sein schwer zu greifender Status füllt den VfB Stuttgart mit einem besonderen Geist, der mich von Beginn an gepackt hat, ohne mir anfangs bewusst zu sein. Im letzten Jahrzehnt führte dieser Geist den Verein scheinbar zielsicher dorthin, wo er heute steht. Für mich macht er den VfB zu etwas ganz Besonderem, etwas Größerem als nur einem Fußballverein.
Der Neugier entlang
Von dieser Erkenntnis war ich noch weit entfernt, als ich vor beinahe zehn Jahren begann, mich mit fußballtaktischen Themen rund um den VfB Stuttgart zu beschäftigen. Getrieben war dieses Interesse von dem Wunsch, zu verstehen, was hinter den Kulissen passiert: Warum gewinnt Mannschaft A statt Mannschaft B? Warum zeigen manche Spieler tolle Leistungen, während andere ihr Potential nicht ausschöpfen können? Und was wären die Hebel, um daran etwas zu ändern?
Wer sich Fragen wie diese stellt, landet zwangsläufig bei dem etwas unscharfen Sammelbegriff der „Taktik“. Dampft man den Begriff auf seine Essenz ein, geht es um den genauen Blick auf das, was auf dem Fußballfeld passiert. Nur hier materialisieren sich in letzter Instanz die Gründe für Sieg und Niederlage. Es gilt der alte Spruch: „Entscheidend ist aufm Platz“. Folglich bestand die ursprüngliche Idee dieses Buches darin, die Erkenntnisse aus einem knappen Jahrzehnt VfB-Taktikanalyse nachzuerzählen und daraus abzuleiten, was diesen Verein im tiefsten Inneren ausmacht. Vordergründig ist das auch der Leitfaden, der Sie durch dieses Werk führen wird.
Die Entdeckung
Die meisten Geschichten in diesem Buch sind Geschichten des Scheiterns. Es ist gar nicht so lange her, Mitte der 2000er-Jahre, da gehörte der VfB Stuttgart noch zu den erfolgreichsten Fußballmannschaften Deutschlands. Mit den jungen Wilden stürmte der Verein an die Spitze der Bundesliga und mischte die Champions League auf. Doch darauf folgte eine lange Durststrecke, begleitet von zwei Abstiegen in die Zweitklassigkeit.
Der VfB ist nicht das einzige Bundesliga-Schlachtross, das in den letzten zehn Jahren ins Taumeln geriet: Vereine wie Schalke 04, der Hamburger SV und der 1. FC Kaiserslautern leisten ihm tragische Gesellschaft. Doch im Gegensatz zu diesen Clubs scheint der VfB sein inneres Zen inzwischen wiederentdeckt zu haben. Nach dem Wiederaufstieg 2020 erlebte der Verein eine ruhige Bundesligasaison auf Platz neun. Noch mehr Lob als für seine Endplatzierung erntete der VfB für seine entschiedene Jugendstrategie und seinen offensiven Spielstil. Die meisten Beobachter teilen den Eindruck, dass sich dieser Verein wieder in eine positive Richtung entwickelt.
In den letzten Jahren hat sich etwas tiefgreifend verändert beim VfB Stuttgart. Der Schlüssel zu dieser Wende war kein einzelner Trainer, Sportdirektor oder Präsident. Keine Fußballtaktik, keine Transferstrategie, keine Scoutingphilosophie. Sondern die Entdeckung universeller, mächtiger Prinzipien des Erfolgs, des Lernens und des Lebens. Um diese Prinzipien zu verstehen, müssen wir uns selbst auf Schatzsuche begeben.
Wir steigen ein im Sommer 2013, nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale. Zu jener Zeit spielte der VfB Stuttgart kreativen und kämpferischen, aber auch etwas einfältigen Fußball. Der Verein steckte mitten in einer langen Ära, die Trainer wie Armin Veh und Bruno Labbadia prägten. Ich fasse ihre Fußballphilosophie unter dem Namen „System Rot“ zusammen. Sie brachte dem VfB die Meisterschaft 2007, aber auch den Abstieg 2016.
Der bittere Absturz in die zweite Liga erwies sich als reinigendes Gewitter. Er erschütterte die Grundfeste des Vereins und schuf Raum für Neues. Auf dem Platz verdrängten Plan, Organisation und Rationalität den vorherrschenden emotionalen Ton. Visionäre und Taktiker übernahmen in Stuttgart das Ruder. Ihr „System Weiß“ brachte den VfB kurzfristig auf Kurs. Doch es dauerte nicht lange, bis ihr Hochmut ihnen und dem Verein zum Verhängnis wurde.
Alles fügte sich schließlich 2019, im Jahr des zweiten Abstiegs. Es begann eine erfolgreiche Phase der Versöhnung, die ich unter dem Begriff „System Weiß-Rot“ zusammenfasse.
Vielleicht haben Sie nach dieser Schilderung bereits eine Vorahnung, nach welchem Schatz wir gemeinsam suchen werden.
System Rot
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
– Hermann Hesse
Im ersten Moment ist nichts, und dann auf einmal alles. Schicksalhaft bricht die Magie des Anfangs herein, etwa als Schmetterlinge im Bauch, wenn man sich frisch verliebt, als Staunen über die brillante erste Szene eines Films, oder als Ehrfurcht, wenn man zum ersten Mal die Wucht eines vollen Stadions spürt. Wie ein kleiner Urknall entsteht jeder Anfang spontan aus dem Nichts. Man kann ihn weder erklären noch erzwingen.
So war auch der Fußball in seinen Anfängen ein zwangloses, intuitives und mysteriöses Spiel. Ohne festgeschriebenes Regelwerk, Systeme oder Strukturen regierte ein rätselhaftes Chaos die allerersten Fußballspiele. Bis die Mannschaften begannen, ihre Kräfte zu bündeln und systematisch als Team zusammenzuarbeiten. Sie entwickelten taktische Prinzipien, Formationen und Deckungssysteme.
Gleichwohl verdrängten diese Organisationsformen noch nicht den intuitiven Geist des Fußballs. Im Gegenteil: Bis vor 10, 20 Jahren besetzten vorwiegend Ex-Profis, Motivatoren und Disziplinfanatiker die Trainerbänke im Spitzenfußball. Taktikfreaks wie Arrigo Sacchi und Valeriy Lobanovskyi waren verstreute Ausnahmeerscheinungen. Kampf, Leidenschaft und individuelle Geistesblitze blieben überwiegend die spielentscheidenden Faktoren.
Der VfB Stuttgart trug länger als viele andere Vereine einen Schimmer dieser urtümlichen Naivität in sich. Der VfB trat seinen Gegnern mit ausgezeichneter Fitness und enormem Einsatzwillen gegenüber. Die Spieler verteidigten aufmerksam, risikobereit und eher gegen den Mann als im Raum, um ihre kämpferische Stärke im direkten Duell in die Waagschale zu werfen.
Kampfgeist ist die eine Seite der Medaille, Kreativität die andere. Es ist kein Zufall, dass der VfB stets über herausragende Spielgestalter im offensiven Mittelfeld verfügte. Denken Sie an Krasimir Balakov, Hansi Müller, Ásgeir Sigurvinsson oder Alexander Hleb. Diese Spieler waren auch deshalb so glanzvolle Erscheinungen, weil sie sich beim VfB Stuttgart kaum durch taktische Vorgaben einschränken mussten. Sie und ihre Mitstreiter durften und mussten Lösungen aus dem Nichts erschaffen. Freiheit, Engagement und Ideenreichtum prägten das Stuttgarter Offensivspiel.
Es dauerte bis zur heutigen Moderne, bis sich die tiefen Risse im primordialen System Rot zeigten. Wie lenkt man das emsige Gewirr auf dem Platz in sinnvolle Bahnen? Wie sorgt man für Ausgewogenheit und Stabilität? Die willkürliche Organisation des Teams zwingt die Spieler regelmäßig in knifflige Drucksituationen, die schnelle, spontane Lösungen verlangen. Je besser der Gegner verteidigt und je weniger Lösungen er anbietet, desto stärker mehren sich Fehler und Misserfolge. Ist die eigene Organisation der des Gegners deutlich genug unterlegen, kann man dieses Gefälle auch durch Kampf und Leidenschaft nicht mehr wettmachen. Wenn dieser Zustand der Unterlegenheit lange genug anhält und die eigene Überzeugung immer wieder an der Realität zerschellt, erodiert irgendwann das Fundament, auf dem man steht.
Kapitelübersicht
Los geht unsere Reise durch die Evolution des VfB Stuttgart mit Bruno Labbadia, der im Sommer 2013 seinen etablierten Fußball auf ein neues Level heben wollte. Labbadias Scheitern leitet über zu Thomas Schneider, der den wilden Stil seines Vorgängers zu zügeln versuchte. Er war ein gewiefter Taktiker, der die Identität des Vereins bewahren und zugleich wandeln wollte. Dieses Kunststück gelang schließlich Huub Stevens, der eine verkorkste Spielzeit mit gewitztem Defensivfußball glimpflich zu Ende brachte.
Zur Saison 2014/15 drehte der Verein die Uhr sieben Jahre zurück: VfB-Meistertrainer Armin Veh, Advokat des schrankenlosen Offensivfußballs, gab sich die Ehre. Seine fünf Monate beim VfB reflektieren beispiellos die Essenz von System Rot – er war die Matryoshka-Figur unter den VfB-Trainern. Auf Veh folgte zum zweiten Mal Huub Stevens, der sich einer vertrackten Rettungsmission gegenüber sah. Dank später Zugeständnisse an das offensive Wesen des Vereins gelang es ihm ein weiteres Mal, den VfB vor dem Gang in die zweite Liga zu bewahren.
Nach dem zweiten blauen Auge begann in Stuttgart schließlich ein Umdenken. Auf der Trainerbank nahm Alexander Zorniger Platz, ein Idealist und Vertreter von extrem offensivem Pressing- und Umschaltfußball. Sein Scheitern lässt sich nacherzählen und auszugsweise erklären, bleibt jedoch im Kern ein Mysterium. Den tristen Schlusspunkt unter System Rot setzt Jürgen Kramny, der dessen größtes Potential und tiefste Abgründe auf einer Haarnadel zusammenbrachte.
Saison 13/14
Bruno Labbadia: Die Grenzen des Wirrwarrs
Ich finde, es ist eine gewisse Grenze erreicht hier. Ich bin vor 22 Monaten hier angetreten, da stand dieser Verein mit zwölf Punkten am Tabellenende. Keiner hat einen Pfifferling drauf gegeben in der Zeit. Danach haben wir die Mannschaft in die Europa League geführt. Wir haben knapp 20 Millionen Euro Etatsenkung mitgemacht. Wir haben einen zweistelligen Millionen-Betrag einnehmen müssen. All diese Dinge. Und ich muss Ihnen sagen, ich kann gewisse Dinge nicht akzeptieren, wenn ein Trainer wie der letzte Depp dargestellt wird, als hätte er gar keine Ahnung. [...] Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
– Labbadias Wutrede im Herbst 2012
Bruno Labbadia hätte in Stuttgart nie einen Publikumspreis abgeräumt, so viel ist sicher. In der Öffentlichkeit galt er nicht erst seit seiner berüchtigten Wutrede als miesepetriger Zweckpessimist. Zudem setze er zu wenig auf die eigene Jugend und sein Fußball mache ähnlich viel Spaß wie ein Zahnarztbesuch, so seine schärfsten Kritiker.
Der schlechte Ruf von Labbadia und der Spielweise seiner Mannschaften scheint paradox, denn der langjährige Coach betont nicht zu Unrecht, dass er eigentlich dem Offensivfußball anhängt.
Tatsächlich zeigte der VfB unter Labbadia hohen Einsatz und versuchte, mutig nach vorne zu spielen. Es war die spielerische Leichtigkeit, die bei aller Intensität ins Hintertreffen geriet. Für einen geschmeidigen Spielfluss war die Mannschaft zu schlecht organisiert und abgestimmt. Daher musste sie zwangsläufig auf komplizierte, schwerfällige Aktionen zurückgreifen. Es folgten zerfahrene Partien mit vielen Zweikämpfen und Spielunterbrechungen. „Umständlicher Offensivgeist“ beschreibt den Wesenskern von Labbadias Fußball ganz treffend.
Vom Naturell her möchte ich Power-Fußball spielen, offensiv, mit einer guten Spieleröffnung. Aber das geht nicht immer.
– Bruno Labbadia
Die Stimmung während Labbadias letztem Sommer als Coach des VfB Stuttgart war zwiegespalten. Auf der einen Seite hatte der VfB ein Pokalfinale sowie eine dringend notwendige Erneuerung in den Führungsgremien hinter sich: Der Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Hundt und Präsident Gerd Mäuser waren zurückgetreten. Mäusers Nachfolger Bernd Wahler erreichte auf der Mitgliederversammlung eine nahezu einstimmige Mehrheit von 97%. Die Mitglieder beschlossen außerdem unter tosendem Jubel der Anwesenden die Wiedereinführung des traditionellen Vereinswappens.
Auf der sportlichen Ebene knirschte es hingegen merklich. Während Präsident Wahler optimistische Prognosen wagte („Warum nicht auf Platz vier schielen?“), schraubte Labbadia die Erwartungen wie üblich herunter („Man hat manchmal das Gefühl, wir hätten Messi und Neymar geholt“).
Labbadia hatte mit seiner Einschätzung nicht ganz unrecht. Der VfB musste seinen Kader auf drei Wettbewerbe ausrichten, da er sich als Pokalfinalist für die Playoffs zur Europa League qualifiziert hatte. Folglich investierte der VfB fleißig in die Breite, verbesserte aber kaum seine erste Elf. Von den neuen Gesichtern im Team brachte allenfalls Timo Werner das Potential zum Gamechanger mit. Der spätere Nationalstürmer ging in dieser Saison mit 17 Jahren seine ersten Schritte im Profifußball.
Chaos-Positionsspiel
Mit einer aufgrund des Europapokals verkürzten Vorbereitung im Rücken wagte sich Labbadia taktisch auf neues Terrain. Er wollte vor allem sein viel kritisiertes Ballbesitzspiel verbessern. Bei diesem Vorhaben bediente sich Labbadia an Ideen aus dem sogenannten Positionsspiel. Das ist eine Ballbesitzphilosophie, die vor allem in Spanien und den Niederlanden verbreitet ist. Die Grundidee des Positionsspiels ist, dass die Spieler sich den Platz so aufteilen, dass sie strukturelle Vorteile gegenüber dem Gegner erhalten: Überzahlen, Raumvorteile und so weiter. Nach derartigen Prinzipien bastelte Labbadia teils radikal an seiner 4-2-3-1-Stammformation, abhängig davon wie er den nächsten Gegner erwartete.
Im DFB-Pokal und der Europa League bestritt der VfB seine ersten Spiele gegen den BFC Dynamo aus Berlin und den bulgarischen Verein Botev Plovdiv. Beide Teams erwarteten den VfB in einem klassischen 4-4-2-Mittelfeldpressing. Um Überzahl gegen die beiden gegnerischen Spitzen zu schaffen, bildete der VfB Dreierketten im Spielaufbau. Dazu ließ sich zum Beispiel ein Sechser zwischen die Innenverteidiger oder hinter einen Außenverteidiger fallen. Die andere Möglichkeit war, dass einer der Außenverteidiger tief blieb und der andere vorrückte. Aus Labbadias 4-2-3-1 entstand somit eine 3-2-5-Aufbaustruktur mit Überzahl in der ersten und letzten Linie.
Systematische Gegneranpassungen wie diese waren Neuland für den VfB Stuttgart. Bislang hatte Labbadia seinen Spielern in Ballbesitz überbordende Freiheiten eingeräumt. Demzufolge handelte es sich bei seinen neuen taktischen Spielereien auch eher um lose Maßgaben als strikte Vorschriften. Die Spieler entschieden zum Beispiel selbst, wer sich wann in die Dreierkette fallen ließ.
Moritz Leitners Zurückfallen aus dem zentralen Mittelfeld sichert Innenverteidiger Serdar Tasci ab, der über außen anschiebt. Weil gleichzeitig Christian Gentner vorstößt, reißt die Doppelsechs jedoch auseinander und es entstehen Konterräume für den Gegner. Keine gute Abstimmung.
Die lockere Organisation der taktischen Maßnahmen passte zwar zum wilden Charakter der Mannschaft, führte aber zu Problemen bei der Abstimmung: Häufig standen sich zwei Stuttgarter auf den Füßen, wenn sie sich gleichzeitig in dieselben Räume bewegten. Umgekehrt bekam der VfB manchmal seine gewünschte Struktur nicht hin, wenn keiner der Spieler die Initiative ergriff.
Und noch ein Problem brachten Labbadias neue Vorgaben mit sich: Anstatt den Spielern die Arbeit zu vereinfachen, waren diese mit noch mehr Anweisungen beschäftigt. Mittelfeldmann William Kvist äußerte nach Labbadias Amtszeit in einem Interview, der Coach habe seine Mannschaft mit Inhalten überfrachtet.
Ich hatte den Eindruck, dass wir oft immer alles auf einmal einüben sollten. [...] Ich sollte die Abwehr stabilisieren und gleichzeitig auch noch offensiv permanent Akzente setzen, das ging nicht.
– William Kvist im September 2013
Nehmen wir noch Anpassungsprobleme der Neuzugänge hinzu und heraus kommt ein alles andere als geschmeidiger Saisonstart. Während Dynamo im Pokal mit einer Abwehrschlacht dagegenhielt, neutralisierten die Bulgaren aus Plovdiv Stuttgarts flexible Offensive mit einer flexiblen Defensivordnung. Der VfB schrammte in beiden Aufeinandertreffen knapp an einer Blamage vorbei.
Klassiker gegen Mainz
Zum Bundesligaauftakt gegen Mainz 05 trat der VfB einen Schritt von seinen Experimenten zurück und präsentierte einen wahren Labbadia-Klassiker. Zum ersten Mal in der Saison lief das bewährte Offensivtrio bestehend aus Ibrahima Traoré, Martin Harnik und Vedad Ibišević gemeinsam auf. Dank ihnen spielte der VfB flüssiger nach vorne als zuvor. Stuttgart versuchte das Spiel in klassischer Labbadia-Manier über Kampfgeist und Aggressivität anzugehen.
Thomas Tuchels Mainzer setzten diesem Vorgehen einen einfachen, aber effektiven Kniff entgegen: Ein Sechser ihres 4-2-3-1 ließ sich zwischen die Innenverteidiger fallen, sodass eine Dreierkette gegen das 4-4-2-Pressing des VfB entstand. Tuchel ließ den VfB seine eigene Medizin schlucken.
Mainz 05 bildet durch Johannes Geis’ Zurückfallen eine Dreierkette. Martin Harnik lässt sich gegen diese Dreierkette aus der Position ziehen, um Leitner und Ibišević im Anlaufen zu unterstützen. Dabei lässt er Mainz’ Linksverteidiger Joo-Ho Park frei.
Der VfB versuchte, die Mainzer Positionsvorteile mit Aggressivität und Offensivdrang abzuwürgen. Es entwickelte sich eine Partie mit hohem Angriffspotential auf beiden Seiten. Am Ende gaben individuelle Schwachpunkte in der gebeutelten Abwehr (unter anderem musste Benedikt Röcker von der zweiten Mannschaft aushelfen) und ein irreguläres Tor der Nullfünfer den Ausschlag für eine knappe 2:3-Niederlage des VfB.
Abenteuer Dreierkette
Auf den Klassiker folgte ein weiteres Experiment: Bruno Labbadia überraschte alle Beobachter, indem er gegen Bayer Leverkusen auf ein vollwertiges Dreierkettensystem, ein 3-4-3 wechselte. Diesen unverfrorenen Schachzug wagte er zu einer Zeit, in der die Viererkette so fest zur Bundesliga gehörte wie das Netz zum Tor. Dreierkette spielten damals allenfalls ein paar Taktikfetischisten aus Italien.
Bruno Labbadias 3-4-3 gegen Leverkusens 4-3-3. Die Dreierkette steht Mann gegen Mann, sodass der VfB im Fall eines Ballverlustes schnell in die Zweikämpfe kommt. Vorne stehen die eingerückten Flügelspieler Traoré und Harnik in den Schnittstellen der Außen- und Innenverteidiger. Zudem ist der Diagonalball auf Gotoku Sakai möglich.
Auf dem Papier ergab Labbadias Umstellung allemal Sinn: Die Leverkusener spielten unter Sami Hyypiä ein unorthodoxes 4-3-3-System mit tiefen Sechsern und hohen Außenspielern. In Ballbesitz überluden Leverkusens Achter zusammen mit dem Mittelstürmer und zwei Außenbahnspielern zu fünft die Viererketten der Bundesliga. Da die Abwehrspieler unter Labbadia für gewöhnlich aggressiv ins Eins-gegen-eins gingen, war eine saubere Zuteilung besonders wichtig. Die ließ sich mit der Dreierkette in allen Spielphasen sicherstellen.
Während der Partie war jedoch kaum zu übersehen, dass die Stuttgarter die Mechanismen der Dreierkette nicht gewohnt waren. Die Abstimmung zwischen Mittelfeld und Abwehr funktionierte nicht. Leverkusens drei Sechser überluden Arthur Boka und Christian Gentner im Zentrum. Sie gelangten regelmäßig in den Raum zwischen den Stuttgarter Linien und gewann von dort aus das Spiel mit 1:0.
Misslungene Raute besiegelt das Aus
Nach einer eher unglücklichen Niederlage im Hinspiel der Europa-League-Playoffs in Rijeka (9:2 Schüsse, 1:2 Tore) musste gegen den FC Augsburg endlich ein Sieg her. Dazu kramte Labbadia ein letztes System aus der Schublade: Ein 4-3-1-2 mit vier zentralen Mittelfeldspielern, die in einer sogenannten Mittelfeldraute angeordnet sind.
Wir haben ein paar Schnittstellen gesehen bei Augsburg, wo zwei Spitzen sehr, sehr gut aussehen können.
– Bruno Labbadia im Vorfeld des Spiels
Labbadia wollte sich zunutze machen, dass Augsburgs Hintermannschaft nicht als homogene Einheit, sondern wild gegen den Mann verteidigte. Die beiden Stürmer des VfB versuchten, mit explosiven Antritten gezielt einen Augsburger Innenverteidiger aus der Position zu ziehen und Raum für den Sturmpartner oder einen nachstoßenden Akteur aus dem Mittelfeld zu öffnen.
Augsburgs Viererkette hinterlässt riesige Schnittstellen, während sie ungleichmäßig zum Flügel verschiebt. Stuttgarts Mittelstürmer laufen diese Räume an, wobei Vedad Ibišević Raum für Mohammed Abdellaoue öffnet.
Schlussendlich war es das Stuttgarter Pressing, an dem die Raute scheiterte. Ohne nominelle Außenstürmer befanden sich vor den Außenverteidigern zu große Räume. Diese Räume luden Gotoku Sakai und Konstantin Rausch fatalerweise dazu ein, noch stärker nach vorne zu verteidigen als sonst. Die beiden Außenverteidiger stürzten sich Hals über Kopf in die Zweikämpfe, anstatt zu verzögern, bis jemand aus dem Mittelfeldzentrum ihnen helfen konnte. So schaffte es Augsburg regelmäßig, einen von ihnen zu isolieren und über die Außenbahn durchbrechen.
Im Reflex attackiert Rechtsverteidiger Gotoku Sakai den eingerückten Raphael Holzhauser. Er bemerkt zu spät, dass er dabei den Flügel für Augsburgs Linksverteidiger Matthias Ostrzolek öffnet und läuft dann nur noch hinterher.
Das 1:2 gegen den FCA war die verdienteste Niederlage des VfB Stuttgart in der bisherigen Saison. Bruno Labbadia schien sich mit seinen immer zahlreicheren und komplexeren Umstellungen verrannt zu haben. Sie wirkten, wie seine Spielphilosophie im Ganzen, angestrengt und unvollendet. Es war schwer, nicht zumindest ein klein wenig Erleichterung zu verspüren, als die Amtszeit des langjährigen VfB-Coaches nach diesem Spiel zu Ende ging.
Fundamente und Entwicklungen
Die Entlassung Labbadias ist vielleicht der letzte Trainerwechsel des VfB, der sich wie ein notwendiger Teil einer Entwicklung anfühlt. Sein Versuch, den Fußball, den er über Jahre in Stuttgart etabliert hatte, mit taktischen Finessen zu ergänzen schien als würde man Räder an ein Segelboot dranschrauben. Labbadia stieß an Grenzen, die er sich selbst gesetzt hatte. Um über den Status Quo hinauszuwachsen, mussten sich beide Seiten voneinander trennen.
Fünf Jahre später vollbrachte Labbadia das Kunstwerk, das ihm beim VfB verwehrt geblieben war. In der Saison 2018/19 gelang ihm mit dem VfL Wolfsburg eine unmögliche Symbiose aus Intensität, Flexibilität und strukturiertem Positionsspiel, mit der er die Wölfe auf den sechsten Rang in der Bundesliga führte.
Der VfB Stuttgart hingegen stand 2013 am Anfang einer langen sportlichen Talfahrt. Der Abschied von Bruno Labbadia bedeutete keineswegs eine Abkehr von System Rot. Labbadias Nachfolger adaptierten seinen von Leidenschaft und Offensivgeist geprägten Stil. In den kommenden Kapiteln werden wir uns anschauen, warum es ihnen nicht gelang, auf diesem Fundament langfristigen Erfolg aufzubauen.
Thomas Schneider: Ketten, Schere, Sichel
Doch die Jahre nach der Meisterschaft höhlten dieses Selbstverständnis schrittweise aus. Immer weniger Talenten aus dem eigenen Stall gelang der Sprung in die Profimannschaft. Das lag zum Teil am fehlenden Vertrauen des VfB in seine Nachwuchskicker. Schließlich schafften es manche von ihnen anderswo bis in die Nationalmannschaft, am prominentesten Bernd Leno, Sebastian Rudy und Joshua Kimmich.
Mit Bruno Labbadias Nachfolger verknüpfte der Verein die Hoffnung einer Rückbesinnung auf die eigene Jugend. Der neue Coach gehörte zu den erfolgreichsten Trainern im deutschen Nachwuchsfußball. Er war ein profilierter Ex-Profi mit dem Auftreten eines Analytikers. In Denkerpose beobachtete er das Spielgeschehen von der Trainerbank aus und kritzelte einen Notizzettel nach dem anderen voll. Der junge Wilde mit analytischem Einschlag heißt Thomas Schneider.
Als Fußballer durchlief Schneider diverse Jugendmannschaften des VfB Stuttgart. In den Neunzigern spielte er bei den Profis als Innenverteidiger und gewann 1997 den DFB-Pokal. Nach seiner aktiven Karriere schloss Schneider 2011 die Ausbildung zum Fußballlehrer mit Bestnoten ab. Anschließend arbeitete er erfolgreich als Trainer der U17 des VfB. Gleich in seiner ersten Saison erreichte er das Endspiel um die deutsche B-Jugend-Meisterschaft, im Jahr darauf gewann er sie. Das erfolgreiche Finale gegen Hertha BSC lag gerade einmal zehn Wochen zurück als Thomas Schneider seine neue Aufgabe antrat.
Mit Schneiders Beförderung schloss sich der VfB der verbreiteten Mode an, seinen Cheftrainer aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum zu rekrutieren. Populär wurde dieser Trend durch Thomas Tuchel, der 2009 die Lizenzmannschaft des 1. FSV Mainz 05 übernahm und den Verein in den folgenden Jahren sensationell ins europäische Geschäft führte. Thomas Schneider sollte nun der Tuchel des VfB werden – bestenfalls über die äußerliche und namentliche Ähnlichkeit hinaus.
Mit feiner Klinge
Man fängt natürlich nicht bei null an. Es geht am Anfang ohnehin nicht darum, seine eigenen Vorstellungen vom Fußball umzusetzen, sondern darum, schnell etwas zu verbessern. […] Wir wollen keine Kontermannschaft sein, sondern selbst aktiv sein und guten Fußball spielen. Der ist ja Teil unserer Identität. Laufbereitschaft, mutiges Spiel nach vorne, ständige Angriffsbereitschaft. Da wollen wir hin. Aber das geht nur Schritt für Schritt.
–Thomas Schneider
Schneiders erste Amtshandlung lag auf der Hand: Weg von Labbadias extravaganten Systemwechseln, hin zu Klarheit und Stabilität. Das 4-2-3-1 kehrte als Grundordnung zurück. Schneider kümmerte sich um eine saubere Organisation der Defensive und feinsinnige Kombinationsangriffe. Zusammen mit dem kämpferischen Offensivgeist der Truppe ergab das einen eigenwilligen Mix.
Dank des breit aufgestellten Kaders konnte Schneider der Mannschaft sofort über die personelle Schiene seinen Stempel aufdrücken. Zunächst holte er den zentralen Mittelfeldspieler William Kvist zurück in die Startelf. Der Däne war ein unauffälliger, intelligenter Sechser, der es verstand, seiner Mannschaft Balance zu verleihen.
Thomas Schneiders vorläufige Stammelf im 4-2-3-1.
Zusammen mit dem ähnlich veranlagten Zehner Alexandru Maxim brachte Kvist Stabilität ins zentrale Mittelfeld. Die beiden sorgten für saubere Strukturen und eine flüssige Ballzirkulation. Kvist diente als verlässlicher Knotenpunkt im Spielaufbau, während Maxim das Bindeglied innerhalb der Offensive bildete. Zusammen dienten sie als Gegengewicht für die ausufernden Vorstöße von Christian Gentner.
Auch für die Außenbahnen fand Schneider eine schlüssige Besetzung. Auf der linken Seite vertraute er Timo Werner, seinem ehemaligen Schützling aus der U17. Für den rechten Flügel traf er mit Moritz Leitner eine unkonventionelle Wahl. Der eigentliche zentrale Mittelfeldspieler rückte von der Außenbahn weit nach innen. Als Reaktion auf Leitners Einrücken schob Maxim von der Zehner-Position etwas nach links. So konnte Timo Werner wiederum in die Tiefe starten, ohne dass seine Grundposition unbesetzt blieb. Die Rollenverteilung des Offensivquartetts griff gut ineinander: Vedad Ibišević blieb als Anspielstation vorne, während Werner für Tempo sorgte und Maxim und Leitner das Spiel gestalteten.
Ähnlich wie sein Vorgänger versuchte auch Thomas Schneider, den Spielaufbau seines Teams flexibel zu gestalten. Diesmal passte die Balance jedoch besser. In dieser Szene lässt sich William Kvist hinter den aufrückenden Rechtsverteidiger Sakai fallen, um eine Dreierkette zu bilden. Weil Christian Gentner zeitgleich nach außen weicht, entsteht im Zentrum ein Loch, welches Alexandru Maxim geistesgegenwärtig füllt. So erhält der VfB eine stimmige Ordnung, die Herthas Flügelstürmer Skjelbred und Ben-Hatira zurückdrängt und das Zentrum für Maxim öffnet.
In dieser klug zusammengestellten Konstellation zog der VfB ein feines Kombinationsspiel auf. Die Spieler verließen sich weniger auf ihre physische Durchsetzungskraft und mehr auf spielerische Präzision. Über schnelle Doppelpässe und Stafetten kombinierte sich der VfB manches Mal sehenswert Richtung Tor.
Dank seines präzisen, effizienten Kombinationsfußballs konnte der VfB auch mit vergleichsweise wenigen Spielern gefährlich angreifen. Dafür kümmerten sich umso mehr Stuttgarter um die Absicherung: Die Außenverteidiger und Sechser schalteten sich nur in ausgewählten Situationen ins Offensivspiel ein. Weil die Mannschaft außerdem vom hervorragenden Gegenpressing unter Labbadia zehrte, war sie mit Konterangriffen kaum zu überlisten.
Die individuelle Klasse des VfB reichte allerdings nicht aus, um die stärksten Defensivreihen der Bundesliga zu knacken. Gegen sie offenbarten sich die Nachteile der geringen Offensivpräsenz unter Thomas Schneider. Für Steilpässe und Flanken standen einfach zu wenige Abnehmer zur Verfügung. Wenn es schnell nach vorne ging, rückten die Stuttgarter zu zögerlich nach. Langen Bällen jagten sie kaum hinterher. Gegen ambitionierte Teams musste der VfB den Ballbesitz zwangsläufig abgeben – und sich Defensivaufgaben widmen.
_______________
SPIELERPORTRAIT
Vedad Ibišević: Knipser und Gestalter
Vedad Ibišević gilt als einer der letzten klassischen Torjäger. Ein Spieler, der im Strafraum lauert und dessen einziger Auftrag darin besteht, den Ball in die Maschen zu befördern.
Raten Sie mal, wen Ibišević einmal als Vorbild seiner Jugend bezeichnete. Es war kein klassischer Goalgetter wie Marco van Basten oder Filippo Inzaghi, sondern der Finne Jari Litmanen. Litmanen war in den Neunzigern Teil einer goldenen Ära des AFC Ajax in den Niederlanden. Sein Trainer Louis van Gaal bezeichnete ihn einst als Schattenstürmer, der aus einer zurückgezogenen Position, aus dem Schatten eines klassischen Mittelstürmers, in die Spitze stößt. Als nomineller Zehner übernahm der filigrane Litmanen zugleich kreative Verantwortung. Ein ungewöhnliches Idol für einen Spieler, aus dem vordergründig ein klassischer Neuner wurde. Der Spielmacher und Schattenstürmer kommt zum Vorschein, wenn man sich den Fußballer Vedad Ibišević genauer ansieht.
Zunächst bringt Ibišević in der Tat alles mit, was ein Torjäger alter Schule braucht: Er ist ein listiger Spieler, der sich gern im Rücken der Verteidiger aufhält, um sich deren Aufmerksamkeit zu entziehen. Er hat einen guten Riecher dafür, in welchen Raum er wann hineinstarten muss, um den entscheidenden Raumvorteil für einen freien Schuss zu ergattern. Ibišević kann mit rechts, mit links oder mit dem Kopf präzise abschließen. Komplizierte Bälle bringt er geschickt unter Kontrolle, setzt flüssig zum Schuss an und macht die Dinger eiskalt rein.
Die Nebenjobs des Torjägers
Der klassische Strafraumstürmer gilt heutzutage als antiquiert. Viele moderne Neuner nutzen zusätzlich ihre körperliche Stärke, um Bälle zu behaupten und abzulegen. Andere verfügen über ein hohes Tempo oder arbeiten fleißig in der Defensive mit. Ibišević ist weder schnell noch besonders laufstark. Dafür ist er durchaus robust, sodass er Bälle mit seinem Körper abschirmen kann. So weit, so Torjäger.
Doch Ibišević ist mehr als ein passiver Prellbock. Er übernimmt selbst Verantwortung für das Kreativspiel seiner Mannschaft.
Ibišević fällt gern zwischen den Linien zurück, um Bälle zu fordern. Kriegt er den Ball, kann man ihm die Kugel in den ersten Momenten kaum abnehmen. Das liegt nicht nur an seiner Physis, sondern auch an Ibiševićs individualtaktischem Verständnis. Er hat einen guten Sinn für die Anlaufbewegung des Gegners und kontert sie mit effizienten, teils artistischen Ballkontakten. So behält er die Kugel auch in sehr engen Situationen unter Kontrolle und kann sich bestenfalls nach vorne drehen.
Mit dem Gesicht zum Tor spielt Ibišević herausragende Pässe in die Tiefe. Er liest genau die Position, den Schwung und die Körperhaltung seiner Mit- und Gegenspieler. Dann fädelt er seinen Steilpass mit perfektem Drall und Gewichtung durch die Schnittstelle, sodass ein Mitspieler ihn erreichen kann, ohne Geschwindigkeit zu verlieren.
Eine spektakuläre Torvorlage von Vedad Ibišević im Trikot der TSG Hoffenheim. Er bekommt im Umschaltmoment den Ball und dreht sich geschickt um Bremens Naldo. Ibiševićs Sturmpartner Demba Ba hat einen minimalen Vorsprung, um seinen Gegenspieler außen zu überholen. Trotz Druck von zwei Mann bleibt Ibišević cool und spielt den Steilpass punktgenau in den Lauf von Ba. Der behält seine volle Geschwindigkeit bei, kommt vor Clemens Fritz an den Ball und vollendet aus guter Position.
Diese Steilpässe sind wohl das Spektakulärste, was Ibišević mit der Kugel anstellen kann. Seine Technik und sein überlegenes Verständnis von Spielsituationen ermöglichen ihm aber auch die Brot-und-Butter-Aktionen des spielenden Mittelstürmers. Präzise Ablagen, Weiterleitungen, kurze Dribblings gegen einen Innenverteidiger, all diese Werkzeuge hat Ibišević im Repertoire.
Telepathie mit Martin Harnik
Ibišević lässt sich im richtigen Moment ruckartig fallen und zieht die Aufmerksamkeit beider Bochumer Innenverteidiger auf sich. Martin Harnik kann daher unbemerkt hinter die Abwehr starten und Gotoku Sakais langen Ball erlaufen.
Von seiner Verpflichtung im Januar 2012 bis zum Frühjahr 2014 war Ibišević als Stoßstürmer ein unumstrittener Fixpunkt beim VfB Stuttgart. Er harmonierte exzellent mit dem Rechtsaußen Martin Harnik, einem torgefährlichen, athletischen Angreifer. Harniks intelligente Läufe bildeten das perfekte Pendant zu Ibiševićs Steilpässen. Der Bosnier ließ sich von der Neun minimal fallen, gerade so weit, dass er von einem Abwehrspieler verfolgt, aber noch nicht vom Mittelfeld aufgenommen wurde. Harnik startete dann in den Rücken des Verteidigers, um Pässe von Ibišević oder dritten Spielern zu fordern.
Unter Thomas Schneiders Nachfolger Huub Stevens gelang Ibišević jedoch kein Treffer mehr für den VfB und er saß zum Ende der Saison 2013/14 häufiger auf der Bank. In der neuen Saison erlitt er einen langwierigen Ermüdungsbruch. Danach spielte er unter dem erneut amtierenden Stevens kaum noch eine Rolle. Nach einer enttäuschenden Spielzeit 2014/15 verließ Ibišević den Verein Richtung Hertha BSC, wo er in seinen Dreißigern noch einmal zum Leistungsträger und Kapitän aufstieg.
Um in einem Atemzug mit Ikonen wie Mario Gomez, Jürgen Klinsmann oder Fritz Walter genannt zu werden, war Ibiševićs Blütezeit in Stuttgart sicherlich zu kurz. Dennoch zählt er zu den herausragenden VfB-Mittelstürmern der Moderne und war eine prägende Konstante im Stuttgarter Offensivspiel.
_______________
Vom Lehrbuch aufs Fußballfeld
Die meisten Fußballfans assoziieren Taktik eher mit der Defensive, mit Regeln und der Disziplin, die man braucht, um diese Regeln einzuhalten. Dagegen gilt die Offensive als spontan und kreativ. Das ist eine Einteilung, die der Realität selten gerecht wird. Doch im Fall von Thomas Schneider ist am Klischee der Defensive als rigide durchorganisiertem Verbund durchaus etwas dran.
Kompaktheit, taktische Disziplin, Organisation, das alles machen wir konsequenter. [...] Wir wissen viel besser, was zu tun ist.
– William Kvist in der Anfangszeit seines neuen Trainers
Anlaufen und Verschieben im 4-4-2-Mittelfeldpressing. Der VfB verteidigt als kompakter, raumorientierter Block.
Schneider installierte beim VfB ein blitzsauberes 4-4-2-Mittelfeldpressing. Wie auf Schnüren aufgereiht standen die Spieler im Raum. Sie verschoben stets als Einheit, als kompakter Block.
Wenn der Gegner sich diesem Block gegenübersah und einen Pass nach außen spielte, lief die ballnahe Sturmspitze den Empfänger so an, dass er gleichzeitig den Weg zurück zum Passgeber blockierte. So schnitt er den Gegner vom wertvollen Zentrum ab und zwang das Spiel auf den Flügel. Außerdem verschob die Mittelfeldlinie engmaschig zum Ball und stellte die Passwege nach vorne zu. So war der VfB gegen vertikale Eröffnungen auf der Seite gut gerüstet.
Scheren und Ketten
Die taktische Konstitution des VfB Stuttgart weckte Erinnerungen an Lucien Favre, der damals als Chefcoach von Borussia Mönchengladbach Erfolge feierte. Beide Mannschaften zeichneten sich durch konstruktives Aufbauspiel, präzise Kombinationen und ein kompakt arrangiertes 4-4-2 aus. Doch der Schein trügt: Beim VfB steckte unter der Fassade von Organisation und Raffinesse die wilde Mentalität der Vorjahre noch tief in den Köpfen. Anders als die Spielweise von Favres Gladbachern wirkte Schneiders Fußball nicht wie aus einem Guss.
Der VfB offenbarte regelmäßig sein altes Gesicht, sobald er den Geltungsbereich seiner taktischen Vorgaben verließ. Nach kurzen Freistößen, langen Bällen oder im Chaos nach Eckbällen fehlte der gegnerische Pass nach außen als Auslöser für die Pressingbewegung. Der VfB schien dann nicht mehr zu wissen, was zu tun ist. Die Spieler wurden unruhig und begannen vereinzelt, ihre Gegner wild zu attackieren. Andere waren bemüht, die Ordnung beizubehalten. Wenn ein Mitspieler aus der Ordnung ausbrach, reagierten sie kaum auf seine Bewegung. Eine Schere zwischen der Aggressivität Einzelner und der Passivität des Kollektivs ging auseinander.
Eine typische Kettenreaktion im Pressing des VfB: Nach einer Ecke schieben die drei Zentrumsspieler Ibišević, Maxim und Gentner mannorientiert zum Flügel. Gleich zwei Spieler setzen den ballführenden Neustädter unter Druck. Ihr stürmisches Vorgehen öffnet das Stuttgarter Mittelfeldzentrum. Diese Zone sichert der VfB nicht vorausschauend genug ab, insbesondere steht William Kvist zu tief. Nach Neustädters Chipball auf Höwedes versucht der Däne seinen Stellungsfehler zu korrigieren, rückt hektisch heraus, kommt zu spät und wird per Doppelpass ausgespielt.
Wenn ein Gegner das übermütige Herausrücken eines VfB-Spielers überwand, kam es häufig zu einer Kettenreaktion: Es dauerte zu lange bis der nächste Stuttgarter in Ballnähe ankam, sodass der Gegner dann schon den nächsten Pass vorbereitet hatte. Der VfB lief mehrfach hintereinander reaktiv ins Leere.
Das gleiche Bild ergab sich im Umschalten: Bei schnellen Konterangriffen des VfB stürmte ein offensiver Block kometenhaft nach vorne, während der Rest unsortiert hinten stehen blieb. Verlor der VfB hierbei den Ball, griff das Gegenpressing überhaupt nicht mehr. Die passive und desorganisierte Absicherung bekam keinen Zugriff und musste sich trotz Überzahl zurückfallen lassen.
Ein Umschaltangriff nach einem Einwurf des VfB in der eigenen Hälfte. Vedad Ibišević verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball. Die fünf absichernden Stuttgarter haben mit diesem Ballverlust überhaupt nicht gerechnet und werden jetzt überrumpelt: Sie stehen zu tief und sind schlecht aufgeteilt. Deshalb kann Gladbachs Max Kruse den Ball seelenruhig in der Lücke annehmen und einen Gegenangriff für seine Mannschaft einleiten.
Weit zurückgedrängt in der eigenen Hälfte zu verteidigen lag dem VfB überhaupt nicht. Traditionell besetzten beim VfB eher kreative, offensivstarke Spielertypen die Abwehr. Bei der Verteidigung des Sechzehners leisteten sich diese Spieler empfindliche Schnitzer. Konter und lange Bälle bekam der VfB daher nicht zuverlässig geklärt, auch wenn eigentlich genügend Spieler präsent waren. Gerade hochklassige Angriffsreihen brachten die Hintermannschaft des VfB gehörig ins Schwitzen.
Der VfB stößt an seine Grenzen
Folgerichtig wurden Thomas Schneiders VfB vor allem von Topteams seine Schwächen aufgezeigt. Gegen Borussia Dortmund, Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach, alles Mannschaften aus dem ersten Tabellendrittel, mussten die Stuttgarter herbe Niederlagen einstecken. Besonders niederschmetternd war die 1:6-Pleite gegen Borussia Dortmund. Der BVB bot eine Offensive mit Weltformat auf: Marco Reus, Henrikh Mkhitaryan und Robert Lewandowski pflückten die schlecht organisierte Restverteidigung des VfB schonungslos auseinander.
Auch gegen Borussia Dortmund, Jürgen Klopps Pressingmaschine, versuchte der VfB Stuttgart flach herauszuspielen – mit schlimmen Ballverlusten wie diesem als Resultat.
Da half es nicht, dass sich der VfB gerade in einer Phase der Selbstüberschätzung befand. Immer wieder versuchte die Mannschaft auch gegen Spitzenmannschaften mit aller Macht flach aufzubauen. Doch dabei zeigten die Sechser zu wenig Präsenz. Kvist und Gentner offenbarten, genauso wie Torwart Sven Ulreich, spielerische Defizite. Aus spielerischer Ambition wurde fataler Übermut.
Nach einem vielversprechenden Start mit Kantersiegen gegen Braunschweig und Hoffenheim rutschte Schneiders VfB während des harten Programms zum Ende der Hinrunde immer weiter nach unten. Anfang Dezember lag der VfB nur noch auf Platz zwölf.
Die Sichelformation
Schneider reagierte noch vor Weihnachten mit einer gravierenden taktischen Umstellung auf den Abwärtstrend seines Teams. Er wechselte von 4-2-3-1 auf 4-4-2, der Zehner machte also Platz für einen zweiten Stürmer. Auf der Sechs bildeten Moritz Leitner und Christian Gentner ein offensivstarkes Pärchen, William Kvist spielte in Schneiders Überlegungen keine Rolle mehr. Da Gentner um die Jahreswende herum verletzt fehlte, kam der junge Rani Khedira vermehrt zu Einsatzchancen.
Schneider kompensierte die Balance, die Kvist und Maxim der Mannschaft intuitiv verliehen hatten mit einer strikteren Offensivtaktik. Die Außenstürmer rückten nicht mehr ins Zentrum ein, sondern hielten stoisch den Kontakt zur Seitenlinie. Die Außenverteidiger blieben dafür meist hinten.
In der gestreckten Grundordnung des VfB befanden sich Offensive und Defensive weit auseinander. Bei so großen Abständen fehlen dem Ballführenden im Spielaufbau häufig sichere Anspielstationen. Andererseits wird pro Pass aber auch mehr Raum überbrückt. Die langen Passwege halfen dem VfB, schnell und raumgreifend nach vorne zu kommen.
Schneiders 4-4-2 im Winter. Bis zu vier gelernte Stürmer standen gemeinsam auf dem Platz.
Die breit postierten Außen zogen die gegnerische Abwehr auseinander, sodass sich Räume für die beiden Mittelstürmer ergaben. Diese bekamen nun zahlreiche Vertikalpässe aus den hinteren Reihen serviert – eine Rolle, die speziell zu Vedad Ibišević hervorragend passte. Der Bosnier bot sich zwischen den Linien an, zog Bälle auf sich und verteilte sie nach außen oder schickte seinen Sturmpartner gekonnt hinter die Abwehr.
War das vertikale Spiel durchs Zentrum nicht möglich, lief der Ball beim VfB über außen. Dort kam von unterschiedlichen Positionen aus Unterstützung: Der ballnahe Mittelstürmer ließ sich gern zur Seite fallen. Ein Sechser kam ebenfalls häufig dazu, während sein Partner die Mitte besetzt hielt.
Schneiders sichelförmige Aufbauformation.
Die Unterstützung für den Flügel verwandelte das 4-4-2 in eine Sichel. Hinten blieb eine Kette aus drei bis vier Verteidigern plus ein Sechser zur Absicherung. Der Flügel wurde überladen und vorne postierte sich die breite Viereroffensive. Das Mittelfeldzentrum ließ der VfB verwaisen.
Seine Flügelüberladung spielte der VfB mit flinken Kombinationen Richtung Tor oder zur Grundlinie aus. Sobald sich das Spielgeschehen dem gegnerischen Strafraum näherte, rückte der ballferne Flügelspieler als zusätzlicher Abnehmer zu den beiden Neunern in die Spitze. Es gibt Angenehmeres als zehn Meter vor dem eigenen Kasten etwa Vedad Ibišević, Moa Abdellaoue und Martin Harnik gleichzeitig verteidigen zu müssen.
Nachdem sich Sakai und Maxim über außen nach vorne kombiniert haben, stehen drei Stürmer zur Abnahme der Flanke bereit. Zugleich verbleiben genügend Spieler zur Absicherung.
Den Flügelspielern fiel in diesem System eine besonders wichtige und komplexe Rolle zu. Sie mussten Tempo machen, kombinieren, dribbeln, sich im Strafraum durchsetzen und Tore schießen. Kein VfBler erfüllte diesen Anspruch in Gänze, wenngleich Timo Werner ihm nahekam. Martin Harnik bringt Torgefahr, aber kaum Dribbelstärke mit. Alexandru Maxim und Ibrahima Traoré können dribbeln und Flanken schlagen, sind aber klar außerhalb des Strafraums zu Hause.
Unverhoffter Schlüsselspieler
Trotz der personellen Kompromisse, die Schneider eingehen musste, brachte das neue Flügelspiel Schwung in die Offensive. Das verdankte der VfB nicht zuletzt der Formstärke eines Akteurs aus dem zentralen Mittelfeld: Moritz Leitner avancierte durch die Systemumstellung vom Mitläufer vorübergehend zur Schlüsselfigur. Im Winter 2013/14 erlebte er seine mit Abstand stärkste Phase im Brustring-Trikot.
Anders als Kvist, Gentner und Khedira verstand sich Leitner als Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft. Er ließ sich zwischen die Innenverteidiger fallen und pendelte nach links und rechts, um sich ins Kombinationsspiel einzuschalten. Seine umtriebige, technisch glanzvolle Spielweise erlaubte es Leitner, fast alleine die spielerischen Aufgaben der Doppelsechs zu schultern. Leitners Nebenmann konnte sich voll und ganz auf die Lauf- und Defensivarbeit konzentrieren.
Im Spiel gegen Hannover 96 brachte das neue Sichelsystem auf Anhieb einen 4:2-Sieg ein. Zum Abschluss der Hinrunde verlor der VfB allerdings in Wolfsburg mit 1:3. Die Mannschaft spielte zwar ordentlich nach vorne, geriet aber durch zwei direkte Freistoßtore von Ricardo Rodríguez und Diego auf die Verliererstraße. So verabschiedete sich der VfB mit gemischten Gefühlen in die Winterpause.
Vier-Stürmer-Wahnsinn
Das Sichel-4-4-2 war ein riskantes Experiment. Zum Zeitpunkt als Thomas Schneider das System einführte, hatte der VfB Stuttgart sieben Spiele lang nicht mehr zu null gespielt. In den beiden Partien nach der Umstellung kamen noch einmal satte fünf Gegentore dazu. Trotzdem setzte Schneider in der Rückrunde alles auf dieses Pferd.
Sein Vorhaben glich einem Himmelfahrtskommando. Mit einer Angriffsreihe aus vier gelernten Mittelstürmern und mehr Aggressivität im Pressingverhalten wollte Schneider die offensive Power maximieren. Doch nach der Winterpause waren Offensive und Defensive noch stärker voneinander abgeschnitten als zuvor. So wurde gar die mangelnde Reichweite von Sven Ulreich zum Problem: Die langen Bälle des Torwarts erreichten teilweise nicht einmal mehr die unglaublich hochstehende Offensive.
So zerbröckelte langsam Stuttgarts Defensivordnung. Der VfB legte eine immer schwächere Zweikampfführung an den Tag. Die Stürmer auf den Außenbahnen arbeiteten nicht mehr richtig nach hinten. Zwar wären Spieler wie Harnik und Werner körperlich dazu in der Lage gewesen, doch sie sparten sich bewusst ihre Kräfte auf. Sie blieben vorne, um nach einem Ballgewinn sofort anspielbar zu sein. Das war bisweilen ein irres Wagnis.
Nach der Klärung einer Leverkusener Ecke spekulieren die vier Angreifer des VfB auf den Ballgewinn, anstatt in der Defensive zu helfen. Es entsteht eine völlig unausgewogene Konstellation: Der VfB ist hinten in Unterzahl und vorne in Überzahl. Falls sie den Ball gewinnen, gibt es einen brandgefährlichen Konter. Wenn nicht, kann Leverkusen die zwei Mann Überzahl ausspielen.
Die ersten drei Partien der Rückrunde gegen verlor der VfB allesamt mit 1:2. Das Team spielte jeweils gefällig nach vorne, während es hinten wackelte. Das entscheidende Gegentor kassierte der VfB jedes Mal erst in den Schlussminuten.
Die späten Gegentreffer hingen damit zusammen, dass der VfB bei unbefriedigenden Spielständen immer auf Sieg spielte. Dann halfen die vorderen Spieler noch weniger im Verteidigen mit als ohnehin schon. Der VfB erlaubte dem Gegner schnelle Abschlüsse, um selbst wieder in Ballbesitz zu kommen und zurückzuschlagen. Es entstanden wilde Partien mit viel Hin und Her. Diese offenen Spielverläufe zog der VfB aber nie entscheidend auf seine Seite.
Trotz der Niederlagen bewegten sich die Leistungen des VfB in den ersten Partien der Rückrunde noch in einem akzeptablen Rahmen. Von fünf Spielen seit Schneiders Systemwechsel verlor der VfB zwar vier, davon aber auch drei gegen Mannschaften aus dem ersten Tabellendrittel. Diese Relativierung funktionierte nach dem folgenden 1:4 gegen den FC Augsburg nicht mehr.
Die Leistung folgt den Ergebnissen
Markus Weinzierls Augsburger deckten eine Schwäche im Stuttgarter Defensivverbund auf, über die wir noch nicht gesprochen haben: die Abseitsfalle. Der FCA visierte in seinem 4-2-3-1 vor allem das offensive Zentrum an, um Stuttgarts Innenverteidiger aus der Position zu locken. Augsburgs Flügelstürmer rückten weit ein und starteten hinter die VfB-Abwehr. Um deren Läufe einzusetzen, kloppten die Mittelfeldspieler den Ball am laufenden Band in die Tiefe, im Zweifel auf Verdacht.
Der VfB verteidigte dieses Steilpassgewitter viel zu idealistisch. Die Viererkette orientierte sich stur nach vorne und versuchte, die einlaufenden Augsburger ins Abseits zu stellen. Dieses Risiko zahlte sich nicht aus: Es musste nur ein Ball durchrutschen und Augsburg stand frei vor Sven Ulreich. Stuttgarts Zweiteilung und riskante Zweikampfführung rissen große Lücken, aus denen die Augsburger ihre anspruchsvollen tiefen Bälle spielen konnten. Weil obendrein Vedad Ibišević eine rote Karte sah, erlitt der VfB gegen den FCA eine ernüchternde 1:4-Pleite.
Nach einem zu kurzen langen Schlag von Sven Ulreich sammelt Augsburg den Ball zwischen Stuttgarts Mittelfeld und Sturm auf. Alexandru Maxim eilt zurück, kann aber Augsburgs Dominik Kohr nicht richtig bedrängen. Daniel Schwaab und Konstantin Rausch verfolgen ihre einlaufenden Gegenspieler nur halbherzig, weil sie das Abseits nicht aufheben wollen. Antonio Rüdiger bleibt sogar komplett stehen, anstatt sich fallen zu lassen. Kohr hat daher genug Zeit, den tiefen Ball so zu timen, dass seine Mitspieler knapp nicht im Abseits stehen. Sein Pass gerät minimal zu lang für Hahn und Milik. Dieses Glück hatte der VfB nicht in jeder Situation.
Wir haben zu viele Gegentore bekommen. Es ist ganz entscheidend, eng und gut zu verteidigen.
– Thomas Schneider vor dem Hoffenheim-Spiel
Nach der Blamage gegen Augsburg schloss Schneider wieder Kompromisse. Gegen die TSG Hoffenheim brachte er Ibrahima Traoré zurück ins Team, den defensiv engagiertesten Flügelspieler im Kader. Traoré ließ sich im Pressing zu einer Fünferkette zurückfallen, während Martin Harnik auf der anderen Seite höher blieb. So wurde aus dem 4-4-2 situativ ein 5-2-3. Das passte gut zu Hoffenheims Ballbesitzstruktur mit einem Sechser zwischen den Innenverteidigern und hohen Außenverteidigern.
Schneiders taktische Anpassung gegen die TSG Hoffenheim. Die situative 5-2-3-Struktur passt gut zur Aufbauformation der TSG, die ihre Außenverteidiger hochschiebt und mit einem Sechser zwischen den Innenverteidigern aufbaut. Die drei Stürmer können Hoffenheims Dreierkette zustellen, während die Fünferkette die offensiven Außenverteidiger abfängt. Schon Mainz und Leverkusen hatten mit ihren aufrückenden Außenverteidigern gegen Schneiders puristisches 4-4-2 für Alarm gesorgt. Diesmal war der VfB gegen dieses Mittel besser gerüstet.
Inzwischen machte sich jedoch ein grundlegender Leistungsabfall in der Offensive bemerkbar. Der VfB spielte immer hektischer nach vorne und verlor seine vorteilhafte sichelförmige Ordnung. Mit fahrigen Ballverlusten schenkten sie ihren Gegnern Spielanteile. Der Abwärtsstrudel nahm seinen unbarmherzigen Lauf.
Rettung durch Raute?
Thomas Schneiders Umstellung auf eine Rautenformation.
Nachdem der VfB Stuttgart Hoffenheim und Hertha BSC unterlegen war, unternahm Schneider einen letzten Versuch, die Situation zu retten. Er schickte sein Team in einem 4-3-1-2 auf den Platz. Auf Knopfdruck löste dieses System die Zweiteilung des Teams auf, denn in der Raute gibt es ein vertikal gestaffeltes Mittelfeld, anstelle der flachen Vier. Mit mehr Spielern auf unterschiedlicher Höhe herrschten kaum noch Lücken zwischen den Mannschaftsteilen. Im Zentrum der Raute gab Christian Gentner viele Kommandos, während Cacau im Sturm die Bälle auf Martin Harnik verteilte. Erfolgreiche Kombinationen beschränkten sich jedoch überwiegend auf Konter.
Schneiders Raute schien nicht schlecht aufzugehen. Die Mannschaft setzte die neuen Vorgaben nicht immer sauber, aber sehr engagiert um. Gegen die wackelige Absicherung von Armin Vehs Frankfurtern erspielte sich der VfB über gutes Umschaltverhalten ein Chancenplus, doch es gelang trotz vieler Abschlüsse wie so oft nur ein Tor. Sinnbildlich verfehlte Alexandru Maxim in der Schlussphase aus wenigen Metern Entfernung das leere Tor.
Gegen Eintracht Frankfurt verteidigt der VfB trotz 1:0-Führung leichtfertig. Im Nachgang an eine Ecke gucken sämtliche Stuttgarter nur auf den Ball und keiner nimmt die Gefahr am zweiten Pfosten und im Rückraum wahr. Frankfurt bleibt angesichts des Rückstandes mit vielen Spieler vorne. Djakpas Flanke auf Rosenthal klärt Daniel Schwaab in allerhöchster Not. Einen möglichen Abpraller hätte Barnetta oder Madlung aus zehn bis fünfzehn Metern völlig unbedrängt aufs Tor schießen können.





























