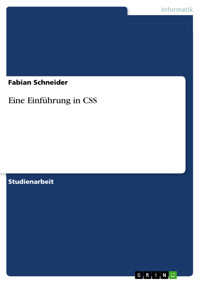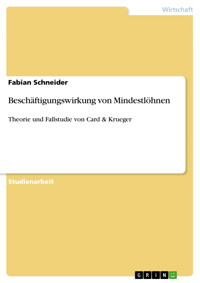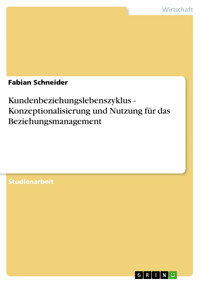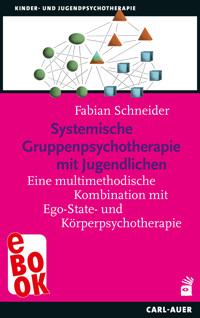
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die transformative Kraft der Gruppe In der ambulanten Psychotherapie mit Jugendlichen wird selten in Gruppen gearbeitet. Dabei spricht vieles für dieses Setting: Die Wirksamkeit ist für viele Störungsbilder erwiesen, der organisatorische Aufwand überschaubar und die kassenärztliche Anerkennung gewährleistet. Was es braucht, ist ein breites Repertoire an flexibel einsetzbaren therapeutischen Methoden. Fabian Schneider stellt ein störungsübergreifendes Modell für die lösungsorientierte Gruppenpsychotherapie mit Jugendlichen vor. Es zeichnet sich zum einen durch klassische systemische Aspekte aus: Auftragsklärung gemeinsam mit Jugendlichen und Eltern; regelmäßige Eltern-, Familien- und Geschwistergespräche; Vielfalt der Perspektiven. Zum anderen integriert es Techniken aus der Ego-State-Therapie und der Körperpsychotherapie. Auf der Seite der Jugendlichen unterscheidet sich die Gruppenarbeit vom Einzelsetting u. a. durch gegenseitiges Lernen sowie durch die Erfahrung von Solidarität und eigener Kompetenz im Kontakt mit anderen. Intensive Beziehungen zu Gleichaltrigen – eine zentrale Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz – werden in der Gruppentherapie gefördert und schaffen die Voraussetzung für die künftige Autonomie der Jugendlichen. Ausführliche Fallbeispiele illustrieren die Struktur einer multimodalen Gruppensitzung. Gastbeiträge von Margarethe Kruczek-Schumacher und Heidrun Lioba Wunram bieten weitere Expertise aus erster Hand. "Fabian Schneider stellt sein Konzept einer systemischen Gruppenpsychotherapie mit Jugendlichen in maximal praxisorientierter Weise vor. Er gliedert den Text in überschaubare Kapitel, deren Aussagen er jeweils in einem Kasten noch einmal kurz zusammenfasst. Zudem wird das konkrete Vorgehen jeweils mit einem Fallbeispiel veranschaulicht." Wilhelm Rotthaus Der Autor: Fabian Schneider, Dr. med.; Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie; Ausbildungen u. a. in Verhaltenstherapie und Systemischer Therapie; seit 2012 niedergelassen in eigener Praxis; seit 2019 praktizierender Gruppenpsychotherapeut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Carl-Auer
Systemische Kinder- und Jugendpsychotherapie
Sie halten ein Buch aus der pinkfarbenen Praxisreihe des Carl-Auer Verlages in Händen. Diese Reihe ist der Systemischen Therapie und Beratung mit Kindern und Jugendlichen und ihren Familien gewidmet. Gute Therapeut:innen wussten schon immer, dass Kindertherapie ohne Eltern einem Schwimmbad ohne Wasser gleicht. In der Praxis reduziert sich der Einbezug der Eltern jedoch meist auf informative Gespräche, in denen über den Therapieverlauf berichtet wird. Um in der obigen Metapher zu bleiben: So wird maximal der Nichtschwimmerbereich mit Wasser gefüllt.
Systemische Kinder- und Jugendpsychotherapie bildet hier einen zentralen Unterschied. Die gesamte Familie, inklusive der Eltern, wird zum Gegenstand der Therapie. Das Kind bzw. der Jugendliche wird eher als Anlass, als Indexpatient:in verstanden; die Veränderung, die Entwicklung wird durch das gesamte Familiensystem angeregt und gefördert. Die Arbeit im Mehrpersonensetting ist sicherlich einer der größten Schätze der Systemischen Therapie, und die besondere Energie dieser Arbeitsweise trägt wesentlich dazu bei, Entwicklungen in der Familie anzustoßen. Durch die sozialrechtliche Anerkennung der Systemischen Therapie für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche können Systemische Therapeut:innen jetzt auch im System der Gesetzlichen Krankenkassen systemisch arbeiten. Damit können nun alle Bevölkerungsschichten die hohe Wirksamkeit und Effektivität der Systemischen Therapie genießen. Jetzt müssen sich nur noch ausreichend viele junge Kolleg:innen finden, die sich im Vertiefungsgebiet Systemische Therapie approbieren und dann auch einen Kassensitz erwerben können, damit diese Therapieform in allen Regionen Deutschlands verfügbar ist.
Sie finden in dieser Reihe Konzepte der systemischen Kinder- und Jugendpsychotherapie, herausragende Fallstudien, Sammlungen von Techniken und Methoden, hypnosystemische Konzepte, lösungsorientierte Ansätze, Beiträge zur Spieltherapie, Embodiment-Verfahren und vieles mehr. Neben Publikationen von erfahrenen Praktiker:innen, die schon lange im systemischen Feld bekannt und geschätzt sind, stehen Veröffentlichungen von jungen Autor:innen, die ihre kreativen Konzepte, Zugänge und Interventionen vorstellen. Alle Bücher verfolgen ein gemeinsames Ziel: Therapeut:innen und Psychiater:innen in ihrer täglichen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien optimal zu unterstützen.
Reinert B. Hanswille
Herausgeber der Reihe
Fabian Schneider
SystemischeGruppenpsychotherapiemit Jugendlichen
Eine multimethodische Kombination mit Ego-State- und Körperpsychotherapie
Mit einem Vorwort von Wilhelm Rotthaus sowie Beiträgen von Margarethe Kruczek-Schumacher und Heidrun Lioba Wunram
2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Sebastian Baumann (Mannheim)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Carmen Beilfuß (Magdeburg)
Dr. Dirk Rohr (Köln)
Dr. Michael Bohne (Hannover)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Torsten Groth (Münster)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt † (Münster)
Reinert Hanswille (Essen)
Jakob R. Schneider (München)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Tom Levold (Köln)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Dr. Dr. Kurt Ludewig (Münster)
András Wienands (Berlin)
Dr. Stella Nkenke (Wien)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Rainer Orban (Osnabrück)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Themenreihe »Systemische Kinder- und Jugendpsychotherapie«
hrsg. von Reinert B. Hanswille
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Umschlagmotiv: © Victoria Schumacher
Illustrationen: Victoria Schumacher, Afshin Amirsadri
Redaktion: Veronika Licher
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0602-9 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8554-3 (ePUB)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Ambulante Gruppentherapien braucht das Land
1.2 Familiengespräche als Basis der systemischen Gruppentherapie
1.3 Eine neue Struktur für aktive Co-Regulation
1.4 Wie sich systemische Therapie, Ego-State-Therapie und Körperpsychotherapie gegenseitig ergänzen
1.5 Warum Gruppentherapie so viel Spaß macht und es für die Therapeutin immer spannend bleibt
2 Der systemische Rahmen
2.1 Zum systemischen Verständnis von Realität, Kausalität, Problem und Beziehungen
2.1.1 Das systemische Realitätsverständnis
2.1.2 Das systemische Kausalitätsverständnis
2.1.3 Das systemische Problemverständnis
2.1.4 Die Verortung des Problems in den Beziehungen
2.2 Systemische Hypothesen
2.3 Auftragsklärung und »Wunschtrance« mit Jugendlichen und Eltern
2.4 Familiengespräche und Setting-Entscheidungen
2.4.1 Familiengespräche planen
2.4.2 Geschwistergespräche
2.4.3 Lehrerinnen und Pädagoginnen
3 Die wichtigsten Eckpfeiler dieser Gruppentherapie
3.1 Eine störungsübergreifende Gruppentherapie für Jungen und Mädchen
3.2 Die Eingangsdiagnostik
3.3 Akquise über die Einzel-Kurzzeittherapie
3.4 Stundenkontingent und halboffene Gruppe
3.5 Der wirtschaftliche Bonus und der Zeitvorteil im Vergleich zur Einzeltherapie
3.6 Optionen: Räumlichkeiten außerhalb der Praxis und Gruppe mit zwei Therapeutinnen
3.7 Ein Altersspektrum von ca. 14 bis ca. 18 Jahren
3.8 Eine Gruppengröße von 5 bis 6 Jugendlichen pro Therapeutin
3.9 Die Kombination von Gruppen- mit Einzeltherapie für Jugendliche mit intensiver Symptomatik
3.10 Ausschlusskriterien
3.11 Supervision als essenzielle Grundlage professioneller Psychotherapie
3.12 Materielle Ausstattung
3.13 Feedback der Familien und Jugendlichen
3.14 Transparenz und Augenhöhe
4 Die Gesprächsführung: aktive Co-Regulation, Perspektivenvielfalt und Dialog
4.1 Aktive Co-Regulation: ein Wechselspiel von Initiativen aus der Gruppe und Interventionen der Therapeutin
4.2 Fünf Regeln für einen sicheren Rahmen
4.3 Die zeitliche Struktur der Gruppentermine
4.3.1 Die Phase der Begrüßung und des Anfangsrituals
4.3.2 Die Phase der Themenarbeit
4.4 Die Reihum-Technik schafft Perspektivenvielfalt
4.5 Interpersonales Lernen und Solidarität im Expertenrat
4.6 Dialog und Gruppenkohäsion
5 Systemische Therapie: familiäre Koevolution fördern
5.1 Die Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen und Eltern nach Rotthaus und Havighurst
5.1.1 Korrespondierende Entwicklungsaufgaben von Eltern und Jugendlichen
5.1.2 Ängste als Hinweise auf unbewältigte Entwicklungsaufgaben
5.1.3 Ablösung als Aufgabe für Eltern und Jugendliche gleichermaßen
5.2 Eine Landkarte der Gesprächsführung: Wo liegen die Lösungen?
5.3 Die Intensivierung von Beziehungen zu Gleichaltrigen als zentrale Entwicklungsaufgabe
5.3.1 Freundschaften aufbauen
5.3.2 Konflikte steuern
5.3.3 Peergruppe statt Mobbing
5.4 Selbstbewusstsein und Identität
5.5 Geflüchtete profitieren von und bereichern die Gruppe
5.6 Die systemische Behandlung von Patientinnen mit Suizidalität in der Gruppentherapie
6 Ego-State-Therapie: Wie viele bin ich und wie verstehen sie sich?
6.1 Was ist ein Ego-State (Ich-Zustand)?
6.2 Wofür kann die Ego-State-Therapie eingesetzt werden?
6.3 Wie nehme ich Kontakt mit einem Ego-State auf?
6.4 Die innere Stärke, der innere Helfer und andere Ego-States mit Ressourcen
6.4.1 Die innere Stärke
6.4.2 Der innere Helfer
6.4.3 Andere Ich-Zustände mit Ressourcen
6.5 Ego-States und psychosomatische Symptome
6.6 Ego-States und nichtpsychotische Wahrnehmungsstörungen
6.7 Die Behandlung von Traumafolgestörungen in der Gruppentherapie
7 Körperpsychotherapie: Zugang zu sich selbst finden
7.1 Wie die Therapeutin körpertherapeutische Interventionen in die Gruppentherapie einbaut
7.1.1 Das Anfangsritual: Den Alltagsstress hinter sich lassen
7.1.2 Der sechste Sinn nach Daniel Siegel
7.1.3 Peter Levines Theorie über Reaktionen in traumatischen Situationen
7.1.4 Bilaterale Stimulation und Verarbeitung
7.1.5 Körper und Selbstbewusstsein
7.2 Die Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie (PEP)
7.3 Psychotherapeutisches Yoga
7.3.1 Eine Einführung in das traumatherapeutische Yoga
7.3.2 Die Polyvagaletheorie nach Stephen Porges
7.3.3 Die spezifische Anwendung ausgewählter Yoga-Interventionen
7.3.4 Zur therapeutischen Haltung und Praxis bei Körperübungen Die dargestellten Übungen in den folgenden Abschnitten ab 7.3.5 sind therapeutische Interventionen und nicht mit den üblichen Yoga-Übungen aus einem Yoga-Kurs zu verwechseln. In diesem Kontext gilt es Folgendes zu beachten:
7.3.5 Achtsamkeitsübungen mit dem Körper
7.3.6 Nein-Sagen und Wut rauslassen mit Katze, Kuh und Löwe
7.3.7 Atemübungen verbinden Geist und Körper
7.3.8 Übungen für Schwindel, Bauch- und Kopfschmerzen sowie nicht-psychotische Wahrnehmungsstörungen
7.3.9 Verbindung durch Singen (Chanten) und was das mit dem Schnurren von Katzen zu tun hat
7.4 Psychische Gesundheit und Sport
8 Eine Auswahl ergänzender Interventionen
8.1 Thema Essen
8.1.1 Warum gemeinsame Mahlzeiten in der Familie?
8.1.2 Die Kulturtechnik des Kochens: ein gemeinsames Projekt
8.1.3 Ernährung und Mikrobiom
8.2 Thema Schlaf
8.2.1 Schlafhygiene
8.2.2 Das Einschlafritual
8.2.3 Umgang mit Albträumen
8.3 Verantwortungsvoller Umgang mit Medien
8.4 Imaginative Stabilisierungstechniken
8.4.1 Der sichere Ort
8.4.2 Die Tresor-Übung
8.4.3 Die Lichtstromtechnik
8.5 Eine Intervention zu den Bedürfnissen unter den Ängsten
Danksagung
Anhang: Ein Programm für guten Schlaf
Verzeichnis der Abbildungen
Literatur
Über den Autor
Dieses Buch widme ich meiner Lehrerin Maria Bosch, die mich als Erste für die Systemische Therapie begeisterte.
Vorwort
Gruppenpsychotherapie wird in den Praxen niedergelassener Kinder- und Jugendpsychiaterinnen1 selten durchgeführt. Ihre Häufigkeit dürfte, verglichen mit Einzelterminen, im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen (in der Therapie mit Erwachsenen liegt sie bei ca. 3%). Das erstaunt. Denn die Wirksamkeit von Gruppenpsychotherapie ist in der Wissenschaft unbestritten und die Zahl der Jugendlichen, für die sie nicht in Betracht kommt, eher niedrig. Zugleich sind die organisatorischen Schwierigkeiten gut zu bewältigen, wenn mit einer offenen, störungsübergreifenden Gruppe gearbeitet wird. Finanziell lohnend ist die Gruppentherapie schließlich auch.
Fabian Schneider stellt sein Konzept einer systemischen Gruppenpsychotherapie mit Jugendlichen in maximal praxisorientierter Weise vor. Er gliedert den Text in überschaubare Abschnitte, deren Aussagen er jeweils in einem Kasten noch einmal kurz zusammenfasst. Zudem wird das konkrete Vorgehen mit einem Fallbeispiel veranschaulicht.
Am Anfang des Buches erörtert der Autor ganz konkrete Fragen der Gruppengröße, des Altersspektrums, der Akquise und der Abrechnungsmöglichkeiten. Letztere wurden mit dem Ziel der Verbreitung von Gruppentherapie seitens der Kassenärztlichen Vereinigung sehr erleichtert: Die Kombination von Gruppentherapie und Einzeltherapie ist unproblematisch, sei es in der Durchführung durch dieselbe Therapeutin oder aber von zwei verschiedenen Therapeutinnen des gleichen Therapieverfahrens. Auch eine gegebenenfalls engmaschige Eingliederung von Terminen mit der Familie oder sonstigen Bezugspersonen ist möglich. Darüber hinaus werden materielle Erfordernisse dargestellt, angefangen von der Raumgröße bis zu den wünschenswerten Materialien.
Aufgrund seines systemischen Therapieverständnisses ist für den Autor die Einbindung der Familie unverzichtbar. Die Familiengespräche vor Beginn der Gruppenarbeit werden genutzt für das Erkennen der familiären Muster, die das Problem aufrechterhalten, undder Funktion, die die Symptomatik in den familiären Beziehungen erfüllt. Es erfolgt die Auftragsklärung und eine Entwicklung erster Lösungsideen mit Eltern und Jugendlichen gemeinsam. Regelmäßig stattfindende begleitende Familien- oder Bezugspersonengespräche werden vereinbart, deren Frequenz an die jeweilige Symptomatik und die Familiendynamik angepasst wird. Geschwistertermine sowie Gespräche mit Großeltern oder auch Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen finden je nach Konstellation ergänzend statt. Die Bedeutung der begleitend zur Gruppentherapie stattfindenden Familiengespräche zeigt sich, so der Autor, nicht zuletzt in Krisensituationen, in denen eine Stabilisierung der Jugendlichen mithilfe des familiären Systems am effektivsten gelingt.
Für die Gruppenarbeit wird eine Ablaufstruktur vorgestellt. Eingehend werden sodann Haltung und Rolle der Therapeutin im Sinne des Prinzips der aktiven Co-Regulation dargestellt. Sie sollte je nach Situation sowohl Zeit haben, auf die tagesaktuellen Bedürfnisse und Themen ihrer Patientinnen ausreichend einzugehen, als auch bei Bedarf aktiv und strukturierend in das Therapiegeschehen einzugreifen und die Gruppe in die gewünschte Richtung zu führen. Um bei ihren Patientinnen das Gefühl der Sicherheit und Selbstwirksamkeit zu fördern, bringt sie ihnen spezifische Techniken und Übungen bei, um Gedanken, Gefühle, Empfindungen und das autonome Nervensystem positiv zu beeinflussen.
In der Gruppe treten die Jugendlichen als Expertinnen für ihre altersgemäßen Probleme auf. Interpersonales Lernen findet nicht zuletzt dadurch statt, dass die Gruppenmitglieder immer wieder zwischen der Rolle der Lösungsideen suchenden Patientin und der der kotherapeutischen Unterstützerin und Problemlöserin wechseln. Dadurch entsteht eine sehr fruchtbare, lösungsorientierte Dynamik, die Gunter Schmidt (2022, S. 64) veranlasst, von der therapeutischen Gruppe als »Kompetenztreibhaus« zu sprechen.
Anschließend wird eine kurze Einführung in die Ego-State-Therapie gegeben und dargestellt, wie auch in der Gruppe individuelle Zugänge zu den verschiedenen Ich-Zuständen angeregt werden können. Nicht zuletzt bei psychosomatischen Beschwerden nutzt der Autor diesen Therapieansatz und kombiniert ihn häufig mit körperpsychotherapeutischen Techniken, die er im Folgenden recht ausführlich darstellt. Dabei kommen mehrere Konzepte zur Sprache, so das des sechsten Sinns nach Daniel Siegel, Peter Levines Theorie der körperlichen Reaktionen auf Verletzungen, die Klopftechnik nach Michael Bohne, das therapeutische Yoga sowie Techniken aus der Polyvagaltheorie. Die jeweils aus diesen Theorien abgeleiteten Anleitungen des Therapeuten werden sehr konkret mit der wörtlichen Ansprache an die Gruppenmitglieder dargestellt, sodass ein ganz anschauliches Bild dieser Arbeit entsteht.
In einem abschließenden Kapitel wird eine Auswahl ergänzender Themen und Interventionen dargestellt, wie das Thema der gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie und des eigenständigen Kochens (das in längeren Abständen in der Praxis mit der Gruppe tatsächlich durchgeführt wird) sowie des Umgangs mit Schlafproblemen und Albträumen. Imaginative Stabilisierungstechniken schließen dieses Kapitel ab.
Der Autor hat ein »Mutmachbuch« geschrieben. Das gelingt nicht nur dadurch, dass er sein gruppentherapeutisches Vorgehen ganz konkret und anschaulich schildert, sondern auch dadurch, dass die Leserin auf jeder Seite des Buches die Begeisterung und Freude des Autors an dieser Arbeit spürt und den Impuls empfindet, selbst möglichst bald mit einer Gruppe von Jugendlichen zu starten. Was hindert Sie noch, liebe Kollegin?
Dr. Wilhelm Rotthaus
Bergheim, im Januar 2025
1Ich schließe mich hier der Praxis des Autors an, für Personen einheitlich die weibliche Form zu verwenden.
1 Einleitung
Dieses Buch soll psychotherapeutische Kolleginnen2 jeglicher Therapieverfahren dazu ermutigen, Gruppenpsychotherapien anzubieten. Denn die Wirkfaktoren, die die Gruppentherapie gegenüber der Einzeltherapie auszeichnen, sind weitgehend unabhängig vom Therapieverfahren. Im Folgenden werden der Leserin eine systemische Grundhaltung, die Struktur der Gruppentherapie sowie Techniken der Gesprächsführung und Kontaktgestaltung vermittelt und ein umfassender Baukasten von Interventionen und Übungen an die Hand gegeben. Veranschaulicht wird die praktische Relevanz der gruppentherapeutischen Arbeit anhand von 21 Fallbeispielen.
Das hier vorgestellte Konzept einer Gruppentherapie mit Jugendlichen soll Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutinnen dazu inspirieren, systemische Therapie, Ego-State-Therapie und Körperpsychotherapie in ihrer Gruppentherapie miteinander zu kombinieren. Es wurde in der ambulanten Praxis entwickelt, kann aber ohne Weiteres auf Gruppentherapien im stationären Setting übertragen werden. Teile dieses Modells können auch in ein bereits bestehendes Gruppentherapiekonzept integriert werden.
Bei einer multimodalen Publikation ergibt sich das Dilemma, dass einerseits mehrere Therapiemethoden in einem Buch behandelt werden, um den Gesamteindruck einer solchen therapeutischen Kombination zu vermitteln. Andererseits würde jeder Therapieansatz für sich genommen bei ausführlicher Darstellung ein ganzes Buch füllen. Daher wurde eine Auswahl derjenigen Teile aus den drei Therapiemethoden getroffen, die sich in der Praxis bewährt haben und für Jugendliche geeignet sind.
Eine seriöse Anwendung der genannten Therapiemethoden setzt selbstverständlich voraus, dass die Therapeutin sich bei fundierten Lehrerinnen fortbildet und sich fachkundig supervidieren lässt.
1.1 Ambulante Gruppentherapien braucht das Land
Im Deutschen Ärzteblatt vom Juli 2020 hieß es anlässlich des Jahrestages der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung (DPtV), bei dem die Gruppentherapie im Mittelpunkt stand:
»Gruppenbehandlungen werden in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung selten angeboten, trotz hoher Wirksamkeit und Effizienz« (Bühring 2020).
Die Zahl der Psychotherapeutinnen, die 2020 ambulante Gruppentherapien in Deutschland anboten, wurde in diesem Artikel auf 300 beziffert, wohingegen 8500 Psychotherapeutinnen eine Berechtigung zur Ausübung von Gruppentherapie in der kassenärztlichen Versorgung hatten. Dabei hatte die Kassenärztliche Vereinigung 2017 und 2019 die Regularien und Abrechnungsmöglichkeiten für die Gruppentherapie vereinfacht, um ihre Attraktivität zu steigern. So gibt es für den Langzeittherapie-Antrag einer Gruppentherapie, anders als bei der Einzeltherapie, kein Gutachterverfahren mehr. Außerdem kann die Gruppenpsychotherapie sowohl bei derselben Therapeutin mit Einzeltherapiesitzungen kombiniert werden als auch mit der Einzeltherapie bei einer anderen niedergelassenen Therapeutin des gleichen Psychotherapieverfahrens.
Auch wenn die Anzahl der angebotenen Gruppentherapien mittlerweile angestiegen sein mag und die in den kinder- und jugendpsychiatrischen Sozialpsychiatriepraxen angebotenen Gruppentherapien nicht mit erfasst sind, so bleibt Gruppentherapie im ambulanten Setting bisher eine Ausnahmeerscheinung. Schäfer (2022, S. 3) bezifferte den Anteil des Einzelsettings an der ambulanten Psychotherapie auf 97%.
Nichtsdestotrotz sehen Strauß und Mattke eine positive Zukunftsperspektive für die ambulante Gruppenpsychotherapie (Strauß u. Mattke 2018, S. 3):
»Wir gehen davon aus, dass Gruppen nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern aufgrund ihres großen Potentials, das wissenschaftlich zunehmend fassbarer wird (vgl. Burlingame et al. 2004, 2013), eine positive Zukunft haben werden und bei der Behandlung vieler Störungsbilder bzw. in vielen Anwendungsbereichen noch sehr an Bedeutung gewinnen werden.«
Langenbach und Pape (2022) nennen in ihrem Übersichtsartikel »Ambulante Gruppentherapie als psychotherapeutisches Behandlungsverfahren« mehrere Studien, die die Wirksamkeit der Gruppenpsychotherapie belegen.
Barkowski et al. (2016) fanden in ihrer Übersicht über metaanalytische Studien, die Primarstudien zum Vergleich von Einzel- und Gruppentherapie zusammenfassten, sowohl störungsspezifisch als auch störungsübergreifend eine vergleichbare Wirksamkeit beider Formate.
Leider gibt es zu wenig wissenschaftliche Evidenz für die Gruppentherapie von Jugendlichen. Tschuschke (1996, S. 38) fasst dies zusammen:
»Gruppentherapeutische Behandlungsansätze von Jugendlichen sind wissenschaftlich bislang kaum untersucht, obwohl klinische Beobachtungen gerade diese Behandlungsform als sehr vielversprechend beschreiben.«
Der amerikanische Psychoanalytiker Yalom, ein Vorreiter der Gruppentherapie für Erwachsene, gewichtet die klinische Relevanz der Gruppentherapie höher als die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Therapieschule (Yalom 2021, S. 23–42). Langenbach und Pape (2022, S. 10) haben Yaloms Darstellung der Wirkfaktoren der Gruppentherapie wie folgt zusammengefasst:
»1. Hoffnung einflößen: Hoffnung in Gruppen entsteht durch die Glaubwürdigkeit des Psychotherapeuten beziehungsweise der Psychotherapeutin und durch die Fortschritte, die die Patientin oder der Patient bei anderen Gruppenmitgliedern wahrnimmt. Dieser Faktor ist oft eine Vorbedingung dafür, dass andere Faktoren überhaupt wirksam werden können.
2. Universalität des Leidens: Viele Patient*innen glauben, nur sie allein hätten belastende oder ängstigende Lebenssituationen, Gedanken, Impulse und Fantasien. Die Relativierung dieser Überzeugung durch den Austausch in der Gruppe bringt Erleichterung und Entlastung mit sich und fördert die Selbstakzeptanz.
3. Mitteilung von Informationen: Hierunter versteht Yalom einerseits psychoedukative Unterweisungen über seelische Gesundheit und Krankheit durch die Psychotherapeutin oder den Psychotherapeuten, andererseits auch Ratschläge, die sich Patient*innen gegenseitig geben.
4. Altruismus: Anfangs glauben viele Patient*innen, den anderen Gruppenmitgliedern nichts Wertvolles bieten zu können. Doch bald werden engagierte Anmerkungen von Gruppenmitgliedern gern aufgenommen und als besonders glaubwürdig hoch geschätzt. Die Erfahrung, für andere wichtig sein zu können, hebt das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung der Gruppenmitglieder.
5. Entwicklung von Techniken des mitmenschlichen Umgangs: Soziales Lernen in Gruppen kann explizit oder indirekt stattfinden. Gruppentherapiepatient*innen, die länger an Gruppen teilnehmen, lernen nachweislich eine Reihe positiver sozialer Fertigkeiten im Umgang mit ihren Mitmenschen. Dazu gehören unter anderem Techniken der Konfliktlösung, Toleranz und Einfühlung in andere.
6. Nachahmendes Verhalten: Gruppenpsychotherapeut*innen und auch Gruppenmitglieder mit ähnlichen Problemen und guten Therapieerfolgen dienen als Modelle, zum Beispiel für Selbstenthüllung und für Unterstützung. Neue Mitglieder orientieren sich in ihrem Verhalten an ›älteren‹ Gruppenmitgliedern, mit denen sie sich identifizieren können, oder an der Psychotherapeutin beziehungsweise dem Psychotherapeuten.
7. Interpersonales Lernen: Yalom sieht diesen Faktor als besonders wichtig und komplex an; in seinen Fragebögen ist er in ›Input‹ (wie andere einen sehen) und ›Output‹ (wie man mit anderen umgeht) aufgeteilt. Da es den Patient*innen oft an engen zwischenmenschlichen Beziehungen fehlt, ist die Gruppe als sozialer Mikrokosmos ein wichtiger Ort für korrigierende emotionale Erfahrungen und ehrliche Rückmeldungen zu ihrem Sozialverhalten und damit für die Entwicklung alternativer Interaktionsmöglichkeiten. Das beinhaltet auch das Durcharbeiten von Beziehungen zu anderen Gruppenmitgliedern und das Erkennen von Übertragungen, wobei er dem Konzept der ›genetischen Einsicht‹ im Sinne frühkindlicher Zusammenhänge eine eher untergeordnete Bedeutung zumisst.
8. Gruppenkohäsion: Der Gruppenzusammenhalt oder das Wir-Gefühl einer Gruppe ist ähnlich wichtig wie die therapeutische Beziehung in der Einzeltherapie. Psychotherapeut*innen investieren viel Energie in den Aufbau von Gruppenkohäsion, weil die Kohäsion eine entscheidende Vorbedingung dafür ist, dass andere therapeutische Faktoren wirksam werden können.
9. Katharsis: Hier geht es um den offenen Ausdruck von intensiven Gefühlen. Katharsis scheint notwendig und wirksam für ein gutes Therapieergebnis zu sein, vor allem wenn der interpersonale Kontext berücksichtigt wird und stützende Gruppenbindungen entstanden sind. Blindes Ausagieren von Gefühlen hat dagegen eher ungünstige Folgen.
10. Existenzielle Faktoren: Gruppen kommen immer wieder auf Themen wie Leben und Tod, Krankheit und Gesundheit, Einsamkeit und Gemeinsamkeit, Verantwortung und Ausgeliefertsein zu sprechen. Erfahrene Gruppenmitglieder betrachten existenzielle Einsichten als bedeutsam für ihre Fortschritte. Die existenziellen Faktoren spielen bei Patient*innen mit lebensbedrohlichen Krankheiten oder bei Hinterbliebenengruppen eine besonders große Rolle.«
Es gibt also genug Argumente, den geringen Anteil der Gruppentherapie an der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung zu steigern, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche. Erwähnenswert ist, dass Gruppentherapie im stationären Setting sehr viel häufiger angeboten wird als in der ambulanten Versorgung. Die Kliniken haben demnach die Bedeutung der Gruppentherapie erkannt und setzen sie um. Sicherlich wäre es interessant, zu untersuchen, aus welchen Gründen die Häufigkeit von Gruppentherapien im stationären und im ambulanten Setting so weit auseinanderklafft.
Kurz gefasst:
Während sich Gruppentherapien im stationären Setting fest etabliert haben, bleiben sie im ambulanten Setting eine Ausnahmeerscheinung.
Die Kassenärztliche Vereinigung fördert ambulante Gruppentherapie durch ein vereinfachtes Antragsverfahren und flexible Möglichkeiten der Kombination mit Einzeltherapie.
Wissenschaftliche Evidenz bestätigt die Wirksamkeit von Gruppentherapien als gleichwertig mit der von Einzeltherapien.
Unabhängig von der therapeutischen Schule wirken in Gruppentherapien Gruppeneffekte, die in Einzeltherapien nicht zum Tragen kommen.
Dieses Buch stellt ein spezifisches Konzept für eine systemische Gruppentherapie vor, das Konzepte aus der Ego-State-Therapie und der Körperpsychotherapie integriert.
1.2 Familiengespräche als Basis der systemischen Gruppentherapie
Jede Mutter will eine gute Mutter,
jeder Vater will ein guter Vater,
jedes Kind will ein gutes Kind sein.
Wilhelm Rotthaus
Das systemische Konzept der hier vorgestellten Gruppentherapie basiert auf einer kombinierten Terminplanung von Gruppenterminen und Familiengesprächen. Die Einbindung der Familie ist dabei von grundlegender Bedeutung und unverzichtbar.
Abbildung 1 zeigt, wie die Familie, die Therapiegruppe und die Peergruppe der Jugendlichen bei dem hier vorgestellten Konzept miteinander in Verbindung stehen: Die Jugendliche ist Teil der Familie und der Therapiegruppe. Gleichzeitig ist sie auch Mitglied ihrer Peergruppe oder, falls sie sozial isoliert sein sollte, strebt sie idealerweise den Aufbau eines Freundeskreises an. Die Therapeutin ist sowohl Teil der Therapiegruppe als auch im Kontakt mit der Familie.
Abb. 1: Die Beziehungen zwischen Patientin, Therapeutin, Therapiegruppe, Familie und Peergruppe (© Victoria Schumacher)
Da die Familie naturgemäß der primäre Lebenskontext einer Jugendlichen ist, kann die Therapeutin ihre Patientin und deren Symptomatik unter Einbeziehung der Familie am besten verstehen. Die Beobachtung und Analyse der familiären Interaktion und Kommunikation, die sich erst in Familiengesprächen mit allen Familienmitgliedern in einem Raum manifestiert, ist dafür eine Grundvoraussetzung. Dies zeigt sich am deutlichsten in Krisensituationen, in denen eine Stabilisierung der Jugendlichen mithilfe des familiären Systems am effektivsten gelingt.
Die Entwicklung einer Jugendlichen steht in Wechselwirkung mit der Entwicklung ihrer Eltern und Geschwister. Wie das Konzept der komplementären Entwicklungsaufgaben von Wilhelm Rotthaus (siehe Abschnitt 5.1) zeigt, werden die Entwicklungsschritte einer Jugendlichen durch komplementäre Entwicklungsschritte der Eltern wesentlich beeinflusst. Entwicklung vollzieht sich als familiäre Koevolution.
Daraus folgt, dass die Prozesse der Auftragsklärung (siehe Abschnitt 2.3) und der Entwicklung von Lösungsideen nur mit Eltern und Jugendlichen gemeinsam gelingen können. Wenn der Kontakt zu den Eltern abgebrochen ist, sollten stattdessen die engsten Bezugspersonen der Jugendlichen, zum Beispiel Pflege- und Adoptiveltern oder Wohngruppenbetreuerinnen, in die Behandlung einbezogen werden.
Ein wesentliches Ziel der Auftragsklärung besteht darin, die Aufmerksamkeit der Klientinnen vom Problemverhalten und -erleben auf das gewünschte, zukünftige Verhalten und Erleben umzulenken. Diese Aufmerksamkeitsfokussierung ist dann besonders effektiv und nachhaltig, wenn sie nicht alleine bei der Patientin, sondern möglichst bei allen Familienmitgliedern evoziert werden kann.
Daher werden zusätzlich zu den Gruppenterminen in regelmäßiger Frequenz Familien- oder Bezugspersonengespräche vereinbart, deren Häufigkeit an die jeweilige Symptomatik und die Familiendynamik angepasst wird. Auch andere Familienmitglieder wie zum Beispiel Geschwister oder involvierte Großeltern beeinflussen mitunter den Therapieverlauf entscheidend und werden daher je nach Familienkonstellation eingeladen. Diese sogenannten Setting-Entscheidungen der Therapeutin, also die Frage, wen sie wann zum Gespräch einlädt, sind von elementarer strategischer Bedeutung für den Therapieverlauf (siehe Abschnitt 2.4).
Rotthaus widmet dem Thema »Setting als Intervention« in seinem Artikel »Der aktuelle Stand der Systemischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie« einen eigenen Abschnitt (Rotthaus 2023a, S. 109):
»Dadurch, dass mehrere Personen Veränderungsimpulse erhalten und die Therapeutin dadurch eine Chance hat, im System eine Koevolution anzuregen, wird eine hohe Nachhaltigkeit des Therapieprozesses erreicht. Eine Reihe von Studien konnten nachweisen, dass Systemische Therapie nicht unbedingt erfolgreicher als andere Verfahren ist, dass der Behandlungserfolg aber in weniger Therapiestunden erreicht wird und ansteigt, je länger die Katamnesezeit andauert. Im Mehrpersonensetting ist es am einfachsten zu erreichen, das Kind aus der Sündenbockrolle zu befreien, in die viele Kinder und Jugendliche, die vorgestellt werden, in den Monaten und Jahren zuvor geraten.«
Bei getrennten Eltern, die nicht zu einem gemeinsamen Gespräch bereit sind, sollten getrennte Elterngespräche mit Vater und Mutter angeboten werden, sofern die Jugendliche zu beiden Kontakt hat. Keineswegs sollte aber auf Familiengespräche verzichtet werden.
Die Kassenärztliche Vereinigung erlaubt, im Therapieantrag an die Krankenkassen ein flexibles Verhältnis von Familiengesprächen zu Gruppentherapieterminen zu beantragen. Die Therapeutin kann also durchaus von dem in der Richtlinientherapie üblichen Standardverhältnis von einem Bezugspersonen-Termin zu vier Jugendlichen-Terminen abweichen zugunsten häufigerer Familiengespräche, wenn dies als erforderlich angesehen wird. Die Krankenkasse genehmigt im Bewilligungsbescheid die entsprechende Anzahl von Gruppen- und Bezugspersonenterminen.
Die neueste Entwicklung der systemischen Gruppentherapie hat die sogenannte Multifamilientherapie hervorgebracht, bei der mehrere Familien in einem Raum behandelt werden. Dieser vielversprechende Ansatz ist zwar für niedergelassene Psychotherapeutinnen aufgrund der Raumgröße, die für mehrere Familien erforderlich ist, in der Regel nicht realisierbar, zeigt aber, welche Möglichkeiten das Gruppentherapiekonzept birgt. Die Multifamilientherapie wird zum Beispiel am Institut für Systemische Familientherapie, Supervision und Organisationsentwicklung (ifs) in Essen gelehrt und an der Tagesklinik Pionierstrasse, Klinik und Ambulanz für Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und Psychotherapie in Köln, praktiziert. Asen und Scholz (2019) sowie Liddle (2009) haben dieses Konzept theoretisch dargestellt und manualisiert.
Kurz gefasst:
Entwicklungsschritte von Jugendlichen setzen komplementäre Entwicklungsschritte ihrer Eltern voraus.
Die Stabilisierung von Jugendlichen in Krisensituationen gelingt meist nur unter Einbeziehung der Familie.
Die Therapeutin kann die Symptomatik der Jugendlichen nur im Familienkontext, das heißt im Gespräch mit allen Familienmitgliedern, wirklich verstehen.
Studien zeigen, dass die systemische Therapie unter Einbeziehung der Familie zwar nicht besser, aber mit weniger Terminen und nachhaltiger wirkt als Einzeltherapie.
Die Vereinbarung von Familiengesprächen und die Setting-Entscheidungen der Therapeutin sind entscheidend für den Therapieverlauf.
Bei der Krankenkasse können häufigere Familiengespräche beantragt werden. Das in der Richtlinientherapie übliche Verhältnis von einem Bezugspersonen-Termin zu vier Jugendlichen-Terminen kann zugunsten der Bezugspersonengespräche verändert werden.
1.3 Eine neue Struktur für aktive Co-Regulation
Wie kann die Gruppentherapeutin ihre jugendlichen Patientinnen im störungsübergreifenden Gruppensetting am besten erreichen, auf sie eingehen und ihnen das Gefühl von Sicherheit geben?
In einer störungsübergreifenden Gruppentherapie wie der hier dargestellten kommen Patientinnen mit sehr unterschiedlichen Funktionsniveaus zusammen. Will man Jugendlichen mit zum Beispiel Angststörungen oder traumatischem Hintergrund in der Gruppe gerecht werden, erfordert dies von der Therapeutin die Fähigkeit, flexibel im Kontakt auf die jeweiligen emotionalen Bedürfnisse der Patientinnen einzugehen. Die Praxis der aktiven Co-Regulation ermöglicht es, den Jugendlichen ein Gefühl der Sicherheit zu geben und so den Teil des autonomen Nervensystems zu aktivieren, der Kontakt und soziale Interaktion ermöglicht. So kann es gelingen, die verschiedenen Patientinnen in das Gruppengeschehen zu integrieren.
Das Konzept der Co-Regulation stammt aus der Erforschung der Interaktion zwischen Eltern und Kindern. In der Psychotherapie beschreibt Co-Regulation einen Prozess, bei dem die Therapeutin aktiv daran beteiligt ist, durch reziproke Interaktion mit den Klientinnen diesen zu helfen, ihre Emotionen zu regulieren. Erfolgreiche Co-Regulation führt bei der Patientin zu einem Gefühl der Sicherheit und ist heilungsfördernd.
Porges und Porges (2023, S. 104) beschreiben Co-Regulation als grundsätzliches menschliches Bedürfnis:
»Aus Sicht der Polyvagal-Theorie geht es bei der sozialen Interaktion um die Förderung der Co-Regulation. Damit ist gemeint, dass unser Körper in der Lage sein muss, im Kontakt mit anderen Menschen Hinweise für Sicherheit sowohl zu senden als auch zu empfangen. Sind wir dazu in der Lage, können wir unser Nervensystem so steuern, dass wir Zustände erreichen, die Gesundheit, Entwicklung und Regeneration fördern.«
Welcher strukturellen Voraussetzungen bedarf es in einer Gruppentherapie, damit die Therapeutin das Prinzip der aktiven Co-Regulation im Kontakt mit ihren Patientinnen umsetzen kann? Sie sollte je nach Situation sowohl Zeit haben, auf die tagesaktuellen Bedürfnisse und Themen ihrer Patientinnen ausreichend einzugehen, als auch bei Bedarf aktiv und strukturierend in das Therapiegeschehen einzugreifen und die Gruppe in eine entwicklungsfördernde Richtung zu führen. Um bei ihren Patientinnen das Gefühl der Sicherheit und der Selbstwirksamkeit zu fördern, bringt sie ihnen spezifische Techniken und Übungen bei, um Gedanken, Gefühle, Empfindungen und das autonome Nervensystem positiv zu beeinflussen.
Hierfür erweist sich weder das Vorgehen anhand eines durchstrukturierten verhaltenstherapeutischen Manuals noch die psychoanalytische Haltung der therapeutischen Abstinenz als geeignet. Wenn in einem Manual die Themen jeder Sitzung vorgegeben sind beziehungsweise durchgearbeitet werden müssen, lässt dies zu wenig Raum, um ausführlich auf die aktuellen Anliegen und Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen. Sollte andererseits die Therapeutin sich weitgehend abstinent verhalten und den Gesprächsverlauf und die Themenwahl ausschließlich der Gruppe überlassen, kann sie sich nicht ausreichend aktiv einbringen, um ihre Patientinnen bei der Emotionsregulation zu unterstützen und so zu stabilisieren. Um sich sicher zu fühlen und sich weiterzuentwickeln, benötigen die Jugendlichen eine Therapeutin in einer aktiven Führungsrolle. Auch wenn die Gruppenteilnehmerinnen viele Lösungsideen und Ressourcen in die Gruppentherapie einbringen, so bedürfen sie dennoch der Unterstützung und neuer Impulse durch die Therapeutin.
Die folgende Struktur der Gruppensitzung (siehe Abb. 2) ermöglicht der Therapeutin, die aktive Co-Regulation in die Praxis umzusetzen. Sie bietet der Therapeutin sowohl Raum, auf die von den Gruppenmitgliedern thematisierten Nöte und Probleme einzugehen, als auch die Möglichkeit, den Jugendlichen ein vielfältiges Repertoire zur Steuerung ihrer Emotionen und Konflikte an die Hand zu geben. Detailliert wird dieses Vorgehen in Kapitel 4 beschrieben.