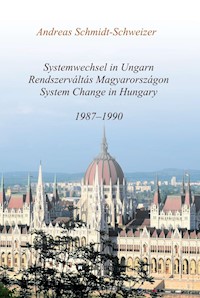
Systemwechsel in Ungarn / Rendszerváltás Magyarországon / System Change in Hungary E-Book
Andreas Schmidt-Schweizer
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Publikation in deutscher, ungarischer und englischer Sprache behandelt den politischen Systemwechsel in Ungarn in den Jahren von 1987 bis 1990. Sie stellt die Bilanz von wissenschaftlichen Forschungen dar, die der Verfasser in den vergangenen drei Jahrzehnten in Ungarn durchgeführt hat. Über die Wissenschaft hinaus wendet sich die Arbeit - auch vor dem Hintergrund der gegenwärtigen politischen Entwicklungen und Diskussionen in Ungarn - an einen breiten Kreis historisch und politisch interessierter Leser. A jelen kiadvány az 1987 és 1990 közötti magyarországi politikai rendszerváltást tárgyalja német, magyar és angol nyelven. E munka azoknak a tudományos kutatásoknak a mérlegét vonja meg, amelyeket a szerző az elmúlt három évtizedben Magyarországon folytatott. A tanulmányt a tudományos világon túl - tekintettel a jelenlegi magyarországi politikai folyamatokra és vitákra is - elsősorban a történelem és politika iránt érdeklődő olvasók széles körének figyelmébe ajánljuk. This study in German, Hungarian and English deals with the political transformation, that is, the political-system change, in Hungary between 1987 and 1990. It presents the results of academic research conducted by the author in Hungary over the past three decades. Beyond the academic world, the work speaks - against the background of current political developments and discussions in Hungary - to a broad circle of readers interested in history and politics.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Andreas Schmidt-Schweizer
„Verhandelte Revolution“ oder „Transformation von innen“?
Charakteristika und Hintergründe des politischenSystemwechsels in Ungarn 1987–1990
„Tárgyalásos forradalom“ vagy „rendszerváltás belülről“?
Az 1987–1990 közötti magyarországi politikai átmenetsajátosságai és háttere
"Negotiated revolution" or "transformation from within"?
Characteristics and Background of the Political-System Change in Hungary 1987–1990
© 2020 Andreas Schmidt-Schweizer
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-10228-6
Hardcover:
978-3-347-10229-3
e-Book:
978-3-347-10230-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis / Tartalomjegyzék / Table of contents
Vorwort
Előszó
Preface
„Verhandelte Revolution“ oder „Transformation von innen“?
I. Einführende Bemerkungen
II. Verlauf und Eigenarten des Systemwechsels
III. Hintergründe des Verlaufs des Systemwechsels
IV. Schlussbemerkungen
„Tárgyalásos forradalom“ vagy „rendszerváltás belülről“?
I. Bevezető megjegyzések
II. A rendszerváltás története és sajátosságai
III. A rendszerváltás háttere
IV. Záró megjegyzések
“Negotiated revolution” or “transformation from within”?
I. Introductory remarks
II. Course and characteristics of the system change
III. Background of the course of the system transformation
IV. Final remarks
Chronologie
Kronológia
Chronology
Quellen – Források – Sources
Literatur – Irodalom – Literature
Vorwort
Die Studie, die hier in deutscher, ungarischer und englischer Sprache vorgelegt wird, ist die Bilanz von wissenschaftlichen Forschungen, die der Verfasser in den vergangenen drei Jahrzehnten über die politische Systemtransformation in Ungarn im letzten Drittel der 1980er Jahre durchgeführt hat. Aus diesen Untersuchungen gingen zahlreiche Publikationen hervor, die – zusammen mit der relevanten Sekundärliteratur und den wichtigsten Quellensammlungen in den genannten drei Sprachen – im Quellen- und Literaturverzeichnis aufgeführt sind. Anhand dieses Verzeichnisses, dass auch eine Übersetzung der Titel in die jeweiligen beiden anderen Sprachen enthält oder – eventuell – auf eine Version in einer zweiten Sprache verweist, kann sich der Leser vertieft mit dem Thema auseinandersetzen. Auch deshalb, insbesondere aber im Interesse einer erleichterten Lesbarkeit, verzichtet die Arbeit auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat. Nach drei Jahrzehnten, die der politische Systemwechsel in Ungarn nunmehr zurückliegt, und vor dem Hintergrund der gegenwärtigen politischen Situation in Ungarn erschien es dem Verfasser wichtig, einen mehrsprachigen, komprimierten und wissenschaftlich fundierten Rückblick auf diese spektakulären Jahre vorzulegen, der sich – über die Wissenschaft hinaus – insbesondere an einen breiten Kreis von historisch und politisch interessierten Lesern richtet.
Andreas Schmidt-SchweizerBudapest, im August 2020
Előszó
Jelen tanulmány, amely német, magyar és angol nyelven egyaránt olvasható, azoknak a tudományos kutatásoknak a mérlegét vonja meg, amelyeket a szerző az elmúlt három évtizedben folytatott az 1980-as évek utolsó harmadában zajló magyarországi politikai rendszerváltásával kapcsolatban. Ezekből a vizsgálatokból számos publikáció született, amelyek listája – a három nyelven megjelent releváns szekunderirodalommal és a legfontosabb forrásgyűjteményekkel kiegészítve – a felhasznált forrásoknál és szakirodalomnál található meg. Az irodalomjegyzék tartalmazza a címek idegen nyelvi fordításait, és adott esetben utal a publikáció másik nyelven megjelent verziójára is. Ez alapján az olvasó jobban elmélyedhet a témában. A könnyebb olvashatóság kedvéért a munka nem tartalmaz tudományos jegyzetapparátust. Három évtizeddel a politikai rendszerváltás után, tekintettel Magyarország jelenlegi politikai helyzetére is, a szerző fontosnak tartja egy több nyelven megjelenő, tömör és tudományosan megalapozott visszatekintés közreadását a nevezetes évekről, amelyet – a tudományos világ mellett – elsősorban a történelem és politika iránt érdeklődők széles körének figyelmébe ajánl.
Schmidt-Schweizer, AndreasBudapest, 2020. augusztusa
Preface
This study, which is presented here in German, Hungarian and English, is the result of academic research conducted by the author over the past three decades on the transformation of the political system in Hungary in the last third of the 1980s. These investigations have resulted in numerous publications, which – together with the relevant secondary literature and the most important source collections in the three languages mentioned – are set out in the list of sources and literature. Based on this list, which also contains a translation of the titles in the other two languages, and refers to versions in a second language, the reader can deal with the topic in greater depth. Also, for this reason, but especially in the interest of readability, the work dispenses with an academic annotation apparatus. After the three decades that have now passed since the change of the political system in Hungary, and against the background of the current political situation in that country, it seemed important to the author to present a multilingual, concise and scientifically based review of these spectacular years, one that – beyond the academic world – is aimed particularly at a broad circle of readers interested in history and politics.
Andreas Schmidt-SchweizerBudapest, August 2020
„Verhandelte Revolution“ oder „Transformation von innen“?
Charakteristika und Hintergründe des politischen Systemwechsels in Ungarn 1987-1990
I. Einführende Bemerkungen
Im letzten Drittel der 1980er Jahre setzten in den Staaten des sogenannten Ostblocks radikale politische Veränderungsprozesse ein, hinter denen sich letztlich die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politisch-ideologische Totalkrise der sozialistischen Systeme verbarg. Diese dynamischen Entwicklungen, denen die Sowjetunion unter Michail Gorbatschow nichts mehr entgegensetzte, führten bekanntlich zum Ende der sogenannten realsozialistischen Ordnungen und zur Etablierung demokratischmarktwirtschaftlicher Systeme nach westeuropäischem Muster. Diese Prozesse wiesen im Hinblick auf ihren zeitlichen Verlauf und ihre Art und Weise allerdings deutliche Unterschiede auf. (Auf die – gegenwärtig besonders aktuelle Frage – der Stabilität bzw. Dauerhaftigkeit der damals entstandenen politisch-wirtschaftlichen Ordnungen soll hier nicht eingegangen werden, die Kenntnis der jüngsten Geschichte könnte aber hilfreich sein, auch diesbezüglich Antworten zu finden.)
In der wissenschaftlichen Forschung wurden in den vergangenen Jahrzehnten die unterschiedlichsten Bezeichnungen verwendet, um die Transformationsprozesse in den einzelnen Staaten Ostmittel- und Südosteuropas zu charakterisieren. So wurden etwa – ausgenommen der Fall Rumäniens – die Begriffe „friedliche“ oder „samtene Revolution“, „lawfull“ oder „self-limiting revolution“ bzw. „reglementierte Revolution“ oder „Refolution“ verwendet, wobei mit Letzterem auf die Vermischung von Elementen einer Revolution und einer Reform angespielt wurde. Für den Verlauf des Systemwechsels in Polen und Ungarn wurde – und wird – in der Politik- und Geschichtswissenschaft in der Regel von einer „ausgehandelten“ oder „verhandelten Revolution“ gesprochen. Dieses Narrativ rückt die politischen Ausgleichsgespräche am Runden Tisch, also die Verhandlungen zwischen den Machthabern und der Opposition, in den Mittelpunkt des Transformationsprozesses.
Hinsichtlich der historischen Aufarbeitung des politischen Systemwechsels in Ungarn offenbart sich gegenwärtig die paradoxe Situation, dass zwar einerseits eine große Zahl von grundlegenden Quellen – nicht nur in ungarischer Sprache – in Form von gedruckten Publikationen oder über das Internet allgemein zugänglich ist und dass das – zum allergrößten Teil erhalten gebliebene – zentrale Quellenmaterial der Umbruchsjahre der Forschung in den ungarischen Archiven auch weiterhin zur Verfügung steht. Andererseits wird das vorherrschende Bild dieses historischen Prozesses in der Wissenschaft und Öffentlichkeit noch immer im Wesentlichen von den subjektiven Erfahrungen der damaligen Akteure geprägt, die – insbesondere auf Seiten der damaligen antisozialistischen Opposition – oft als Geistes- und Sozialwissenschaftler tätig waren bzw. sind. Ein wirklicher kontroverser, wissenschaftlich konstruktiver und über die Grenzen Ungarns hinausreichender Diskurs über den Charakter des ungarischen politischen Systemwechsels wurde bislang nicht geführt und wird wohl auch in absehbarer Zeit nicht geführt werden. Einer objektiven wissenschaftlichen Behandlung der Thematik stand und steht vor allem auch der Versuch der ungarischen Politik im Wege, die damaligen Ereignisse für ihre politischideologischen Zwecke zu instrumentalisieren und die Wissenschaft in diesem Sinne „einzuspannen“.
Die vorliegende historiografische Arbeit stellt im ersten Teil, losgelöst vom Korsett der – für den ungarischen Fall eher irreführenden und wenig aussagekräftigen – politikwissenschaftlichen Transformationstheorien, die meines Erachtens entscheidenden Ereignisse und Entwicklungen des ungarischen politischen Systemwechsels vor, zeigt die Rolle der einzelnen Akteure auf und geht letztlich der Frage nach, ob hier tatsächlich eine Charakterisierung als „verhandelte Revolution“ oder überhaupt als „etwas Verhandeltes“ zutreffend ist. Im zweiten Teil werden einige wesentliche Hintergründe für den dargelegten spezifischen Verlauf der politischen Systemtransformation in Ungarn dargelegt. Hierzu ist es notwendig, einen kurzen Blick auf das sich nach dem Volksaufstand vom Herbst 1956 herausbildende politisch-ökonomische System, auf den sogenannten Kádárismus, zu werfen.
II. Verlauf und Eigenarten des politischen Systemwechsels in Ungarn
Mitte der 1980er Jahre geriet der ungarische Reformsozialismus – ähnlich den anderen kommunistischen Ordnungen im östlichen Europa – in eine offene, tiefe und umfassende Krise, die insbesondere im Bereich der Wirtschaft dramatische Ausmaße annahm. Das mangelhafte Funktionieren der realsozialistischen Ökonomien (einschließlich der liberalisierten Zentralverwaltungswirtschaft Ungarns) wurde nun – vor allem durch den Rückgang der Produktivität, durch den Verfall der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie durch die wachsende technologische Zurückgebliebenheit bzw. den Mangel an Innovation – besonders offensichtlich. Parallel hierzu verschärften sich deviante Erscheinungen wie Selbstmord und Alkoholismus in der Gesellschaft, und im Bereich der Ideologie klafften Anspruch und Wirklichkeit immer weiter auseinander. Die ökonomischen Schwierigkeiten Ungarns wurden dadurch noch verschärft, dass die ungarische Führung seit den 1970er Jahren in zunehmendem Maße auf Westkredite zurückgegriffen hatte, um damit ihre Politik des kontinuierlich wachsenden Lebensstandards, den sogenannten Gulaschkommunismus, zu finanzieren. Ergebnis dieser Politik war, dass Ungarn in eine Schuldenfalle geriet und schließlich kaum mehr in der Lage war, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.
Die überalterte Führung der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (MSZMP) um János Kádár, der sogenannte Kádár-Zirkel, stand diesen Entwicklungen seit Herbst 1986, nach drei Jahrzehnten der Alleinherrschaft, immer ratloser gegenüber, und war deshalb schließlich auch bereit, neue, jüngere Kräfte in Führungspositionen aufsteigen zu lassen. Im Zuge des Mitte 1987 beginnenden Generationswechsels wurde das Politbüro-Mitglied Károly Grósz – dem der Kádár-Zirkel die Überwindung der Krise unter Wahrung der führenden Rolle der Partei am ehesten zutraute – zum Ministerpräsidenten ernannt, und der junge, marktwirtschaftlich versierte Ökonom Miklós Németh übernahm die Leitung der Wirtschaftspolitik. Beide Politiker verfolgten nun – vor dem Hintergrund der durch Gorbatschow eröffneten Möglichkeiten – einen Kurs, der nicht nur radikale ökonomische Spar- und Rationalisierungsmaßnahmen zur Krisenbekämpfung, sondern auch den Übergang zu einer „regulierten Marktwirtschaft“ vorsah. In dieser sollte zwar einerseits weiterhin der sozialistische Sektor (Staatsbetriebe und Genossenschaften) eine vorrangige Rolle spielen, andererseits sollten aber auch die Eigentumsformen, insbesondere im (begrenzten) Privatsektor, entwickelt werden und es war vorgesehen, das Wirtschaftsleben selbst nicht mehr vorrangig durch den Plan, sondern im Wesentlichen durch den Markt zu koordinieren. (Damit ging das Vorhaben weit über die Ziele der ungarischen Wirtschaftsreformen von 1966/1968 hinaus.)
Für die weiteren politischen Entwicklungen war von besonderer Bedeutung, dass der neue wirtschaftspolitische Kurs durch innenpolitische Liberalisierungsmaßnahmen flankiert werden sollte, d. h. durch die prinzipielle Ausweitung der Freiheitsrechte der Bevölkerung im Rahmen des Einparteiensystems einschließlich der – im östlichen Lager einzigartigen – Gewährung eines weltweit gültigen Reisepasses für die ungarischen Staatsbürger. Hinter diesem Schritt verbarg sich die Auffassung, dass die Bekämpfung der Wirtschaftskrise und der Übergang zum Marktmechanismus nur bei aktiver Mitwirkung der mit politisch-ökonomischen Rechten ausgestatteten, durch den Paternalismus Kádárs bis dahin politisch entmündigten und passiven Bevölkerung sowie nur unter offener Artikulation der gesellschaftlichen Interessen erfolgreich sein könnten. Natürlich beabsichtigte die Führung mit ihren politischen Reformen auch, die Bevölkerung für die mit der wirtschaftlichen Konsolidierungs- und Transformationsphase – zumindest vorübergehend – verbundenen Einschränkungen im Lebensstandard zu entschädigen. Im ungarischen Fall sehen wir so deutlich, dass der politische Veränderungsprozess nicht aufgrund von Druck aus der Bevölkerungsmasse oder aus Oppositionskreisen – oder gar durch einen „Freiheitskampf des Volkes“ – in Gang gesetzt wurde, sondern in erster Linie durch radikale ökonomische Vorhaben, zu denen sich jüngere „einsichtige Kräfte“ in den Reihen der Machthaber vor dem Hintergrund der katastrophalen Wirtschaftslage und gegen den hinhaltenden Widerstand des Kádár-Zirkels durchgerungen hatten.
Nachdem Mitte 1987 bereits vier wesentliche Merkmale des Kádárismus, nämlich die Prinzipien der Plankoordinierung der Wirtschaft (in Form einer liberalisierten Zentralverwaltungswirtschaft), des kontinuierlich steigenden Lebensstandards, der Vollbeschäftigung und der politischen Nicht-Mobilisierung der Bevölkerungsmassen aufgegeben worden waren, fand die Ära Kádár im Frühjahr 1988 – mit der Ablösung János Kádárs als Generalsekretär – auch ihr offizielles Ende. Die Kräfte um den neuen Parteivorsitzenden, Ministerpräsident Károly Grósz, sowie um den Wirtschaftspolitiker Miklós Németh, den Generalsekretär der Patriotischen Volksfront, Imre Pozsgay, und den „Vater der Wirtschaftsreformen von 1968“, Rezső Nyers, gingen nun daran, die – vom Kádár-Zirkel nicht wirklich akzeptierte – Konzeption der regulierten Marktwirtschaft umzusetzen. Gleichzeitig implementierten sie im Zeichen des „sozialistischen Pluralismus“ eine Reihe von politischen Reformen, die vor allem der Gewährung des Versammlungs- und Vereinigungsrechts im Rahmen des Einparteiensystems, der Entwicklung der Arbeitnehmerrechte sowie der Entfaltung der innerparteilichen Demokratie dienen sollten.
Diese Politik löste allerdings – ähnlich wie in der Tschechoslowakei während des Prager Frühlings 1968 – in der ungarischen Gesellschaft dynamische Pluralisierungsprozesse aus, die in diesem Ausmaß von der neuen Partei- und Staatsführung nicht erwartet worden waren und schnell den Rahmen des „sozialistischen Pluralismus“ sprengten. So kam es seit Frühjahr 1988 zur Gründung einer Vielzahl von Verlagen, alternativen Gewerkschaften und parteiunabhängigen gesellschaftlichen Vereinigungen, die bereits bestehenden oppositionellen Gruppierungen (insbesondere die liberalurbane „Demokratische Opposition“ und die nationaltraditionalistische „Volkstümliche Opposition“) die intensivierten ihre Aktivitäten und es erfolgte die Neugründung oder Reaktivierung von politischen Organisationen bzw. Parteien, die bereits offen bürgerlichdemokratische Zielsetzungen verfolgten. Diese Pluralisierungsprozesse beschränkten sich im Allgemeinen allerdings auf die hauptstädtischen, zersplitterten und untereinander stark zerstrittenen kleinen Intellektuellenkreise, waren mit keiner dauerhaften Massenmobilisierung verbunden und konnten so auch keinen unmittelbaren, wirksamen und zielgerichteten politischen Druck auf die Herrschenden ausüben. Die diffusen innenpolitischen Entwicklungen stellten die Machthaber aber spätestens im Herbst 1988 vor die Alternative, die Pluralisierungsprozesse entweder – wie 1968 in der Tschechoslowakei oder 1956 in Ungarn – gewaltsam zu unterdrücken, oder die Veränderungen zu akzeptieren und zu versuchen, sich an ihre Spitze zu stellen, um den politischen Veränderungsprozess „in Eigenregie“ zu vollziehen und zu ihren eigenen Gunsten zu beeinflussen.





























