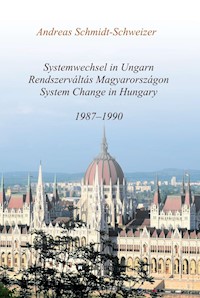Die Kulturbeziehungen zwischen der Volksrepublik Ungarn und den beiden deutschen Staaten A Magyar Népköztársaság és a két német állam közti kulturális kapcsolatok (1949-1989/90) E-Book
Andreas Schmidt-Schweizer
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch behandelt die Kulturbeziehungen zwischen der Volksrepublik Ungarn und den beiden deutschen Staaten im Zeitalter der bipolaren Weltordnung (1949-1989/90).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Andreas Schmidt-Schweizer
Die Kulturbeziehungen zwischen der Volksrepublik Ungarn und den beiden deutschen Staaten
A Magyar Népköztársaság és a két német állam közti kulturális kapcsolatok
(1949–1989/90)
© 2022 Andreas Schmidt-Schweizer
ISBN Hardcover:
978-3-347-74403-5
ISBN E-Book:
978-3-347-74404-2
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Einleitende Bemerkungen
Erste Phase (1949–1959): Rudimentäre Anfänge der ostdeutsch-ungarischen kulturellen Kontakte
Zweite Phase (1959–1965): Konsolidierung und Ausbau der ostdeutsch-ungarischen Kulturbeziehungen, Beginn marginaler westdeutschungarischer Kulturkontakte
Dritte Phase (1965–1973): Dynamisierung der ostdeutsch-ungarischen Kulturbeziehungen, „vernünftige Ausweitung“ der westdeutschungarischen Kulturkontakte
Vierte Phase (1973–1977): Deutsch-ungarische Kulturbeziehungen im Zeichen der anhaltenden Dominanz Ostberlins
Fünfte Phase (1977–1985): Beginn zwischenstaatlicher Kulturbeziehungen zwischen Bonn und Budapest, Fortbestand des ostdeutschen Monopols bei Sprachpflege und Minderheitenbetreuung
Sechste Phase (1985–1989/90): Durchbruch bei den westdeutsch-ungarischen Kulturbeziehungen, „Auslaufmodell“ ostdeutsch-ungarische Kulturkontakte
Bilanz der deutsch-ungarischen Kulturbeziehungen (1989/90)
Chronologie
Dokumente
Literaturverzeichnis
Zum Verfasser
Tartalomjegyzék
Bevezető megjegyzések
Az első szakasz (1949–1959): A magyar–keletnémet kulturális kontaktusok kezdetleges indulása
A második szakasz (1959–1965): A magyar–keletnémet kulturális kapcsolatok konszolidációja és továbbfejlesztése, az érintőleges magyar–nyugatnémet kulturális kontaktusok kezdete
A harmadik szakasza (1965–1973): A magyar–keletnémet kulturális kapcsolatok dinamizálása, a magyar–nyugatnémet kulturális kontaktusok „észszerű kibővítése”
A negyedik szakasz (1973–1977): A magyar–német kulturális kapcsolatok a folytonos Kelet-Berlini dominancia jegyében
Az ötödik szakasz (1977–1985): A magyar–nyugatnémet államközti kulturális kapcsolatok indulása, a német nyelvápolásra és a német nemzetiség gondoskodására vonatkozó keletnémet monopólium megőrzése
A hatodik szakasz (1985–1989/90): Áttörés a magyar–nyugatnémet kulturális kapcsolatokban, a magyar–keletnémet kulturális kontaktusok mint „kifutó modell”
A magyar-német kulturális kapcsolatok mérlege
Dokumentumok
A szerzőről
Die Kulturbeziehungen zwischen der Volksrepublik Ungarn und den beiden deutschen Staaten 1949–1989/90
Einleitende Bemerkungen
Die vorliegende Untersuchung1 behandelt die deutsch-ungarischen kulturellen Beziehungen in den vier Jahrzehnten von 1949 bis 1989/90, sie befasst sich also mit den Kulturkontakten der Volksrepublik Ungarn zu den beiden deutschen Staaten und mit den Kulturbeziehungen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland zu Ungarn während der Ära der bipolaren Weltordnung. Damit thematisiert sie einen – bislang nicht behandelten – Teilbereich der deutsch-ungarischen Beziehungsgeschichte, der sich nicht nur inhaltlich sehr komplex und vielschichtig gestaltete, sondern der auch hinsichtlich seines Verlaufs besonders wechselvoll und spannungsgeladen war sowie stark von antagonistischen weltanschaulichen Faktoren beeinflusst wurde.2 In dieser historischen Epoche, die durch die Zweiteilung der Welt, Europas und Deutschlands geprägt war, mussten die Blockkonfrontation und vor allem auch die Deutsche Frage besondere Auswirkungen auf die Entwicklung der deutsch-ungarischen Kulturkontakte haben.
In meiner Überblickstudie versuche ich, die deutsch-ungarischen kulturellen Beziehungen mit Blick auf Zielsetzungen, Maßnahmen und tatsächliche Ergebnisse zu skizzieren. Hierbei stelle ich den Wandel des Beziehungsgefüges anhand einer Einteilung in sechs, klar voneinander zu unterscheidende Phasen dar. Diese Periodisierung ergibt sich in erster Linie aus der sich verändernden Intensität und Qualität der Kulturkontakte sowie aus dem sich verschiebenden Gewicht der beiden deutschen Staaten im ungarischen Kulturleben. Über die empirisch-deskriptive Ebene hinaus beabsichtige ich, vor dem Hintergrund der innen-, deutschland- und weltpolitischen Geschehnisse Erklärungen für die festgestellten Entwicklungen zu geben und einige grundsätzliche Probleme dieser schwierigen „Dreiecksbeziehung“3 herauszustellen. Natürlich kann ich in diesem Rahmen nur auf einige, mir grundlegend erscheinende Aspekte eingehen und zur Illustration nur fallweise konkrete, paradigmatische Beispiele anführen. Auf eine Darlegung der Diskussionen innerhalb der Führungsgremien der drei Staaten muss aus Gründen des Umfangs verzichtet werden. Abschließend werfe ich einen kurzen Blick auf die langfristigen, bis heute relevanten Auswirkungen dieser kulturellen Beziehungsgeschichte.
Die Schlüsselbegriffe „Kulturbeziehungen“, „Außenkulturbeziehungen“ bzw. „auswärtige Kulturpolitik“ bedürfen einer Erläuterung.4 Kulturbeziehungen können sich einerseits auf der offiziellen staatlichen Ebene (Staat und Länder) abspielen, wobei sie auf zwischenstaatlichen Verträgen, Vereinbarungen und Absprachen beruhen. Kulturelle Kontakte können andererseits aber auch unterhalb dieser Ebene zustande kommen, also im nicht offiziell zwischenstaatlich geregelten Bereich. Akteure der auswärtigen Kulturbeziehungen sind staatliche Organe oder staatlich kontrollierte Institutionen, vom Staat unmittelbar oder mittelbar beeinflusste Einrichtungen, private Vereinigungen oder Unternehmen, Vereine und Künstlerensembles usw. sowie Privatpersonen. In der hier behandelten Epoche kommt der staatlichen Ebene bzw. den staatlich regulierten Aktivitäten – vor allem wegen des Charakters der sozialistischen Systeme – eine zentrale Rolle zu. Als Kulturbeziehungen selbst betrachte ich in erster Linie die Kontakte auf den Gebieten Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Hochschulwesen, Kunst (Literatur, Musik, Malerei, Bildhauerei, Theater, Film), Sprachpflege, Jugendkontakte, Sport und Massenmedien.5 Bei den Wissenschaftsbeziehungen unterscheide ich zwischen dem – ideologisch weniger „sensiblen“ – technisch-naturwissenschaftlichen Bereich und den – weltanschaulich problematischeren – Geistes- und Sozialwissenschaften. „Auswärtige Kulturpolitik“, „Außenkulturpolitik“ bzw. „Kulturdiplomatie“ sind Mittel zur Gestaltung der kulturellen Außenbeziehungen. Wie in der Außenpolitik überhaupt handelt es sich hierbei – entgegen aller idealistischen Rhetorik und der Betonung des Prinzips der Gegenseitigkeit (Reziprozität) – selbstverständlich auch immer um nationale Interessen- und Machtpolitik,6 deren Ziele zu hinterfragen sind.
Die bipolare Weltordnung7 als weltpolitischer Hintergrund dieser Epoche und die sich aus ihr ergebenden Konflikte und Handlungszwänge bestimmten den politischen Aktionsradius der drei Staaten in ihrer jeweiligen Bündniskonstellation auch in der Außenkulturpolitik auf entscheidende Weise. Der Begriff „deutsche Frage“8 betrifft jene Probleme, die sich aus der deutschen Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg ergaben, und vor allem diejenigen Spannungen, die dadurch entstanden, dass sich beide deutsche Staaten gegenüber dem Ausland als Vertreter der deutschen Staatlichkeit, Nation und Kultur profilieren wollten. Die deutsche Teilung führte damit zwangsläufig zu einer scharfen Konkurrenz in den kulturpolitischen Bestrebungen der beiden deutschen Staaten, die Drittländer wie Ungarn in Rechnung stellen mussten.9
Nach dem Zusammenbruch der zwischenstaatlichen Beziehungen infolge der Auflösung des Dritten Reichs, der Besetzung Deutschlands und Ungarns durch die Alliierten und der gewaltsamen Vertreibung von etwa der Hälfte der 400.000 Ungarndeutschen aus ihrer Heimat10 kann erst im Herbst 1949 von einem Neuanfang in den deutsch-ungarischen Kulturbeziehungen gesprochen werden. Unter den Bedingungen des sich verschärfenden Kalten Kriegs und des Stalinismus konnte es sich dabei anfänglich ausschließlich um Beziehungen zwischen der am 20. August 1949 proklamierten Volksrepublik Ungarn und der am 7. Oktober 1949 gegründeten Deutschen Demokratischen Republik handeln.
1 Die Untersuchung entstand im Rahmen eines Projekts über die westdeutschungarischen Beziehungen von 1949 bis 1990, das der Verfasser am Institut für Geschichtswissenschaft des Zentrums für Humanwissenschaften des Loránd-Eötvös-Forschungsnetzwerks durchführt und das vom Ungarischen Wissenschaftlichen Forschungsfonds (OTKA, K-81562) gefördert wurde. Editorischer Hinweis: Beim Zitieren deutschsprachiger Quellen wird den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung (Duden) Rechnung getragen. Die zitierten ungarischsprachigen Dokumente wurden vom Verfasser ins Deutsche übersetzt.
2 Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ungarn und den beiden deutschen Staaten waren demgegenüber bekanntlich wesentlich stärker an pragmatischen Interessen ausgerichtet und wiesen durch die vier Jahrzehnte hindurch ein beinahe kontinuierliches Wachstum auf.
3 Die deutsch-deutschen Kulturbeziehungen werden – wie gezeigt – hier nicht behandelt. Siehe hierzu Lindner, Zwischen Öffnung und Abgrenzung.
4 Zur allgemeinen Begriffserörterung siehe Harnischfeger, Auswärtige Kulturpolitik, S. 713-723; Praxenthaler, Die Sprachverbreitungspolitik der DDR, S. 2-10.
5 Hier orientiere ich mich an der Definition der verschiedenen Bereiche von Kultur bei Werner Maihofer (Maihofer, Kulturelle Aufgaben des modernen Staates, S. 977). Einer der Hauptbereich bei Maihofer, nämlich die Religion, wird hier, da er in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt, weggelassen, während der Bereich der Sprachpflege – aus noch aufzuzeigenden Gründen – eine besondere Bedeutung erhält.
6 Horst Harnischfeger stellt in diesem Sinne hinsichtlich der auswärtigen Kulturpolitik fest, dass es hier „entscheidend ist, dass die Staaten für die allgemeinen Zwecke der Außenpolitik versuchen, mit Mitteln der Kultur auf die Staatenwelt Einfluss zu nehmen oder ihren Einfluss bzw. Macht über die kulturellen Beziehungen zu erhöhen.“ (Harnischfeger, Auswärtige Kulturpolitik, S. 713).
7 Siehe hierzu neuerdings Gaddis, Der Kalte Krieg, klassisch Loth, Die Teilung der Welt. Zur Rolle Ungarns zur Zeit der Ost-West-Konfrontation siehe neuerdings Békés, Enyhülés és emancipáció.
8 Zur Deutschen Frage nach dem Zweiten Weltkrieg siehe Dülffer/Michalka (Hrsg.), Die deutsche Frage.
9 Zur Geschichte der west- bzw. ostdeutschen auswärtigen Kulturpolitik siehe Paulmann, Auswärtige Repräsentationen, S. 1-32; Griese, Auswärtige Kulturpolitik und Kalter Krieg, S. 23-54; Saehrendt, Kunst als Botschafter, S. 47-89; Praxenthaler, Die Sprachverbreitungspolitik der DDR, S. 27-39; 96-161; Muth, Die DDR-Außenpolitik, S. 14-53. Für Ungarn existieren diesbezüglichen keine grundlegenden wissenschaftlichen Untersuchungen.
10 Zur Vertreibung der Deutschen aus Ungarn sowie zu den internationalen und innerungarischen Zusammenhängen des Vertreibungsprozesses siehe Tóth, Migrationen in Ungarn.
Erste Phase (1949–1959):Rudimentäre Anfänge der ostdeutsch-ungarischen kulturellen Kontakte
Die erste Phase der deutsch-ungarischen Kulturbeziehungen setze ich für den Zeitraum von 1949 bis 1959 an. Bereits wenige Wochen nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der DDR und Ungarn am 19. Oktober 1949 wurde seitens Ostberlin das Vorhaben, offizielle Kulturbeziehungen zu Budapest aufzunehmen,11 in Angriff genommen.12 Diese Initiative führte am 24. Juni 1950 zur Unterzeichnung des ersten Abkommens über kulturelle Zusammenarbeit zwischen der DDR und Ungarn.13 In diesem lediglich elf knappe Artikel umfassenden Vertrag stellten beide Seiten zum einen das Ziel des „Niederkämpfens der faschistischen und militaristischen Ideologie“ heraus, zum anderen skizzierten sie – ganz allgemein – das Vorhaben, in den Bereichen Schulwesen, Wissenschaft, Medien, Propaganda, Theater, Film und Musik zu kooperieren.
Hinter all diesen im östlichen Europa abgeschlossenen bilateralen Verträgen stand in erster Linie die machtpolitisch und ideologisch motivierte Absicht des Kremls, das Kulturleben in den Satellitenstaaten nach sowjetischem Muster bzw. im Sinne des „sozialistischen Realismus“ umzugestalten.14 Aber auch das Regime in Ostberlin hatte ein existenzielles Motiv, nämlich die – von der Bundesrepublik unter Konrad Adenauer infrage gestellte – staatliche Existenz der DDR auf internationaler Ebene zu demonstrieren15 und eine alternative „sozialistische deutsche Kultur“ gegenüber der „faschistischen, imperialistischen und militaristischen“ Kultur der Bundesrepublik zu propagieren.16 Und in Budapest war man an Kulturbeziehungen zu Ostberlin offenbar vor allem aufgrund des noch immer hohen Stellenwerts der deutschen Sprache interessiert. Bezeichnend in diesem Zusammenhang war, dass die wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte zwischen Ungarn und anderen Ostblockstaaten in den 1950er Jahren oftmals in deutscher Sprache – und nicht auf Russisch – gepflegt wurden.17
Die ostdeutsch-ungarischen kulturellen Kontakte entwickelten sich in dieser ersten Phase in der Praxis allerdings recht schleppend, d.h. es wurde nur ein Teil der sowieso wenigen Vorhaben, die in jährlichen Arbeitsplänen zusammengefasst wurden, verwirklicht. Zumeist handelte es sich dabei um einzelne Veranstaltungen im Bereich von Film, Musik, Malerei und Literatur sowie um Begegnungen einzelner Wissenschaftler auf naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen Kongressen und im Zuge von Studienreisen. 1952, im aktivsten Jahr in der Anfangsphase der ostdeutsch-ungarischen Kulturbeziehungen, zählten die deutsche Kulturwoche in Budapest im Oktober und die ungarische Kulturwoche in Berlin im gleichen Monat sowie deutsche Filmwochen an verschiedenen Orten Ungarns im Mai zu den publikumswirksamsten Veranstaltungen.18 Ähnlich gering entwickelte Kulturkontakte waren in den 1950er Jahren auch für die ostdeutsch-rumänischen Beziehungen charakteristisch, die Peter Ulrich Weiß in seiner Dissertation dementsprechend auch als „schwunglose Kulturbeziehungen“19 betitelte. Diese Schwäche kann allgemein auf das Fehlen von entsprechender Infrastruktur und qualifiziertem Fachpersonal20 sowie auf den Vorrang des Wirtschaftsaufbaus und der Konsolidierung der kommunistischen Macht zu Beginn des „Aufbaus des Sozialismus“ zurückgeführt werden. Und schließlich rückten die schweren inneren Erschütterungen nach dem Tode Stalin in der DDR (Juni 1953) sowie in Polen und Ungarn (Sommer/Herbst 1956) die Kooperation im Bereich der Kultur für geraume Zeit gänzlich in den Hintergrund.
Zwischen der Volksrepublik Ungarn und der Bundesrepublik bestanden in dieser Phase keinerlei Kulturbeziehungen auf staatlicher Ebene.21 Nach dem Tode Stalins entwickelten sich seit 1954 aber zumindest marginale informelle Kontakte auf verschiedenen, zumeist in Westdeutschland abgehaltenen Konferenzen und Kongressen (vor allem zu medizinischen und naturwissenschaftlichen Themen), bei Sportveranstaltungen sowie im Bereich Film, Musik und Messewesen.22 Im Zuge des internationalen „Tauwetters“ gab es dann in den Jahren 1955/1956 im ungarischen Außenministerium erstmals Überlegungen, die sich – unter Verweis auf die engen historischen Bande – mit einer Intensivierung der Beziehungen zu Westdeutschland und mit der Wiederaufnahme der offiziellen Kulturbeziehungen befassten. Dabei ging man davon aus, dass „ein beträchtlicher Teil der Beziehungen, insbesondere in geistig-kultureller Hinsicht, der Sache des Fortschritts beider Völker und ihres kulturellen Aufstiegs“ gedient habe, und man empfahl, bei den folgenden Wirtschaftskonsultationen auch Gespräche über die Entwicklung der kulturellen Beziehungen zu führen.23 Hinter dieser Initiative verbarg sich ganz offensichtlich das Verlangen Ungarns, durch die Aufnahme kultureller Beziehungen zu Westdeutschland der unter Stalin verordneten einseitigen kulturellen „Ostorientierung“ zu entfliehen bzw. eine „kulturelle Rückkehr nach Europa“ zu erreichen, sowie die Absicht, durch die Kulturkontakte auch die Wirtschaftsbeziehungen positiv zu beeinflussen. Auf Seiten Adenauer-Deutschlands zeichnete sich damals allerdings kein Interesse ab, mit einem „sowjetischen Satelliten“, der noch dazu die DDR diplomatisch anerkannt hatte, offizielle kulturelle Beziehungen aufzunehmen.24 Und schließlich wurden die Erwägungen im ungarischen Außenministerium durch die Niederschlagung des Volksaufstandes vom Herbst 1956 und die folgende Repressionspolitik unter dem neuen KP-Chef János Kádár25 sowieso gegenstandslos.26
11 Siehe hierzu Protokoll Nr. 26 der Sitzung des Politbüros der SED vom 10. Juni 1949 (Bundesarchiv Berlin (im Folgenden: BA), DY/30/IV 2/2/26).
12 Ende Oktober 1949 teilte der Leiter der neu eingerichteten ungarischen Mission in Ostberlin der Führung der ungarischen kommunistischen Partei mit, dass die „demokratische deutsche Regierung in allernächster Zeit ein Kulturabkommen mit Ungarn schließenr“ wolle und sich nach einem Zeitpunkt für diesbezügliche Verhandlungen erkundige (Staatsarchiv des Ungarischen Nationalarchivs (im Folgenden: MNL OL), 276. f. 80/1949/ 16. ő. e.). Zu den Anfängen der ostdeutsch-ungarischen Kulturbeziehungen siehe auch Somogyi, Der ungarische Schriftsteller Gyula Háy.
13 Siehe I. Dokument. Das Original des Abkommen wird in ungarischer und deutscher Sprache im Politischen Archiv des Auswärtigen Amts in Berlin (im Folgenden: PA AA) unter der Signatur MfAA V 883 aufbewahrt.
14 Zur sowjetischen Außenkulturpolitik in der DDR siehe Becker, Die Kulturpolitik der sowjetischen Besatzungsmacht, zur Sowjetisierung Osteuropas siehe „klassisch“ Brzezinski, Der Sowjetblock und neuerdings Apor/Apor/Rees (Hrsg.), The sovietization of Eastern Europe.
15 Diesbezüglich sei darauf verwiesen, dass selbst Moskau die staatliche Existenz der DDR erst ab Mitte der 50er Jahre als „endgültig“ betrachtete (siehe hierzu Scholtyseck, Die Außenpolitik der DDR, S. 5-15; Wentker, Außenpolitik in engen Grenzen, S. 96-99).
16 Unter den außenpolitischen Interessen der DDR in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens hebt Ingrid Muth unter anderem hervor: „[…] die außenpolitische Sicherung der Existenz und der Stabilität der DDR als eigenständiger, souveräner Staat und als Völkerrechtssubjekt; […] die Durchsetzung der uneingeschränkten völkerrechtlichen Anerkennung der DDR als zweiter deutscher Staat und der Aufbau eines internationalen Ansehens als gesellschaftliche Alternative zur Bundesrepublik.“ (Muth, Die DDR-Außenpolitik, S. 49); siehe auch Saehrendt, Kunst als Botschafter, S. 50, S. 60-61.
17 Siehe hierzu die Studie „Wertschätzung der deutschen Sprache in Ungarn“ der von Fritz Valjavec geführten „Studiengruppe Südost“ aus dem Jahre 1955 (PA AA, B 42/82).
18 Siehe Zusammenstellung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten vom 25. Oktober 1952 (BA, DC/20/15705).
19 Weiß, Kulturarbeit, S. 88.
20 Die Kulturdiplomaten der kommunistischen Staaten waren – infolge des radikalen Elitenwechsels nach 1945 – in der Regel verdiente Parteifunktionäre ohne entsprechende Fachkenntnisse. So verhielt es sich auch in Ostdeutschland, wo die SED-Führung bewusst mit der personellen Tradition des Auswärtigen Amtes brach (vgl. Muth, Die DDR-Außenpolitik, S. 157).
21 Offizielle Kontakte gab es zu dieser Zeit ausschließlich auf dem Gebiet der Wirtschaft. Nachdem bereits im August 1948 ein Handelsabkommen zwischen der amerikanischen und britischen Militärregierung in Deutschland und dem ungarischen Staat abgeschlossen worden war, konnten die neugegründete Bundesrepublik und Ungarn beim Aufbau ihrer Wirtschaftskontakte daran anknüpfen und im März 1950 ein erstes Protokoll über den Warenverkehr (Bundesanzeiger Nr. 126 vom 5. Juli 1950, S. 1) unterzeichnen.
22 Siehe hierzu Aufzeichnung des Deutschlandreferats im ungarischen Außenministerium vom 28. Mai 1956 (MNL OL, XIX-J-1-k (NSZK, Admin., 1948-1963), 1. d., 26. t.).
23 Siehe hierzu Aufzeichnung des Deutschlandreferats im ungarischen Außenministerium vom 8. Juni 1956 (MNL OL, XIX-J-1-k (NSZK, Admin., 1948-1963), 1. d. , 26. t.); siehe auch Schmidt-Schweizer/Dömötörfi, Adenauer és a keleti „olvadás“, S. 59-66.
Zweite Phase (1959–1965):Konsolidierung und Ausbau der ostdeutsch-ungarischen Kulturbeziehungen, Beginn marginaler westdeutschungarischer Kultur- und Wissenschaftskontakte
Auch die zweite Phase der deutsch-ungarischen Kulturbeziehungen, die ich von 1959 bis 1965 ansetze, war durch eine absolute Vorrangstellung Ostdeutschlands gekennzeichnet. Ostberlin und Budapest bemühten sich nun, insbesondere nachdem in Ungarn die „Nachwehen“ von 1956 überwunden worden waren, erstmals intensiv darum, ihre kulturellen Kontakte – ganz im Zeichen der Konsolidierung des sozialistischen Weltsystems in der Ära des Poststalinismus – mit konkreten Inhalten zu füllen und die notwendigen infrastrukturellen, personellen und vertraglichen Voraussetzungen zu schaffen. Darüber hinaus ging Ostberlin nun daran, die kulturelle „Betreuung“ der schätzungsweise 200.000 in Ungarn verbliebenen Deutschen zu übernehmen. Nachdem die DDR bereits 1957 damit begonnen hatte, kulturellen (und natürlich ideologischen) Einfluss auf die Ungarndeutschen zu nehmen, wurden diese Bestrebungen 1958/1959 – auf Ersuchen Ungarns27 – weiter intensiviert, wobei die DDR von nun an „in großem Umfang Schulbücher, Fachliteratur sowie Schriften über wirtschaftliche und kulturelle Probleme an Schulen und Kulturvereinigungen der Ungarndeutschen“ verschickte.28 Seit 1959 hielt sie zudem kulturelle deutschsprachige Veranstaltungen sowie Sommerkurse für ungarndeutsche Jugendliche ab und es kam zur Entsendung von ostdeutschen Sprachlehrern und Professoren nach Ungarn. Ende der 1950er Jahre kristallisierte sich damit eine besondere, zweieinhalb Jahrzehnte fest in den Händen Ostberlins verbleibende „Domäne“ der auswärtigen Kulturpolitik der DDR in Ungarn heraus.
Das Ziel, die bilateralen Kulturbeziehungen auf eine höhere Ebene zu heben, ging vor allem auch aus dem zweiten ostdeutsch-unga- rischen Kulturabkommen vom 19. Dezember 195929 hervor. In diesem Vertrag, der im Gegensatz zum ersten Kulturabkommen die antifaschistische und antiimperialistische Rhetorik in den Hintergrund rückte, betonten beide Seiten ihre Absicht, „die freundschaftlichen, auf den Prinzipien des sozialistischen Internationalismus beruhenden Beziehungen zwischen beiden Ländern durch das gegenseitige Kennenlernen der wissenschaftlichen und kulturellen Traditionen und Errungenschaften zu vertiefen“ (Präambel). In den anschließenden 15 Artikeln wurden die Ziele der Wissenschaftskooperation, der gegenseitigen Sprachförderung und des Studentenaustauschs sowie die Kooperation in den „klassischen“ Bereichen der Kultur (Literatur, Film, Theater, Musik, Rundfunk und Fernsehen, Presse) herausgestellt. Besondere Bedeutung für die konkrete Umsetzung der kulturellen Kooperationsvorhaben hatte schließlich der Plan, „Kultur- und Informationsbüros bzw. -zentren im Lande der Abkommenspartned“ zu errichten. Dem Vertrag selbst schloss sich in den folgenden Jahren außerdem eine Reihe von konkreten Kooperationsvereinbarungen an30.
Vor diesem Hintergrund kam es seit der ersten Hälfte der 1960er Jahre – und insbesondere nach der Stabilisierung der SED-Herrschaft durch den Mauerbau am 13. August 1961 – zu einer deutlichen Intensivierung der ostdeutsch-ungarischen Kulturbeziehungen.31 Diese betraf an erster Stelle die Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschaft. Die Akademien der beiden Staaten kooperierten nunmehr in insgesamt 28 Wissenschaftsbereichen, wobei es zum gegenseitigen Austausch von zahlreichen Wissenschaftlern kam. Dementsprechend konnte der ungarische Botschafter in Ostberlin im Januar 1963 feststellen: „Die Zusammenarbeit der beiden Akademien ist selbst im Vergleich zu den [anderen] sozialistischen Staaten sehr gut und freundschaftlich.“32 Auch der Studentenaustausch konnte erstmals einen deutlichen Anstieg verzeichnen.33 Auf eine Ausweitung der kulturellen Kooperation konnten beide Staaten auch in den Bereichen Fernsehen, Radio und Film, Theater und Musik sowie beim Journalistenaustausch verweisen. Gemäß dem zweiten Kulturabkommen wurde überdies bereits Anfang Februar 1960 ein „Kultur- und Informationsbüro“ der DDR34 im Zentrum von Budapest (Straße der Volksrepublik, heute Andrássy-Straße) eingerichtet.
In dieser zweiten Phase zeichnete sich darüber hinaus auch die besondere Rolle ab, die die DDR bei der Verbreitung der deutschen Sprache in Ungarn – als herausragendes Instrument ihrer Kultur- und Ideologievermittlung und gefragtes „Kulturprodukt“ – spielte. Diese – in der Dissertation von Martin Praxenthaler35 eingehend behandelte – ostdeutsche Sprachverbreitungspolitik, die grundsätzlich der Popularisierung der DDR dienen sollte und als Gegenprogramm zur Sprachförderungspolitik der Bundesrepublik gedacht war, sollte in den folgenden Jahrzehnten in Ungarn besondere Erfolge mit nachhaltiger Wirkung verzeichnen können. Die Sprachverbreitungsaktivitäten der DDR stellten allerdings insofern ein zweischneidiges Schwert dar, als durch sie natürlich auch die Sprache des „westdeutschen Klassenfeindes“ gefördert wurde.
Hinter der Intensivierung der Kulturbeziehungen innerhalb des Ostblocks in dieser zweiten Phase verbarg sich ein grundlegender Wandel in der sowjetischen Außenpolitik. Dieser neue Kurs wurde seit Anfang der 1960er Jahre unter der Bezeichnung „friedliche Koexistenz“36 von KPdSU-Chef Nikita Chruschtschow nachdrücklich propagiert und basierte auf der Erkenntnis, dass kriegerische Auseinandersetzungen als Mittel zur Lösung von internationalen Konflikten aufgrund des atomaren Vernichtungspotenzials der Großmächte nicht mehr praktikabel waren. Der Wettstreit der antagonistischen Gesellschaftssysteme wurde nun auf die Bereiche Wirtschaft und Kultur verlegt. Aus diesem würde das östliche Lager – so hoffte man – letztlich als Sieger hervorgehen. Dieses Ziel wiederum implizierte – neben der intensiven Wirtschaftskooperation im Rahmen des Rats für Gegenseitige Wirtschaftshilfe – natürlich auch eine enge Zusammenarbeit der östlichen Welt auf dem Gebiet der Kultur.