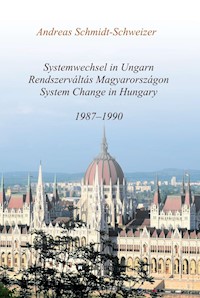Die westdeutsch-ungarischen Beziehungen im Zeitalter der bipolaren Weltordnung (1947-1990) A magyar-nyugatnémet kapcsolatok a bipoláris világrend idején (1947-1990) E-Book
Andreas Schmidt-Schweizer
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die hier vorliegende zweisprachige (deutsch-ungarisch) wissenschaftliche Abhandlung befasst sich mit den westdeutsch-ungarischen Beziehungen in den Jahren von 1947 bis 1990 und basiert auf langjährigen Forschungen des Verfassers zu diesem Thema. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Entwicklung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen, die in mehrere Phasen unterteilt wird. Als Hintergrund stellte der Verfasser das weltpolitische und blockinterne Geschehen sowie die - außenpolitisch relevanten - innenpolitischen Entwicklungen in beiden Ländern in Rechnung. Außerdem werden auch die Auswirkungen der "deutschen Frage" auf das westdeutsch-ungarische Verhältnis behandelt. Abschließend legt der Verfasser die spezifischen Interessenkonstellationen in beiden Staaten, die die Entwicklung dieser außergewöhnlichen Beziehungsgeschichte maßgeblich beeinflussten, dar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andreas Schmidt-Schweizer
Die westdeutsch-ungarischen Beziehungen im Zeitalter der bipolaren Weltordnung
(1947-1990)
A magyar-nyugatnémet kapcsolatok a bipoláris világrend idején
(1947-1990)
© 2021 Andreas Schmidt-Schweizer
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-36790-6
Hardcover:
978-3-347-36791-3
e-Book:
978-3-347-36792-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitende Bemerkungen
1. Die Anfänge der offiziellen westdeutsch-ungarischen Beziehungen (1947–1955)
1.1. Erste Schritte der Kontaktaufnahme
1.2. Die Ingangsetzung des bilateralen Handels
2. Die bilateralen Beziehungen in der Phase der Destalinisierung und der Niederschlagung des Volksaufstands (1955–1957)
2.1. Versuche einer Neuorientierung der ungarischen Außenpolitik
2.2. Die ersten westdeutsch-ungarischen politischen Verhandlungen
2.3. Die Adenauer-Regierung, die Niederschlagung des Volksaufstands und die Ungarn-Flüchtlinge
3. Die Fortsetzung des bilateralen Handels und die Wiederbelebung der politischen Kontakte (1957–1963)
3.1. Der westdeutsch-ungarische Handel in Zeiten der politischen Abkühlung
3.2. Versuche zur Wiederaufnahme der politischen Kontakte
4. Der Ausbau der Handelskooperation und der Beginn der offiziellen Regierungskontakte (1963–1969)
4.1. Das Handelsabkommen und die Entwicklung der kommerziellen Zusammenarbeit
4.2. Die ersten Kontakte auf Regierungsebene und das Scheitern der Aufnahme diplomatischer Beziehungen
5. Die „Neue Ostpolitik“ Bonns und die Entwicklung der bilateralen Beziehungen (1969–1973)
5.1. Die Außenpolitik der Regierung Brandt und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen
5.2. Schwungvolle Entwicklung und Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen
5.3. Beginn und begrenzte Entwicklung der offiziellen Kulturbeziehungen
6. Aufschwung in den politischen und ökonomischen Kontakten, zwischenstaatliche Regelung der Kulturbeziehungen (1973–1979)
6.1. Ausbau und Vertiefung der politischen Beziehungen
6.2. Intensivierung der Wirtschaftskooperation
6.3. Der Abschluss des Kulturabkommens und die stockende Entwicklung der Kulturbeziehungen
7. Die bilateralen Beziehungen zur Zeit der erneuten Zuspitzung des Ost-West-Verhältnisses und der weltwirtschaftlichen Rezession (1979–1985)
7.1. Das politische Verhältnis in der Phase der wiederauflebenden Ost-West-Konfrontation
7.2. Beschränkte Weiterentwicklung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen
8. Der Wandel der bilateralen Beziehungen in der Spätphase der Ära Kádár (1985–1988)
8.1. Die „Neuerwägung“ des westdeutsch-ungarischen Verhältnisses
8.2. Die „neue Qualität“ in den bilateralen politischen Beziehungen
8.3. Die bilaterale Wirtschaftskooperation am Vorabend des wirtschaftlichen Systemwechsels in Ungarn
8.4. Ungarns kulturelle Westöffnung und die Entwicklung der bilateralen Kulturbeziehungen
9. Die bilateralen Beziehungen im Zeichen des ungarischen Systemwechsels und der „deutschen Frage“ (1988–1990)
9.1. Die politische Wende in Ungarn und die Reaktion der westdeutschen Politik
9.2. Das westdeutsch-ungarische Verhältnis zur Zeit der DDR-Flüchtlingswelle und der ungarischen Grenzöffnung
9.3. Die deutsche Vereinigung als Herausforderung für Ungarn
9.4. Die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen bis zur deutschen Einheit
9.5. Die westdeutsch-ungarischen politischen Beziehungen bis zur deutschen Einheit
Abschließende Bemerkungen
Chronologie
Literaturverzeichnis
Zum Verfasser
Tartalomjegyzék
Előszó
Bevezető megjegyzések
1. A hivatalos magyar–nyugatnémet kapcsolatok kezdetei (1947–1955)
1.1. Az első lépések
1.2. A kereskedelmi kapcsolatok hivatalos újraindítása
2. A kétoldalú kapcsolatok a desztalinizáció, valamint az 1956-os forradalom leverése idején (1955–1957)
2.1. A magyar külpolitika reorientációjának kísérlete
2.2. Az első magyar-nyugatnémet politikai tárgyalások
2.3. Az Adenauer-kormány, az 1956-os forradalom leverése és a magyar menekültek
3. A kétoldalú kereskedelem folytatása, a politikai kapcsolatok újraindítása (1957–1963)
3.1. A magyar–nyugatnémet kereskedelem a politikai lehűlés idején
3.2. Kísérletek a politikai érintkezés újrafelvételére
4. A kereskedelmi együttműködés továbbépítése és a hivatalos kormányközi kapcsolatok kezdete (1963–1969)
4.1. A kereskedelmi egyezmény és a kereskedelmi együttműködés alakulása
4.2. Az első kormányközi szintű kontaktusok valamint a diplomáciai kapcsolatok felvételének meghiúsulása
5. Az NSZK „új keleti politikája” és a kétoldalú kapcsolatok alakulása (1969–1973)
5.1. A Brandt-kormány „új keleti politikája” és a diplomáciai kapcsolatok felvétele
5.2. A gazdasági kapcsolatok lendületes fejlesztése és bővítése
5.3. A hivatalos kulturális kapcsolatok megindulása és korlátozott fejlődése
6. A politikai és gazdasági kapcsolatok fellendülése, a kulturális kooperáció államközi szabályozása (1973–1979)
6.1. A politikai kapcsolatok kiépítése és elmélyítése
6.2. A gazdasági együttműködés intenzív növekedése
6.3. A kulturális egyezmény megkötése és a kulturális kapcsolatok akadozó fejlődése
7. A magyar–nyugatnémet kapcsolatok az újabb keletnyugati válság és a világgazdasági recesszió idején (1979–1985)
7.1. A politikai viszonyok a nyugat-keleti konfrontáció újabb szakaszában
7.2. A gazdasági és kulturális kapcsolatok korlátozott fejlődése
8. A kétoldalú kapcsolatok „új minősége” a Kádár-rendszer alkonyán (1985–1988)
8.1. A magyar–nyugatnémet viszony „újragondolása”
8.2. A kétoldalú politikai kapcsolatok „új minősége”
8.3. A gazdasági együttműködés a magyarországi gazdasági rendszerváltás előestéjén
8.4. Magyarország kulturális nyitása Nyugat felé és a kulturális kapcsolatok alakulása
9. A bilaterális kapcsolatok a magyarországi rendszerváltás és a „németkérdés” jegyében (1988–1990)
9.1. A magyarországi politikai fordulat és a nyugatnémet politika reakciója
9.2. A magyar–nyugatnémet viszony az NDK-menekült hullám és a határnyitás idején
9.3. A német egyesítés, mint kihívás Magyarország számára
9.4. A gazdasági kapcsolatok alakulása a német egyesítésig
9.5. A kétoldalú politikai kapcsolatok a német egyesítésig
Összegzés és értékelés
Kronológia
Irodalomjegyzék
A szerzőről
Vorwort
Der vorliegende Überblick über die westdeutsch-ungarischen Beziehungen in den Jahren von 1947 bis 1990 ist im Rahmen eines laufenden Forschungsprojekts entstanden, das sich mit der umfassenden Dokumentation, Darstellung und Analyse der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn in den Jahrzehnten der bipolaren Weltordnung befasst. Die diesbezüglichen Arbeiten, aus denen bereits eine Reihe von Publikationen hervorgegangen ist (siehe Literaturverzeichnis), führt der Verfasser als wissenschaftlicher Mitarbeiter (Senior Research Fellow) am Institut für Geschichtswissenschaft des Zentrums für Humanwissenschaften in Budapest durch.
Da bislang keine wissenschaftlich fundierte Zusammenfassung existiert, die diese bilaterale Beziehungsgeschichte behandelt, schien es mir an der Zeit, meine bisherigen Forschungen komprimiert – in deutscher und ungarischer Sprache – vorzulegen und zugleich im Anmerkungsapparat einen Überblick über die wichtigste Sekundärliteratur zu geben. Auf einen Verweis auf die zahlreichen grundlegenden Quellen, die in deutschen und ungarischen Archiven zur Verfügung stehen, wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Diesbezüglich sei auf die Quellenverweise in der zitierten Sekundärliteratur hingewiesen.
Beim Abfassen dieser kleinen Synopse meiner Forschungen erhielt ich von meinen Institutskollegen Sándor Horváth, Gusztáv D. Kecskés, Miklós Mitrovits und Gergely Krisztián Horváth sowie von Csaba Békés, Ferenc Eiler und László J. Kiss wertvolle Ratschläge und Hinweise. Ihnen gilt mein herzlicher Dank. Dank schulde ich auch dem früheren Institutsleiter Ferenc Glatz, der dieses Forschungsprojekt initiierte, und meinem ehemaligen Kollegen Tibor Dömötörfi, mit dem ich dieses Thema mehrere Jahre lang gemeinsam erforschte.
Andreas Schmidt-SchweizerNézsa/Ungarn, im September 2021
Előszó
Jelen kötet egy az 1947 és 1990 közötti magyar–nyugatnémet kapcsolatokkal foglalkozó, folyamatban levő kutatási projekt keretében született. Ez a tudományos vállalkozás a Német Szövetségi Köztársaság és Magyarország közötti gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok széleskörű dokumentálásával, bemutatásával és elemzésével foglalkozik a kétpólusú világrend négy évtizedében. A kutatást, amelynek eddigi részeredményeiből már számos publikáció jelent meg (lásd az irodalomjegyzéket), a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főmunkatársaként végzem.
Azért vállalkoztam arra, hogy az eddigi eredményeket – német és magyar nyelven – összefoglaljam és egyúttal a legfontosabb szakirodalmat a jegyzetekben ismertessem, mert mindmáig nem áll rendelkezésünkre tudományos igényű áttekintés a témáról. A kötetben nem hivatkozom közvetlenül a német és magyar levéltárakban fellelhető gazdag forrásanyagot. A témát érintő alapdokumentumok az irodalomjegyzékben felsorolt művekben találhatóak, ill. pontos lelőhelyük ezekben van feltüntetve.
A szinopszis elkészítését tanácsaikkal és javaslataikkal segítették intézeti kollégáim, Horváth Sándor, Mitrovits Miklós, Kecskés D. Gusztáv és Horváth Gergely Krisztián, valamint Békés Csaba, Eiler Ferenc és Kiss J. László. Valamennyiüknek hálásan köszönöm! Köszönettel tartozom ezenkívül az intézet egykori vezetőjének, Glatz Ferencnek, aki annak idején a kutatási projektet kezdeményezte, valamint egykori kollégámnak, Dömötörfi Tibornak, akivel több éven át közösen foglalkoztunk e témával.
Schmidt-Schweizer AndreasNézsa, 2021 szeptemberében
Einleitende Bemerkungen
Die vorliegende wissenschaftliche Studie beschäftigt sich mit der Darstellung und Analyse der – schrittweisen, aber keineswegs bruchlos und parallel verlaufenden – Entwicklung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zwischen Westdeutschland und Ungarn in den Jahren von 1947 bis 1990. Aufgrund der Charakteristika der in diesen drei Bereichen stattfindenden Entwicklungen kann die Geschichte der bilateralen Beziehungen in mehrere (9) Phasen unterteilt werden. Als Hintergrund werden die wichtigsten, Westdeutschland bzw. Ungarn betreffenden weltpolitischen und blockinternen Entwicklungen sowie die in außenpolitischer Hinsicht relevanten innenpolitischen Ereignisse in beiden Ländern in Rechnung gestellt. Darüber hinaus untersucht der Verfasser auch die Auswirkungen der „deutschen Frage“ auf das westdeutsch-ungarische Verhältnis.
Die westdeutsch-ungarischen Beziehungen wurden in der behandelten Ära von vier grundlegenden Faktoren geprägt: 1) von der sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausbildenden bipolaren Weltordnung bzw. von den Gegensätzen und Konflikten zwischen dem westlichen und dem östlichen Lager; 2) von der vollständigen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Integration Westdeutschlands in die westliche Welt und in das westliche Bündnissystem sowie von dem – damit einhergehenden – außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Anpassungsdruck; 3) von der Sowjetisierung der politischen, kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung Ungarns sowie von der Eingliederung des Landes in den von der Sowjetunion dominierten sogenannten Ostblock bzw. von der stark beschränkten staatlichen Souveränität Ungarns und seinem engen innen- und außenpolitischen Spielraum; 4) von der staatlichen Teilung Deutschlands und der Zugehörigkeit der beiden, über unterschiedliche wirtschaftlich-gesellschaftliche Systeme verfügenden deutschen Staaten zum westlichen bzw. östlichen „Lager“, d.h. von der damit verbundenen ungarisch-westdeutsch-ostdeutschen „Dreieckskonstellation“.
1. Die Anfänge der offiziellen westdeutsch-ungarischen Beziehungen (1947–1955)
1.1. Erste Schritte der Kontaktaufnahme
Nachdem die offiziellen staatlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn infolge des Zweiten Weltkriegs 1944/1945 unterbrochen1 und von Januar bis Juni 1946 etwa 130.000 Ungarndeutsche aus Ungarn in die amerikanische Besatzungszone zwangsausgesiedelt worden waren,2 erfolgten 1947/1948 erste Schritte zur Kontaktaufnahme zwischen dem westdeutschen Territorium und Ungarn.3 Im Juli 1947 übergab die ungarische Regierung den amerikanischen Militärbehörden eine Note, in der um die Genehmigung zur Einrichtung eines ungarischen Konsulats in Frankfurt am Main ersucht wurde. Diesem Wunsch erteilten die Amerikaner im Januar 1948 eine positive Antwort, sodass das Konsulat seine Tätigkeit in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands im Laufe des Jahres 1948 aufnehmen konnte. Währenddessen richteten die Westalliierten in der ungarischen Hauptstadt das „Budapester Büro der Alliierten Hohen Kommission in Deutschland“4 in der französischen Botschaft, dessen Tätigkeit von der ungarischen Regierung im April 1948 genehmigt wurde, ein. Die zentrale Aufgabe beider Institutionen war es, sich mit westdeutsch-ungarischen Reiseangelegenheiten zu befassen, d.h. sie beschäftigten sich in erster Linie mit der Wiederherstellung persönlicher Kontakte auf individueller und offizieller – anfänglich vor allem geschäftlicher – Ebene.
Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (im Mai bzw. Oktober 1949) richtete die ungarische Regierung im Herbst 1949 – nachdem Ungarn und die DDR noch im Oktober 1949 diplomatische Beziehungen aufgenommen hatten – in Ostberlin eine Botschaft ein und beauftragte diese auch mit der Wahrnehmung der westdeutsch-ungarischen politischen Beziehungen. Ungarn, das während des Bestehens der Alliierten Kontrollkommission in Ungarn (bis September 1947) außenpolitisch nicht selbstständig handeln konnte, stellte anschließend seine außenpolitischen Aktivitäten vollständig in den Dienst der sowjetischen Außenpolitik. Budapest selbst begann erst 1955, sich näher mit dem politischen Verhältnis zu Westdeutschland zu beschäftigen, nachdem die Bundesrepublik ihre (fast vollständige) staatliche Souveränität wiedergewonnen hatte und fest in das westliche Bündnissystem integriert worden war. Währenddessen befasste sich die westdeutsche Regierung unter Konrad Adenauer, die bis 1951 über keine und bis 1955 nur über eine beschränkte außenpolitische Handlungsfähigkeit verfügte, so gut wie nicht mit dem politischen Verhältnis zu Ungarn (siehe unten). Die offiziellen bilateralen Kontakte beschränkten sich so auf die Handelsbeziehungen.
1.2. Die Ingangsetzung des bilateralen Handels
Nach dem Zweiten Weltkrieg existierten zwischen den westlichen Besatzungszonen und Ungarn zweieinhalb Jahre nur vereinzelte „schwarze“ bzw. inoffizielle Handelsaktivitäten.5 Im Oktober 1947 schlossen die Behörden der westlichen Besatzungszonen und die ungarische Regierung ein Zahlungsabkommen und im August 1948 unterzeichneten sie einen Handelsvertrag. Während die Westalliierten durch den Handel mit Ungarn in erster Linie versuchten, die Lebensmittelversorgung in ihren Besatzungszonen sicherzustellen, hatte die ungarische Seite ein besonderes Interesse, fehlende Industriewaren für die Bevölkerung zu importieren und Investitionsgüter für den Wiederaufbau der Industrie zu besorgen. Die Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949 machte es dann möglich, dass sich zwischenstaatliche Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und Ungarn entwickelten.
Im September und Oktober 1949 verhandelten Repräsentanten der Westalliierten, die noch bis November 1949 für die Abwicklung der westdeutschen Außenhandelsangelegenheiten zuständig waren, mit Delegierten der im August 1949 ausgerufenen „Volksrepublik Ungarn“. Als Ergebnis der Gespräche unterzeichneten beide Seiten ein Protokoll über die Warengruppen und -mengen, deren Import bzw. Export sie anstrebten. Mit diesem Schritt konnte der offizielle Warenaustausch zwischen Ungarn und der Bundesrepublik – auf der Grundlage des sogenannten Clearing-Systems6 – Anfang des Jahres 1950 beginnen. Ab Herbst 1950 kam es im Rahmen von Sitzungen einer westdeutsch-ungarischen Gemischten Kommission zu Verhandlungen, im Zuge derer beide Seiten die jährlichen Handelskontingente nach Warengruppen festlegten. Um die bilateralen Handelsbeziehungen weiterzuentwickeln, richtete die ungarische Seite im Jahr 1951 eine Handelsvertretung („Büro der Vertretung der Ungarischen Außenhandelsunternehmen“) in Frankfurt am Main ein. Die Tatsache, dass die westdeutsche Großindustrie7 und die Regierung Adenauer ab 1953 – zur Zeit des Beginns des westdeutschen „Wirtschaftswunders“8 – versuchten, eine möglichst effiziente Wirtschaftskooperation mit der Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten zu entwickeln,9 gab auch dem westdeutsch-ungarischen Handel einen weiteren Anstoß.
Die Beweggründe für die Weiterentwicklung der bilateralen Handelsbeziehungen sind in einer historisch-traditionellen Interessenkonstellation zu suchen: Während es im Interesse (West-) Deutschlands lag, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Produkte der Nahrungsmittelindustrie und Rohstoffe einzuführen sowie die Erzeugnisse seiner hochentwickelten Industrie zu exportieren, strebte Ungarn an, vor allem seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse10 und außerdem gewisse Mineral- und Rohstoffe (z.B. Bauxit) auszuführen sowie Industrieartikel und Investitionsgüter zu importieren. An letzteren bestand seit Anfang der 1950er Jahre infolge der Politik der forcierten Industrialisierung in Ungarn ein besonders großer Bedarf. Darüber hinaus hatte die ungarische Seite reges Interesse daran, sich mittels der Handelskontakte moderne „westliche“ Technik zur Modernisierung seiner Wirtschaft zu beschaffen, da offensichtlich war, dass diese nicht aus den sozialistischen „Bruderländern“ bzw. im Rahmen des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW oder COMECON) bezogen werden konnte.11 Selbstverständlich war das Interesse der beiden Staaten an den Wirtschaftsbeziehungen unterschiedlich groß. Für Ungarn war der bilaterale Handel – mit Blick auf den Gesamtumsatz – von Anfang an wesentlich wichtiger als für die Bundesrepublik: Ungarns Anteil am gesamten Handelsumsatz Westdeutschlands war in der ersten Hälfte der 1950er Jahre (mit ca. 1 Prozent) wesentlich kleiner als der westdeutsche Anteil am gesamten Handelsumsatz Ungarns (ca. 5 Prozent). Außerdem war der Handel mit Westdeutschland für Ungarn auch im Hinblick auf die Qualität der Produkte von herausragender Bedeutung: Verglichen mit anderen kapitalistischen Staaten war – von Anfang an – nicht nur die Qualität der westdeutschen Produkte besser, die Erzeugnisse waren auch billiger und die Lieferfristen kürzer.12
Trotz des wechselseitigen Interesses und trotz der Knüpfung offizieller Wirtschaftskontakte war das Volumen des westdeutschungarischen Handels in der ersten Hälfte der 1950er Jahre minimal.13 Dahinter verbarg sich nicht nur der Umstand, dass die traditionellen Märkte infolge des Zweiten Weltkriegs zusammengebrochen waren, sondern auch die Tatsache, dass die Wirtschaftssysteme – also die (stalinistische) Plan- bzw. die westliche Marktwirtschaft – nicht wirklich kompatibel waren und die Prioritäten des ungarischen Außenhandels einen grundlegenden Wandel erfahren hatten: Seit der zweiten Hälfte der 1940er Jahre wurde der ungarische Außenhandel immer stärker den Macht- und Wirtschaftsinteressen der sowjetischen Vormacht untergeordnet. Die Sowjetunion entwickelte sich so – mit weitem Vorsprung – zum „Handelspartner Nr. 1“ der Volksrepublik Ungarn.
Im Jahr 1950 importierte die Bundesrepublik Waren im Wert von nur 102 Millionen DM aus Ungarn und exportierte lediglich Produkte im Wert von 132 Millionen DM dorthin. Dieses unbedeutende Handelsvolumen verringerte sich in den folgenden drei Jahren – wegen des Koreakriegs bzw. des westlichen Boykotts gegenüber den Ländern des „Ostblocks“ – weiter: 1951 machte der westdeutsche Import 82 Millionen DM und der Export 73 Millionen DM aus, 1952 waren es 61 Millionen DM bzw. 65 Millionen DM und 1953 waren es 45 Millionen DM bzw. 68 Millionen DM.14 Erst mit der Entspannung der weltpolitischen Lage 1954/1955 kam es zu einem neuerlichen Ansteigen des bilateralen Handels. 1954 erreichte der westdeutsche Import 66 Millionen DM und der Export 99 Millionen DM, ein Jahr später stiegen die Zahlen dann deutlich an. Die Einfuhr in die Bundesrepublik betrug 1955 87 Millionen DM, die westdeutsche Ausfuhr 146 Millionen DM. Damit näherte sich der Handelsumsatz wieder demjenigen des Jahres 1950 an. Nachdem die Bundesrepublik und Ungarn im Oktober 1955 ein Zahlungsabkommen geschlossen hatten, stieg das Gesamtvolumen des bilateralen Handels in den Monaten von Anfang Januar bis Ende Oktober 1956 dann auf 241 Millionen DM.
1 Nachdem Horthy-Ungarn auf deutscher Seite am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hatte, erklärte die ungarische Provisorische Nationalregierung, die im von sowjetischen Truppen eroberten Ostungarn, in Debrecen, gebildet worden war, Deutschland Ende Dezember 1944 den Krieg.
2 Aus Ungarn wurden im Zeitraum von Januar 1946 bis Juni 1948 insgesamt etwa 170.000 Ungarndeutsche in zwei Wellen in die amerikanische und in die sowjetische Besatzungszone in Deutschland zwangsausgesiedelt, etwa 50.000 Deutsche waren bereits gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland geflüchtet. Dies bedeutete, dass bis Mitte 1948 rund die Hälfte der Ungarndeutschen (220.000 Personen) ihre Heimat hatte verlassen müssen. In den Jahren von 1945 bis 1950 waren insgesamt 12 Millionen Menschen deutscher Abstammung aus dem Osten zwangsausgesiedelt bzw. vertrieben worden, vor allem aus den Gebieten der neuerrichteten Staaten Polen und Tschechoslowakei. Die zwangsausgesiedelten Ungarndeutschen bildeten somit nur eine sehr Gruppe unter den Vertriebenen. Näheres siehe Matthias Beer, Flucht und Vertreibung der Deutschen. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen. München 2011; Ágnes Tóth, Migrationen in Ungarn 1945-1948. Vertreibung der Ungarndeutschen, Binnenwanderungen und slowakisch-ungarischer Bevölkerungsaustausch. München 2001.
3 Hierzu und zum Folgenden siehe Andreas Schmidt-Schweizer, Rückblick auf die westdeutsch-ungarischen Beziehungen (1949–1987). In: Andreas SchmidtSchweizer (Hrsg.), Die politisch-diplomatischen Beziehungen in der Wendezeit 1987–1990 (= Quellen zu den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn 1949–1990, Bd. 3). Berlin–Boston 2018, S. 11–13; György Lázár, Magyarország és Nyugat-Németország kapcsolatai 1945 és 1958 között. In: Archivnet 5 (2005), H. 2, S. 1–10.
4 Seit Mai 1949 „Französische Botschaft–Deutsches Reisebüro”.
5 Siehe hierzu Schmidt-Schweizer, Rückblick, S. 13–16.
6 Das Clearing-System beruht darauf, dass zwei Staaten die entstehenden Verbindlichkeiten und Forderungen wechselseitig und zentral verrechnen und den Unterschied zwischen beiden begleichen. Die Abrechnung erfolgt jeweils zu einem festgelegten Zeitpunkt in einer bestimmten konvertiblen Währung.
7 Die Spitzenverbände der westdeutschen Großindustrie hatten bereits im Oktober 1952 den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft ins Leben gerufen. Dessen Aufgabe war es, die Wirtschaftsbeziehungen zu den osteuropäischen Staaten und insbesondere zur Sowjetunion zu entwickeln.
8 In den Jahren von 1951 bis 1956 wuchs das westdeutsche Bruttoinlandsprodukt (GDP) jährlich zwischen 7,3 und 12,4 Prozent. Bis Mitte der 1960er Jahre entwickelte sich die Bundesrepublik so zur drittgrößten Industriemacht der Welt.
9 Siehe hierzu Karsten Rudolph, Wirtschaftsdiplomatie im Kalten Krieg. Die Ostpolitik der westdeutschen Großindustrie 1945–1991. Frankfurt–New York 2004, S. 61–79.
10 Der ungarische Gesamtexport bestand in den Jahren von 1953 bis 1957 zu mehr als 60 Prozent aus landwirtschaftlichen Produkten.
11 Vgl. Mihály Ruff, A hivatalos Magyarország nyugatnémet politikai kapcsolatairól (1956–1958) [Über die politischen Beziehungen des offiziellen Ungarn zu Westdeutschland (1956–1958)]. In: Századok 132 (1998), H. 5, S. 1128.
12 Vgl. Mihály Ruff, A magyar–NSZK kapcsolatok (1960–1963). Útkeresés a doktrínák útvesztőjében [Die ungarisch-westdeutschen Beziehungen (1960–1963). Wegsuche im Labyrinth der Doktrinen]. In: Múltunk 44 (1999), H. 3, S. 10.
13 Vgl. Othmar Nikola Haberl et. alt. (Hrsg.), Unfertige Nachbarschaften. Die Staaten Osteuropas und die Bundesrepublik Deutschland. Essen 1989, S. 268.
2. Die bilateralen Beziehungen in der Phase der Destalinisierung und der Niederschlagung des Volksaufstands (1955–1957)
2.1. Versuche einer Neuorientierung der ungarischen Außenpolitik
Im Zuge der Destalinisierungswelle, die nach dem Tod Stalins im März 1953 eingesetzt hatte, und der internationalen Entspannung beendete die Sowjetunion im Januar 1955 und Ungarn im März 1955 offiziell den Kriegszustand mit Deutschland. Und im September 1955 nahmen Moskau und Bonn diplomatische Beziehungen auf. Vor diesem Hintergrund erfolgten 1955/1956 im ungarischen Außenministerium, nachdem zuvor entsprechende Beschlüsse auf der Parteiebene getroffen worden waren, erste Schritte zur Ausarbeitung einer neuen, aktiveren und die nationalen Interessen Ungarns stärker berücksichtigenden Außenpolitik. 15 (Zu dieser Zeit unternahm auch die polnische und tschechoslowakische Diplomatie ähnliche konzeptionelle Anstrengungen.) Als Ergebnis entstanden im ungarischen Außenministerium Pläne, die darauf abzielten, dass sich Ungarn nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch der Bundesrepublik annähern sollte. Die bilateralen politischen Beziehungen sollten normalisiert werden und es sollte sich ein modus vivendi zwischen beiden Staaten entwickeln. Ende Juni 1955, parallel zu den sowjetisch-westdeutschen Verhandlungen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, erstellte der ungarische Außenminister János Boldóczki eine Konzeption über die Knüpfung von vertraglichen Kontakten zu Westdeutschland, darunter auch über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Unter Berufung auf die historischen Traditionen, die weitgehend konfliktfreie Vergangenheit und die günstig erscheinende internationale Lage unterbreitete das Außenministerium der Parteiführung im Sommer 1956 eine Reihe konkreter Vorschläge für eine schrittweise Annäherung beider Staaten. In den Vorstellungen spielte – neben der Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit – unter anderem die Absicht eine Rolle, die ungarische Regierung solle Kontakte zu westdeutschen Oppositionspolitikern, in erster Linie zu „progressiven“ Sozialdemokraten, zur westdeutschen linken Presse sowie zu „offenen“ liberalen Politikern, die am Ausbau der Wirtschaftskontakte interessiert seien, herstellen. Außerdem sollte sie die – lange Zeit zurückreichende – Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Kultur und Sport reaktivieren sowie die Reisemöglichkeiten zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Ungarn erleichtern. Das Verhältnis zur westdeutschen Kommunistischen Partei (KPD bzw. DKP) spielte eine drittrangige Rolle, da die Partei – während der gesamten behandelten Epoche – keinen politischen Einfluss auf die westdeutsche Politik ausübte.
2.2. Die ersten westdeutsch-ungarischen politischen Verhandlungen
Infolge der ungarischen Bemühungen kam Anfang Oktober 1956 ein erstes Treffen zwischen ungarischen Diplomaten und westdeutschen Politikern (und Journalisten) zustande: Mitarbeiter der ungarischen Botschaft in Ostberlin (u.a. Sándor Kurtán und János Beck) kamen mit westdeutschen Politikern der Freien Demokratischen Partei (FDP) zusammen, unter ihnen Erich Mende und Walter Scheel.16 Die liberalen Politiker motivierte – entsprechend dem Charakter der FDP als Unternehmerpartei – in erster Linie die Absicht, die Wirtschaftskontakte nach Osten auszubauen, zu diesem Schritt. Im Laufe der Gespräche erörterten beide Seiten die sich aus den unterschiedlichen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Systemen ergebenden grundlegenden Probleme des Ost-West-Handels sowie die Möglichkeiten, die politischen Beziehungen sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und Ungarn zu entwickeln. Hinsichtlich der Wirtschaftskooperation plädierten sie – unter anderem – für die Entsendung von Expertendelegationen und bezüglich des politischen Verhältnisses vertraten beide Seiten die Meinung, dass es notwendig sei, diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Ungarn herzustellen.
Währenddessen kam es auch zu ersten, allerdings nicht zwischenstaatlich organisierten bilateralen Kontakten im Bereich von Sport, Wissenschaft und Kultur: So wurden beispielsweise – zumeist in der Bundesrepublik – Fußballspiele, wissenschaftliche (Mediziner-) Konferenzen und Kunstausstellungen ausgerichtet.
Seitens der seit September 1949 amtierenden christlichkonservativen Regierung unter Konrad Adenauer bzw. der regierenden Unionsparteien, der Christlich Demokratischen Union (CDU) und der Christlich-Sozialen Union (CSU), zeigte sich allerdings – über die pragmatisch behandelten Wirtschaftskontakte hinaus – keinerlei Interesse an einer Normalisierung der politischen Beziehungen. Diese Haltung kann darauf zurückgeführt werden, dass sich Adenauer in seiner Außenpolitik fast ausschließlich auf die Westintegration der Bundesrepublik konzentrierte.17 Die bundesdeutsche Regierung war lediglich bereit, politisch-diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion aufzunehmen, da Moskau die herrschende, alles dominierende Macht im „Ostblock“ war und das Land für Westdeutschland – aufgrund seiner gewaltigen Rohstoffvorhaben – wirtschaftlich besonders wichtig war. Darüber hinaus war die Sowjetunion – aufgrund der internationalen Verträge des Jahres 1945 – eine der vier Großmächte, ohne die die sogenannte deutsche Frage, also das Problem der Teilung Deutschlands bzw. das Verhältnis der beiden Teilstaaten, sowie die – damit verbundene – BerlinFrage (siehe unten) nicht gelöst werden konnten.18