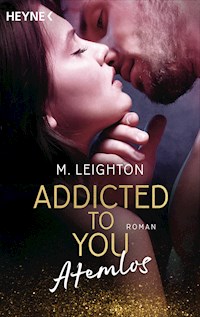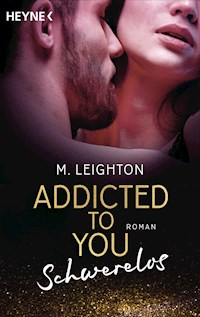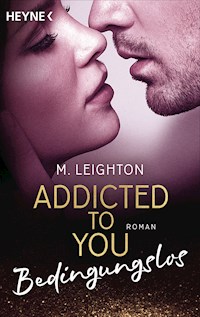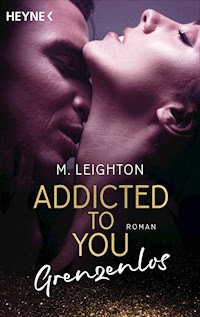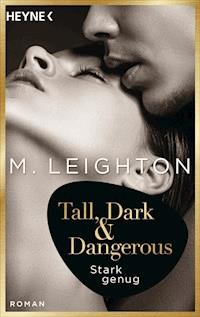
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tall, Dark & Dangerous-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ist sie stark genug, dem gefährlichsten Mann zu vertrauen, den sie je getroffen hat?
Muse Harper ist Künstlerin und hat eine Schwäche für Rotwein, schräge Filme und Männer mit Geheimnissen. Vor acht Monaten musste sie eine Entscheidung treffen – alles zurücklassen, was sie je gekannt hat, um ihre Familie zu beschützen, oder zu bleiben und riskieren, dass jemand verletzt wird. Muse entschied sich für ersteres. Ihr Plan hatte super funktioniert, bis sie herausfand, dass ihr Vater verschwunden war. Bei dieser Gelegenheit lernte sie Jasper King kennen – ihre Liebe, ihr Verderben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DAS BUCH
Wie würde ich mich selbst beschreiben? Also, ich bin Muse Harper. Ich bin in meinen Zwanzigern, Künstlerin, habe eine Schwäche für Rotwein, schräge Filme und Männer mit Abgründen. Aber das war, bevor ich Jasper King getroffen habe. Er wurde mein fürchterlicher Fehler. Vor acht Monaten musste ich eine Entscheidung treffen – alles zurücklassen, was ich je gekannt habe, um meine Familie zu beschützen, oder zu bleiben und zu riskieren, dass jemand verletzt wird. Ich entschied mich für Ersteres. Mein Plan hatte super funktioniert, bis ich herausfand, dass mein Vater verschwunden war. Jasper sollte mir helfen, meinen Vater zu finden. Was ich nicht wusste, war, dass unser Treffen kein Zufall war. Menschen zu jagen ist nicht Jaspers einzige Beschäftigung. Und mir zu helfen war nur ein Teil seines Plans. Ich wünschte, ich hätte es früher herausgefunden, bevor mein Herz begann sich einzumischen. Aber selbst dann weiß ich nicht, ob ich irgendetwas anders gemacht hätte …
DIE AUTORIN
Michelle Leighton wurde in Ohio geboren und lebt heute im Süden der USA, wo sie den Sommer über am Meer verbringt und im Winter regelmäßig den Schnee vermisst. Leighton verfügt bereits seit ihrer frühen Kindheit über eine lebendige Fantasie und fand erst im Schreiben einen adäquaten Weg, ihren lebhaften Ideen Ausdruck zu verleihen. Sie hat unzählige Romane geschrieben. Derzeit arbeitet sie an weiteren Folgebänden, wobei ihr ständig neue Ideen, aufregende Inhalte und einmalige Figuren für neue Buchprojekte in den Sinn kommen.
LIEFERBARE TITEL
Addicted to You – Atemlos
Addicted to You – Schwerelos
Addicted to You – Bedingungslos
The Wild Ones – Verführung
The Wild Ones – Verlangen
The Wild Ones – Verheißung
All the Pretty Lies – Erkenne mich
All the Pretty Lies – Befreie mich
All the Pretty Lies – Liebe mich
M. Leighton
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Sabine Schilasky
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
Strong Enough bei Berkley.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt
und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen
unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung
sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung,
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglich-
machung, insbesondere in elektronischer Form, ist
untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter
enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine
Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen,
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der
Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbucherstausgabe 12/2017
Copyright © 2015 by M. Leighton
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Uta Dahnke
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
unter Verwendung von shutterstock/Artem Furman
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-21733-4V001
www.heyne.de
Prolog
Jasper
Siebzehn Jahre zuvor
»Was macht er jetzt, Mom?«, frage ich und versuche mich ihr zu entwinden, doch sie hält mich fest. Ich fühle, dass gleich etwas Schlimmes passieren wird, aber ich weiß nicht, warum. »Vielleicht kann ich dafür sorgen, dass er nicht böse wird. Lass mich los!«
»Schhh, Baby. Alles wird gut. Du musst hier bei mir bleiben, sonst holt er dich auch.«
Mein Herz schlägt so heftig, dass es wehtut, so wie das eine Mal, als Mikey Jennings mir gegen die Brust geboxt hat. Nicht mal die Umarmung meiner Mutter macht den Schmerz besser, und dabei wird sonst immer alles besser, wenn sie mich umarmt.
Mir brennen die Augen, während ich aus dem Fenster starre. Ich darf nicht blinzeln. Wage es nicht. Ich will nicht sehen, was Dad mit meinem großen Bruder Jeremy macht, aber wegschauen kann ich auch nicht.
Je länger ich hinsehe, desto weniger kann ich mich rühren. Als wären meine Füße am Boden festgeklebt und meine Arme an meinem Körper. Ich habe das Gefühl, nicht atmen zu können. Ich kann nur zu dem kalten, grauen Wasser und den beiden Umrissen hinüberschauen, die sich ihm nähern.
Ich sehe, wie Jeremys Finger sich in die Hand meines Dads krallen, während der ihn an den Haaren mitschleift. Doch es nützt ihm nichts. Dad lässt nicht los. Jeremy stolpert in seinen schmutzigen Turnschuhen durch den Matsch und das Gras, aber mein Vater wird nicht langsamer. Daran, wie er seine andere Faust ballt, erkenne ich, dass er wütend ist. Vielleicht sogar wütender als sonst.
Jeremy hatte heute wieder Ärger in der Schule. Sie haben Dad bei der Arbeit angerufen, nicht Mom; deshalb wusste sie von nichts, bis Dad mit Jeremy nach Hause gekommen ist. Doch da war es schon zu spät.
»Keines meiner Kinder benimmt sich wie ein Monster. Mit dir stimmt was nicht, Junge«, hatte Dad gesagt, als sie zur Tür reinkamen. Jeremy ging vor ihm her, und Dad stieß ihn so fest von hinten, dass mein Bruder hinfiel und über den Küchenboden schlitterte.
Es stimmt wirklich etwas nicht mit Jeremy. Der Arzt hat das gesagt. Er hat gesagt, dass Jeremy Medizin braucht, aber Dad will das nicht hören. Ihn macht es nur wütend, noch wütender auf Jeremy.
Ich stand neben Mom, als Dad vor ihr stehen blieb. Er zeigte mit dem Finger auf sie, wobei er fast ihre Nasenspitze berührte. Seine Augen waren an den Rändern ganz rot, wie sie es immer waren, wenn er sich bereit machte, Jeremy zu verprügeln. »Bete lieber, dass dieses kleine Stück Scheiße hier nicht noch genauso wird!«, sagte er und verpasste mir mit der flachen Hand eine Ohrfeige. Mein Gesicht brannte wie von einem Bienenstich, aber ich habe nicht mal »Aua« gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. So dumm war ich nicht, dass ich den Mund aufgemacht hätte. »Einer reicht.«
Dann hat Dad Jeremy hinten an seinem Hemd gepackt, ihn hochgezogen und aus der Küchentür nach draußen geschleudert. Jeremy fiel wieder hin, doch das hielt Dad nicht weiter auf. Er ist hinter ihm her in den Garten.
»Hoch mit dir, du nutzloses kleines Arschloch«, brüllte er. Da war etwas überhaupt nicht Gutes in Jeremys Augen, als er aufsah, und dann spuckte er auf Dads Arbeitsstiefel. Ich wusste, dass er das nicht hätte tun sollen. Und erst recht wusste ich es, als Dad ihm in die Rippen trat.
Jetzt schauen wir zu, wie mein großer Bruder weggeschleppt wird, um bestraft zu werden.
Aber statt bei dem alten Baumstumpf haltzumachen, über den er Jeremy legt, um ihn auszupeitschen, geht Dad weiter, geradewegs in den See. Er bleibt nicht mal am Rand stehen.
Mir tun die Augen weh, aber ich kann sie nicht zumachen. Etwas ist diesmal anders. Fühlt sich anders an. Etwas an den heißen Tränen, die mir übers Gesicht strömen, verrät mir, dass es diesmal anders ist.
Dad watet in seinen Stiefeln durch das flache Wasser. Er zieht meinen Bruder hinter sich her wie einen Müllsack, wenn er seinen Truck belädt, um zur Deponie zu fahren. Jeremy fällt hin, steht wieder auf, fällt hin und steht wieder auf. Jetzt kämpft er richtig. Er tritt und schlägt um sich. Ich sehe, dass sein Mund weit offen ist, als würde er schreien, doch ich kann es nicht hören. Das Einzige, was ich höre, ist mein Herzklopfen. Es ist laut wie Trommeln in meinen Ohren.
Dad bleibt stehen, als ihm das Wasser bis zu den Hüften geht. Er zieht Jeremy zu sich. Nun sehe ich sein Gesicht von der Seite – das von meinem Vater. Es ist so rot, dass es lila aussieht. An seinem Hals treten die Adern hervor. Das Gesicht meines Bruders ist beinahe so weiß, als würde er Halloween-Gespensterschminke tragen. Doch seine Augen sind trocken. Er hat schon längst aufgehört, wegen der Sachen zu heulen, die Dad ihm antut.
Dad brüllt Jeremy an, wobei er den Mund so weit aufreißt, dass es aussieht, als könnte er ihn auffressen. Ihn wie eine Schlange im Ganzen schlucken. Jeremy starrt ihn bloß mit seinem bleichen Gesicht an. Dad schüttelt meinen Bruder so fest, dass Jeremys Kopf nach hinten fliegt, und dann taucht er ihn unter Wasser.
Ich ringe nach Luft. Das habe ich Dad noch nie tun sehen, egal, wie wütend er auf Jeremy war. Etwas in meiner Brust brennt, während ich zuschaue, wie Dad ihn unter Wasser hält. Als könnte ich auch nicht atmen. Als würde die Luft in mir feststecken und brennen. So wie ich hier feststecke. Und es mir wehtut.
Ich schmecke das Salz von meinen Tränen und lecke sie weg, denn ich schäme mich, weil ich weine. Etwas tropft mir auf den Kopf und wird zu einem kleinen Rinnsal, das mir schneckengleich seitlich am Gesicht runterkriecht. Ich wische es weg und blicke auf meine Hand. Das ist nur Wasser. Warmes Wasser.
Tränen. Aber nicht meine. Die sind von Mom.
Ich zähle die Sekunden. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig. Und ich frage mich, wie lange Jeremy die Luft anhalten kann. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich platzen.
Vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig.
Luft und Lärm drängen sich durch meine enge Kehle und kommen als gurgelnder Schrei aus meinem Mund. Sie dröhnen wie Donner durch den stillen Raum. Es ist das einzige Geräusch, das ich mache. Das einzige, das ich machen kann.
Ich beobachte Jeremys Hände, die auf den Unterarm meines Dads einschlagen. Dad rührt sich aber nicht, lässt nicht locker. Sein Arm ist gestreckt und unnachgiebig, hält meinen einzigen Bruder unter Wasser.
Moms Arme drücken mich ganz fest. Es wird noch schwerer, weiter zu atmen.
Siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig.
Ich zähle, obwohl die Zeit stehen geblieben ist. Als ich bei vierzig bin, fange ich wieder von vorn an. Ich fange für Jeremy neu an, damit er mehr Luft bekommt. Damit er noch eine Chance kriegt. Nur nutzt er die nicht. Er kann nicht. Seine Zeit ist schon abgelaufen. Sein Atem verbraucht. Ich weiß es, als ich sehe, wie seine Hände herunterfallen. Sie plumpsen ins Wasser und treiben dort, als hingen sie nicht an jemandem dran. Als wäre mein Bruder einfach … weg.
Dad lässt ihn los. Er schiebt ihn ins tiefere Wasser. Jeremy treibt dort, als würde er »Toter Mann« spielen. So wie er es früher gemacht hat, wenn Mom im Sommer mit uns baden ging, solange unser Vater bei der Arbeit war.
Ich sehe nicht hin, wie Dad aus dem See kommt. Ich beobachte nicht, wie er durch den Garten geht. Ich blicke nicht mal auf, als er durch die Küchentür wieder hereinkommt. Stattdessen beobachte ich Jeremy, warte, dass er sich bewegt, dass er aufwacht.
»Hol deine Handtasche. Wir gehen essen. Die Jungs können sich hier ein Brot machen.«
Jungs? Heißt das, Jeremy geht es gut?
Ich will zur Tür laufen, aber Mom packt mich. »Jasper, sei ein lieber Junge und hol meine Handtasche, Süßer. Die hängt neben der Haustür.«
Ihre Augen sind anders. Sie wirken ängstlich, und das macht mir Angst. Deshalb gehe ich einfach ihre Handtasche holen und bringe sie ihr, wie sie gesagt hat. Als ich sie ihr gebe, nimmt Mom sie und zieht mich an sich. Ich fühle, dass ihre Arme zittern, und als sie mich loslässt, weint sie. Aber sie lächelt auch, als dürfte sie nicht weinen. Keiner von uns darf weinen.
»Du setzt dich da vor den Fernseher, okay? Und rühr dich nicht.« Ihre Stimme warnt mich vor irgendwas. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe Angst. Und sie hat auch Angst.
»Okay.«
Ich schalte eine Zeichentrickserie an und setze mich auf die Couch, bis ich höre, wie Dads Truck startet. Dann springe ich auf und renne, so schnell ich kann, durch die Küche, zur Hintertür hinaus und durch den Garten zum See.
Es regnet jetzt, und das Gras ist rutschig. Zweimal falle ich hin, ehe ich das Ufer erreiche. Dort rufe ich laut nach meinem Bruder.
»Jeremy!« Er bewegt sich nicht, treibt einfach auf der Oberfläche wie meine grüne aufblasbare Schildkröte. »Jeremy!«
Ich sehe zurück zum Haus und wieder zu meinem Bruder. Hier kenne ich keinen, der mir helfen kann. Keiner legt sich mit meinem Dad an. Nicht mal meine Mom. Wenn ich Jeremy nicht helfe, wird er sterben.
Meine Hände zittern, und meine Knie fühlen sich komisch an, als ich ins Wasser gehe. Es ist so kalt, dass es auf meiner Haut piekt, so wie letzten Winter, als ich von meinem Schlitten gefallen bin und Schnee in meine Hose kam. Den konnte ich gar nicht schnell genug herausbekommen. Er war so kalt, dass er brannte. Aber diesmal gehe ich weiter, egal, wie sehr es wehtut.
Als mir das Wasser bis zum Kinn geht und meine Zähne so klappern, dass ich mir auf die Lippe beiße, überlege ich umzukehren. Jeremy ist so weit weg. Ich kann ihn kaum noch sehen, und ich bekomme nicht genug Luft, um nach ihm zu rufen.
»J-J-Jer…«, versuche ich es noch einmal.
Ich paddle weiter hinaus. Meine Arme und Beine sind ganz schwer, und es ist schwierig, sie im Wasser zu bewegen. Als würde ich versuchen, in kalter, dicker Suppe zu schwimmen. Ich strenge mich an, den Kopf hochzuhalten, schlucke das Wasser, das mir in den Mund schwappt.
Ich schwimme und schwimme und schwimme, beobachte Jeremys Hinterkopf, bis ich so nah dran bin, dass ich ihn anfassen kann. Es gießt nun richtig. Große, dicke Tropfen platschen meinem Bruder in den Nacken und laufen mir über die Stirn und in die Augen.
Ich greife mit der Hand in sein dunkles Haar und hebe Jeremys Kopf aus dem Wasser. Seine Augen sind offen, aber sie sehen mich nicht an. Sie starren irgendwas anderes an, was ich nicht sehen kann. Ich greife nach seinem Arm. Der ist kalt und fühlt sich ein bisschen wie dieser Fisch an, den Dad nach Hause mitgebracht hatte und dem Jeremy die Haut abziehen musste.
Mein Bauch tut weh, und meine Augen brennen. Es fühlt sich an, als würde mir jemand den Oberkörper zusammendrücken, und das so fest, dass ich nicht mal weinen kann.
Ich nehme die Hand meines großen Bruders und ziehe ihn zu mir, in Richtung Ufer. Er treibt ziemlich leicht, also schwimme ich ein Stück und ziehe, schwimme wieder ein bisschen und ziehe.
Nach einer Weile wird es immer schwerer, mich zu bewegen, immer schwieriger, mein Gesicht über Wasser zu halten. Das Ufer, der Rasen, die Hintertür des Hauses … alles ist so weit weg, kommt nicht näher. Ich habe mehr Angst als jemals zuvor. Sogar noch mehr als das eine Mal, als Jeremy mich gezwungen hatte, Tanz der Teufel mit ihm zu gucken.
Jetzt kommt Jeremy mir schwer vor, als würde er jedes Mal, wenn ich an ihm zerre, versuchen, mich nach unten zu ziehen. »Schwimm, Jer, schwimm«, murmle ich mit dem Mund voller Wasser. »Bitte!«
Ich gehe unter. Als ich um Hilfe schreien will, obwohl ich doch weiß, dass keine kommt, läuft mir Wasser in den Hals. Ich will husten, kann aber nicht. Da ist keine Luft.
Ich sehe das Licht über mir und strenge mich an, mit schweren Armen und Beinen dem Hellen entgegenzukraulen. Als mein Gesicht endlich aus dem Wasser ist, greife ich nach der Hand meines Bruders. Ich halte sie so fest, wie ich noch nie etwas festgehalten habe, nicht mal meinen liebsten G.I. Joe-Soldaten.
Ich paddle so schnell und so fest, wie ich kann, ziehe Jeremy hinter mir her, bis ich den glitschigen Grund des Sees mit den Füßen erreiche. Dann ziehe und zerre ich Jeremy in den flachen Teil und drehe ihn auf den Rücken.
Seine Lippen sind blau, und sein Gesicht ist immer noch so weiß. Aber seine Augen machen mir am meisten Angst. Die sehen nicht aus, als wäre er wach. Aber sie sehen auch nicht aus, als würde er schlafen. Eigentlich sehen sie so aus, wie sich meine anfühlen – verängstigt. Als hätte er etwas gesehen, wovor er sich verstecken wollte, ohne aber schnell genug wegkommen zu können, und jetzt ist er einfach … erstarrt.
Ich rüttle an seinen Schultern, schreie seinen Namen. Und ich weine, obwohl ich das nicht will.
Schließlich gebe ich auf und haue ihm auf die Brust. Ich weiß, dass er mir, wenn er aufsteht, gegen die Beine boxen wird, bis ich schreie, aber das ist mir egal. Ich will einfach nur, dass er aufsteht. Doch das tut er nicht. Er steht nicht auf. Er rührt sich gar nicht, rutscht bloß über den Matsch, bis er wieder im Wasser ist.
Ich will nach ihm greifen, rutsche aber selbst aus und falle fast ins Wasser zurück. Das macht mir solche Angst, dass ich wie irre schreie. Ich kann da nicht wieder rein. Wenn ich wieder ins Wasser gehe, komme ich nicht mehr raus. Das weiß ich.
Zwing mich nicht wieder rein! Zwing mich nicht wieder rein!
Aber was ist mit Jeremy? Was ist mit meinem Bruder?
Ich weine so leise wie möglich, als er wieder von mir wegtreibt, und blicke seinem weißen Geistergesicht nach, bis mir schwarz wird vor Augen.
Kapitel 1
Muse
Ich schüttle den Dreihundert-Dollar-Pullover aus, den ich eben zum dritten Mal zusammengelegt hatte, und versuche es erneut. Etwas mit den Händen zu tun scheint meine Nerven zu beruhigen. Es lenkt mich von dem Mann ab, auf den ich warte, und von meiner Sorge, weil ich diesen Schritt wage.
Als das eisblaue Kaschmir perfekt gefaltet ist – zum vierten Mal –, lege ich den Pullover oben auf den Stapel der anderen und sehe auf meinem Handy nach der Uhrzeit.
»Es ist fast Mittag, verdammt!«, murmle ich, als könnte mich meine Freundin Tracey Garris am anderen Ende der Stadt hören. Sie ist diejenige, die diesen Typen kennt. Ich hätte von ihr mehr Informationen über ihn bekommen sollen, aber sie war heute Morgen in Eile und ist jetzt in einem Meeting, sodass ich leider weiter warten muss. Uninformiert. Ich weiß nur, was sie ins Telefon geflüstert hat, ehe sie auflegte: dass ein Typ hier vorbeikommt, der Jasper King heißt.
Ich stoße ein frustriertes Knurren aus und schnappe mir den nächsten Pullover, den ich so schwungvoll ausschüttle, dass der eine Ärmel mit dem Geräusch eines fernen Donnerschlags auf den Tisch knallt. Aus irgendeinem Grund geht es mir besser, nachdem ich ein wenig von meinem Frust an etwas ausgelassen habe, wenn auch nur an einem unschuldigen, sehr teuren Kleidungsstück.
Statt mich gleich wieder in meine Verärgerung hineinzusteigern, blende ich bewusst alles aus bis auf den Song, der gerade läuft: If I Loved You. Das Lied erinnert mich immer an Matt, den Mann, den ich hinter mir gelassen habe. Den Mann, der es hätte hassen sollen, mich gehen zu sehen. Den Mann, der es gehasst hätte, mich gehen zu sehen, wenn er mich so geliebt hätte, wie ich es mir von ihm wünschte. Aber das tat er nicht. Er ließ mich gehen. Einfach so. Und auch jetzt noch, nach acht langen Monaten, tut es mir weh, an ihn zu denken.
Ich verdränge den Schmerz nicht. Vielmehr aale ich mich auf eine verquere Art in ihm. Wie die meisten Künstler schätze auch ich alle Emotionen. Ob gute oder schlechte, sie inspirieren mich. Sie verleihen meinem Leben Farbe, wie Pinselstriche auf einer weißen Leinwand. Sie geben mir das Gefühl, lebendig zu sein. Manchmal gebrochen, aber immer lebendig.
Nachdem ich mit dem Pullover fertig bin, schlendere ich durch den Laden, ganz in Gedanken an meinen Ex und den Trennungsschmerz versunken. Ich richte gerade einen Krawattenständer, als die Türglocke Kundschaft meldet. Aus dem Augenwinkel nehme ich eine Bewegung wahr und sage automatisch zur höflichen Begrüßung: »Willkommen bei Mode Chic.« Einerseits stört mich die Unterbrechung, andererseits bin ich fast dankbar.
Es kommt keine Reaktion, also ordne ich seufzend die letzte Krawattenreihe und streiche meine Weste glatt, bevor ich mich zu dem Kunden umdrehe. Kaum erblicke ich den Störenfried, verpuffen sämtliche Gedanken an Matt, die Vergangenheit und alle Sorgen der Welt, bis ich wieder Luft bekomme.
Der Mann steht hinter mir. Ich habe ihn nicht näher kommen hören, kein Aftershave und keine Seife gerochen, auch sonst nichts bemerkt. Er kam in einem Moment durch die Tür und war im nächsten Augenblick direkt hinter mir.
Er ist groß, sehr groß und von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Abgesehen davon und von seinem schlanken, extrem V-förmigen Körper, ist das alles, was mir an seiner Figur auffällt. Sein Gesicht ist es, das mich gefangen nimmt. Als Künstlerin fühle ich mich an eine Bronzestatue erinnert, wie sie von den begabten Händen eines Michelangelo oder Donatello geformt sein könnte, von Bernini oder Rodin. Als Frau finde ich ihn schlicht atemberaubend.
Sein Gesicht ist durch scharfe Konturen gekennzeichnet – die glatte Stirn, die gerade Nase, die hohen Wangenknochen, das kantige Kinn. Sogar seine Lippen sind so klar umrissen, dass ich mich dabei ertappe, sie anstarren, eine Hand heben und sie berühren zu wollen. Um mich zu vergewissern, dass sie echt sind. Dass er echt ist. Doch am Ende sind es seine Augen, an denen mein Blick hängen bleibt. Sie sind von einem hellen, funkelnden Goldbraun, wie ein Glas Honig, wenn man es in die Sonne hält. Und sie sind genauso warm und klebrig, halten mich in ihren köstlichen Tiefen gefangen.
Trotz all meiner Sorgen, die mich nun schon seit Tagen belasten, nehme ich nichts wahr außer der rohen, urtümlichen Kraft, die ihn umgibt wie Hitze ein Feuer. Er muss nichts sagen, muss keinen einzigen Muskel bewegen, um Selbstsicherheit und Kraft auszustrahlen. Und Gefahr. Jede Menge Gefahr.
Ich weiß nicht, wie lange ich ihn angestarrt habe, bis mir bewusst wird, dass sich seine Lippen zu einem kaum merklichen Lächeln verziehen. Es ist minimal höflich und kein Verrat an der Intensität, die er aus allen Poren verströmt, sondern ganz im Gegenteil von einer ungeheuren Wirkung, die in meinen weiblichen Organen widerhallt gleich dem Echo eines Trommelschlags in den Tiefen einer Höhle. Mein Gott, er ist umwerfend!
So sehr ich das Weichwerden meiner Knie und das Kribbeln in meinem Bauch auch genieße, zwinge ich mich doch aus meiner Trance. Nicht, weil ich es unbedingt will, sondern vielmehr, weil ich es muss. Ich bin bei der Arbeit. Männer kommen hier nicht rein, um angegafft zu werden. Sie kommen her, um sich einkleiden zu lassen.
Es sei denn, sie wollen mich hier aufsuchen. Dieser Gedanke trifft mich wie eine Ohrfeige. Könnte er womöglich der Kautionsjäger sein, von dem Tracey mir erzählt hat?
»Verzeihung«, bringe ich schließlich heraus, trete einen Schritt zurück in die Realität, und meine Sorgen brechen wie eine Flutwelle über mich herein. »Was kann ich für Sie tun?«
Er neigt seinen Kopf leicht zur Seite, seine Tigeraugen verengen sich. Die Stille dehnt sich.
Ich warte. Teils hoffe ich, dass dies der Mann ist, der mir helfen wird, teils bete ich, er möge es nicht sein.
Als er endlich spricht, geschieht es mit einer Stimme, die perfekt spiegelt, was seine Erscheinung ausstrahlt – dunkle Intensität, stille Gefahr. »Ich muss meine Maße für einen Anzug nehmen lassen.«
Langsam atme ich aus und stelle fest, dass ich komischerweise enttäuscht bin, nicht erleichtert. »Das kann ich machen.« Dann trete ich noch einen Schritt zurück und verschränke die Hände auf meinem Rücken, fest entschlossen, zumindest einen Funken Gelassenheit aufzubringen, trotz seiner Gegenwart. Ich sehe zu Melanie, die heute mit im Laden arbeitet. Sie ist die Tochter der Besitzerin und mittlerweile schon seit vier Stunden ununterbrochen damit beschäftigt, hinter der Kasse zu sitzen und auf ihrem Handy rumzutippen. Wahrscheinlich sollte ich ihr sagen, dass ich nach hinten gehe, um Maße zu nehmen; doch bockig beschließe ich, sie es selbst herausfinden zu lassen, sobald sie mich sucht. Es dürfte nicht lange dauern, bis sie mitbekommt, dass ich weg bin – höchstens, bis jemand den Laden betritt und ich nicht vorn bin, um ihr die Arbeit abzunehmen. »Hier entlang«, sage ich und drehe mich zum hinteren Ladenbereich um.
Ganz professionell stelle ich einige Fragen, während ich auf die Umkleidekabinen zugehe. Obwohl sich in mir beim Klang seiner vollen, samtigen Stimme eine vielsagende Wärme ausbreitet, fällt es mir leicht, mich zu konzentrieren, solange ich den Mann nicht sehe, der mir ruhig folgt. Er beantwortet meine Fragen höflich und scheint nicht zu bemerken, welche Wirkung er auf mich ausübt.
Ich führe ihn zu der größeren Umkleide, in deren Mitte sich ein Podest in einem Spiegelhalbkreis befindet. Die Kabine bietet ausreichend Platz für einen Schreibtisch mit Computer auf einer Seite, weshalb wir diesen Raum für das Maßnehmen benutzen. Sowohl für maßgeschneiderte Anzüge als auch für besondere Anproben, etwa von Brautgesellschaften oder anderen Gruppen.
Ich schaue nach links, als wir den verspiegelten Bereich betreten. Sofort fällt mein Blick auf die Gestalt hinter mir. Ich sehe rasch wieder weg, bemerke jedoch noch, wie geschmeidig er sich bewegt. Mit der fließenden Anmut jener Dschungelkatze, an die seine Augen mich erinnern.
Wie ein Tiger. Sicher. Lautlos. Tödlich.
Ohne mich umzudrehen, weise ich mit einem Arm auf das Podest. »Wenn Sie sich bitte da oben hinstellen. Ich hole mein Maßband und bin gleich wieder bei Ihnen.« Ich bezweifle nicht, dass er meine Anweisung befolgt, auch wenn er nicht antwortet. Nach wie vor kann ich ihn weder hören, noch irgendeine Bewegung in der Luft wahrnehmen. Doch jetzt fühle ich ihn, als hätte sich mein Körper in den fünf Minuten, die er im Laden ist, vollkommen auf ihn eingestellt. Das ist absolut lächerlich, aber die reine Wahrheit. Noch nie war ich mir der Nähe eines Mannes deutlicher bewusst. Niemals.
Ich hole das Stoffmaßband, einen kleinen Notizblock und einen Stift, wobei ich mich bemühe, bei der Sache zu bleiben. Immerhin schaffe ich es, mein Denken ein klein wenig zu kontrollieren. Damit ist es allerdings vorbei, und mein Mund wird knochentrocken, als ich mich umdrehe und ihn auf dem Podest stehen sehe. Seine muskulösen Arme hängen locker an seinen Seiten, und seine langen, kräftigen Beine sind lässig ein bisschen ausgestellt. Es ist jedoch nicht seine Haltung, die mich überwältigt. Es ist sein Blick. Diese intensiven, durchdringenden Augen sind es. Sie beobachten mich wie die eines Jägers die Beute. Ich fühle, wie sie mich ausziehen, nach all meinen Geheimnissen forschen, all meine Schwächen bloßlegen.
»Ich wäre so weit«, murmelt er und schreckt mich aus meinen Gedanken.
»Ja, sicher, okay«, antworte ich, löse meinen Blick von seinen Augen und konzentriere mich auf seinen Körper. So verstörend es auch ist, ihn so unverhohlen zu mustern, ist es nicht annähernd so schlimm wie der direkte Blickkontakt. Also bleibe ich dabei.
Während ich ihn betrachte, wird mir klar, dass er ein Prachtexemplar von einem Mann ist. Ich würde wetten, dass er mit seinen Maßen alles tragen kann, vom eleganten Anzug bis hin zum Pyjama. Und, guter Gott, ich mag mir nicht mal ausmalen, was für eine umwerfende Figur er in einem Smoking machen würde! Er würde wie ein Werbe-Model aussehen. Für Waffen vielleicht. Oder Bourbon. Etwas Gefährliches und Aufregendes oder Mildes und Berauschendes.
Ich räuspere mich, als ich auf ihn zugehe, und achte auf meine Füße, während ich zu ihm auf das Podest steige. Ich spüre seinen Blick auf mir, als ich mich bewege, und fühle mich prompt tollpatschig und ein bisschen aus dem Gleichgewicht.
Ich lege den Block auf dem niedrigen Podest zu meiner Rechten hin und klemme mir den Bleistift zwischen die Zähne, ehe ich das Maßband straffe. Mit Bewegungen, die zum Glück schnell und sicher sind, messe ich seinen Nacken und die Schulterbreite, seine Brust und die Armlänge. Ich notiere die Zahlen, bevor ich mich seiner Körpermitte zuwende und das leichte Zittern meiner Hand verfluche, als meine Fingerknöchel seinen harten Bauch streifen.
Ich schreibe seine Maße auf, die den mathematischen Beweis für seine makellose Statur liefern. Was ich nicht notiere, sind die Dinge, die Zahlen nicht vermitteln können. Das muss ich auch nicht, denn sie dürften sich mir für alle Ewigkeit ins Gedächtnis eingebrannt haben.
Sagenhaft breite Schulter, an die eine Frau sich klammern kann, wenn sie Angst hat. Starke, eisenharte Arme, die eine Frau von den Füßen reißen können. Lange, straffe Beine, um unermüdlich alles zu jagen, was er will.
Als ich zur Schrittlänge komme, wird es etwas … angespannt. Trotz aller Sorgen, die mich belasten, entgeht mir die schwere Wölbung nicht, die beim Maßnehmen gegen meinen Handrücken drückt. Mein Bauch zieht sich unter einem Verlangen zusammen, das mich komplett durchbebt. Allmächtiger Herr im Himmel!
Ich richte mich ruckartig wieder auf und drehe mich weg, um die letzten Maße aufzuschreiben, bevor er sehen kann, dass ich rot werde. Normalerweise würde ich all diese Berührungen klasse finden, aber nicht jetzt. Nicht heute. Nicht so.
Ohne ein Wort oder einen Blick nehme ich meinen Block und steige von dem Podest. Dann gehe ich zum Computer, um ein Neukunden-Formular aufzurufen. Mein Puls beruhigt sich, je länger ich nur auf den Monitor starre. »Wie ist Ihr Name, Sir? Ich muss ein Profil für Ihren Auftrag anlegen.« Immer noch sehe ich nicht zu ihm, sondern starre auf den Bildschirm.
»King«, antwortet er, und seine Stimme ist so nah, dass ich unwillkürlich zusammenzucke. Ich blicke mich nicht um, als ich ihn hinter mir spüre, sondern verkrampfe mich bloß.
Dann gebe ich seinen Namen ein. Erst als ich die Enter-Taste drücke, macht es klick! King. Der Name des Kautionsjägers, von dem Tracey mir erzählt hat.
Ich drehe mich abrupt um, um ihn mit einem vorwurfsvollen Blick abzustrafen, erstarre jedoch, als ich feststelle, dass er mich gar nicht ansieht. Er schaut auf seine Hände. In denen hält er den Bleistift, den ich zwischen den Zähnen hatte, und seine Finger fahren die winzigen Bissspuren an dem Stift nach.
Ich beobachte, wie sein Daumen sanft und langsam über die Vertiefungen streicht. Vor und zurück, wie ein intimes Streicheln. Es ist hypnotisierend. Erotisch. Etwas zieht sich tief in mir zusammen und bewirkt, dass ich nach Luft schnappe. Es fühlt sich an, als würde er mich mit diesen langen Fingern streicheln. Mich berühren, mich erregen. Es ist so körperlich, so greifbar, so real, dass ich mich an der Schreibtischkante hinter mir abstützen muss.
»Was für spitze Zähne Sie haben«, sagte er leise und in einem Ton, als wäre er ein großer böser Wolf. Als er mich ansieht, sind seine Augen dunkler, ernster, bernsteinfarben. »Beißen Sie?«
»Nein«, flüstere ich. »Sie?«
»Nur, wenn man mich nett darum bittet.«
Kapitel 2
Jasper
Ich beobachte, wie sich ihre vollen Lippen öffnen. Ihr Atem geht bereits flacher. Sie ist aus dem Gleichgewicht. Genau, wie ich es mag. »Sind Sie Traceys Bekannter?«, fragt sie, sobald sie einen klaren Gedanken fassen kann. An den klammert sie sich.
»Bin ich«, antworte ich und strecke den Arm an ihr vorbei, um den Stift auf den Schreibtisch zu legen. Dabei kommt mein Gesicht ihrem ganz nah, und unsere Arme streifen sich. Ich höre, wie sie nach Luft ringt.
»Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie mussten nicht so tun, als seien Sie ein Kunde.«
Wut. Die ersetzt die Verwirrung. Ich sehe es an der Art, wie ihre schläfrigen grünen Augen Smaragden gleich zu blitzen beginnen.
»Ich wollte einige Minuten mit Ihnen allein, ehe Sie in Verteidigungsstellung gehen. So wie jetzt.«
»Warum? Wollten Sie mich prüfen oder so? Ich dachte, ich wäre diejenige, die Sie anheuert.«
»Sind Sie. Aber ich weiß gerne, für wen ich arbeite, bevor ich einen Job wie diesen übernehme.«
Obwohl ihre Miene mir sagt, dass sie nichts von meiner Taktik hält, ist sie zu neugierig, um es dabei zu belassen. »Und?«
»Und was?«
»Und was haben Sie herausgefunden? Was glauben Sie, nach zehn Minuten des Schweigens über mich zu wissen?«
Ich blicke ihr sekundenlang stumm in die Augen, ehe ich antworte. Mir ist bewusst, wie unwohl sie sich dabei fühlt. Daran bin ich gewöhnt. Diese Direktheit macht die meisten Leute nervös, aber das stört mich nicht. Andere zu verunsichern ist stets von Vorteil für mich. »Ich muss Sie nicht befragen, um Dinge über Sie in Erfahrung zu bringen. Bei Ihnen zu sein reicht vollkommen.«
»Ja, klar«, höhnt sie in dem Versuch, lässig zu sein.
»Zum Beispiel sind Sie eine fleißige Mitarbeiterin, die ihren Job ernst nimmt, auch wenn ich nicht glaube, dass dies der Job ist, den Sie eigentlich machen wollen. Sie sind gut, aber so richtig zu Hause sind Sie hier nicht, was mir verrät, dass es keine langfristige Sache ist. Sie wirkten traurig und abgelenkt, als ich reinkam, als würde Ihnen jemand fehlen. Vielleicht ist das der Teil, um den es Ihnen eigentlich geht. Und dann ist da die Tatsache, dass Sie mich anheuern wollen. Ich würde sagen, die erklärt dieses besorgte Stirnrunzeln, das ich immer wieder in Ihrem Gesicht sehe.«
Einige Sekunden steht ihr der Mund offen, ehe sie ihn zuklappt. »Ist das alles?«, fragt sie sarkastisch und zieht ihre Weste fester zu, als würde sie sich nackt fühlen. Auch das bin ich gewohnt. Keiner fühlt sich gern bloßgestellt, als wären seine Geheimnisse keine mehr.
»Nein, nicht alles, aber ich bezweifle, dass Sie den Rest hören wollen.«
Für einen Moment beäugt sie mich misstrauisch. Dann reckt sie ihr Kinn und sieht mir tapfer in die Augen. »Selbstverständlich will ich.«
Sie ist mutig. Draufgängerisch. Das gefällt mir.
»Nun, spontan würde ich sagen, Sie haben einen guten Blick für Farben, was mich zu der Annahme verleitet, dass Sie eigentlich künstlerisch tätig sind. Künstler sind gewöhnlich sehr … emotional. Ich würde sagen, dass Sie, wenn Sie nicht gerade von Sorgen zerfressen sind, die Neigung haben, sich kopfüber in alles hineinzustürzen, was Ihr Gefühl Ihnen sagt, egal, wie es ausgeht.«
»Das können Sie unmöglich wissen.«
»Oh doch. Das weiß ich. Genau wie ich weiß, dass Sie Ihr Haar mit etwas waschen, was Flieder enthält.« Ihre Augen werden größer, aber sie sagt nichts, also fahre ich fort, wobei ich mich ein klein wenig zu ihr lehne: »Und dann wäre da noch der Umstand, dass Sie sich zu mir hingezogen fühlen. Sie wollen es nicht. Wahrscheinlich denken Sie sogar, Sie sollten es nicht, aber das wiederum macht es für Sie umso unwiderstehlicher, stimmt’s?«
Sie zittert. Zittert sichtlich, doch ich weiche nicht zurück. Ich gebe ihr keinen Zentimeter des Raums, von dem ich sehe, dass sie ihn braucht. Ich will, dass sie aus dem Gleichgewicht ist, unsicher. Sie ist die Art Frau, die, wenn sie die Wahl hat, lieber fühlt, als dass sie denkt. Und das ist gut für mich. Nicht bloß wird es meinen Job leichter machen, es ist auch höllisch sexy.
Ihre Wangen leuchten vor Röte, und ich erwäge, mit dem Finger über ihre Haut zu streichen, um zu prüfen, ob sie so seidig ist, wie sie aussieht. Aber das tue ich nicht. In diesem Moment wäre es zu viel. Wenn ich eines habe, dann ist das eine Antenne für die Empfindungen anderer. Und ich bin stets beherrscht. In meiner Branche muss man das sein.
Als sie zwischen mir und dem Schreibtisch einen Schritt zurücktritt, muss ich lächeln. An ihrem Gesichtsausdruck erkenne ich, dass sie beschlossen hat, meine Einschätzung ihrer Persönlichkeit zu ignorieren. Das ist ja auch viel leichter, als die Wahrheit leugnen zu wollen.
»Sie … haben gesagt ›einen Job wie diesen‹. Einen Job wie was? Ich dachte, das machen Sie immer.«
Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Meine Aufträge sind nicht genau wie dieser, aber ziemlich nahe dran. Die Hauptsache ist, dass ich … Dinge aufspüre. Und darin bin ich verdammt gut. Also, erzählen Sie mir, meine Schöne, was darf ich für Sie suchen?«
Kapitel 3
Muse
Seine Stimme, seine Intensität … Oh Gott!Stellt er mir tatsächlich eine harmlose Frage? Denn es kommt mir vor, als würde er mich so viel mehr fragen.
»Äh, es geht nicht um ›was‹, sondern ›wen‹.«
Er nickt langsam. Sein Blick weicht nicht von meinen Augen, bleibt forschend, bohrend, prüfend, suchend. »Okay, also wen darf ich für Sie finden, Muse?«
Ich bekomme eine Gänsehaut auf den Armen, als hätte er mich berührt, statt schlicht meinen Namen auszusprechen. Hat er natürlich nicht, könnte er aber genauso gut.
Wer zum Teufel ist dieser Kerl? Und was zur Hölle stimmt mit mir nicht?
Vielleicht hat mich der Stress am Ende doch zu weit getrieben. Oder es ist einfach zu lange her, dass ich mit jemandem was hatte – wirklich was hatte –, weshalb ich hieraus mehr mache, als es eigentlich ist. So oder so ist es nicht gut. Ich darf so nicht denken und erst recht nicht so fühlen. Es gibt Wichtigeres, worauf ich mich konzentrieren muss.
Ich räuspere mich und schüttle den Zauber ab, den seine Augen auf mich ausüben. »Einen Mann.«
Eine seiner dunklen Brauen schießt nach oben. »Einen Mann? Um wen geht es?«
»Einen … Freund«, antworte ich zögerlich, weil ich ihm nicht mehr Informationen geben will, als ich unbedingt muss. Es ist zu gefährlich.
Wieder nickt er bedächtig. »Und weiß dieser Mann, dass Sie nach ihm suchen?«
»Wahrscheinlich.« Sicher war meinem Vater klar, dass ich nach ihm suchen würde, wenn ich ihn nicht erreichen konnte.
»Und hat dieser Mann … jemanden an seiner Seite, von dem ich wissen sollte?«
»An seiner Seite?«, frage ich verwirrt.
»Ja. Eine Frau, Freundin? Einen Freund?«
»Nein, aber was spielt das für eine Rolle?«
»Ich frage mich nur, ob ich es mit einer wütenden Geliebten oder einem wütenden Liebhaber zu tun bekommen könnte.«
»Was?« Erst jetzt begreife ich, was er denken muss. »Nein! Oh Gott, nein! So ist das nicht.«
»Ach nein? Wie ist es dann?«
»Dieser Typ ist älter.«
Jasper hebt beide Hände. »Hey, ich urteile nicht.«
»Nein, nein, ich meine, er … er ist nicht die Art Freund.«
Wortlos betrachtet er mich. Meine Erklärung stellt er weder infrage, noch akzeptiert er sie. »Ich brauche natürlich mehr Informationen. Einen Ausgangspunkt.«
»Okay. Was immer Sie brauchen.«
Er blickt sich um. »Passt es jetzt?«
So gern ich würde, kann ich mich nicht ewig hier hinten verstecken. Obwohl Melanie wahrscheinlich noch nicht mal mitbekommen hat, dass ich weg bin. »Na ja … eigentlich nicht. Können wir uns, ähm, nach der Arbeit treffen?«
Jasper sieht auf seine klobige schwarze Armbanduhr. Sie sieht aus wie ein Teil, das ein Navy Seal oder jemand Ähnliches tragen würde, das die Uhrzeit in einer Million Ländern anzeigt und mit einer Todesschwadron synchronisiert werden kann. »Ich habe noch einiges zu erledigen. Kann ich später bei Ihrem Apartment vorbeikommen?«
Ich merke, dass ich die Stirn runzle. Schon wieder. »Woher wissen Sie, dass ich in einem Apartment lebe?« Jasper bedenkt mich mit einem Blick, der so viel heißt wie: Im Ernst? »Ah, richtig. Sicher haben Sie sich schon über mich informiert.« Einerseits fühle ich mich bei dem Gedanken ein bisschen unwohl, als hätte er meine Privatsphäre verletzt. Andererseits, und das ist jetzt richtig pervers, finde ich es fast aufregend, dass er vor meinem Haus gewesen sein, mich von Weitem beobachtet haben könnte. Waren meine Jalousien eventuell nicht ganz geschlossen? Hatte er mich beim Frühstück oder beim Anziehen gesehen?
Ich erschauere. Das ist echt irre. Allerdings auch nicht irrer als meine Reaktion auf den bloßen Gedanken, von jemandem wie ihm gestalkt zu werden.
Wobei das natürlich unwahrscheinlich ist, bedenkt man, wie viele Informationen heutzutage allein übers Internet zu haben sind; und dennoch … ist es möglich.
»Dann heute Abend?«, fragt er.
»Äh, ja. Das wäre gut. Ich werde da sein.«
»Dann sehen wir uns später.«
Ich lächle verhalten, um das zittrige, nervöse, aufgeregte Gefühl zu überspielen, das in mir von Synapse zu Synapse springt.
Dann sehe ich Jasper nach, als er weggeht, und nehme alles wahr, von seinen fließenden, geschmeidigen Bewegungen bis hin zu der Art, wie sein kurzes, pechschwarzes Haar im Licht schimmert. Meine gesamte Existenz scheint in sich zusammenzusacken, als er außer Sicht ist, und seine Abwesenheit löst einen Kälteschauer bei mir aus.
Noch nie ist mir jemand begegnet, der so reizvoll, gut aussehend und faszinierend war wie Jasper King. Ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, dem ich so viele Fragen stellen wollte. Und ganz sicher habe ich noch keinen getroffen, bei dem ich das Gefühl hatte, keine einzige Antwort zu bekommen.
Kapitel 4
Jasper
Flieder. Ich rieche ihn, als ich die Hand hebe, um an die Tür ihres Apartments zu klopfen. Er ist wie ein zarter Schleier, der sie umhüllt, und durchdringt die Luft, wo immer sie sich aufhält. Mich erinnert er an eine Kleinstadt außerhalb von Paris, durch die ich einmal gekommen bin. Irgendwie war der Ort von den meisten modernen Dingen unberührt geblieben, ein einzelner weißer Faden in einem ansonsten schmutzigen, vergilbten Wandteppich.
Muse braucht fast volle zwei Minuten, um die Tür zu öffnen. Dann reißt sie sie auf, starrt mich an und schnürt ihren türkis- und rosafarben gemusterten Bademantel fester zu. Sie ist mal wieder wütend. Das erkenne ich nicht bloß an ihren Augen, sondern auch an der Anspannung ihres Körpers.
Sie legt direkt los: »Sie müssen meinen Aufzug entschuldigen. Ich war so dumm anzunehmen, dass Sie zu einer anständigen Zeit vorbeikommen würden.«
»Sind Sie immer so?«, frage ich.
Wieder mal ein Stirnrunzeln. »Wie?«
»So geladen?«
Ihr steht der Mund offen vor Entsetzen. »Ich bin nicht geladen.«
Das kommentiere ich nicht. Mir gefällt, dass ich sie aus dem Konzept bringe, so sehr sie auch um Fassung ringt. Ich mag es, dass sie in meiner Gegenwart so angespannt ist und alles an ihr zu schreien scheint, dass sie dringend loslassen will. Ich mag es, dass sie kämpft. Ja, das mag ich sogar sehr. Und ich mag ihr Feuer. Alles in meinem Leben ist kalt und zweckorientiert. Da fühlt sich Feuer manchmal gut an.
»Nun, was Ihre Beschwerde angeht: Ich kann um diese Uhrzeit noch anständig sein, aber falls Sie das Bedürfnis verspüren, unanständig zu sein, lassen Sie sich nicht aufhalten.«
»Ich habe nicht … Das ist nicht, was … Kommen Sie rein«, faucht sie und tritt zur Seite. Als ich an ihr vorbeigehe, atme ich ihren sauberen, blumigen Duft ein. Es ist eindeutig Flieder, doch da ist noch eine dunklere, moschusartige Note, die den Duft von unschuldig in verführerisch verwandelt. Ich kann mir keinen vollkommeneren Duft für eine Frau vorstellen. Für diese Frau mit ihren auffälligen Stimmungsschwankungen und der völligen Unfähigkeit, ihre Gefühle zu verbergen. Sie ist heiß und kalt, Feuer und Eis, sexy und grundanständig. Sie könnte sich kaum stärker von mir unterscheiden, selbst wenn sie es wollte, und das finde ich seltsam erfrischend. Menschen sind meistens berechenbar, diese Frau jedoch nicht. Vielmehr habe ich inzwischen den Eindruck, dass sie alles andere als berechenbar ist.
Ich warte, bis sie die Tür geschlossen hat, und folge Muse in ein gemütliches Wohnzimmer. Der Grundton des Raumes ist durch das dunkle Parkett und die graubraunen Möbel verblüffend streng, doch dadurch wird Muses Einsatz von – und offensichtliche Liebe zu – Farben umso bemerkenswerter. Von den knallroten Zierkissen bis hin zu den farbgewaltigen Bildern in unterschiedlichen Größen und Formen an allen Wänden, möchte ich wetten, dass Muse geradezu ihr Herzblut bei der Gestaltung dieses Zimmers vergossen hat.
Ich gehe hinüber zum Kamin, der anscheinend schon seit Längerem nicht mehr zum Heizen genutzt wird. Das kalte Innere ist sauber und enthält ein paar Dutzend elfenbeinfarbene Kerzen anstelle von Holzscheiten. Aber das ist es nicht, was mich anzieht. Es ist das Gemälde darüber, das auf dem Sims an die Wand gelehnt ist.
Es zeigt einen Baum, nichts als einen schlichten Baum, und doch zieht etwas an der Art, wie die Äste sich neigen, meinen Blick auf sich. Als ich genauer hinschaue, sehe ich, dass blassgelbe Regentropfen Tränen gleich von den dunklen Blättern tropfen und Pfützen auf dem Boden bilden. In den flachen Pfützen wiederum spiegelt sich der Halbmond am Mitternachtshimmel. So erstaunlich die Kontraste von Farben und Schatten auch sind, wirkt das Bild vor allem ergreifend und irgendwie tragisch.
Ich drehe mich um und stelle fest, dass Muse mich beobachtet. Sie sieht nicht mehr ängstlich aus. Eher scheint sie nervös.
»Was ist? Haben Sie Angst, dass ich zu viel sehe?«
Sie reckt ihr Kinn und versucht, sich lässig zu geben. »Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Geht es Ihnen immer noch so?«
»Wie?«
»So, wie es Ihnen ging, als Sie das gemalt haben?«, frage ich mit einem Nicken zum Kaminsims.
Ihre Augen weiten sich, und für einen Sekundenbruchteil steht ihr Mund offen, bevor sie ihn schließt. »Wie … Woher wissen Sie, dass ich …«
»Ich bin aufmerksam.«
»Aber …« Sie sieht zu der Leinwand hinter mir, als suchte sie nach einem Hinweis, der sie verraten haben könnte. Was sie wahrscheinlich nicht sieht, was wohl kein Künstler sehen kann, ist, dass sie überall in dem Bild zu erkennen ist.
»Geht es Ihnen noch so?«, kehre ich zu meiner Frage zurück.
Ihr Blick huscht wieder zu mir, und sie zuckt mit den Schultern, wobei sich ihre Zehen rhythmisch in den weichen Teppich krümmen, auf dem sie steht. »Manchmal«, antwortet sie leise. Kleinlaut. Schaut beiseite.
»Was hat diese Gefühle herbeigeführt?«
»Ich vermisse die Menschen, die ich liebe.« Als sie wieder zu mir sieht, runzelt sie für einen winzigen Moment die Stirn. »Tut das nicht jeder?«
Nun ist es an mir, mit den Schultern zu zucken. »Ich schätze schon, wenn man Menschen hat, die man liebt.« Bevor sie darauf etwas sagen kann, komme ich zum Wesentlichen: »Also, erzählen Sie mir von diesem Mann, den Sie finden wollen.«
Sie holt tief Luft und seufzt. »Er heißt Denton Allen Harper und wohnt in Treeborn, South Carolina.«
»Job?«
»Er ist pensionierter Ex-Militär. Ab und zu berät er einige private Sicherheitsfirmen, aber …«
»In welcher Beziehung steht er zu Ihnen?« Sie kneift die Lippen zusammen. Offensichtlich soll ich ihr keine persönlichen Fragen stellen. Was mich erst recht neugierig macht. »Hören Sie, wenn ich diesen Typen finden soll, müssen Sie ehrlich zu mir sein.« Als sie immer noch zögert, füge ich hinzu: »Ich bin kein Cop oder so, falls er in irgendwas Illegales verstrickt ist.«
»Das ist er nicht. Er ist doch kein Krimineller!«, erwidert sie. »Er ist ein hochanständiger Mann.«
»Sind Sie sich da sicher?«
»Selbstverständlich bin ich mir sicher. Er … er ist mein Vater.«
Ich nicke. »Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen?«
»Vor einem Monat. Am Freitag war es genau einen Monat her.«
»Nur einen Monat? Ich nehme an, das ist ungewöhnlich.«
»Ja. Es ist eine … feste Angewohnheit. Wir telefonieren immer einmal im Monat. Danach kann man die Uhr stellen.«
»Am Freitag war es also einen Monat her. Natürlich haben Sie die letzten fünf Tage versucht, anzurufen.« Sie nickt. »Haben Sie es bei seinen Freunden, Bekannten oder anderen Leuten versucht, die wissen könnten, wo er ist?«
»Ähm, nicht direkt. Ich meine, ich kann eigentlich nicht … ich kann nicht … Es ist kompliziert, aber trotzdem weiß ich, dass er da gewesen wäre, als ich angerufen habe, wenn alles okay wäre.«
»Wo gewesen? Zu Hause? An seinem Handy? Wo?«
»Wo er ist, wenn wir telefonieren.«
»Und das wäre?« Sie antwortet nicht. Geschlagene zwei Minuten mustere ich sie schweigend, lange genug, dass sie unruhig wird. »Ihnen ist hoffentlich klar, dass es, je mehr Sie mir verschweigen, desto unwahrscheinlicher wird, dass ich ihn finde.«
»Ich dachte, Sie können jeden finden. Hatten Sie nicht selbst gesagt, Sie wären verdammt gut darin?«
»Habe ich. Und bin ich, aber ich bin kein Hellseher. Ich brauche immer noch irgendwas, womit ich arbeiten kann.«
»Und das habe ich Ihnen gegeben. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß, was dabei helfen kann, ihn zu finden.«
»Wo rufen Sie einmal im Monat an?«
Sie atmet hörbar aus, sichtlich gereizt. »Wir benutzen Münztelefone, aber immer unterschiedliche in Treeborn.« Muse schüttelt den Kopf, sodass ihr dichtes Haar über ihre Schultern streicht. »Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass er nicht da war, als ich angerufen habe, und er ist immer da. Irgendwas stimmt nicht, und ich will, dass Sie ihn suchen.«
»Warum haben Sie nicht einfach die Polizei angerufen und ihn vermisst gemeldet? Lange genug her ist es ja.«
»Ich kann nicht … Wir … Das ist eben keine Option. Deshalb engagiere ich Sie. Sie machen das beruflich und müssten ihn finden können, oder?«
Ich stocke. »Ja, ich kann ihn finden. Es könnte nur einige Tage dauern.«
»Einige Tage? Ist das alles?«
»Ja, ich denke schon. Es klingt nicht allzu schwierig. Vorausgesetzt, ich bin erst mal da, versteht sich.«
»Und das wäre … wann? Fliegen Sie morgen hin?«
»Nein, ich fahre.«
»Sie fahren? Sie fahren die ganze Strecke von San Diego nach South Carolina?«
»Ja. Ist das ein Problem?«
»Ich … Nein, ich schätze nicht. Ich bin nur … verwundert, das ist alles.«
»Spielt es denn eine Rolle, wie ich dorthin komme?«
»Nein, eigentlich nicht. Es ist nur, dass … Die Sache ist die, dass ich mitkommen will.«
Damit hatte ich nicht gerechnet. Vielleicht ist sie wirklich unberechenbar. »Und warum das? Falls ich irgendwas von Ihnen brauche, kann ich anrufen.«
»Nein, ich muss ihn sehen, mit ihm reden. Von Angesicht zu Angesicht.«
Eine Weile lang sage ich nichts. Nichts könnte mich froher stimmen als diese Wendung, doch das darf Muse natürlich nicht wissen. Sehr wohl aber sollte ich einige Grundregeln klären. »Einverstanden, unter bestimmten Bedingungen.«
Fragend zieht sie eine Braue hoch. »Und die wären?«
»Ich arbeite allein. Wenn ich Sie mitkommen lasse, erwarten Sie nicht, dass ich Sie über Einzelheiten, Gespräche oder Quellen informiere. Rechnen Sie nicht damit, dass ich einen Haufen Fragen beantworte oder erkläre, warum ich tue, was ich tue. Vertrauen Sie einfach darauf, dass ich Ihren Vater finde. Ich werde ihn finden und Sie zu ihm bringen. Wenn Sie das tun, mich meinen Job machen lassen und keine Fragen stellen, werden wir keine Schwierigkeiten bekommen.«
Ich kann an dem Ausdruck ihrer sehr grünen Augen und dem Zucken ihrer überaus vollen Lippen ablesen, dass sie etwas sagen will. Wahrscheinlich widersprechen. Doch sie wird es nicht. Ich sitze am längeren Hebel, und das weiß sie. Sicher würde sie andernfalls eine ganze Menge sagen, aber sie beherrscht sich, weil sie mich braucht, um ihren Vater zu finden.
»Okay, das kriege ich hin.« Sie stockt. »Was ist mit dem Geld. Wie viel berechnen Sie?«
»Eine Anzahlung von tausend Dollar. Über den Rest reden wir, wenn ich ihn gefunden habe.«
Sie wird ein wenig blass. »Gut. Ich … Ist in Ordnung.«
Mir macht es nichts aus, ihr Geld zu nehmen. Es ist ja nicht so, als würde ich es behalten.
»Hören Sie, ich weiß, dass es spät ist. Wie wäre es, wenn Sie mir die letzte bekannte Adresse und Telefonnummer der Zielperson notieren, damit ich mich an die Arbeit machen kann und Sie wieder zurückkönnen zu …« Ich blicke zu dem stummgeschalteten Fernseher. »Was immer da gerade läuft.«
»Das ist