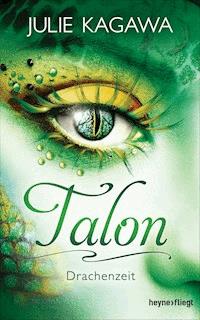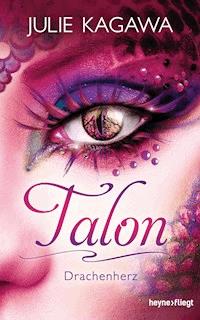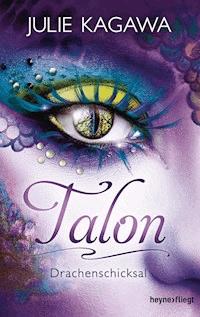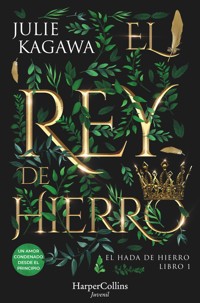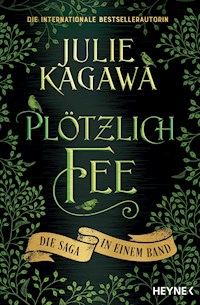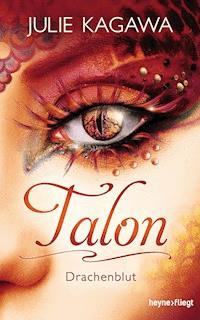
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Talon-Serie
- Sprache: Deutsch
Auf alles war das unerschrockene Drachenmädchen Ember vorbereitet - aber nicht auf den Schmerz, den sie empfindet, als der Sankt-Georgs-Ritter Garret leblos in ihren Armen niedersinkt, vom Schwert des Gegners schwer verwundet.
Ohne zu wissen, ob Garret jemals wieder die Augen aufschlagen wird, muss Ember in den nächsten Kampf ziehen. Denn die mächtige Organisation Talon rüstet sich zum endgültigen großen Schlag gegen die Ritter und die aufständischen Drachen. Ganz vorne mit dabei: Dante, Embers Zwillingsbruder. Gemeinsam mit dem rebellischen Drachen Riley, der weiter um ihr Herz kämpft, dringt Ember in Dantes Versteck vor. Was die beiden nicht ahnen: Dante erwartet sie bereits. Und in seinen finsteren Plänen spielt Ember eine der Hauptrollen. Sollte sie sich widersetzen, ist ihr Leben nichts mehr wert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
JULIE KAGAWA
Talon
DRACHENBLUT
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Charlotte Lungstrass-Kapfer
Das Buch
Auf alles war die Drachenkriegerin Ember vorbereitet – nur nicht auf den Schmerz, den sie empfindet, als der Sankt-Georgs-Ritter Garret leblos in ihren Armen niedersinkt, vom Schwert des Gegners schwer verwundet.
Ohne zu wissen, ob Garret jemals wieder die Augen aufschlagen wird, zieht Ember in den nächsten Kampf. Denn die mächtige Organisation Talon rüstet sich zum endgültigen Schlag gegen die Ritter und die aufständischen Drachen. Ganz vorne mit dabei ist Dante, Embers Zwillingsbruder. Gemeinsam mit dem rebellischen Drachen Riley, der weiter um ihr Herz kämpft, dringt Ember in Dantes Versteck vor. Was die beiden nicht ahnen: Dante erwartet sie bereits. Und in seinen finsteren Plänen spielt Ember eine der Hauptrollen. Sollte sie sich widersetzen, ist ihr Leben nichts mehr wert …
Die Autorin
Schon in ihrer Kindheit gehörte Julie Kagawas große Leidenschaft dem Schreiben. Nach Stationen als Buchhändlerin und Hundetrainerin machte sie ihr größtes Interesse zum Beruf und wurde Autorin. Mit ihren Fantasy-Serien Plötzlich Fee und Plötzlich Prinz wurde sie rasch zur internationalen Bestsellerautorin. Drachenblut ist der vierte Band in der Talon-Serie um eine magische Liebe, die nicht sein darf. Julie Kagawa lebt mit ihrem Mann in Louisville, Kentucky.
Für Tashya, Laurie und Nick,
mein großartiges Trio
Erster TeilES MÜSSEN OPFER GEBRACHT WERDEN
Dante
Sie war immer ihr Liebling.
»Ember!« Schon zum zweiten Mal in dieser Stunde stieß Mr. Gordon einen tiefen Seufzer aus. »Bitte pass auf. Das ist wichtig. Hörst du überhaupt zu?«
»Ja«, murmelte meine Zwillingsschwester, ohne vom Tisch aufzublicken, wo sie lustlos Strichmännchen in ihr Buch malte. »Ich höre zu.«
Mr. Gordon runzelte die Stirn. »Also schön. Kannst du mir sagen, wie man den fleischigen Teil des menschlichen Ohres nennt?«
Ich hob die Hand. Wie erwartet ignorierte Mr. Gordon mich völlig.
»Ember?«, hakte er nach, als sie nicht reagierte. »Kennst du die Antwort auf diese Frage?«
Seufzend legte Ember den Stift hin. »Ohrläppchen.« Ihr Tonfall verriet unmissverständlich, was sie dachte: Das ist langweilig, und ich wünschte, ich wäre jetzt irgendwo anders.
»Stimmt«, bestätigte Mr. Gordon mit einem Nicken. »Den fleischigen Teil des menschlichen Ohres nennt man Ohrläppchen. Sehr gut, Ember. Schreibt euch das auf, das ist wichtig für den morgigen Test.« Ember kritzelte etwas in ihr Heft, allerdings ging ich nicht davon aus, dass es die korrekte Antwort oder sonst irgendetwas war, was auch nur im Entferntesten mit dem Test zu tun hatte. Also schrieb ich den Begriff auf, nur für den Fall, dass sie es vergaß. Inzwischen fuhr Mr. Gordon fort: »Nun zur nächsten Frage. Haare und Fingernägel der Menschen bestehen aus der gleichen Substanz wie die Krallen und Hörner der Drachen. Wie nennt man diese Substanz? Ember?«
»Äh.« Ember blinzelte ratlos. Offenbar hatte sie keine Ahnung. »Weiß nicht.«
Ich wollte schon die Hand heben, überlegte es mir dann aber anders. Es hatte ja doch keinen Zweck.
»Das haben wir gestern erst durchgenommen«, rügte Mr. Gordon sie. »Während der ganzen Stunde haben wir ausschließlich über die menschliche Anatomie gesprochen. Du solltest es also wissen. Haare und Fingernägel des Menschen sowie Krallen und Hörner der Drachen bestehen aus …?«
Komm schon, Ember, drängte ich sie innerlich. Du weißt es. Es ist irgendwo in deinem Hirn gespeichert, auch wenn du gestern fast die ganze Zeit aus dem Fenster gestarrt hast.
Ember zuckte nur mit den Schultern und lehnte sich lässig in ihren Stuhl zurück, was ihre Ich-will-hier-raus-Attitüde noch weiter unterstrich. Unser Lehrer seufzte erneut und wandte sich mir zu. »Dante?«
»Keratin«, antwortete ich prompt.
Ein knappes Nicken, dann konzentrierte er sich wieder auf Ember. »Jawohl, Keratin. Dein Bruder hat aufgepasst.« Er kniff die Augen zusammen. »Warum gelingt dir das nicht?«
Embers Miene verfinsterte sich. Sie mit mir zu vergleichen war eine todsichere Methode, um sie auf die Palme zu bringen. »Ich sehe einfach nicht ein, warum ich den Unterschied zwischen Schuppen und menschlichen Zehennägeln kennen sollte«, murmelte sie und verschränkte abwehrend die Arme vor der Brust. »Wen interessiert schon, wie man das nennt? Ich wette, die Menschen wissen selbst nicht, dass ihre Haare aus Keramik bestehen.«
»Keratin«, korrigierte Mr. Gordon sie stirnrunzelnd. »Und es ist sogar von größter Wichtigkeit, dass du weißt, welche Form dein Körper bei einer Verwandlung annimmt, innerlich wie äußerlich. Wenn du die Menschen bis ins kleinste Detail nachahmen willst, musst du sie auch bis ins kleinste Detail kennen. Sogar wenn sie selbst es nicht tun.«
»Ich finde es trotzdem dämlich«, brummte Ember und warf wieder einen sehnsüchtigen Blick aus dem Fenster. Hinter dem Maschendrahtzaun, der das Gelände umgab, erstreckten sich die Wüste und der endlos weite Himmel. Die Miene unseres Lehrers wurde immer düsterer.
»Nun, dann sorgen wir doch mal für zusätzliche Motivation. Wenn Dante und du bei dem Test morgen nicht mindestens fünfundneunzig Prozent erreicht, ist das Spielzimmer für euch einen Monat lang gesperrt.« Ruckartig fuhr Ember hoch und riss wütend die Augen auf. Mr. Gordon lächelte nur kalt. »So wichtig ist Talon eine fundierte Kenntnis der menschlichen Anatomie. Wenn ich ihr wäre, würde ich also fleißig lernen.« Er deutete mit der Hand auf die Tür. »Die Stunde ist beendet.«
»Das ist so was von unfair«, wütete Ember, während wir den staubigen Innenhof überquerten, um zu unseren Schlafräumen zu gelangen. Die heiße Sonne von Nevada vertrieb die Kälte der Klimaanlagenluft aus dem Klassenzimmer und hinterließ wohlige Wärme auf meiner Haut. Oder sollte ich besser sagen: auf meiner Epidermis?
Ich musste grinsen; Ember würde den Witz wohl nicht verstehen. Und selbst wenn, fände sie ihn bei ihrer momentanen Laune wahrscheinlich nicht besonders komisch.
»Gordon ist ein Tyrann«, schimpfte sie weiter und trat so heftig gegen ein Steinchen, dass es wild über die trockene Erde hüpfte. »Der kann uns doch nicht einen ganzen Monat lang aus dem Spielzimmer verbannen – wie krank ist das denn? Dann drehe ich durch. Hier kann man doch sonst überhaupt nichts machen!«
»Na ja, du könntest versuchen, im Unterricht besser aufzupassen«, schlug ich vor. Wir hielten auf das lang gestreckte Gebäude ganz hinten am Zaun zu. Wie erwartet gefiel ihr meine Idee nicht sonderlich.
»Wie soll ich das denn machen, wenn der ganze Kram so langweilig ist?«, fauchte Ember und riss die Eingangstür auf. Wir betraten das Wohnzimmer, das fast bis auf Minusgrade heruntergekühlt war. Zwei Ledersofas bildeten ein L um den Couchtisch und waren gleichzeitig auf den riesigen, glänzenden Fernseher ausgerichtet, der stumm und dunkel an der gegenüberliegenden Wand hing. Mit dem Ding konnten wir über hundert Kanäle empfangen, alles von Science-Fiction bis hin zu Nachrichten-, Film- und Sportsendern. Vermutlich sollten wir damit ruhiggestellt werden, auch wenn das bei Ember nie so ganz funktionierte. Sie trieb sich lieber draußen herum, statt den ganzen Tag vor der Glotze zu hängen. Das Zimmer war aufgeräumt und makellos sauber, und das, obwohl ein gewisser Zwilling hier fast täglich das totale Chaos hinterließ.
Ember marschierte zu einem der Sofas und warf ihre Bücher auf die Polster. »Die lassen mich keine Sekunde in Ruhe«, jammerte sie, ohne darauf zu achten, dass eines der Bücher von der Couch rutschte und polternd auf dem Boden landete. »Immer machen sie mir Druck: Das kannst du besser, du musst schneller sein, pass besser auf! Egal was ich mache, es ist nie gut genug für sie.« Genervt, aber mit einem halben Grinsen im Gesicht sah sie mich an. »Mit dir machen sie das nie, Diedeldum.«
»Was daran liegen könnte, dass ich im Unterricht aufpasse.« Ich legte meine Tasche auf den Tisch und ging in die Küche, um mir etwas zu trinken zu holen. Unser Betreuer Mr. Stiles war nirgendwo zu sehen, also war er entweder nicht da oder in seinem Zimmer. »Ich gebe ihnen einfach keinen Grund, so hinter mir her zu sein.«
»Tja, dir ist wohl nicht klar, was für ein Glück das ist«, knurrte Ember. Sie marschierte in den Flur, der zu ihrem Zimmer führte. »Falls du mich suchst: Ich bin in meinem Zimmer und stopfe mir für den blöden Test morgen das Hirn mit Wissen voll. Und mach dir keine Sorgen, falls es irgendwann laut wird. Das ist nur mein Kopf, den ich gegen die Wand hämmere.«
Klar doch, dachte ich, während ich hörte, wie ihre Zimmertür erst geöffnet und dann zugeknallt wurde. Ich bin ein Glückspilz.
Ich schenkte mir Orangensaft ein, setzte mich auf einen der Hocker am Frühstückstresen und starrte trübsinnig in mein Glas.
Glück, hatte Ember gesagt. Ihr kam das wahrscheinlich wirklich so vor. Sie war ja auch der Liebling, auf den sich die gesamte Aufmerksamkeit konzentrierte. So war es schon immer gewesen. In den vergangenen elf Jahren war anscheinend immer sie diejenige gewesen, der zuerst die Fragen gestellt oder neue Dinge gezeigt wurden, bei der die Erzieher zuerst dafür gesorgt hatten, dass sie alles lernte, was sie wissen musste. Klar, sie übten eine Menge Druck auf sie aus und verlangten, dass sie immer alles richtig machte. Dabei schien aber niemand zu bemerken, dass ich die Antworten bereits wusste. Oder es interessierte keinen. Und wenn sie mich dann mal beachteten, sollte ich bloß als Beispiel für meine Schwester herhalten. Siehst du, Dante kennt die Antworten. Dante weiß die Lösung schon. Ich würde einen Mord begehen, um auch nur halb so viel beachtet zu werden wie sie.
Ich trank den Saft aus, stellte das Glas in die Spülmaschine und ging in mein Zimmer. Ich muss einfach noch besser werden, dachte ich entschlossen. Meiner Schwester flog die allgemeine Aufmerksamkeit automatisch zu, während ich sie mir durch Arbeit verdienen musste. Ember war temperamentvoll und brachte sich ständig in Schwierigkeiten; meine Aufgabe bestand darin, auf uns beide aufzupassen. Aber wenn ich gleichzeitig weiter hart arbeitete und großartige Leistungen brachte, würde ihnen sicher irgendwann auffallen, dass ich in allem besser war als meine Schwester. Sie würden begreifen, dass ich der Clevere von uns beiden war, dass ich derjenige war, der jede ihrer Prüfungen bestand. Wenn man bei Talon nicht von allein bemerkte, wozu ich fähig war, würde ich es ihnen eben vor Augen führen.
»Mr. Hill? Der Große Wyrm erwartet Sie. Sie können jetzt zu ihr hineingehen.«
Mit diesen Worten wurde ich in die Gegenwart zurückgeholt. Ich saß in einem kalten, hell erleuchteten Vorzimmer. Kopfschüttelnd versuchte ich, die finsteren Gedanken und die Erinnerungen loszuwerden. In letzter Zeit hatte ich oft an Ember gedacht, ständig spukte sie in meinem Kopf herum, was sich fast zu einer Belastung entwickelte. Fühlte ich mich etwa schuldig, weil ich sie im Stich gelassen hatte? Weil ich meine Zwillingsschwester nicht vor ihrem schlimmsten Feind hatte beschützen können – sich selbst?
Ich stand auf, bedankte mich mit einem knappen Nicken bei der menschlichen Assistentin und ging auf die wuchtige Doppeltür zu, die zum Büro des Großen Wyrm führte. So durfte ich nicht länger denken. Ich war jetzt kein Elfjähriger mehr, der verzweifelt versuchte, seinen Wert unter Beweis zu stellen. Ich war nicht mehr der armselige Zwilling, der stets hinter der Tochter des Großen Wyrm zurückstand. Nein, ich hatte der gesamten Organisation bewiesen, dass ich meines Erbes würdig war. Ich war die rechte Hand des Großen Wyrm, ich war derjenige, dem sie Talons wichtigste Operation übertragen hatte.
Und wenn alles gut ging, würde ich eines Tages die gesamte Organisation anführen. Eines Tages würde das alles mir gehören. Heute stand ich kurz davor, genau das zu erreichen, was ich mir vor so vielen Jahren vorgenommen hatte. Jetzt durfte ich nicht zögern.
Vor mir ragte die schwere Holztür zum Büro des CEO auf, deren Messingklinken im grellen Licht schimmerten. Weder klopfte ich, noch wartete ich darauf, vom Großen Wyrm hereingerufen zu werden. Nein, ich zog die Tür einfach auf und ging hinein.
Der Große Wyrm saß am Schreibtisch, tippte mit perfekt lackierten Nägeln auf der Tastatur und blickte konzentriert auf den Bildschirm des Computers. Die Furcht einflößende, alles erdrückende Ausstrahlung dieser Frau erfüllte den gesamten Raum, auch wenn sie mich überhaupt nicht ansah. Leise durchquerte ich das Zimmer, bis ich direkt vor ihrem Schreibtisch stand, wo ich die Hände hinter dem Rücken verschränkte. Freien Zugang zum Büro des Großen Wyrm für sich beanspruchen zu können, war eine Sache. Den Großen Wyrm unaufgefordert zu unterbrechen, bevor man von ihr zur Kenntnis genommen worden war, eine ganz andere. Zwar war ich der Erbe eines der größten Imperien der internationalen Geschäftswelt, aber sie war noch immer der CEO von Talon und der mächtigste Drache der Welt. Nicht einmal als ihr Sohn stand ich über dem Protokoll.
Während der Große Wyrm wortlos weitertippte, wartete ich stumm darauf, dass sie ihre Arbeit beendete. Schließlich klickte sie ein letztes Mal mit der Maus, schob den Tastaturauszug unter die Schreibtischplatte und sah mich an. Ihre stechenden grünen Augen hatten große Ähnlichkeit mit meinen und Embers.
»Dante.« Während die meisten Drachen ein Lächeln nur mühsam nachahmen konnten, wirkte ihres vollkommen aufrichtig. Natürlich wurde sie genau dadurch so gefährlich – bei ihr wusste man nie, ob das, was sie einem zeigte, echt oder nur gespielt war. »Schön, dass du wieder da bist. Wie war die Reise?«
»Sehr angenehm, Ma’am, danke.«
Sie nickte, erhob sich und deutete auf die beiden Sessel, die vor ihrem Schreibtisch standen. Während ich mich gehorsam setzte und die Beine übereinanderschlug, kam der Große Wyrm um den Tisch herum, wobei sie mich keine Sekunde aus den Augen ließ. Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit wirkte erdrückend, trotzdem lehnte ich mich mit entspannter, aber trotzdem aufmerksamer Miene zurück und achtete genau darauf, keine Angst zu zeigen.
»Unsere Pläne sind angelaufen«, sagte der Große Wyrm. Ihre leise Stimme jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken. »Bald ist alles bereit. Nun fehlt uns nur noch eines. Eine Sache, um die wir uns kümmern müssen.«
Mein Puls beschleunigte sich. Mir war klar, was der Große Wyrm mit dieser letzten Sache meinte. Dabei konnte es nur um sie gehen. Nicht einmal jetzt war ihr bewusst, von welch großer Bedeutung sie war.
»Ember Hill muss zurückgebracht werden«, fuhr der Große Wyrm mit bedrohlicher Eindringlichkeit fort. Ich bekam eine Gänsehaut, und ein Teil von mir krümmte sich furchtsam zusammen, als mich der schreckliche Blick des alten Drachen erfasste. »Es ist unerlässlich, dass sie zu Talon zurückkehrt. Jetzt dürfen keine Fehler mehr passieren. Wir werden wie folgt vorgehen …«
Ember
Er ist tot.
Ich kniete auf dem harten Salzboden und hielt Garrets reglosen Körper auf meinem Schoß, während die Sonne langsam über den Horizont kroch und die öde Landschaft in blutrotes Licht tauchte. Das schlaffe Gesicht des Soldaten war leichenblass, seine Haut noch warm, auch wenn er gerade in meinen Armen verblutete. Um mich herum herrschte hektische Aktivität, mehrere Stimmen schrien durcheinander, stellten Fragen, die vielleicht sogar an mich gerichtet waren. Aber für mich war nichts davon real. Garret war tot. Ich hatte ihn verloren.
»Verdammt, er verliert zu viel Blut.« Das war Riley, der neben dem Soldaten kniete und ihm einen blutigen Lappen an den Brustkorb drückte. »Wir können nicht auf den Krankenwagen warten – wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, ist er in zwei Minuten tot.«
»Hier«, hörte ich hinter mir eine atemlose Stimme. Tristan St. Anthony, Garrets ehemaliger Partner und aktiver Georgskrieger, ließ sich neben Riley auf die Knie fallen. Er hatte eine große Plastikkiste dabei, deren Deckel er nun aufriss. Darin befanden sich jede Menge Pflaster, Verbandszeug und andere medizinische Utensilien. »Ich kann sofort eine Transfusion vornehmen«, erklärte Tristan und zog einen langen, dünnen, durchsichtigen Schlauch aus der Kiste. »Aber ich habe nicht die richtige Blutgruppe. Sein Körper wird das Blut abstoßen, wenn es nicht passt.«
»Was braucht er denn?«, knurrte Riley.
»0 positiv.«
»Verdammt.« Riley wühlte kurz in der Kiste und holte etwas hervor, das metallisch funkelte. Einen Moment lang starrte er es reglos an, als müsse er zu einer Entscheidung gelangen. »Ich kann nicht glauben, dass ich das tue«, murmelte er dann und stach sich mit dem Skalpell in die Armbeuge. Sofort quoll Blut aus dem Schnitt und lief über seinen Unterarm. Mir wurde übel.
Tristan riss die Augen auf. »Bist du …«
»Halt die Klappe und mach weiter, bevor ich anfange, das noch mehr zu bereuen.«
Hastig befolgte Tristan Rileys Befehl und legte Garret den Transfusionszugang. Der Einzelgänger nahm das andere Ende des Schlauchs und stand kopfschüttelnd auf. »Ich kann echt nicht glauben, dass ich das tue«, knurrte er noch einmal, während er sich den Schlauch unter die Haut schob.
Der dunkle Strom aus Rileys Arm floss träge durch den Kunststoffschlauch und kroch zentimeterweise auf den verletzten Soldaten zu. Fasziniert und mit wild klopfendem Herzen starrte ich auf das rote Rinnsal. Erst Rileys harsche Stimme holte mich aus meiner Trance.
»Sitz nicht einfach nur rum, Rotschopf! Wie wäre es, wenn du langsam mal anfängst, ihn zusammenzuflicken, bevor er den Boden auch noch mit meinem Blut bewässert?«
Ich zuckte schuldbewusst zusammen, aber Tristan holte bereits mit grimmiger Entschlossenheit Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial, Nadel und Faden aus seinem Kasten. Als er kurz aufblickte, verrieten mir seine blauen Augen, wie aufgewühlt er hinter der betont emotionslosen Maske des professionellen Soldaten war. Ein dicker Kloß stieg in meiner Kehle auf, und ich ließ Garret sanft zu Boden gleiten, um die Utensilien entgegennehmen zu können, die Tristan mir hinhielt. In den nächsten Minuten taten wir alles dafür, damit der Soldat, den wir beide liebten, uns nicht auf den kargen Salzebenen von Salt Lake City unter den Händen wegstarb. Riley stand reglos neben uns, durch ein dünnes rotes Band mit Garret verbunden. Sein Gesicht war so finster wie der Himmel vor einem Gewittersturm.
Riley
Oh, oh, mir wird ganz komisch.
Zähneknirschend versuchte ich, gegen den Schwindel anzukämpfen, der mich plötzlich überfiel, taumelte aber trotzdem kurz. Zum Glück schienen Ember und St. Anthony, die immer noch mit dem Soldaten beschäftigt waren, nichts davon zu bemerken. Sie hatten seine zahlreichen Wunden versorgt, entweder mit Verbänden oder indem sie sie vernäht hatten, und nun lag er wie ein Toter zwischen ihnen auf dem harten, salzverkrusteten Boden. Seine Haut war fast so weiß wie der Untergrund. Auf Embers Wangen glänzten Tränen. Ob sie wohl auch um mich weinen würde, wenn ich irgendwann einmal ins Gras biss?
»Lebt er noch?«, fragte ich barsch.
Der andere Georgskrieger fühlte seinen Puls, nickte knapp und ließ sich dann aufatmend auf die Fersen sinken. »Jawohl«, antwortete er ebenso brüsk. »Vorerst.«
»Prima. Dann wird mir hier wenigstens nicht umsonst so übel.« Ich sah zu, wie der Georgskrieger dem Soldaten vorsichtig den Schlauch aus dem Arm zog und ein Pflaster auf diese letzte Wunde klebte. Den Schlauch ließ er dabei einfach fallen, sodass mein Blut auf den Salzboden floss.
»Ihr solltet gehen«, stellte St. Anthony leise fest, ohne mich anzusehen. »Bringt ihn hier weg. Und zwar bevor der Rest des Ordens auftaucht.«
Mit einem müden Nicken stimmte ich ihm zu. »Ich werde Wes anrufen«, wandte ich mich an Ember. Mein menschlicher Freund, das Hackergenie, wartete sozusagen im Stand-by-Modus darauf herbeizurasen, falls etwas schiefging. Und diese Sache hier war definitiv total schiefgegangen. »Er müsste in ein paar Minuten hier sein.«
Ember nickte ohne aufzublicken und fixierte weiter den reglosen Soldaten. Am liebsten hätte ich geknurrt, unterdrückte den Impuls aber mühsam. Stattdessen zog ich mein Handy aus der Tasche und drückte eine der Kurzwahltasten.
»Bitte sag mir, dass du nicht tot bist, Riley«, meldete sich eine angespannte Stimme mit britischem Akzent.
Ich seufzte gereizt. »Nein, Wes, sie haben mir das Hirn weggepustet, und mein Geist ruft dich aus dem Jenseits an. Was glaubst du denn?«
»Na ja, da du mich anrufst, gehe ich davon aus, dass die Sache nicht so abgelaufen ist wie geplant. Dann hat der Georgskrieger es vielleicht geschafft, sich umbringen zu lassen?«
Mein Blick wanderte zu Ember und dem Soldaten. »Könnte sein.«
»Könnte sein? Was ist das denn für eine dämliche Antwort? Entweder ist er tot, oder er ist es nicht.«
»Das ist kompliziert.« Ich erklärte ihm möglichst knapp die momentane Lage und wie es dazu gekommen war. Dass Garret vom Patriarchen und Anführer des Georgsordens zu einem Duell auf Leben und Tod herausgefordert worden war, wusste Wes bereits. Dem Soldaten war es mit Mühe gelungen, den Mann zur Kapitulation zu zwingen und so den Kampf zu beenden. Aber dann hatte er einen entscheidenden Fehler gemacht, indem er sein Leben verschonte. Während der Soldat sich abgewandt und davongegangen war, hatte der Patriarch eine Pistole gezogen und ihm in den Rücken geschossen. Mit dieser Aktion hatte er sein Leben dann doch noch beendet, da einer seiner eigenen Sekundanten blitzschnell reagiert und dem ehemaligen Patriarchen mehrere Kugeln in den Leib gejagt hatte. Für den Soldaten kam diese Hilfe allerdings zu spät, sodass er nun halb tot auf der Salzebene vor den Toren von Salt Lake City lag.
»So viel zum berühmten Ehrgefühl der Georgskrieger«, murmelte ich, da am anderen Ende der Leitung schockierte Stille herrschte. »Jedenfalls müssen wir ihn – und uns – jetzt schleunigst hier wegschaffen. Kriegst du das hin?«
»Verdammt, Riley.« Wes seufzte. »Könntest du nicht wenigstens mal versuchen, nicht immer in Situationen zu geraten, in denen einer von euch fast draufgeht?« Er unterbrach sich, und ich hörte, wie ein Motor gestartet wurde. »Ich komme, so schnell ich kann. Und achte bitte darauf, dass nicht noch jemand erschossen wird, okay?«
»Eine Sache noch.« Ich senkte die Stimme, bis ich fast flüsterte, und wandte dem Trio auf dem Boden den Rücken zu. »Hiermit aktiviere ich das Abschirmprotokoll für Notfälle. Schick die Nachricht an alle Verstecke im Netzwerk.«
»Verflucht, Riley«, hauchte Wes. »Ist es wirklich so schlimm?«
»Gerade eben wurde der Anführer des Georgsordens, der große Zampano höchstselbst, getötet. Selbst wenn sie das nicht uns in die Schuhe schieben – was sie tun werden, da kannst du dir sicher sein –, wird jetzt Chaos ausbrechen. Und ich will nicht, dass einer von uns angreifbar ist, wenn die Lage eskaliert. Bis ich etwas anderes sage, rührt sich niemand vom Fleck oder streckt auch nur eine Schuppe vor die Tür.«
»Mist, verdammter«, murmelte Wes, und ich hörte, wie er auf eine Tastatur einhämmerte. Selbst in Warteposition behielt Wes seinen Laptop immer in Reichweite. »Abschirmprotokoll ist … aktiviert.« Diesmal klang sein Seufzen erschöpft. »Das wäre erledigt. Dann nehme ich mal an, dass wir uns auch einbunkern und abwarten, bis man im Orden die Nachricht vernommen hat und entsprechend ausrastet.«
»Komm so schnell es geht, Wes.«
»Alles klar, bin unterwegs.«
Ich steckte das Handy weg und rang mir ein Grinsen ab, während ich St. Anthony fragte: »Eure Leute haben nicht zufällig eine Trage mitgebracht, oder?«
»Doch, haben wir.« Er kniete immer noch neben dem reglosen Sebastian im Salz. Seine ernste Stimme schwankte leicht, auch wenn man sehr genau hinhören musste, um es zu bemerken. »Der Orden ist stets auf alles vorbereitet. Allerdings dachten wir, es würde nur … eine Leiche geben.«
Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, was das Schwindelgefühl noch zu verstärken schien. Mein Blick wanderte von der kleinen Gruppe vor mir zu der reglosen, ganz in Weiß gekleideten Gestalt, die einige Meter weiter auf der Salzkruste lag. Wie auch der Soldat war sie voller Blut, am Rücken ihrer vorher so makellosen Uniform ließ sich durch die roten Flecken genau ablesen, wo die Kugeln den Körper getroffen hatten. Der Patriarch des Georgsordens lag noch immer dort, wo er tot zusammengebrochen war, das Gesicht in einer Mischung aus Ungläubigkeit und Wut erstarrt.
Ich wäre vermutlich auch überrascht, wenn einer meiner eigenen Soldaten mir mehrmals in den Rücken schießen würde. Und nicht einmal der, den ich zum Kampf auf Leben und Tod gefordert hatte.
»Tristan St. Anthony.« Hinter uns erklang eine leise, kalte Stimme. Der Angesprochene schloss kurz die Augen, bevor er den Kopf hob.
»Sir.«
»Steh auf. Entferne dich von den Drachen, sofort.«
St. Anthony gehorchte prompt und distanzierte sich mit ein paar Schritten von Ember und mir. Doch seine Bewegungen waren steif und unbeholfen. Mit bemüht ausdrucksloser Miene drehte er sich zu dem Mann um, der hinter uns aufgetaucht war. Der Patriarch hatte ihn mit Martin angesprochen – Lieutenant Martin. Er war weder besonders groß noch besonders breit, schon etwas älter, verfügte aber über diese besondere Autorität, die ich schon öfter an Truppenführern und den Veteranen unter den Drachentötern bemerkt hatte. St. Anthony nahm Haltung an und starrte blind geradeaus, während der andere ihn mit seinen dunklen Augen musterte, aus denen sich nichts ablesen ließ.
Ich beobachtete die Szene aufmerksam. Würde er den jungen Soldaten gleich hier hinrichten? Vielleicht stand auf die Tötung des Patriarchen ja die Todesstrafe. Obwohl St. Anthony sich in meinen Augen vollkommen richtig verhalten hatte. Die Aufgabe der Sekundanten bestand darin sicherzustellen, dass das Duell fair ablief, dass niemand eingriff, betrog oder den Kampf irgendwie beeinflusste. Sebastian hatte gewonnen – der Patriarch hatte sich ergeben, und das Duell war damit eindeutig beendet gewesen. Sebastian in den Rücken zu schießen war nicht nur extrem feige gewesen, sondern hatte auch zweifelsfrei die Schuld des Patriarchen bewiesen, weshalb St. Anthony absolut korrekt reagiert hatte. Vermutlich war es ein Reflex gewesen, und ihm war erst später klar geworden, was er getan hatte, trotzdem hatte er dadurch vermutlich die anderen Sekundanten davor bewahrt, von zwei rachsüchtigen Drachen zu Kohle verarbeitet zu werden.
Doch ich kannte mich nicht besonders gut aus mit den Richtlinien und Gesetzen des Georgsordens, wusste nur, dass sie wohl extrem streng waren, fast schon fanatisch. Vielleicht spielte für sie ja gar keine Rolle, was der Patriarch getan hatte. Vielleicht zog die Tötung des verehrten Anführers aller Georgskrieger ja automatisch ein sofortiges Todesurteil nach sich, ganz egal, welche Absicht dahintergesteckt hatte. Würde mich nicht überraschen.
St. Anthony auch nicht, seiner Miene nach zu urteilen.
Der Offizier musterte den jungen Soldaten noch einen Moment lang schweigend, dann seufzte er schwer. »Du hast getan, was getan werden musste, St. Anthony«, erklärte er steif, woraufhin sein Gegenüber ruckartig den Kopf hob. »Du hast in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Heiligen Georg gehandelt. Der Patriarch hatte sich schuldig gemacht, und seine Taten verlangten nach sofortigen Sanktionen.« Sein Tonfall passte nicht hundertprozentig zu seiner Miene. Anscheinend fiel es ihm schwer, sich mit dieser Wahrheit abzufinden. »Du hast deine Pflicht getan, auch wenn der Rat das eventuell anders sehen wird«, fuhr er fort. St. Anthony zuckte kurz zusammen. »Aber ich werde mich für dich einsetzen und alles tun, damit du nicht bestraft wirst.«
»Sir«, erwiderte St. Anthony leise, verstummte dann aber wieder, da mit knirschenden Schritten der zweite Offizier zu uns trat. Er war älter als die beiden anderen Georgskrieger, hatte einen weißen Bart und trug eine Augenklappe. Als er uns ansah, verzog sich sein Gesicht voller Hass.
Mit vor Wut zitternder Stimme verkündete er: »Wisset dies, Drachen: Am heutigen Tag mögt ihr siegreich gewesen sein, aber gebrochen habt ihr uns damit nicht. Der Orden wird sich von diesem Schlag erholen, und wenn es so weit ist, werden wir nicht eher ruhen, bis Talon vernichtet ist. Dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Er hat gerade erst begonnen.«
Ich musste grinsen und hätte gerne etwas angemessen Trotziges und Unverschämtes geantwortet, aber da löste Ember zum ersten Mal den Blick von dem reglosen Soldaten und blickte zu den Menschen hoch.
»So muss es nicht sein«, sagte sie leise und beherrscht. »Manche von uns wollen nichts mit Talon oder dem Krieg zu tun haben. Manche von uns versuchen einfach nur zu überleben.« Durchdringend sah sie St. Anthony an. »Garret wusste das. Deshalb ist er überhaupt nur zu dir gekommen, deshalb hat er alles riskiert, um den Patriarchen auffliegen zu lassen. Talon hat den Orden dazu benutzt, Drachen töten zu lassen, die sich der Organisation nicht anschließen wollen. Der Orden des Heiligen Georg glaubt, wir wären alle gleich, aber das ist nicht wahr.« Leise Verzweiflung schlich sich in ihre Stimme, und sie starrte wieder auf den reglosen Soldaten vor sich.
»Wir wollen diesen Krieg nicht«, murmelte sie. »Es hat schon zu viele Tote gegeben. Es muss einen Weg geben, ihn zu beenden.«
»Es gibt einen«, erwiderte der Offizier kalt. »Der Krieg wird enden, wenn auch der letzte Drache auf diesem Planeten ausgelöscht wurde. Keinen Tag früher. Selbst wenn du die Wahrheit sagst, wird der Orden des Heiligen Georg niemals wanken. Der Orden wird niemals von seiner Mission abrücken: die Bedrohung auszumerzen, die deine Art darstellt. Wenn überhaupt, hat diese Angelegenheit nur wieder einmal bewiesen, wie tückisch ihr Drachen seid. Vielleicht hat Talon das alles sogar genau so geplant, um dem Orden durch die Beseitigung des Patriarchen einen schweren Schlag zu versetzen.«
»Sind Sie wirklich so dämlich?«, schaltete ich mich ein, was mir einen scharfen Blick der drei Männer eintrug. »Ist man im Orden derart blind und verbohrt, dass man nicht einmal in Erwägung zieht, dass es auch eine andere Sichtweise geben könnte? Macht die Augen auf, Georgskrieger! Hier stehen zwei Drachen vor euch, die Talon genauso hassen, wie der Orden es tut. Und wenn ihr glaubt, das sei alles ein perfider Plan der Organisation gewesen, um den Patriarchen loszuwerden, dann habt ihr das nicht richtig durchdacht. Warum sollte Talon den Patriarchen umbringen wollen, wenn in Wahrheit doch sie die Fäden gezogen und den Orden genau dorthin gelenkt haben, wo sie ihn haben wollten? Wir …«, ich zeigte auf Ember, den Soldaten und mich, »… wir waren gezwungen, diese Allianz auffliegen zu lassen, sonst hätte Talon euch nur weiter dazu benutzt, uns auszuschalten. Vielleicht solltet ihr mal darüber nachdenken, was das heißt.«
Mir fiel auf, dass St. Anthony noch immer Ember beobachtete, die krampfhaft Sebastians Hand umklammert hielt. In seinen Augen spiegelte sich Verwirrung, und er runzelte kaum wahrnehmbar die Stirn. Doch dann ergriff der alte Mann wieder das Wort, kein bisschen weniger kalt als zuvor.
»Nehmt Sebastian mit und verschwindet.« Er trat einen Schritt zurück. »Der Orden wird euch nicht verfolgen, zumindest heute nicht. Doch der Tag der Abrechnung wird kommen, Drache. Und dann solltet ihr besser weit, weit weg sein, sonst werdet ihr mit dem Rest von euresgleichen untergehen. Martin, St. Anthony.« Er stapfte zum Leichnam des Patriarchen hinüber, der inzwischen in einer großen Blutlache lag. Martin folgte ihm, während Tristan noch einen Moment stehen blieb und Ember durchdringend musterte, bevor er auf dem Absatz herumwirbelte und hoch aufgerichtet davonging. Keiner der Männer sah sich noch einmal um.
Ich kniete mich hin, legte Ember eine Hand auf die Schulter und beugte mich über sie. »Wes ist unterwegs. Bald kommen wir hier weg.«
Sie nickte, ohne mich anzusehen. »Meinst du … meinst du, er schafft es?«, flüsterte sie.
Einerseits wollte ich ihr nicht wehtun, andererseits konnte ich sie auch nicht belügen. Oder ihr falsche Hoffnungen machen. »Ich weiß es nicht, Rotschopf«, murmelte ich deshalb. »Er hat sehr viel Blut verloren. Ich habe keine Ahnung, ob die Kugel lebenswichtige Organe verletzt hat, aber … sein Zustand ist kritisch. Du solltest dich wohl auf das Schlimmste gefasst machen.« Sie presste die Lider zusammen, und als sie den Kopf hängen ließ, rann eine Träne über ihre Wange. Mein Drache erwachte, und ich spürte, wie ein dicker Kloß in meiner Kehle aufstieg. Verbittert musste ich daran denken, was sie dem Soldaten zugeflüstert hatte, als er sterbend in ihren Armen lag. An das leise Geständnis, das sie ihm mit in die Bewusstlosigkeit gegeben hatte. In diesem Moment wusste ich, dass sie diese Worte wohl nie zu mir sagen würde.
Es sei denn, es gäbe ihn nicht mehr.
Bei diesen finsteren, ekelhaften Überlegungen meines Drachen wurde mir ganz schlecht. Schnell stand ich auf und ging ein paar Schritte, wobei ich den leeren Horizont absuchte.
Der Patriarch war also tot. Wir hatten erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Na ja, nicht unbedingt, den Mann umzubringen, aber doch, ihn vor dem Rest des Ordens auffliegen zu lassen und damit das Bündnis zwischen ihm und Talon zu beenden. Nun konnte die Organisation nicht mehr die Strippen des Ordens ziehen, da ihre liebste Marionette von der Bühne abgetreten war. Das würde den Georgsorden ins Chaos stürzen, und sie würden Vergeltung für den Tod ihres Anführers fordern, aber zumindest waren sie so eine Weile beschäftigt. Und während die Georgskrieger ihr weiteres Vorgehen überdachten, konnte ich mein Netzwerk noch besser im Untergrund verstecken, damit wir beim zu erwartenden Gegenschlag nicht mehr auffindbar waren.
Blieb allerdings immer noch Talon.
Mit einem unguten Gefühl in der Magengrube sah ich zu, wie die Sonne langsam über den Horizont stieg und die Salzebene in rotes Licht tauchte. Irgendetwas lag in der Luft, das spürte ich. Der Tod des Patriarchen würde auch Talon zu einer Reaktion zwingen. Vielleicht hatten sie es ja tatsächlich so geplant. Ich kam mir vor wie eine Figur auf einem Schachbrett – ein Bauer, der gerade einen Läufer geschlagen hat, sich umdreht und plötzlich der Dame gegenübersteht, die ihn quer über das Brett hinweg angrinst.
Stirnrunzelnd schüttelte ich den Kopf. Langsam wurde ich paranoid. Selbst wenn Talon mit so etwas gerechnet hatte, hätte das nichts an unseren Plänen geändert. Wir wären trotzdem gezwungen gewesen, den Patriarchen zu entlarven, und alles wäre genauso gekommen: Am Ende wurde der Anführer des Ordens erschossen, und der Soldat, der ihn enttarnt hatte, schwebte auf dem blutverklebten Salzboden zwischen Leben und Tod.
Über die Schulter schaute ich zu Ember und dem Menschen zurück, die eng aneinandergeschmiegt auf der tristen, gnadenlosen Ebene hockten. Das Gesicht des Soldaten war ebenso weiß wie das Salz unter ihm, während ungefähr die Hälfte seines Blutes – und wahrscheinlich auch ein wenig von meinem – in der aufgehenden Sonne trocknete. Versuch, nicht zu sterben, Georgskrieger, dachte ich plötzlich, was mich selbst überraschte. Von nun an wird alles noch unüberschaubarer werden, und es wäre nicht schlecht, dich dabeizuhaben, wenn alles den Bach runtergeht. Falls Talon sich dazu entschließt, mit geballter Macht gegen uns vorzugehen, brauchen wir jede Hilfe, die wir bekommen können. Außerdem würde Ember es dir nie verzeihen, wenn du jetzt den Löffel abgibst.
Und ich will nicht den Rest meines Lebens mit einem beschissenen Geist konkurrieren müssen.
Garret
Ich flog.
Unter mir breiteten sich die Wolken aus wie ein wogendes, endlos weites Meer aus Weiß- und Grautönen. Der Himmel über mir war so makellos blau, dass einem schwindelig werden konnte. Ich spürte den Wind im Gesicht, der den Geruch von Regen und Nebel in sich trug, und die warmen Sonnenstrahlen auf meinem Rücken. Wie lange flog ich schon so? Ich wusste es nicht mehr, aber es schien eine Ewigkeit zu sein und gleichzeitig nicht länger als ein Herzschlag. Warum war ich hier oben? Ich war … ich war auf der Suche nach etwas, nicht wahr? Oder auf der Jagd nach etwas.
Oder irgendetwas jagte mich.
Hinter mir ertönte ein leises Grollen. Als ich mich umsah, entdeckte ich eine schwarze Wolkenwand, die aus dem weißen Teppich aufstieg und mit erschreckender Geschwindigkeit auf mich zuglitt. Hastig versuchte ich, schneller zu fliegen, aber der Himmel verdunkelte sich abrupt, und um mich herum zuckten die ersten Blitze, während der Sturm sich weiter näherte und einen durchdringenden Ozongeruch herantrug.
Garret.
Eine leise weibliche Stimme glitt über die Wolken hinweg und ließ mich zögern. Ich wusste, wem sie gehörte. Wo war sie? Warum konnte ich sie nicht sehen?
Ich bin hier, Garret. Halt durch.
Wo bist du?, wollte ich rufen, bekam aber keinen Ton heraus. Die bedrohliche Dunkelheit hinter mir kam immer näher, grelle Blitze zuckten in der schwarzen Wand.
Wie geht es ihm?, fragte eine zweite Stimme. Auch sie war gedämpft und seltsam vertraut. Gleichzeitig weckte sie eine merkwürdige Wut in mir. Ich konnte mich weder an das dazugehörige Gesicht erinnern, noch wusste ich, was derjenige getan hatte, und trotzdem stieg ein leises Knurren in meiner Kehle auf.
Er kämpft. Die weibliche Stimme klang erstickt, was ein schmerzhaftes Ziehen in meiner Magengrube auslöste. Seine Temperatur ist viel zu hoch, und in den letzten Nächten war er regelrecht im Fieberwahn. Wes meint, dass sein Körper versucht, sich an das Transfusionsblut anzupassen, was ein paar seltsame Nebenwirkungen hervorruft. Aber eigentlich wissen wir gar nichts. Sie zog die Nase hoch, bevor sie noch leiser fortfuhr: Wir können nur warten und hoffen, dass er sich erholt.
Der andere seufzte. Wenigstens lebt er noch, Rotschopf. Mir ist einfach nichts anderes eingefallen.
Ich weiß.
Die Stimmen wurden von der Dunkelheit und dem aufziehenden Sturm verschluckt, und ich kämpfte verzweifelt darum, sie weiter zu hören. Warte, wollte ich rufen, wollte der Stimme folgen, bis ich die Person auf der anderen Seite gefunden hatte. Geh nicht. Lass mich nicht allein.
Doch es antworteten nur der Wind und der grollende Donner in meinem Rücken. Vor mir erstreckte sich der endlose Himmel voller dicker grauer Wolken. Hinter mir drängte die brodelnde schwarze Wand heran, verschlang alles, was sich ihr in den Weg stellte, und erfüllte die Luft mit prickelnder Elektrizität.
Plötzlich erkannte ich, was ich tun musste.
Ich fuhr herum und stellte mich dem aufziehenden Sturm. Für den Bruchteil einer Sekunde hing ich kopfüber in der Luft und sah meinen Schatten auf den Wolken unter mir: ein schmaler, scharfer Umriss mit langem Hals und großen, wild schlagenden Flügeln. Dann raste ich auf die schwarze Wand zu. Die Wolken raubten mir die Sicht, als ich in die flackernde Schwärze eintauchte und alles um mich herum verschwand.
Ich taumelte durch die Flammen, deren lautes Brüllen in meinen Ohren dröhnte. Das gesamte Lagerhaus brannte lichterloh, die Feuerzungen leckten an den Stahlträgern und sprangen hungrig auf die Paletten und Kisten über, die ein dichtes Labyrinth bildeten. Wohin ich auch sah, lauerte das kreischende, knackende Feuer und verwandelte die Umgebung mit seinem flackernden Glühen in eine wahre Hölle. Aber ich hatte keine Angst. Neben mir brach mit ohrenbetäubendem Getöse ein Palettenstapel in sich zusammen und ließ einen Regen aus glühenden Holzstückchen auf mich niedergehen, aber es tat nicht weh, ja, es war nicht einmal unangenehm. Ich spürte die Hitze, roch den Qualm und fühlte, wie sich die Rauchpartikel in meiner Lunge sammelten, aber es störte mich nicht im Geringsten.
Rotschopf?
Die leise, raue Stimme schien aus dem Labyrinth zu kommen. Ember?, fragte sie noch einmal, diesmal leicht besorgt. Du sitzt jetzt seit acht Stunden hier. Geh schlafen. Lass mich oder Wes die Wache übernehmen – er wird schon nicht weglaufen.
Nein, erwiderte die Stimme, bei deren Klang mein Herz einen Sprung machte. Ich will hierbleiben. Wenn er aufwacht, sollte ich hier sein. Vorhin war er einmal ziemlich klar im Kopf. Ich glaube … ich glaube, er hat nach mir gerufen.
Ich machte mich auf die Suche nach der Stimme, spürte die Hitze an Nacken und Rücken, als ich mich unter einem brennenden Trägerbalken hindurchschob. Hastig lief ich weiter. Die Stimmen waren immer noch zu hören, aber leiser, als würde das Brüllen der Flammen sie verschlucken. Ein Oberlicht an der Decke wurde durch die Hitze gesprengt, sodass ein Schauer aus Glasscherben niederging und klirrend auf dem Boden landete. Ungeduldig hob ich eine Hand vors Gesicht, um mich zu schützen, und ging weiter.
Aus einem dunklen Gang trat der Patriarch hervor. Er war in Weiß und Rot gekleidet und trug ein Schwert am Gürtel. Sofort wurde er von den Flammen erfasst, sie verbrannten seine Uniform, leckten an seinem Bart, sprangen in seine Haare. Sein Gesicht wurde schwarz, die Haut platzte auf und nässte, doch seine blauen Augen leuchteten durch den Qualm. Langsam hob er die brennende Hand und zeigte mit dem Finger auf mich.
»Verräter«, flüsterte er. »Drachenliebchen. Genau wie deine Eltern. Du bist verdammt, Sebastian. Deine Seele wurde unauslöschlich befleckt, und man muss dich wie einen Dämon zur Strecke bringen, denn nichts anderes bist du.«
Er kam auf mich zu. Ich hob meine Waffe und schoss ihm mitten in die Brust. Der Patriarch zerstob zu einer wirbelnden Aschewolke, die sich schnell im Rauch verlor. Trotzdem hallte seine Stimme weiter durch das Lagerhaus.
Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Das Böse steckt in deinem Blut, Sebastian. Du wirst untergehen, du wirst von den Flammen verzehrt werden, die du selbst herbeirufst, genau wie deine Eltern.
Ich steckte meine Waffe weg, marschierte durch die Aschewolke und tauchte in die Dunkelheit dahinter ein.
Sonnenlicht stach in meine Augen. Ich kniff die Lider zusammen und hob schützend den Arm vors Gesicht, um in der plötzlichen Helligkeit etwas erkennen zu können. Der Geruch von Salz und Sand, Wellenrauschen, kreischende Möwen und leises Gelächter. Blinzelnd ließ ich den Arm sinken und stellte fest, dass ich mich am Strand befand – rechts und links nur weißer Sand, vor mir der funkelnde Ozean.
Irgendwie kam mir die Szenerie vertraut vor, auch wenn ich mich nicht genau erinnern konnte. War ich schon einmal hier gewesen? Und falls ja, warum löste der Anblick des Meeres sowohl Vorfreude als auch Furcht in mir aus?
»Garret«, ertönte Tristans Stimme hinter mir. Er klang ungeduldig, also drehte ich mich schnell zu meinem Kameraden um. Mein Partner trug Shorts und ein Tanktop und musterte mich mit leicht gerunzelter Stirn. »Alles okay?«, fragte er. »Du warst einen Moment lang total weggetreten. Hast du überhaupt gehört, was ich gesagt habe?«
»Nein«, antwortete ich abwesend, denn plötzlich kehrte die Erinnerung zurück, und ich wusste wieder, warum wir hier waren. Um einen Drachen aufzuspüren und zu töten. Wie schon unzählige Male zuvor. Warum schien es diesmal also anders zu sein? Es kam mir vor, als hätte ich etwas Wichtiges übersehen. »Tut mir leid.« Ich rieb mir die Augen. »Was hast du gesagt?«
Tristan seufzte. »Ich sagte: Der Drache versteckt sich gleich dort drüben, vielleicht solltest du rübergehen und mit ihm reden, bevor er wieder verschwindet.«
Er streckte den Arm aus. Als ich mich umdrehte, wurde ich zunächst wieder von der Sonne und vom Funkeln der Wellen geblendet. Unten am Wasser standen ein paar Teenager, die sich lachend gegenseitig nass spritzten. Im Gegenlicht konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen, sie waren nur Silhouetten, die sich schimmernd vor Sand und Himmel abzeichneten.
»Ich sehe da keinen Drachen«, murmelte ich und trat ein paar Schritte vor.
»Wirklich nicht?« Fast unhörbar folgte Tristan mir durch den Sand. »Er steht direkt da vorne, nicht zu übersehen. Wenn du nicht so blind vor Liebe wärst, würdest du vielleicht sein wahres Wesen erkennen. Und dann müsste ich dich jetzt nicht töten.«
Ich fuhr herum. Tristan stand genau hinter mir und zielte mit seiner Pistole auf meine Brust. Mit unerbittlicher Härte im Blick starrte er mich an, dann drückte er ab.
Es geschah vollkommen lautlos: Das Mündungsfeuer blitzte auf, und ich spürte, wie ich zusammenbrach.
Ich schlug die Augen auf.
Der Himmel war trüb und grau. Nur Nebel, kein blaues Fleckchen, keine Wolken, keine aufblitzende Sonne. Nur ein konturloser grauer Himmel, der noch dazu viel zu tief zu hängen schien. Ich blinzelte mehrmals, woraufhin sich der Himmel in eine graue Zimmerdecke verwandelte, die von mehreren Rissen durchzogen wurde. Anscheinend lag ich in einem kleinen, fast leeren Zimmer, war bis zur Brust zugedeckt und hatte die Hände flach auf den Bauch gelegt. Mein Körper fühlte sich schwer an, irgendwie taub, und mein Gehirn schien mit Watte vollgestopft zu sein, denn es fiel mir schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Wo war ich? Wie war ich hierhergekommen? Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte …
Träge versuchte mein Verstand, zwischen Realität und Albträumen zu unterscheiden. Was war mit mir geschehen? Erinnerungen regten sich, vertraute Gesichter und Stimmen, aber ich schaffte es noch immer nicht, Fakten und Einbildung voneinander zu trennen. War ich verwundet worden? Oder war ich auf der Jagd nach etwas gewesen?
Ganz langsam drehte ich den Kopf und sah mich um. Plötzlich machte mein Herz einen Satz.
Neben meinem Bett stand ein Metallstuhl, auf dem ein Mädchen saß. Sein Oberkörper war auf meiner Matratze zusammengesackt. Der Kopf ruhte auf den gefalteten Unterarmen, sodass nur zerzauste rote Haare zu erkennen waren. Sie hatte die Augen geschlossen, und ihre schmalen, nackten Schultern hoben sich regelmäßig.
Ember. Ich holte tief Luft, und endlich löste sich die merkwürdige Traumwelt komplett auf, sodass die Wirklichkeit wieder Fuß fassen konnte. Mit einem Mal schien das alles – wo ich mich befand, was mit mir passiert und wie viel Zeit vergangen war – nicht mehr wichtig zu sein. Nur noch eines war von Bedeutung: dass sie hier war.
Da ich meiner Stimme noch nicht ganz traute, streckte ich die Hand aus und berührte ihren Arm.
Sie zuckte zusammen, hob den Kopf und riss überrascht die grünen Augen auf. Einen Moment lang starrte sie mich völlig verwirrt an, dann realisierte sie, was geschehen war. Ich konnte mein Spiegelbild in ihren Augen sehen und betrachtete sie schweigend, da ich kein Wort herausbrachte.
»Garret«, hauchte sie kaum hörbar. Dann warf sie sich auf mich und schlang fast schon schmerzhaft fest die Arme um meinen Hals. Ich erwiderte die Umarmung, glücklich, ihren Herzschlag an meiner Brust zu spüren, ihre warme Wange an meinem Gesicht. Mit geschlossenen Augen hielt ich sie fest. Ich zitterte.
»Hallo, du«, flüsterte ich. Meine Kehle war so trocken, dass es kaum mehr war als ein heiseres Krächzen. Ich schluckte mehrmals, und plötzlich merkte ich, wie heiß mir war, meine Haut schien regelrecht zu glühen, als hätte ich hohes Fieber. Die Hitze schien in spürbaren Wellen von mir abzustrahlen, und ich war froh, dass ich nur mit einem dünnen Laken zugedeckt war. »Was ist passiert?«, presste ich hervor. Ember setzte sich auf und fixierte mich mit diesen leuchtend grünen Augen. »Wo sind wir?«
Nachdem sie mich ernst gemustert hatte, erklärte sie: »Wir sind in einem von Rileys Verstecken, einem ehemaligen Bunker aus Zeiten des Kalten Krieges, den er umgebaut hat. Momentan befinden wir uns wortwörtlich im Untergrund. Warte kurz.« Sie rutschte von der Matratze und wandte sich einem kleinen Tischchen zu, das neben dem Bett stand. Dort standen eine Schüssel mit einem nassen Lappen, ein Glas und ein Wasserkrug. Ember schüttete den Rest aus dem Krug in das Glas und fragte skeptisch: »Kannst du dich aufsetzen?«
Vorsichtig kämpfte ich mich hoch und beugte mich vor. Ich war immer noch schwach und schlaff. Ember schüttelte meine Kissen auf. Als ich mich zurückgelehnt hatte, reichte sie mir das Glas, und ich zwang mich, trotz des Brennens in Hals und Brust möglichst langsam zu trinken.
Erst als ich das leere Glas auf den Nachttisch gestellt hatte, sah ich wieder zu Ember hoch. Sie strich mir sanft die Haare aus der Stirn. Ihre kühlen, weichen Finger waren wie Balsam für meine erhitzte Haut. »Woran kannst du dich noch erinnern?«
»Ich … ich weiß nicht.« Es war immer noch alles verschwommen, außerdem schien die Hitze in meinem Inneren immer stärker zu werden. Ich presste die Hand an die Stirn, um den Druck hinter den Augen zu lindern und so vielleicht besser denken zu können. »Ich glaube … ich habe gegen den Patriarchen gekämpft«, sagte ich langsam. »Er hat mich zum Duell gefordert, und ich habe mich bereit erklärt, gegen ihn anzutreten. An mehr kann ich mich nicht erinnern.«
Ember nickte. »Du hast gewonnen«, ergänzte sie leise. »Du hast den Patriarchen besiegt, aber als das Duell vorbei war, hat er auf dich geschossen. Als du ihm den Rücken zugewandt hast.« Ein wilder Glanz trat in ihre Augen, der mich ernsthaft anzweifeln ließ, ob der Patriarch noch lebte – oder ob er der Rachsucht eines wütenden roten Drachen zum Opfer gefallen war. »Du wärst fast gestorben«, fuhr Ember fort, und die Wut in ihrem Blick wurde von Kummer verdrängt. »Du hast stark geblutet, und wir konnten dich nur retten, indem wir direkt vor Ort eine Bluttransfusion gemacht haben. Uns blieb nicht genug Zeit, um dich in ein Krankenhaus zu bringen. Aber nur einer von uns hatte die richtige Blutgruppe, also … war Riley der Spender.« Sie zögerte kurz. »Riley hat dir das Leben gerettet, Garret.«
Im ersten Moment begriff ich gar nicht, was das bedeutete und warum sie so verstört war deswegen. Hatte sie vielleicht Angst, dass ich ein Problem damit haben könnte, von meinem ehemaligen Erzfeind gerettet worden zu sein? Zog man unsere persönliche Vergangenheit in Betracht, war es tatsächlich schockierend, dass der Einzelgänger sein Blut gegeben hatte, um einen Krieger des Heiligen Georg zu retten. Hätte Riley mich vielleicht doch lieber sterben lassen? Eigentlich hielt ich ihn nicht für so rachsüchtig, aber immerhin war ich sein Rivale. Kein Feind mehr, aber doch ein Kontrahent der schlimmsten Art – im Wettstreit um das Mädchen, das hier neben mir saß. Wenn ich nicht mehr da war, hätte Riley Ember ganz für sich.
Und dann begriff ich. Die Hitze in meinem Inneren, das Gefühl, als ströme flüssiges Feuer durch meine Adern. Ich stieß hörbar den Atem aus.
»Ich habe … Drachenblut in meinem Körper.«
Ember zuckte schuldbewusst zusammen. »Es hat zu einigen Komplikationen geführt«, flüsterte sie. »Ein paar dieser Nebenwirkungen waren gut, zum Beispiel sind deine Wunden wesentlich schneller verheilt, als es sonst der Fall gewesen wäre. Aber während der letzten zehn Tage hattest du hohes Fieber. Bis heute wussten wir nicht, ob du wieder aufwachen würdest.« Als ich sie fassungslos anstarrte, senkte sie den Blick. »Wes meint, dass dein Körper erst mal lernen muss, mit diesem neuen Blut klarzukommen, und dass er sich irgendwann anpassen wird, aber sicher ist er sich nicht. So etwas ist noch nie gemacht worden. Wir wissen nicht … was für Auswirkungen es auf dich haben wird. Jetzt, aber auch langfristig gesehen.«
Benommen ließ ich mich wieder in die Kissen sinken. Riley hatte mir das Leben gerettet, indem er mir Drachenblut injiziert hatte. Schlug mein Herz deshalb so schnell, als wäre ich gerade einen Marathon gelaufen, obwohl ich ganz still auf dem Rücken lag? Mein sowieso noch etwas aus der Spur geratenes Gehirn ließ sich zu wüsten Spekulationen hinreißen: Was würde diese Infusion aus mir machen, innerlich wie äußerlich? Schwebte ich in Lebensgefahr, weil meine inneren Organe durch die Hitze des Drachenblutes gekocht wurden? Oder konnte es sogar noch seltsamere Dinge mit mir anstellen? Drachen waren magische Wesen, ein winziger Rest dieser uralten, übernatürlichen Kraft strömte durch ihre Adern. Das musste sogar der Orden des Heiligen Georg eingestehen. Was würde diese Kraft mit meinem menschlichen Körper machen? Konnte ich überhaupt als ganz normaler Mensch aus dieser Sache hervorgehen?
Vor meinem inneren Auge stieg das bizarre Bild auf, wie ich eines Tages mit Schuppenhaut aufwachte oder beim Aufstehen plötzlich einen Schwanz hinter mir her schleifte. Hastig unterdrückte ich diese Vorstellung. Das ist unmöglich, sagte ich mir, während ich verzweifelt versuchte, mich an der Logik festzuklammern, die sich mir allerdings mit aller Kraft entziehen wollte. Solche Dinge konnte Blut nicht bewirken. Ganz bestimmt verwandelte ich mich nicht plötzlich in eine Art komischen Halbdrachen. Das Schlimmste, was mir zustoßen konnte, war der Tod: Wenn mein Körper das neue Blut abstieß und nach und nach sämtliche Organe versagten.
Mir wurde bewusst, dass Ember mich angespannt musterte – offenbar wartete sie auf meine Reaktion. Ich griff nach ihrer Hand, und sofort schlossen sich ihre Finger um meine, als wolle sie mich nie wieder loslassen. »Schon okay«, versicherte ich ihr lächelnd. »Falls es Probleme gibt, werde ich bestimmt damit klarkommen. Im Moment reicht es mir, dass ich überhaupt noch da bin.«
Sie stieß halb lachend, halb knurrend den Atem aus und beugte sich so weit vor, dass sie ihre Stirn an meine Wange drücken konnte. »Verdammt, Garret«, flüsterte sie mir ins Ohr. »Ich dachte, ich hätte dich verloren. Mach das ja nie wieder!«
»Ich werde es versuchen«, antwortete ich leise. Ihre Haut war schön kühl, und ich umschloss mit beiden Händen ihre Arme. »Aber wirst du noch dasselbe für mich empfinden, wenn ich plötzlich Flügel und einen Schwanz bekomme?«
Mit einem leisen Lachen gab sie zu: »Eigentlich wäre das sogar ziemlich cool. Obwohl du dann nie wieder in der Öffentlichkeit Shorts tragen könntest. Ein paar Hürden müssten wir dann also schon nehmen.«
Ich wollte sie einfach nur fest an mich drücken und auf ihren und meinen Herzschlag lauschen. Aber plötzlich wurden meine Lider immer schwerer, der Schlaf drohte mich zu überwältigen, obwohl ich krampfhaft versuchte, wach zu bleiben. »Was ist mit dem Orden geschehen?«, fragte ich, um wenigstens noch ein paar Antworten zu bekommen, bevor ich mich der Erschöpfung ergeben musste.
»Wissen wir nicht.« Ember löste sich von mir. »Nach dem Duell haben sie den Leichnam des Patriarchen eingesackt und sind verschwunden. Wir sind von Salt Lake City aus direkt hierhergekommen und seitdem nicht mehr nach draußen gegangen.«
Ich nickte verstehend. Gute Taktik. Der Patriarch war tot. Der hoch angesehene Anführer des Georgsordens war vom Feind niedergemacht worden. Selbst wenn es nicht sofort zu einem Gegenschlag kommen würde, war es nur klug, momentan nicht auf dem Radar des Ordens aufzutauchen. Trotzdem war es beunruhigend, so wenig zu wissen. Was ging jetzt im Orden und auch bei Talon vor? Wir hatten beiden Organisationen einen riesigen Knüppel zwischen die Beine geworfen, das musste doch irgendeine Reaktion nach sich ziehen. Früher oder später würden sie etwas unternehmen. Und wir mussten uns darauf vorbereiten.
Aber nicht jetzt sofort. Zumindest ich nicht. Es wurde immer schwieriger, bei Bewusstsein zu bleiben, obwohl ich noch einen Haufen Fragen hatte. Außerdem spukte mir noch etwas anderes im Kopf herum, das nicht greifbare Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Dabei ging es um den Orden … und um mich. Ember musste etwas bemerkt haben, denn sie strich mir wieder mit ihren angenehm kühlen Fingern über die Stirn, bevor sie mir einen sanften Kuss auf die Schläfe drückte.
»Schlaf ein bisschen, mein kleiner Soldat«, flüsterte sie so voller Erleichterung, dass mich das Gefühl wie auf einer Welle davonzutragen schien. »Hier bist du sicher. Ich werde da sein, wenn du aufwachst.«
Eingelullt durch dieses Versprechen, fügte ich mich ihrem Befehl.
Ember
Ich sah zu, wie Garret einschlief: Erst sank er schlaff in die Kissen, dann wurde seine Atmung immer tiefer und gleichmäßiger. Diesmal war es ein fester, friedlicher Schlaf, er zuckte nicht, sprach nicht, und seine Lider blieben ruhig. Albträume schien er auch nicht zu haben, denn er schlug nicht wild um sich. Hoffentlich ging sein Fieber nun zurück, und er begann sich zu erholen, auch wenn seine Haut noch beunruhigend heiß war. Heißer als es bei einem Menschen normal war.
Aber zumindest war er endlich aufgewacht und bei klarem Verstand, was schon eine enorme Erleichterung war. Es war schrecklich gewesen, ihm dabei zusehen zu müssen, wie er sich im Schlaf herumgewälzt und unsinniges Zeug gemurmelt hatte. In einer Nacht hatte er so heftig um sich geschlagen, dass wir ernsthaft überlegt hatten, ihn zu fixieren. Ich wusste, dass Fieber und Krankheit durch das Drachenblut in seinem Körper ausgelöst wurden, da sein Immunsystem versuchte, sich dem Transfusionsblut anzupassen – oder es abzustoßen. Ich wusste, dass Garret seine Verletzung ohne das Drachenblut wohl nicht überlebt hätte und dass Riley ihm durch seine schnelle Reaktion das Leben gerettet hatte. Aber während er dort lag und stöhnend versuchte, gegen die Feinde in seinem Kopf anzukämpfen, wobei er einmal sogar Laute ausstieß, die einem Fauchen erschreckend nah kamen … da fragte ich mich schon, wie er wohl sein würde, wenn er aus dem Delirium erwachte. Falls er das überhaupt tat.
Zum Glück hatte er das nun getan. Und anscheinend hatte er sich nicht verändert. Zumindest nicht äußerlich. Über das, was in seinem Inneren vorging, konnte man nur Vermutungen anstellen. Unseres Wissens nach hatte noch nie zuvor ein Mensch Drachenblut injiziert bekommen, es fehlte uns also an Vergleichsmöglichkeiten. Flügel und Schwanz würden Garret wohl nicht wachsen – was verstörend, aber auch cool gewesen wäre –, doch ich war mir ziemlich sicher, dass ein Mensch nicht mit Drachenblut im Körper leben konnte, ohne dass es zu gewissen Nebenwirkungen kam.
Allerdings schien das alles in diesem Moment, in dem ich zum ersten Mal seit über einer Woche einen friedlich schlafenden Soldaten vor mir hatte, nicht sonderlich wichtig zu sein. Er hatte überlebt und war klar im Kopf, was für mich bedeutete, dass ich in die Welt zurückkehren konnte. Riley war sicher erleichtert. Seit unserer Ankunft hatte ich ihn und Wes kaum zu Gesicht bekommen, denn ich hatte dieses Zimmer eigentlich nur verlassen, wenn ich an Garrets Bett eingeschlafen war und Riley mich in mein eigenes Quartier getragen hatte. Bestimmt wollte er sofort erfahren, dass Garret aufgewacht war, und sei es nur, weil ich mir nun weniger Sorgen machte.
Nachdem ich noch einen letzten Blick auf den reglosen Soldaten geworfen hatte, schlich ich aus dem Zimmer.
Draußen im Flur hätte ich mir – wieder einmal – fast den Kopf an der niedrigen, gewölbten Decke angeschlagen, zog ihn jedoch gerade noch rechtzeitig ein. Ein leises Knurren konnte ich mir aber nicht verkneifen. Der sogenannte Korridor bestand eigentlich aus einer riesigen, rostigen Metallröhre, von der die einzelnen Räume abzweigten. An ihrem Ende führte eine senkrechte Eisenleiter hinauf zu einer winzigen Betonhütte, die irgendwo mitten im Nirgendwo von Wyoming stand. Eigentlich eine ziemlich typische Konstruktion für einen Atomschutzbunker. Riley meinte, er wäre vor vielen Jahren »zufällig darüber gestolpert« und hätte dann eine Art Langzeitversteck für Notlagen daraus gemacht. Der Bunker war dunkel und klaustrophobisch eng, aber laut Riley und Wes auch der sicherste Ort, der uns momentan zur Verfügung stand. Ein Unterschlupf, in dem wir abwarten konnten, bis sich das Chaos in der Außenwelt gelegt hatte und wir wieder davon ausgehen konnten, dass der Orden uns nicht plötzlich in der Nacht einen Besuch abstattete.
Wobei mir die Vorstellung, das alles einfach auszusitzen, nicht unbedingt gefiel. Jetzt, wo es Garret besser ging, hieß das, tatenlos herumzusitzen und darauf zu hoffen, dass Talon und der Orden uns vergessen würden. Für mich klang das weniger nach einem Plan als nach einer Verzögerungstaktik. Keine der Organisationen würde uns so einfach vergessen. Und wir hatten so hart gekämpft, um beiden einen entscheidenden Schlag zu versetzen – das Bündnis zwischen Talon und dem Patriarchen zerschlagen zu haben, war ein großer Triumph für uns, auch wenn es einen von uns fast das Leben gekostet hätte. Jetzt sollten wir uns nicht zurückziehen und verkriechen, ganz im Gegenteil. Aber Riley wollte das einfach nicht einsehen.
Im Zimmer neben Garret waren Riley und Wes untergekommen, aber nun war der Raum leer. Also ging ich zum einzigen anderen Ort, an dem die beiden stecken konnten: zur »Kommandozentrale« am anderen Ende der Röhre.
Wie alles andere in diesem Untergrundversteck verfügte die Kommandozentrale über eine niedrige Decke, nackte Betonwände und gerade mal genug Platz, um sich darin umzudrehen. In der Mitte des Raums stand ein quadratischer Tisch, auf dem sich Landkarten, Aktenordner und diverse Papiere stapelten, während eine Ecke von einem Schreibtisch und mehreren Regalbrettern eingenommen wurde. Erstaunlicherweise hatte Wes es geschafft, den Bunker an das Stromnetz anzuschließen. Gegenüber der Schreibecke gab es noch einen uralten, aber funktionstüchtigen Fernseher, in dem momentan ein grauenhaft fröhlicher Meteorologe ankündigte, dass es das ganze Wochenende über regnen werde.
Kaum hatte ich die Kommandozentrale betreten, blieb ich verblüfft stehen. Wes saß – wenig überraschend – am Computer, wobei neben dem fest installierten PC auch noch sein Laptop lief. Riley hingegen stützte sich mit beiden Händen auf dem großen Tisch ab und starrte nachdenklich auf eine Landkarte. Er war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, und seine dunklen Haare waren zerzaust. Hitze stieg in mir auf, als mein Drache sich regte. Wie jedes Mal, wenn Riley in der Nähe war.
Aber wirklich erstaunt war ich über die dritte Person im Raum. Sie stand mit verschränkten Armen auf der anderen Seite des Tisches und wandte mir den Rücken zu, sodass ich vor allem die langen, glatten Haare sah, die ihr bis zur Taille reichten.
»Jade?«
Die zierliche Chinesin – die in Wahrheit ein ungefähr zwölf Meter langer, voll ausgewachsener asiatischer Drache war – drehte sich um und begrüßte mich mit einem schmalen Lächeln. »Hallo, Ember. Es freut mich, dich wiederzusehen. Nach dem, was Riley mir erzählt hat, hatte ich gar nicht damit gerechnet, dich in den nächsten Tagen zu Gesicht zu bekommen.«
»Was machst du hier?«