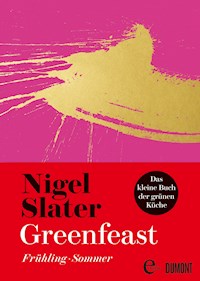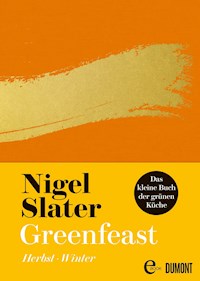19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nigel Slater ist einer der angesehensten britischen Food-Journalisten. Er hat über 30 Jahre lang jede Woche eine Kolumne über seine Rezepte und seinen Garten für den Observer geschrieben, seine Memoiren wurden verfilmt und seine Kochbücher sind preisgekrönt. Slaters größtes Talent ist es, den Zauber im Gewöhnlichen zu finden, seine Prosa ist mühelos, voller Herz, Zärtlichkeit und Humor. Seine Erzählungen in diesem Buch feiern die alltäglichen Freuden, die oft übersehen werden. Er hält Erinnerungen fest, die von Erlebnissen in der Küche über Beobachtungen im Garten bis zu Reisen in ferne Länder reichen. Es sind flüchtige Momentaufnahmen, die das Leben in all seinen Facetten einfangen: der Genuss einer reifen Mango im Regen oder der Duft von Weihrauch in einem Tempel. Seine Geschichten laden dazu ein, innezuhalten und die kleinen, goldenen Augenblicke zu schätzen, die das Leben bereichern. In einer Welt voller Herausforderungen bieten sie Trost und Inspiration, die guten Dinge zu suchen und zu feiern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jahrelang hat Nigel Slater Momente des Staunens, kuriose Begegnungen und besondere Beobachtungen in seinen Notizbüchern festgehalten. Er schrieb an seinem Küchentisch in London, in einer Fischerhütte in Reykjavik, in einem Moosgarten in Japan oder während eines Schneesturms in einer Wiener Konditorei.
Es sind die kleinen Augenblicke, Ereignisse und Begebenheiten, die Freude bereiten, bevor sie verschwinden. Die Misosuppe zum Frühstück, das Packen eines Koffers für eine Reise und die Beobachtung eines Schmetterlings.
Nigel Slaters Sammlung ebenso flüchtiger wie schöner Momente lehrt uns, jeden Tag den Blick auf die Freude zu lenken, die uns umgeben.
© Jenny Zarins
Nigel Slater ist einer der angesehensten britischen Food-Journalisten. Er schreibt seit über 30 Jahren jede Woche eine Kolumne über seine Rezepte und seinen Garten für den Observer, seine Memoiren wurden verfilmt und seine Kochbücher sind preisgekrönt. Slaters größtes Talent ist es, den Zauber im Gewöhnlichen zu finden, denn es sind nicht die großen Gesten, die das Leben bereichern, sondern die bewusst wahrgenommenen kleinen Momente.
Nigel Slater
Tausend kleine Freuden
Geschichten übers Essen, Reisen und Gärtnern
Aus dem Englischen von Sofia Blind
Von Nigel Slater sind bei DuMont außerdem erschienen:
A Cook’s Book
Greenfeast – Herbst / Winter
Greenfeast – Frühling / Sommer
Das Wintertagebuch
Ein Jahr lang gut essen
eat
Das Küchentagebuch
Tender. Obst
Tender. Gemüse
Einfach genießen
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel A Thousand Feasts bei HarperCollins Publishers Ltd., London.
© Nigel Slater 2024
E-Book 2025
© 2025 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Übersetzung: Sofia Blind, Geilnau/Lahn
Lektorat: Kerstin Thorwarth, Köln
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1139-8
www.dumont-buchverlag.de
Für James
Notizen, Geschichten und kleine Momente des Glücks
Es gibt so viele Freuden. Eine Woge aus Schneeglöckchen unter den knorrigen Ästen einer Eiche; die strahlend weißen Seiten eines neuen Tagebuchs; ein ramponierter Dämpfkorb voller frisch gegarter Teigtaschen. Ich erfreue mich daran, meine Sachen für eine Kurzreise zu packen, ein improvisiertes Picknick aus Brot und Käse zu verputzen, an einem Strauß selbst gezogener Duftwicken zu schnuppern oder befriedigt einen ordentlichen Stapel frisch gebügelter Wäsche zu betrachten. Kleine Freuden, aber für mich sind sie ebenso bereichernd wie ein üppig gedeckter Tisch, um den sich fröhliche, innig geliebte Freundinnen und Freunde versammelt haben. Diese vergnüglichen Kleinigkeiten sind da, sobald wir uns die Mühe machen, nach ihnen Ausschau zu halten – kleine Glücksmomente, die eine sich verdüsternde Welt aufhellen. Sie nähren die Seele und füttern den Geist. Zumindest bei mir.
Neben meinen Küchentagebüchern – in denen ich verzeichne, was ich koche und esse – führe ich Notizbücher. Sie enthalten Einzelheiten eines Lebens, das sich vor allem in der Küche abspielt, erzählen aber auch von Zeiten im Garten, im Zug oder im Flugzeug, vom Leben zu Hause und in der Ferne. Zwischen ihren verschlissenen Umschlagdeckeln stecken Rezepte und Einkaufslisten, Quittungen und Pläne, unleserliche Wörter und, ganz vereinzelt, Passagen in fließend geschwungener Kalligrafie. Viele Momente sind nur in einem einzigen Satz festgehalten.
Jede Notiz ist eine Erinnerung: Es sind keine detaillierten Berichte über wichtige Ereignisse, sondern Aufzeichnungen über Dinge von insgesamt eher flüchtiger Natur. Jene Art von Augenblicken, die sich wahrscheinlich im Nebel der Vergangenheit auflösen würden, ein Wirrwarr aus Merkwürdigkeiten und Überlegungen, geschrieben an meinem Küchentisch oder durchnässt in einer Fischerhütte in Reykjavík, in einem japanischen Moosgarten oder auf der Flucht vor einem Schneesturm in einer warmen, pralinenschachtelgefüllten Wiener Konditorei.
Es gibt keine ordentliche Reihe sorgfältig beschriebener, ledergebundener Kladden. Alles, was ich habe, ist ein unordentlicher Haufen zufälliger Beobachtungen, Anmerkungen und Geschichten, gekritzelt in Notizbücher oder auf billige Spiralblöcke, auf Briefumschläge oder lose Zettel. Es gibt ein ausgebleichtes rosa Schulheft, das ich in Delhi gekauft habe, ein paar Kladden mit braunen Pappumschlägen – viele mit Klebeband oder Bindfäden zusammengehalten – und einen Schreibblock, dessen Seiten nach Jahren in der Küche fleckig und gewellt sind. Die mit Bleistift geschriebenen Zeilen sind verblasst und Teile von ihnen für immer verloren; andere haben sich so klar in mein Gedächtnis eingeprägt, dass sie unvergesslich bleiben.
Was sie verbindet, ist ihr Geist – das Bedürfnis, die guten Dinge schriftlich festzuhalten: Erinnerungen an gemeinsam oder alleine verzehrte Mahlzeiten, an Reisen und Orte, Ereignisse und Begebenheiten, an Kleinigkeiten, die uns Freude bereitet haben, bevor sie für immer entschwanden. Ich nehme an, jeder einzelne Text ist eine Kurzgeschichte, die mich an etwas – Gewöhnliches oder Außergewöhnliches – erinnert, das ich für aufzeichnungswürdig hielt. Es handelt sich fast ausnahmslos um Momente stillen Jubels: eine reife Mango, gegessen im peitschenden Regen, der Duft von Weihrauch in einem Tempel oder der Klang von Schritten auf dem Steinboden einer Abtei. Dies sind Chroniken von Ruhe und Frieden, von geschäftigen Tagen in der Küche und von sinnlichen, im Garten verbrachten Nachmittagen.
Wer hofft, hier Geschichten von ausschweifenden Tischrunden und orgiastischer Völlerei zu lesen (und mich offensichtlich nicht allzu gut kennt), wird enttäuscht sein. Ich habe schon immer lieber über Sirup geschrieben, der von einem Löffel tropft, als über das Aufspüren und Töten meiner eigenen Abendmahlzeit. Und während andere – zum Glück! – über das große Ganze schreiben, habe ich meine gesamte Kochbiografie lang nur die ganz kleinen Beobachtungen notiert, weil mich diese winzigen, intimen Details des Lebens faszinieren.
Ich muss gestehen, dass ich nur die guten Teile meines Lebens aufschreibe. Goldene Momente, die einen ganzen Abend dauern oder blitzschnell vorübergehen können. Es kommt mir sinnlos vor, Negatives, Trauriges oder Schmerzhaftes zu Papier zu bringen. Davon gibt es genug, weiß der Himmel. Auch wenn ich nicht in einer rosaroten Blase leben möchte, habe ich doch eines gelernt: dass man sich auf die »positiven Sachen« konzentrieren, sie wirklich wertschätzen sollte. Ich suche sie aktiv, schaue eher nach oben als nach unten, bin neugierig und halte mich, so gut ich nur kann, an solchen »guten Dingen« fest, seien sie auch noch so klein. Aus diesem Grund habe ich all die Geschichten, Textbrocken und Zeilen – kurze Momente der Freude, jeder einzelne ein kleines Fest – hier zusammengestellt.
Was Sie in Händen halten, ist ein buntes Sammelsurium besonders glücklicher Zeiten, jener kleinen Freuden, die das Salz in meiner Suppe waren. Ein Kuriositätenkabinett zum Herumstöbern, als Trost und als – wenn auch nur kurze – Ablenkung in komplizierten Zeiten. Ich habe diese Momente nicht nur für mich selbst gesammelt (obwohl das, ehrlich gesagt, eine Rolle gespielt hat), sondern auch, damit sich andere, wie ich hoffe, ebenfalls daran erfreuen.
Mit dem Löffel in der Hand
Mangos im Monsun
Varca Beach, Goa
Auf dem Rücksitz gleite ich immer wieder vom Wachen in den Schlaf hinüber. Langsame, tiefe Atemzüge, ein und aus, wie das Vor und Zurück von Wellen am Strand. Das Krachen eines Astes gegen die Windschutzscheibe weckt mich auf, und der Fahrer raunzt mich an, ich solle das Fenster schließen. Einen Augenblick später trommeln kirschgroße Regentropfen auf das Autodach, und die Scheibenwischer spritzen hysterisch. Swisch-stock, swisch-stock. Die uralten Kokospalmen, vorher so weise und ruhig, schwanken jetzt hin und her; ihre Blätter flattern wie Elefantenohren.
Wir halten an. Der Fahrer kann die Straße nicht mehr sehen und schon gar nicht den Schlaglöchern ausweichen. Ich frage mich, ob die Karosserie seines makellosen antiken Morris Oxford, dessen gehäkelte Kopfstützenschoner täglich von der Mutter des Fahrers gewaschen und gebügelt werden, den Regen verkraftet oder ob das Wasser den Motor überfluten wird. Regen empfinde ich immer als wohltuendes Ereignis, hier erst recht, aber dies ist ein vollkommen anderes Ausmaß an Regen. Ich fühle mich winzig, bedroht.
Auf dem Beifahrersitz liegt ein Haufen kleiner, runder Mangos. Der Fahrer reicht eine über die Schulter nach hinten, und ich packe sie wie ein Rettungsboot. Ich schaue zu, wie er mit den Zähnen Klumpen aus kurkumagelbem Fruchtfleisch abreißt. Er isst seine Mango wie einen Apfel und spuckt dabei die Haut in die linke Hand. Ich tue es ihm nach.
Genau wie es Regen und REGEN gibt, gibt es Mangos und MANGOS. Ein Tropfen Nektar rinnt an meinem Kinn herunter und brennt auf meinen nackten, sonnenverbrannten Schenkeln. Das Fruchtfleisch ist honigsüß und weich wie Eiscreme. Der Regen trommelt aufs Dach. Der Himmel ist kohlschwarz und karmesinrot. Wir wissen beide nicht, ob das Auto wieder anspringen wird.
Während ich noch darüber nachdenke, wie die Benimmregeln zum Umgang mit dem sauber abgelutschten Stein und seinem orangeroten Bart lauten mögen, schwingt das Auto vor und zurück wie ein Schaukelpferd, und wir brechen in hysterisches Lachen aus. Mir schießt durch den Kopf, dass es schlechtere Arten zu sterben gibt als in einem Monsun, lachend, mit Mangosaft auf den Lippen.
Ein winziger Würfel aus weichem Tofu in der Farbe von Buttermilch. Auf seiner Oberseite eine kleine Perle aus grünem Wasabi und eine einzelne eingelegte Kirschblüte. Er liegt in einem durchscheinenden, klaren Burggraben aus Ponzu-Soße auf einem alten blau-weißen Teller. Ich habe wirklich noch nie etwas Schöneres gesehen.
Appam in Galle
Sri Lanka
Dünn wie Papier, in der Mitte hell und teigig, an den Rändern zart und knusprig wie Honigwaben: Ein Appam ist schon verlockend, bevor er mit einem Löffel saftigem Gemüsecurry gefüllt wird. Dieser tröstlich mild schmeckende Pfannkuchen hat vieles mit Pikelets oder Crumpets gemeinsam, wird aber so dünn gebraten, dass seine Kanten steif und fein wie belgische Spitze aussehen. Von allen Hefeteigprodukten dieser Welt ist der Appam das leichteste und, wenn er wirklich gut ist, auch das zerbrechlichste.
Das Exemplar, das gestern Abend in Galle auf meinem Teller landete, war ein Kunstwerk, das begleitende Curry mild und mit Kokos gesüßt, wie so oft in Rezepten aus Küstenregionen. Die terrakottafarbene Soße dämpft meinen Ärger über die Hauseigentümer ein wenig, die sämtliche antiken Möbel und sogar die Originaltüren an gierige Antiquitätenhändler aus aller Welt verkauft haben, die mit Bargeldbündeln am Eingang des alten Hotels auftauchen.*
Ich sitze in der Lobby auf der Vorderkante eines Kolonialstil-Sessels mit geflochtener Rückenlehne, während durch die offenen Türen wässrige Morgensonne hereinsickert, und schreibe in mein Tagebuch. Aus einem der Hotelzimmer lässt jemand Montserrat Caballé schmettern. Gerade ist mir ein Glas Mangosaft serviert worden, dick wie Sirup. Ein besserer Start in den Tag ist schwer vorstellbar. Montserrat Caballé und eine reife Mango. Ich habe dieses Leben nicht verdient.
Der Koch, der das gestrige Abendessen zubereitet hat, kommt vorbei, um mich zu begrüßen. Wir plaudern über die Kunst des Appam-Bratens. Er bietet mir an, es mir zu zeigen, und ich folge ihm in die Küche wie ein Lämmchen. Wie bei Pfannkuchen hängt die Zartheit nicht nur vom richtigen Teigrezept ab, über dessen Details er sich eher wolkig äußert, sondern auch vom Geschick im Umgang mit der alten, geschwärzten Appachatti-Eisenpfanne, die aussieht wie ein dicker Wok mit zwei Griffen. Er gießt Teig hinein und den Großteil davon gleich wieder hinaus, sodass an den Seiten nur eine hauchdünne Schicht klebt. Dann folgen zahlreiche Schwenkbewegungen aus dem Handgelenk, die ich zu wiederholen versuche, als ich selbst an der Reihe bin. Das Ergebnis: bei ihm eine Waffel mit winzigen Löchern und Rüschenrand, bei mir ein dicker, glitschiger Pfannkuchen, so zart und fein wie ein nasser Badeschwamm, von dem er mir versichert, er sei für den ersten Versuch nicht schlecht. Während der Dankesbekundungen und der Übergabe eines neuen Appachatti als Geschenk nehme ich mir im Stillen vor, mich in Zukunft auf Crumpets zu beschränken.
*Jahre später scheint es, als hätten die Antiquitätenplünderer der Welt (wenn auch nicht dem Hotel) einen Dienst erwiesen, als ein furchtbarer Tsunami das Gebäude überflutet und viele der umliegenden Häuser zerstört. Zumindest etwas ist gerettet worden, wenngleich in einem Luxusappartment in Florida.
Ein Lamm-Festmahl
Bekaa-Ebene, Libanon
Wir schleppen verschiedene Tische hinaus in den Hof und schieben sie auf dem unebenen Boden aneinander. Sie passen nicht recht zusammen; manche sind höher als die anderen, hier und da wackelt ein Bein. Ein Künstler, der im Camp lebt, hat den längsten Tisch mit rot-gelben Schmetterlingen auf knallblauem Hintergrund bemalt. Jemand verteilt Plastikteller, goldumrandet und mit Rosen in Pink und Türkis verziert. Wir trinken aus Pappbechern und essen mit Löffeln.
Servierplatten aus Glas, so groß wie Lenkräder, werden aus der Küche gebracht. Auf ihnen türmen sich dampfender Reis, gelbe Speiserübchen und Brocken aus geschmortem Lammfleisch, noch am Knochen. Ringsherum liegt ein Ring aus knusprigen Falafelbällchen, jedes einzelne ein perfektes, spitzes Ei aus Weizen, Thymian und gehackten Zwiebeln. Schalen mit blassgelber Soße – eine Mischung aus Bratensaft, Kurkuma und Joghurt – werden zwischen Stapel von warmen, pfannkuchengroßen Fladenbroten gequetscht, die aussehen wie zerknitterte Bettwäsche. Es gibt Plastikflaschen mit Wasser und orangeroter Squash-Limonade, keinen Alkohol.
Aus einem staubigen Ghettoblaster erklingt Musik, hypnotischer libanesischer Rock, den ich mit wackeliger Internetverbindung vergeblich über die App Shazam zu identifizieren versuche. Auf meinem Teller mit säuerlicher gelber Soße, einem Fabergé-Ei aus Falafel und dicken gebratenen Cashewnüssen lugt eine blaue Rose unter einem Hügel aus seidigem Langkornreis hervor. Ich lutsche das Fleisch von den dünnen Rippenknochen und löffele Bratensaft und Joghurt über meinen Reis.
Anfangs ist das Gespräch leise, es beschränkt sich auf arabisches, französisches und englisches Geflüster. Wir sind Künstlerinnen und Köche, Musikerinnen und Musiker, darunter Einheimische, aber auch Menschen, die weit, weit weg von zu Hause sind. Platten werden um den Tisch gereicht, Wasser, Soßenschalen, Lammfleisch und warmer Reis mit beifälligem Murmeln begrüßt.
Als die Sonne untergeht, steigert sich das Gespräch allmählich zu einem fröhlichen Tumult, einem auf entspannte Weise lebhaften Geplauder, bis es den Punkt erreicht, an dem man nur noch die neben einem Sitzenden versteht. An jedem anderen Ort der Welt würde ich das auf die allmählich einsetzende Wirkung des Alkohols zurückführen. Aber hier liegt es am Essen und an der Freude daran, es zu teilen.
Während sich der Himmel lila und safrangelb verfärbt, zucken Fledermäuse über unseren Köpfen hin und her, und Krähen lassen sich auf den zerklüfteten Dächern zerstörter Gebäude nieder, deren Putz rissig und voller Löcher ist. In der Ferne sind Explosionen zu hören, als ständige Erinnerung daran, wie nahe wir Syrien sind. Aber zumindest jetzt feiern wir das Essen.
Frühstück auf der Terrasse, Libanon. Ein Quadrat aus weißem Schafskäse auf einem weißen Teller, feucht und krümelig, mit dem reinen, scharfen Geschmack von Sauermilch. Ich träufele flüssigen Honig über die unebene Oberfläche, lasse ihn langsam vom Löffel rinnen und schaue zu, wie er in den Rissen und Mulden des Käses winzige Pfützen aus Gold formt.
Piper nigrum
Malabarküste
Anfangs konnte ich sie kaum sehen. Dann ein Aufblitzen von wehendem safrangelbem Stoff im sattgrünen Dickicht. Noch eines, diesmal violett, dann ein weißes Stirnband und ein schwarz-beige gestreifter Wickelrock wie eine Fata Morgana. Die Pfefferpflücker arbeiten zwei Meter über meinem Kopf; sie balancieren auf Bambusleitern, die mit Bast zusammengebunden sind, halb verborgen hinter den üppigen Ranken der Pfefferpflanzen.
Ich bin auf einer der vielen Pfefferplantagen der Malabarküste, und doch sehe ich kilometerweit nichts außer ordentlich beschnittenen Kamelienbüschen, die wie sorgsam zurechtgestutzte Ziergehölze wirken. Die Büsche entpuppen sich als Teesträucher (also hatte ich recht mit der Gattung Kamelie); der Pfeffer wächst an Ranken, die an hohen, auf der ganzen Plantage verteilten Silbereichen emporklettern. Pfeffer wird hier als Mischkultur angebaut; er gedeiht hoch oben in den Bergen zwischen den Teepflanzen. Dieser Ort hat noch nie Schnee, Frost oder Hagel erlebt, und während wir bergan steigen, sehen wir weitere lange Rispen mit Pfefferkörnern an den Bäumen; an den Trieben hängt alles von nadelkopfkleinen grünen Pünktchen bis zu reifen roten und dicken schwarzbraunen Beeren. Es dauert sieben Monate, bis sich aus winzigen sternförmigen Blüten reife Früchte entwickelt haben.
Heute sammeln die Pflücker nur violette und braune Beeren, die allesamt dazu bestimmt sind, neben meinem Ofen für die Pfeffermühle zu trocknen. (Grüne Beeren werden frisch gepflückt und in Lake eingelegt.) An jedem Baumstamm arbeiten bis zu drei Pflücker, die vorsichtig die Rispen mit reifenden Pfefferkörnern abzupfen und in hellgelbe Säcke gleiten lassen, die hinten um ihre Hüften gebunden sind. So haben sie beide Hände frei und können mit der einen die dicken Blätter anheben und mit der anderen die kleinen Beerenzweige darunter pflücken.
Es ist Teestunde. Die Arbeiter sitzen im Kreis und plaudern lebhaft, zweifellos über den komischen Kerl, der gekommen ist, um ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Ich lehne den angebotenen Chai ab – zu dunkel und milchig für mich – und ernte äußerst erstaunte Blicke.
Später sehe ich, wie die Pfefferbeeren auf riesigen gewebten Matten im Freien getrocknet werden, in der glutheißen Sonne. Ich zerdrücke ein paar der frisch getrockneten Körner und lege sie in meine Handfläche. Ich atme ein. In meiner Nase prickelt es so heftig, als wäre ich an einem frostigen Wintermorgen hinaus ins Freie getreten. Die Luft riecht nach Zitrone und Menthol und nach etwas Dunklem, fast Verbranntem, wie geräucherter Lapsang-Souchong-Tee. Der Duft ist mehr Parfum als Gewürz, vielleicht mit einem Hauch von gutem, altmodischem Aftershave, und sehr weit weg von dem schwarzen Staub im Pfefferstreuer. Allerdings auch sehr weit weg von meinem »frisch gemahlenen Pfeffer« aus der Mühle.
Diese flüchtigen Düfte – Muskat vom Baum (eine Andeutung von Gartennelke), Kurkumawurzeln in Säcken auf dem Gewürzmarkt (ein Dunst von Ingwer und Antiquariat) oder der Zitronen-Pfeffer-Stoß von dicken, frischen Ingwerknollen – konnte ich nur kurz genießen. Man findet sich nicht jeden Tag in den Kardamombergen wieder. Und dann muss man einfach die Augen schließen und die Sinne in diesen ätherischen Ölen baden lassen. Sie werden sie nie vergessen – ich jedenfalls nicht –, egal, wie kurz Sie darin eintauchen. Diese kleine Freude ist vielleicht die flüchtigste von allen, aber sie prägt sich ins Gedächtnis ein wie ein Tattoo.
Langsam ein Zimtbrötchen zerzupfen, in einem Café.
Kaffee in Nakazakicho
Osaka, Japan
Es gibt »Hölle-auf-Erden«-Einkaufszentren und breite Fußgängerstege, die sich hoch über dem Stadtverkehr dahinschlängeln. Es gibt dunkle, dampfende Gassen, in denen jede Tür zu einer unvergesslichen Mahlzeit führt, Museen, in denen die Besucher schweigen müssen, und Bars, in denen ein solcher Lärm herrscht, dass das Personal Lippenlesen gelernt hat. In einer regnerischen Nacht fühlt es sich hier an wie auf dem Filmset von Blade Runner.
Vom alten Osaka ist wenig übrig. Ich schlendere durch Nakazakicho, die Reste der traditionellen, engen Straßen der Stadt. Jede Haustür ist von einem reizenden Sammelsurium aus Blumentöpfen mit herabhängenden Duftgeranien, Trichterfarnen und Zitronenbäumen umgeben. Neben dem Meditationszentrum steht ein eigenartig gruseliges gemauertes Modell der Umgebung, wie eine Weihnachtskrippe, das ich zur Orientierung verwende. (Die Japan-Karten im Internet sind frustrierend lückenhaft.) Vor den geschlossenen Rollläden der Bars stehen Kästen mit leeren Flaschen, Zeugen des örtlichen Nachtlebens. Jetzt ist alles außer dem öffentlichen Badehaus und ein paar Lebensmittelgeschäften geschlossen.
Lebenszeichen sind rar um neun Uhr morgens, aber im schummerigen Licht der Cafés sind schattenhafte, sich bewegende Figuren zu sehen, und der Duft frisch gerösteter Kaffeebohnen dringt hinaus in die kühle Herbstluft. Das traditionellste Kaffeehaus hat sein Schaufenster mit Porzellankatzen und handgefertigten Modellen von rosafarbenen und pistaziengrünen Küchlein unter Glashauben dekoriert; der Innenraum ist dunkel und verlockend, aber anscheinend wollen sie noch nicht aufmachen. Ein neueres Café, im skandinavischen Stil mit hellem Naturholz, röstet offensichtlich vor Ort, und ich stelle mich in die kurze Schlange Begeisterter, die sich gegenseitig für die sozialen Medien fotografieren.
Der gute Kaffee wird in einer winzigen Porzellantasse anstelle der üblichen fürchterlichen Becher serviert, aber ich bin vor allem von einem Gericht fasziniert, das fast ausnahmslos an jedem Tisch bestellt wird – eine Crème Caramel, auf der eine brüchige Portion Eiscreme balanciert, spitz wie ein Pierrot-Hut. Neugierig bestelle ich mir eine und erlebe nicht das erwartete Schrecknis, sondern die köstliche Kollision zweier klassischer Desserts, Affogato al caffè und Crème Caramel. Eis und Creme sind exzellent, genau wie der heiße Kaffee, der darübergegossen wird, das Vanilleeis aufweicht und auf dem Teller zu wunderschönen cremeweiß-braunen Wirbeln zerläuft. Ich bin sofort süchtig.
In Hokkaido wird ein Knäuel wilder essbarer Blätter aus den Bergen, ausgebacken in Tempura-Teig, auf einer Scheibe aus weißem Papier präsentiert wie eine mit Eis überzogene Blüte.
Schlange stehen für Fladenbrote
Teheran
Selbst in der Morgendämmerung tut das Atmen weh. Ein feuerrotes Band durchstrahlt den in der Kehle beißenden Smog.
Wir gehen zu Fuß zur Bäckerei und halten uns dabei im Schatten der Bäume; dann stehen wir in einer lockeren Schlange griesgrämiger Männer, während uns die Morgenluft kühl um die nackten Knöchel streicht. Irgendwo, nicht weit weg, ist der Klang von fließendem Wasser zu hören.
Wir betreten den Laden, und die Temperatur steigt. Strahlendes Weiß blendet uns. Saubere Fliesen, Säcke voller Mehl und bärtige junge Bäcker in weißen Hemden und bodenlangen Schürzen sind zu sehen. In der Rückwand klaffen zwei raue Schlitze, breit genug, um die hölzernen Brotschieber mit ihren länglichen, dünnen Teigportionen aufzunehmen. Hinter jeder Öffnung sieht man Brotfladen auf glühenden Kieselsteinen backen.
Der Teig ist eine Nacht lang zu kittfarbenen Halbkugeln mit gänseeigroßen Blasen aufgegangen. Der Bäcker dreht Teigklumpen ab und zieht sie zu langen, gut handspannenbreiten Bändern auseinander. Er lässt sie mit einem langstieligen Schieber in den Ofen gleiten, wo sie nur kurz auf den glutheißen Kieseln liegen.
Die Sangak-Fladen – ihr Name bedeutet »kleine Steinchen« auf Farsi – sind auf dem unebenen Ofenboden knubbelig und wellig geworden; sie werden mit einem Backhandschuh vom Ofen zur Theke getragen. Dort klopft man sie kräftig, um festklebende Steinchen zu entfernen, und faltet sie ordentlich und schnell, erst in zwei, dann in vier Schichten. Die Kunden verlassen die Bäckerei mit Brotbündeln, die sie sich unter den Arm klemmen wie Geschäftsleute ihre Morgenzeitung.
Man bräuchte die Selbstdisziplin eines Imams, um nicht auf dem Weg schon ein Stück Fladenbrot abzureißen und herunterzuschlingen. Ich filme und muss deshalb, zum Ärger der Leute in der Warteschlange, die ganze Prozedur noch einmal wiederholen. Diesmal drehe ich das Brot von der Kamera weg, damit der Regisseur die fehlende Ecke nicht bemerkt.
An einem Sonnendach auf dem Markt hängen Ketten von Wasserkesseln, teils goldfarben, teils aus einfachem Aluminium. Sie sind – Griff an Ausgießer, Griff an Ausgießer – ineinandergehakt, als würden sie sich an den Händen halten.
Grüne Sprossen
Finnland
Es gibt einen Topf voll grobem Haferbrei mit Blaubeeren, ein ganzes geräuchertes Lachsfilet auf einem Brett mit Rindenkante und Wild-Blutwurst, krümelig wie Schokoladenkuchen. Brennnesseln sind in Knäckebrot gepresst wie Blätter in das Eis auf einem Teich. Nur eine Schlittenfahrt von Lappland entfernt sitze ich vor dem Frühstück meiner Träume. Draußen schneit es, und ich häufe mir Kartoffel-Grünkohl-Küchlein auf den Teller, zu denen ich in Roter Bete marinierte Lachsscheiben esse. Aus einem Schnapsglas trinke ich leuchtend roten Preiselbeersaft, der sich anfühlt wie eine Bluttransfusion, und rühre Beerenkompott in meinen Joghurt. Dann gehe ich hinaus und spaziere zum Hafen mit seinen rostroten Holzhäusern hinüber.
Das Herbstlicht in Oulu sickert golden durch die Bäume, meist Birken, deren dünne weiße Rinde sich blättrig von den Stämmen schält und deren Blätter schon in der leisesten Brise flirren. Das Gras darunter, ein Perserteppich aus grünem, braunem und ockergelbem Herbstlaub, ist feucht und mit winzigen Pilzen gesprenkelt. Ich untersuche ihre Stiele, wie ich es als junger Mann eifrig zu tun pflegte, aber diese hier sind gerade.
Das Mittagessen beginnt früh und dauert lang: Erbsensuppe, gegrillter Arktischer Saibling und eine Granita aus Zitronenverbene. Doch mit der Nachmittagssonne sinken auch die Temperaturen. Ich habe einen guten Schal und Handschuhe dabei, aber meine Winterunterwäsche ist dem Wetter nicht gewachsen, und so mache ich mich auf den Weg zu einem prasselnden Feuer und einem Cocktail. Im ersten Drink kommen Preiselbeeren, Fichtentriebe und Holunder vor. Im zweiten, und es gibt immer einen zweiten, Gin, Fichte und Zitrone.
Tags darauf gibt es noch mehr Fichtensprossen, diesmal als Saft vor dem Frühstück. Die Nadeln sind die jungen, weichen, hellgrünen Büschel von den Zweigspitzen – weich genug, um sie zu pürieren und wie Weizengras zu trinken. Allerdings ist diese Flüssigkeit nicht bitter, sondern hat ein verblüffend zitronig-säuerliches Aroma, nach dem ich mich in Zukunft an jedem Wintermorgen sehnen werde.
Ein Holzregal vor einer Bäckerei in Stockholm. Mehlige, unregelmäßig geformte Platten aus Knäckebrot, gestapelt wie Zeitungen und mit schmalen blauen Bändern zusammengebunden.
Eine Speisekarte gereicht bekommen
Ich war beinahe pünktlich, wurde zu meinem Tisch geführt und bekam einen Drink angeboten. Vielleicht halte ich ihn sogar gerade in der Hand und habe jenen ersten, seligen Schluck hinter mir. Den Raum und die vorherrschende Atmosphäre habe ich bereits sondiert, das Temperament des Servicepersonals und die aromatischen Düfte aus der Küche. Alles wird gut, erkenne ich – dankbar. Und als wäre das noch nicht genug, bringt jemand eine gedruckte Liste der Freuden.
Eine Speisekarte ist eine Kollektion der Versuchungen. Eine Sammlung, aus der wir etwas auswählen dürfen, das jemand anderes kocht. Ausnahmsweise eine Mahlzeit, für die ich nicht eingekauft, geschnibbelt und gespült habe. Glauben Sie mir: Für jemanden, der so viel Lebenszeit am Herd oder an der Spüle verbringt, gibt es kaum einen größeren Luxus.
Heute sind die Speisekarten weniger formell als früher; sie haben die Tyrannei der drei Gänge abgeschüttelt. Man kann sich zwei kleine Gerichte aussuchen, ein größeres oder – vermutlich – drei Desserts; allerdings kann ich nicht behaupten, das je versucht zu haben. (Darüber nachgedacht vielleicht schon.) Noch besser: Man kann, ohne die Küche in Schwierigkeiten zu bringen, eine Auswahl von Gerichten für den ganzen Tisch bestellen, von denen sich alle nach Lust und Laune bedienen. Ich mag es, Essen mit anderen zu teilen. So esse ich am liebsten im Restaurant – außer beim Nachtisch natürlich, der mir, und nur mir, gehört. (Ich schreibe das vor allem, um die Pläne der »Keinen-Nachtisch-Besteller« zu durchkreuzen, die anschließend einen Großteil von meinem aufessen.)
Auf der ersten Speisekarte, von der ich je bestellen durfte, waren unter den Vorspeisen auch Säfte – Ananas, Grapefruit und Orange – aufgelistet. Sie wurden in kleinen Weingläsern auf Tellern mit Spitzendeckchen serviert. Man nippte sie langsam, während die Erwachsenen ihre Suppe schlürften. Sehr einfach, ja, aber die Begeisterung darüber, mein Essen auf einer getippten, in eine blaue Kunstlederhülle gezwängten Speisekarte aussuchen zu dürfen, war unbeschreiblich und markierte den Beginn einer lebenslangen Liebe zu Restaurants.
Honig und ein Bär im Wald
Amir Kola, Iran
Hinter den wirbelnden Rauchschwaden sind die Bienenstöcke kaum zu erkennen; mindestens fünfzig stehen auf einer Waldlichtung, jeder mit verwitterten Holzwänden und fleckigem Zinkdeckel. Ein paar sind segelbootblau lackiert. Der Rauch ist geisterhaft dünn, und das Summen der Bienen wird vom rauschenden Wasser des Sturzbachs unter uns fast übertönt. Es ist unheimlich, aber nur auf eine Weise, die einem das Gefühl gibt, ein Faun wie Herr Tumnus aus den Narnia-Romanen könnte gleich durch die Bäume galoppieren.
Wir sind stundenlang ins Vorgebirge hinaufgefahren und haben nach den Bienenstöcken Ausschau gehalten. Unterwegs begegneten wir keiner Menschenseele und wollten schon aufgeben, weil wir glaubten, uns verfahren zu haben. Aber der Rauch (er dient dazu, die Bienen zu beruhigen) war ein nützlicher Wegweiser für das Team. Unser Imker erweist sich als Bär von einem Mann mit den vielleicht größten Händen, die ich je gesehen habe. Sanft und freundlich, wie man es von jemandem erwartet, dessen Leben von alten Bäumen und süßem Honig durchtränkt ist. Ein Mann, der seine Bienen umsorgt, als wären sie seine Kinder.
Drei Mal in meinem Leben habe ich einen Imkeranzug aus weißem Overall, Hut und Schleier getragen. Es fühlt sich an, als tappte man auf dem Mond herum. Hier gibt es keinen solchen Luxus, und ich halte reichlich Abstand, als der Imker den Deckel anhebt und eines der hölzernen »Rähmchen« herauszieht, auf dem dicke Honigwaben zu sehen sind.
Wir frühstücken im Zelt des Imkers; in der einen Ecke ist ein ungemachtes Bett, in der anderen ein winziger Ofen und ein alter Blechkessel zu sehen. Der Honig wird auf einem ovalen Blechtablett serviert: zerklüftete Wabenbrocken, deren klebrige Fracht auf das Metall sickert. Wir schaufeln den Honig mit Gabeln auf (ich halte vergebens nach einem Löffel Ausschau) und bemühen uns sehr, nicht auf den müden rosa Teppich zu kleckern, der den Zeltboden bedeckt. Der Honig ist nicht so süß wie der zu Hause, flüssiger, und sein Aroma ist sowohl blumig als auch harzig.
Im Zelt auf einem Berg zu hocken, umgeben von hohen Kiefern, dem Duft eines Holzfeuers und fernem Wasserrauschen auf Felsen, das wie glückliches Kinderlachen klingt – wunderbarer kann ein Frühstück kaum sein.
Gold essen
Kanazawa, Japan
Der breite, lebhafte Bach schlängelt sich durch den Garten, vorbei an schweren Steinen, die vor lauter Moos grün strahlen. Hin und wieder stürzt der Bach plötzlich als kleiner, lauter Wasserfall drei Meter in die Tiefe.
Ich bin gekommen, um das Museum für zeitgenössische Kunst in Kanazawa zu besuchen, habe mir aber den einen Tag der Woche ausgesucht, an dem es geschlossen ist. Das passiert in einem Land, dessen Öffnungszeiten einigermaßen exzentrisch sind, nur allzu leicht. Stattdessen kaufe ich Essstäbchen als Geschenk für einen Freund, und viele Tassen gerösteten Tee später spaziere ich den Hügel hinauf, um die Kirschblüten zu sehen.
Sie sind auf eine bestimmte Art bezaubernd, wie alle Kirschblüten – rosa und rüschig und ein klein wenig süßlich –, aber nur wenige Schritte von den Massen entfernt gibt es ein Häuschen, in dem Eiscreme verkauft wird. Ich stehe für ein Waffelhörnchen an, das mit einem perfekten weichen Wirbel gefüllt und dann mit Blattgold bestreut wird. Winzige Schneeflocken aus Gold auf einer Woge aus Vanilleeis, die ich unter den Kirschbäumen esse. Albern, dekadent und atemberaubend schön.
Ein knorriger grauer Baum, dessen Äste mit cremeweißen Bällchen aus gerade aufgehenden Blüten bedeckt sind. Als wäre der Baum mit Popcorn geschmückt.
Das Frühstücksbuffet
Seoul, Südkorea
Ein Algensalat, der aussieht wie nasser Pfeifentabak, puppenhauskleine Maki-Rollen, die mir vorkommen wie Sushi für Kinder, ein klebriger Salat aus Nattō – fermentierten Sojabohnen – und ein glitschiger aus rohem Lachs. Es gibt Kimchi aus weißem Rettich und aus Gurken, eine rostrote Version mit Chinakohl und noch eine weitere Variante, ein Knäuel aus kleinen weißen Wurzeln, deren übersetzter Name mir auch nicht weiterhilft.
Pürees aus Pflaumen und dunklen Beeren schwimmen auf Joghurt in Glasbechern, Jakobsmuscheln und Austern wabbeln auf Schalenhälften, und Teller mit Sashimi stehen auf scharfkantigen Kristallen aus zerstoßenem Eis. Scheiben aus gekochtem Schinken mit Senfglasur sind in soldatisch straffen Reihen angeordnet; pochierter Weißfisch ist üppig mit Frühlingszwiebeln bestreut; eine Mixtur aus Auberginen und Schweinehack und eine andere aus scharfem Blattsenf ruhen in Warmhaltegefäßen neben Edelstahlkesseln mit Misosuppe. Es gibt Flechtkörbe mit dampfenden Teigtaschen und einen ganzen Tisch voller Zutaten – Reis, Eier, Blattgemüse und Sojasoße –, aus denen man sich sein eigenes Bibimbap zusammenstellen kann.
So heißt mich das Frühstück in meinem Hotel in Seoul willkommen, außerdem mit einem Kochlehrling, der liebevoll seine Omeletts versorgt, einem zweiten, der Gyoza in Pfannen anbrät, und einem dritten, der Nudeln in die Luft wirft, als wäre das ein olympischer Sport. Und erst dann entdecke ich den Smoothie-Stand, ein Trio von Sushi-Fachleuten und die Gebäckabteilung mit ihren Miniatur-Croissants und perfekt röhrenförmigen Paris-Brests.
Der junge amerikanische Geschäftsmann am Nebentisch kommt mit einer Schale knallbunter Cheerios vom Buffet zurück.
Ich nehme keinen Zucker, habe aber eine spezielle Zuckerdose für Gäste: ein helles koreanisches Seladon-Gefäß mit sechseckigem Deckel, das mir eine Freundin geschenkt hat. Es passt nur so wenig hinein, vielleicht sechs Teelöffel, dass der Inhalt kostbar wirkt – was Zucker einst ja auch war. Das Gefäß erinnert mich immer an die Zuckerverkostungsszene aus Jessie Burtons Roman Die Magie der kleinen Dinge, in der alle mit geschlossenen Augen den Zucker von ihren Teelöffeln lecken.
Gebt mir Saures
Zwischen Kimchi und Sauerkraut, Joghurt und Kefir, im obersten Fach des Kühlschranks, steht eine Reihe von Gläsern, deren Inhalt bunt ist wie Modeschmuck. Das ist mein Vorrat an Tsukemono, japanischem eingelegtem Gemüse, so suchterregend herb, würzig, scharf, säuerlich und knackig, dass ich unmöglich darauf verzichten kann.
Besonders stark ist diese Abhängigkeit bei Gari, den papierdünnen Scheiben aus eingelegtem Ingwer, die als Standardbeilage zu Sushi gereicht werden. In meinem Kühlschrank steht immer ein rundliches Gari-Glas mit knackigen, gehobelten jungen Wurzeln. Ihre funkelnde, salzige Schärfe ist weltenweit von den schlaffen beigen Lappen entfernt, die bei gekauften Sushi-Portionen mitgeliefert werden. Die reinste Qualität wird aus festem jungem Ingwer hergestellt, der an den Außenseiten einen zarten rosigen Schimmer zeigt, aber ein Großteil wird künstlich eingefärbt, was auch nicht weiter schlimm ist. (Ich meide die knallrosa Sorte, die so grellbunt und süß wie Bonbons ist.) Die Kochbuchautorin Joanna Weinberg schrieb einmal, Sushi-Ingwer habe »die Farbe von Ballettschläppchen«.
Das wahre Knacken beginnt bei eingelegten Gurken. Die japanische Sorte ist dünner als unsere Salatgurke und enthält weniger Kerne; sie wird in feine Scheiben geschnitten und in Lake konserviert, manchmal mit ein wenig Reiskleie oder Sojasoße. Sie kommt mir besonders salzig vor, was sie ebenso verlockend macht wie die einfachen Kartoffelchips, die ich liebe.
Die prachtvolle Rotkohlfarbe von Shibazuke – eingelegten Auberginen und Gurken – stammt von roten Shiso-Blättern und Pflaumenessig. Diese Sorte Tsukemono wird in kurze Streifen geschnitten und mit Salz, Essig, fein gehackten roten Perillablättern und Ingwer eingelegt; sie ist Herz und Seele der sogenannten Kyoto-Pickles, und ich hoffe immer darauf, dass sie mir zu meiner Donburi-Reisschale serviert wird.
Ich kann ohne gelben eingelegten Daikon oder andere Rettiche leben – sie haben einen angenehmen Biss zu Reis, sind aber oft mit einem Übermaß an Sojasoße gewürzt. Trotzdem finden sie oft ihren Weg in meine Einkaufstasche. Zusammen mit ihren Verwandten liefern sie jene knackig reinen, scharf-sauren Aromen, nach denen ich ein fast irrsinniges Bedürfnis hege. Aromen, die im Lauf der Jahre meinen Wunsch nach Süßem, Cremigem ersetzt haben. Die den Gaumen eher anregen als betäuben.
Von Umeboshi darf ich gar nicht erst anfangen …
Ein Schälchen weißbespitzter Radieschen, eingelegt in frischem Yuzu-Saft.
Die wohlwollende Warmherzigkeit eines Löffels
Ein Löffel fühlt sich im Mund auf natürliche Weise weich an, rund und glatt, dadurch hat er etwas Sanftes an sich. Es liegt Zärtlichkeit in einem Löffel – schon in der Art, wie seine Rundung meine Unterlippe berührt. Meine Oberlippe darf die Flüssigkeit im Inneren spüren, mit ihrer tröstlichen Wärme, noch bevor ich den ersten Tropfen geschluckt habe.
Ein Löffel ist gastfreundlich; er ist das Werkzeug, das ich verwende, um Essen auf den Teller eines geliebten Menschen zu legen. Er ist das Erste, was ein Kleinkind nach der Mutterbrust mit Essen in Verbindung bringt. Seine glatten Ränder und die weiche Form wirken beruhigend. Eine Gabel fühlt sich mit ihren scharfen Zinken zum Aufspießen des Essens vergleichsweise brutal an. Dinge, die wir mit dem Löffel essen, kommen uns sättigender vor als Aufgegabeltes, weil sie oft von einem Teich aus Suppe oder Soße umgeben sind. Einer kleinen, nahrhaften Extrapfütze.
Manche meiner Löffel sind aus Holz gemacht – etwas, das ich wärmstens empfehlen kann. Das Geräusch eines Holzlöffels in einer Holzschale macht den morgendlichen Porridge zu einem sanft flüsternden Tagesbeginn. Holzlöffel haben etwas Tröstliches, das Metalllöffeln fehlt. Trotzdem bestehen die meisten meiner Löffel aus Edelstahl, nur selten sind sie aus Silber oder versilbert. Die wenigen gebrauchten Silberstücke, die ich besitze, sind angelaufen.
Ein Löffel kann wenig Schaden anrichten. Ihm fehlen scharfe Kanten oder Spitzen, und so ist er ungefährlich. Anders als bei Messer, Gabel und (tatsächlich!) Essstäbchen würde ich bezweifeln, dass jemals ein Mord mit einem Löffel verübt wurde.
Besonders gutwillig ist der Suppenlöffel. Seine weite, flache Schale lässt die Suppe schnell abkühlen, damit meine zarten Lippen und die Zunge keinen Schaden erleiden, aber er ist auch breit genug, um die Bohnen und Gemüsewürfel einer Minestrone aufzunehmen. Sein Niedergang stimmt mich ein wenig traurig.
Wenn ein Löffel nicht richtig funktioniert, ist das oft eine Frage der Balance – oder genauer: ihres Fehlens. Mal ist der Hals zu eckig, mal sind die Schultern zu breit, oder vielleicht ist die Höhlung zu tief und spitz, sodass man mit der Zunge hineintauchen muss, um das letzte bisschen Vanillesoße herauszubekommen.
Um für Hand und Mund wahrhaft komfortabel zu sein, müssen Griff, Hals und Schale miteinander harmonieren. Jeder Löffel ist brauchbar, und darüber bin ich froh. (Dies schreibt jemand, der schon einmal im Hotelzimmer ein Curry mit der Kreditkarte gegessen hat.) Aber wenn wir den richtigen Löffel finden, perfekt in Form, Gewicht und Design, kann das unsere Freude an dem Essen in unserer Schüssel oder auf unserem Teller unermesslich mehren. Darüber sollten Designer vielleicht nachdenken, bevor sie versuchen, dieses spezielle Rad neu zu erfinden.
Sweet Jesus
Kykladen, Griechenland
Das Weiß schmerzt. Das durchdringende, stechende Weiß der sonnenbeschienenen Mauern, Gassen und Steine einer griechischen Insel. Das scharfe Scharlachrot von Geranien auf himmelblauen Fensterbänken. Das kreischende Violett von Bougainvillea. Alles ist gleichzeitig da, zusammen mit dem unerbittlich blauen Himmel und dem Tinnitus zirpender Grillen. Ich sehne mich nach Kühle, nach langen Schatten und dem Frieden sanfter, gedämpfter Farben.
Ich ducke mich in ein düsteres, menschenleeres Café. Ein surrender Ventilator, ein Hund mit verfilztem Fell und eine Luft, die so kalt ist, dass ich mir beinahe wünsche, ich hätte einen Schal dabei. Restaurant und Kochbereich sind durch eine Warmhaltetheke voneinander getrennt, in der verbeulte Aluminiumbehälter wie aus einer Schulküche, Platten mit lauwarmen gerösteten Paprika und eine dicke Moussaka mit faltiger Kruste stehen. Die Gerichte wirken, als würden sie sich nach einem Vormittag im Ofen allmählich setzen und zur Ruhe kommen.
Neben der Kochstelle, am Ofen, ruht eine Lammschulter schläfrig im eigenen Saft. Ihr knuspriges Fett hat die Farbe von Honig, so golden, als wäre es von innen beleuchtet. Ich gehe um die Anrichte herum, um einen näheren Blick darauf zu werfen. Die Schulter ist mager und verdreht, mehr Knochen als Fleisch. Das Fett sieht jetzt sogar noch besser aus, und ich stehe dicht genug davor, um die angebrannten Thymianzweige in der Bratform zu riechen. Die Begrüßung fällt flüchtig aus. Ich bitte um ein paar Scheiben Fleisch und einen Tomatensalat, kehre zu meinem Tisch und dem hölzernen Schulstuhl zurück und wische das Edelstahlbesteck gründlich mit meinem T-Shirt ab.
Der Salat besteht aus Tomaten, Öl und Salz. Die Früchte sind in klobige Brocken gehackt und auf eine weiße Platte gehäuft, mit Öl in der Farbe von Smaragden. Das Fleisch wurde nicht in Scheiben geschnitten, sondern in einem einzigen zerfransten Klumpen vom Knochen gerupft. Es ist violett wie ein blauer Fleck, mit einer schwarzbraunen Kruste wie trockenes altes Holz, zäh und fast verbrannt. Da ist ein Hauch von Knoblauch und dem allgegenwärtigen Thymian, außerdem etwas Magisches, das entsteht, wenn man Fleisch in einer seit Urzeiten benutzten Bratform gart. Einer Form, die wahrscheinlich allenfalls einmal am Tag flüchtig ausgewischt wird, bevor sie für das nächste Stück Fleisch verwendet wird. Der Bratensaft ist dünn, salzig und mit klebrigen Bändern aus schwarzer, sirupähnlicher Schmiere durchsetzt.
Es ist das Lamm meiner Träume. Das Fleisch ist so süß, der Saft so salzig, das Fett so knusprig, auf diese Art, die zu Hause so selten ist. Dieses Lammfleisch stammt von einem Tier, das sein Leben auf einem felsigen Berghang damit verbracht hat, in der glühenden Sonne wilden Oregano und Gestrüpp zu fressen. Es ist die Sorte Lamm, die entsteht, wenn das Fleisch langsam in einem wackeligen alten Ofen gegart wird, von jemandem, der das jahrzehntelang täglich ohne Aufhebens oder gar Sorgfalt getan hat. Dies … ist das Lamm Gottes.
In Istanbul frühstücken wir auf der Terrasse, Katzen streichen um unsere Füße. Auf unseren Tellern ein Kuddelmuddel aus Käse. Ein krümeliger weißer Ziegenkäse mit dem seltsamen Schildchen »bag of goat«, Käsefäden aus Industriecheddar, wie man sie britischen Kindern mit in die Schule gibt, und eine karamellbraune, angeblich mit Kräutern versetzte Sorte. Wir träufeln braunroten Maulbeersirup darüber.
Das Blütenpicknick
Fukuoka, Japan
Mit Einkaufstaschen und Weidenkörben, Bento-Boxen und Picknicksets bewaffnet, sind wir auf dem Weg in den Park. Menschenmengen bereiten mir Unbehagen (wir sind zu Hunderten), und mir schießt der Gedanke durch den Kopf, einfach kehrtzumachen.
Trotz der vielen Menschen herrscht Stille, als würden wir ein Museum betreten. Vielleicht empfinden auch die anderen Ehrfurcht angesichts des blassrosa Baldachins über unseren Köpfen, des Blütenteppichs zu unseren Füßen und der Blütenblätter, die wie Schneeflocken herabschweben, während die meisten von uns im Schneidersitz unter den Kirschbäumen hocken.
Die Szene könnte ein Filmset sein. Großfamilien, junge Paare, Großmütter, Kleinkinder und winzige Hunde. Es gibt ältere Damen, die Sonnenschirme aus Papier halten, Kinder mit Hello-Kitty-Rucksäcken und Punks in Lederjacken und schweren schwarzen Stiefeln. Weiße Pappschachteln voller Kuchen mit Zitronenglasur und rosa Kirschblüten erscheinen auf dem Gras, Lachssushi auf flachen Lacktabletts und schneeweiße Onigiri-Dreiecke, in getrocknete Algenblätter gewickelt. Selbst die süßen Brötchen aus der Bäckerei sind mit rosa Blüten dekoriert. Kinder rennen unter den Bäumen herum; ihr Lachen und Schwatzen klingt wie Wasser, das über Steine plätschert.
Ich habe eine Art Picknick dabei, vor allem Kuchen. Ein Erdbeer-Frischkäse-Sandwich aus so luftigem Milchbrot, dass man hineinbeißt wie in eine Wolke, zwei Mochi mit roter Bohnenpaste und einen Windbeutel mit Kaffee-Sahne-Füllung. Ich sitze da und lese, kann mich aber nicht konzentrieren. Nach meinem süßen Nachmittagstee spaziere ich zum Schloss. Hier wird die schäumende Pracht spärlicher, die Blüten sind eher einfach als gefüllt und irgendwie schöner, unter geringerem Leistungsdruck. Der Strom der Familien dünnt zu einem Rinnsal von Händchen haltenden Verliebten aus, die unter den Zweigen niedliche Fotos knipsen.
Auf dem Rückweg gehe ich noch einmal die gleiche Route durch den Park, diesmal langsamer, erschöpft von einem Nachmittag auf den Beinen. Die Menge hat sich zerstreut, die Blütenblätter fallen weiterhin. Auf dem Gras sind kaum Spuren zu erkennen. Kein einziges Einwickelpapier, keine Flasche, keine weggeworfene Plastiktüte weit und breit.
Diese plötzliche Begierde, die Sehnsucht nach etwas, das man schon lange nicht mehr geschmeckt hat. Heute sind es lange eingelegte Peperoni von der Sorte, die sich aufrollt wie Aladins Pantoffeln, eingelegte rosa Rübchen, eiskalt aus dem Kühlschrank, und schartige Brocken aus säuerlich-scharfem weißem Käse.
Das Lieblingsessen
Eine bestimmte Frage ist mir für meinen Geschmack schon viel zu oft gestellt worden. »Oh … und noch ein letztes Thema … Was essen Sie am liebsten?« Es ist fast unmöglich, sie wahrheitsgetreu zu beantworten, weil mein Lieblingsessen von heute wahrscheinlich nicht mein Lieblingsessen von morgen sein wird. Das Ergebnis eines solchen – offen gesagt fantasielosen – Verhörs ist meist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Bislang habe ich noch jedes Mal eine freundliche Antwort zustande gebracht, wenn auch durch heimlich zusammengebissene Zähne.
Aber wie lautet die Antwort? Sprechen wir über Süßes (Stachelbeer-Crumble) oder Salziges (Sashimi)? Geht es um einen Wintertag (Porridge mit Ahornsirup) oder um den Hochsommer (gekühlter Agedashi-Tofu)? Soll es ein kleiner Happen vor dem Essen sein (einfache Kartoffelchips) oder ein After-Dinner-Drink (Umeshu-Likör mit Umeboshi-Pflaumen)? Ist es ein Snack (wieder Chips) oder ein luxuriöser Leckerbissen (Yuzu-Softeis im Hörnchen)? Und was ist mit Hühnchen vom Holzkohlegrill, gewürzt mit Zitrone und Za’atar, oder mit Ofenkartoffeln, die man aus der Bratform schaben muss? Mit püriertem Kabeljaurogen oder butterbestrichenen Crumpets?
Die brutale Wahrheit lautet, dass meine Reaktion davon abhängt, wer fragt und wo meine Antwort veröffentlicht wird. (Schwindeln macht Spaß.)
Aber manchmal muss man die Wahrheit sagen, und sei es nur dem eigenen Seelenfrieden – und vermutlich der Selbstachtung – zuliebe. Und dann sind wir wieder bei einfachen Kartoffelchips.